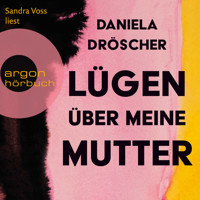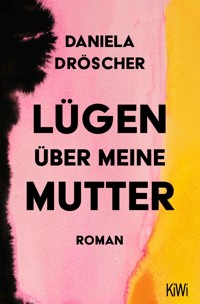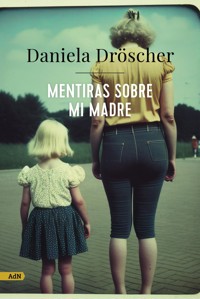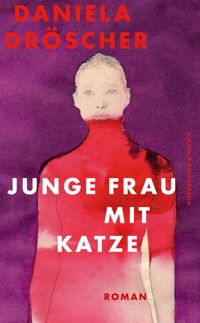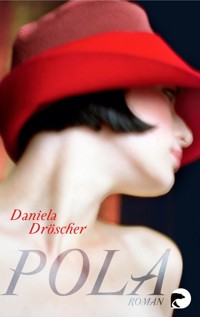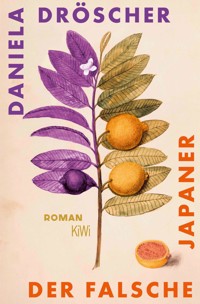
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wie lebt und liebt es sich, wenn man nicht weiß, wer man ist und wo man herkommt? George Psalmanazar beschließt, sich eine Identität zu erfinden, eine so fantastische, dass alle, denen er 1760 in London begegnet, davon geblendet sind. In seiner Heimat Formosa, fabuliert George, lebten die Menschen als Sonnenanbeter und Kannibalen, die nackt herumliefen und sich singend verständigten, er selbst sei dort von Jesuiten adopiert worden. Das widerspricht zwar allem, was Missionare und Reisende bis dahin zu berichten gewusst hatten, doch alle glauben dem falschen Japaner seine Geschichten. Sogar Salonlöwe Samuel Johnson, der englische Goethe, geht ihm auf den Leim und beschließt sogleich, George unter seine Fittiche zu nehmen. George schafft es gar bis nach Oxford. Aber wie lebt es sich, wenn man ständig fürchten muss, enttarnt und attackiert zu werden? Zum Glück ist da noch Lucy, Johnsons Tochter, die sich in George verliebt, obwohl sie ahnt, dass er wohl ein Hochstapler, ganz sicher aber ein Mann mit einem dunklen Geheimnis ist …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 343
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Daniela Dröscher
Der falsche Japaner
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Daniela Dröscher
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Daniela Dröscher
Daniela Dröscher, Jahrgang 1977, aufgewachsen in Rheinland-Pfalz, lebt in Berlin. Promotion im Fach Medienwissenschaft an der Universität Potsdam sowie ein Diplom in »Szenischem Schreiben« an der Universität Graz. Ihr Romandebüt »Die Lichter des George Psalmanazar« erschien 2009, es folgten der Erzählband »Gloria« (2010) und der Roman »Pola« (2012) sowie das Memoir »Zeige deine Klasse« (2018). Sie wurde u.a. mit dem Anna Seghers-Preis, dem Arbeitsstipendium des Deutschen Literaturfonds sowie dem Robert-Gernhardt-Preis (2017) ausgezeichnet. Der Roman »Lügen über meine Mutter« (2022) stand auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises und ist bald im Kino zu sehen.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
In seiner Heimat Formosa, fabuliert George, lebten die Menschen als Sonnenanbeter und Kannibalen, die nackt herumliefen und sich singend verständigten, er selbst sei dort von Jesuiten adoptiert worden. Das widerspricht zwar allem, was Missionare und Reisende bis dahin zu berichten gewusst hatten, doch alle glauben dem falschen Japaner seine Geschichten. Sogar Salonlöwe Samuel Johnson, der englische Goethe, geht ihm auf den Leim und beschließt sogleich, George unter seine Fittiche zu nehmen. George schafft es gar bis nach Oxford. Aber wie lebt es sich, wenn man ständig fürchten muss, enttarnt und attackiert zu werden? Zum Glück ist da noch Lucy, Johnsons Tochter, die sich in George verliebt, obwohl sie ahnt, dass er wohl ein Hochstapler, ganz sicher aber ein Mann mit einem dunklen Geheimnis ist …
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
Dieser Roman erschien erstmals 2009 unter dem Titel »Die Lichter des George Psalmanazar«.
Das Bild des Formosanischen Alphabets stammt aus dem Public Domain Image Archive. Quelle: Internet Archive/Boston Public Library.
© 2025, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung Barbara Thoben, Köln
Covermotiv © akg-images
ISBN978-3-462-31409-0
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Hinweise
0 Fische
1 Perlen
2 Piazza
3 Steine
4 Herzen
5 Türen
6 Korallen
7 Wellen
8 Milch
9 Blitze
10 Glas
11 Köpfe
12 Meer
Quellen
Dieser Roman erschien erstmals 2009 unter dem Titel
»Die Lichter des George Psalmanazar«.
Das Bild des Formosanischen Alphabets stammt aus dem Public Domain Image Archive. Quelle: Internet Archive/Boston Public Library.
0Fische
Inmitten von dichten silbrigen Halmen, die über das Ufer bis ins Meer hinein wuchsen, lag, die Glieder weit von sich gestreckt, ein Mensch. Er hatte die Lider geschlossen. Er lächelte. Die Luft roch nach Salz und Pinien. Am Himmel zogen Adler ihre Kreise, am Boden liefen Sterntaucher ihre Bahnen. Der Einzige, der mit Gewissheit hätte Auskunft darüber geben können, ob der Mensch inmitten der Halme wach war oder schlief, war der Mensch selbst. Er lag als stilles, leichtes Kreuz, im Schatten der Bäume, durch deren Geäst man die Wolken sah, und wenn der Wind in sie fuhr, fiel schütteres Laub auf ihn. Erst als die Sonne unterging, schlug er die Augen auf, trat aus dem Schatten und fing zu beten an.
Der Mensch, der im Licht der untergehenden Sonne sein Tagwerk begann, war George. George waren Sonne und Mond heilig, und am liebsten betete er zu ihnen, wenn die Sterne aus dem nachtblauen Tuch der Nacht hervorgekrochen kamen. Er betete, indem er die Hände gen Himmel reckte, mit der Stirn den Boden berührte und eine Geschichte, die er »Fata« nannte, hinauf zu den großen Lichtern sang. George liebte die Sonne genauso wie den Mond, doch hatte er auch gelernt, die Sonne zu fürchten, und so waren alle frei liegenden Körperteile vom Hals abwärts mit einfachem Tuch umwickelt. Darüber trug er einen grauen Rock, dessen einstige Form sich nur noch schwer erraten ließ. Den Kopf bedeckte ein Fell, das er wie zu einem Turban flocht. Es hatte einmal einem weißen Tier gehört.
Am anderen Morgen stand George auf dem Marktplatz eines schottischen Küstenortes. Die zahnlosen Kinder des Dorfes jagten ihn, was häufig geschah, wenn er irgendwo auftauchte, bei seinem morgendlichen Gebet über den Platz und versuchten, ihm den Schutz über die Ohren zu ziehen. George flüchtete auf einen hohen Felsen. Dort saß er eine Weile, in völliger Reglosigkeit, doch mit einem zum Schuss gespannten Körper, um dann jäh in die Tiefe zu schnellen und schließlich mit einem Bündel glänzender Fische unter dem Arm auf den Marktplatz zurückzukehren.
Das Wasser aus seinem Rock auswringend, schlug George die noch zuckenden Tiere gegen den Stein. Einem Barsch biss er den Kopf ab. Er kaute den Bissen und schluckte einen Teil hinunter, die andere Hälfte ließ er in seinem Brotbeutel verschwinden. Dann zog er aus seinem Seesack beschriebene Blätter hervor und begann, die übrigen Fische darin einzuwickeln. Die Umstehenden standen still, nur das Muschelband um Georges Handgelenk raschelte.
Wer er sei, fragte ein Mann, der nur noch einen einzigen vorderen Zahn in seinem Mund vorzuweisen hatte.
Woher er komme, fragte ein anderer, dessen Gesicht kein Lächeln zu kennen schien.
George aber hätte nicht einmal zu sagen gewusst, ob er sich an einer französischen oder an einer schottischen Küste befand.
Fischmann!, Seemann!, kreischten die Kinder und zeigten mit schmutzschwarzen Fingern auf Georges tropfende Silhouette.
George stand da und blickte in die neugierigen Gesichter. Wer er war, hätte er nicht sagen können. Seine Vergangenheit lag im Dunkeln, wie ein mattglänzender Spiegel erschien ihm sein Gedächtnis bisweilen. Einzig seine Tage waren klar wie die Silberlinge, die er am Abend in Essig sauber kochte. Er streifte die Küsten entlang und verweilte, wenn Form und Anzahl der Fische ihm behagten.
Der Einzahnige, der ihn eben noch spöttisch belächelt hatte, verstummte, als George, der den ersten Fisch des Tages, eine schlanke, hochmütige Dorade, zum Verkauf in die Höhe hielt, mit summender Stimme zu fabulieren begann. Der Mann starrte verwundert auf das Blatt, in das die Dorade dabei eingewickelt wurde.
Mitten in seine Fata hinein streckte sich George eine Hand aus sonderbar weißem Fleisch entgegen. Von den Fingern der Hand wuchsen bunte Steine, die an glänzenden Ringen steckten. Die Hand war eine Hand aus Eisen, über die ein weißer Handschuh gezogen war.
Als George aufsah, blendeten ihn zwei kleine Augen, die im Gesicht eines alten Mannes hockten. George zog die Nase kraus und schnüffelte. Der Mann verströmte den Duft von Myrrhe.
Der Fisch hing, nicht mehr George und noch nicht dem Käufer gehörend, schwankend in der Luft. Und in der Luft hing auch Georges, mit schuppigem Tuch umwickelte Hand mit dem Muschelband, leise raschelnd wartete sie auf die Münzen.
Es hatte ein dumpfes Raunen unter den Bewohnern gegeben, als der Bischof von Innes aus der Kutsche gestiegen war. Die Leute des Küstenstriches fürchteten den Mann, von dem man sich hinter vorgehaltener Hand zuflüsterte, dass er den Einfällen der Inquisition nicht so abgeneigt war wie die Landeskirche, der er neuerdings diente. Er war in den Aufstand um die katholischen Stuarts und Bonnie Prince Charlie verwickelt gewesen, war aber dann zum Glauben der britischen Krone hinübergewechselt.
George summte nichts ahnend seine Fata zu Ende, verbeugte sich, zeichnete den Umriss einer Münze in die Luft und überreichte dem Einzahnigen schnell seine Dorade.
Dann trat er heran, um die andere Hand des Bischofs zu bestaunen. In ihr floss gewöhnliches Blut, aber auch sie war mit einem edlen Handschuh bekleidet. George deutete auf sein schuppiges Tuch, das bis zu den Fingerspitzen reichte.
Weiße Hände wie diese, sagte er und hielt einen Fisch in die Luft, hätte er gern, doch müsse man arg viele Fische dafür hergeben.
Der Bischof sah George mit zusammengekniffenen Augen an, dann griff er nach dem oberen Ende des ihm dargebotenen Makrelenpäckchens und schüttelte es, bis sich das Blatt aufrollte und der Fisch zurück in Georges Hände fiel. Der Bischof starrte auf das ölige Blatt. Es war dicht beschrieben mit einer Fata. Die meisten konnten das Geschriebene, das George aus seinem Seesack zog, nicht lesen, geschweige denn verstehen, doch gaben sie ihm bereitwillig ihre Münzen, denn sie freuten sich über die wundersame Zugabe mit dem zarten, überaus schön anzusehenden Muster.
George verwendete alles, was ihm auf seinen Wanderungen begegnete. Er schrieb auf getrocknete Palmblätter, auf dünne Holzscheite, auf Leinentücher. Das Kostbarste, was George besaß, war eine granitene Mine.
Die Makrele des Bischofs war eingewickelt in eine Erzählung von Adam, der unter dem Baum im Garten Eden saß. Eva sang ihm aus einem Folianten vor, während sich eine zierliche Schlange träge und zutraulich um ihrer beider Fesseln rollte.
Den Heilbutt, den er daraufhin verlangte, erhielt der Bischof zusammen mit einer dramatischen Schilderung über eine Stadt, in der bunt glänzende Schriftzeichen von den Dächern leuchteten.
Die Dorfbewohner lauschten Georges Stimme, die immer wieder unverhofft hinüberwechselte in ein langsames ehrwürdiges Latein, das an Sonntagen von den prächtigen Kanzeln der Kirchenmänner auf sie herabregnete. Während George sprach, zeichnete seine Hand mit anmutigen Bewegungen Gestalten in die Luft. Und wie er da stand und fabulierte, erschien der sonderbare Mensch in dem abgetragenen Rock den Bewohnern des Dorfes von unerhörter Schönheit. Sie klatschten und warfen die Hände empor, als George zum Abschied einen eleganten Kopfstand darbot. Die Dorfkinder hüpften um ihn herum, und das Klatschen hörte erst auf, als die Kinder es ihm nachtaten, ihre Körper den Kampf gegen die Schwerkraft verloren und Kopf auf Stein und Stein auf Kopf aufschlugen.
Die Sonne hing als stille Scheibe über dem Hafenbecken. Der Bischof schnüffelte an den Blättern.
Obwohl das Geschriebene dem Bischof sprunghaft, unvollständig und allzu farbenfroh erschien, war es doch schön und fromm gepredigt. Einen solch famosen Schreiber konnte er brauchen, denn wann immer er selbst seine Predigten verfasste, sträubte sich die Schrift sonderbar unter seiner Hand. Wenn er auf die Kanzel trat, um die mühsam gefertigten Zeilen aufzusagen, klangen ihm die Worte dumpf und falsch. Vielleicht hielten sich seine Schäfchen deshalb zunehmend fern. Er schüttelte sich bei dem Gedanken an die wenigen und dazu fauligen, stinkenden Gesichter, die ihm sündig aus dem Kirchenschiff entgegenschielten.
Der Bischof tippelte sich mit dem steifen Zeigefinger gegen die Lippen und merkte, wie die Vorstellung, George bei sich aufzunehmen, sein haariges Herz erhitzte.
Er steckte die Makrele und den Heilbutt in seine Rocktaschen und winkte den Jungen zu sich heran.
George schob das schützende Fell ein Stück über seine Ohren, beugte sich vor und sog dabei den Duft der Myrrhe ein.
Eine warme Mahlzeit, ein warmes Bett, Dach über dem Kopf. Dies alles erhalte er, wenn er nur mit ihm käme, um fortan das Schreiben der bischöflichen Predigten zu übernehmen.
Die warme Mahlzeit, sagte George mit einem freundlichen Nicken, könne auch kalt sein, das Bett sei nicht vonnöten. Aber ein kleines Dach über dem Kopf, eines, das man überall mit hinnehmen könne, freue ihn sehr.
Unter den neugierigen Augen der Dorfbewohner packte George seine Fische zusammen, schnürte den Seesack und bestieg, während die Kinder ihm auf schmutzschwarzen Fingern hinterherpfiffen, die bischöfliche Kutsche.
Sie fuhren über Wege und Straßen, Klippen und Kornfelder wechselten einander ab, und überall glaubte sich George vom Duft des Meeres begleitet.
Als die Kutsche am Abend ein abgelegenes Dorf erreichte und vor dem bischöflichen Anwesen hielt, reckte George augenblicklich die Arme in die Luft und warf sich nieder, um, wie es seine Gewohnheit war, der im Meer untergehenden Sonne die Ehre zu bezeugen. Erstaunt sah er sich um. Ein Wasser war hier nirgendwo zu sehen.
Der Bischof führte ihn auf geradem Weg in seine Gelehrtenstube. Dort stand der Junge lange still in der Mitte des Raumes. Die großen Augen schienen unter dem Tuch förmlich hinauszudrängen. Schließlich trat er auf das Bücherregal zu und näherte sich einem der dort aufgestellten Folianten.
Nie zuvor hatte George so viele Bücher aus der Nähe gesehen, aber es war, als gebe es hier etwas zu erinnern. Gerade noch rechtzeitig fuhr der Bischof mit erhobenem Arm dazwischen, und mit einem Satz entfernte sich die schuppige Gestalt vom Regal. Mit jedem Schritt, den der Bischof auf ihn zutat, wich George weiter zurück. Die Ecken des Zimmers dienten ihm als immer neue Zuflucht, sodass der Bischof schließlich von einem Klaps auf die Hände absah.
Zuallererst versuchte der Bischof, sich Klarheit über die Herkunft des Jungen zu verschaffen. War er anfangs noch zuversichtlich, das Geheimnis durch das Aufgebot seiner Beichtkunst, die noch jede Sünde ans Licht hervorgezerrt hatte, entlüften zu können, so misstraute der Bischof bald entschieden jedem Wort, das der Kerl von sich gab. Im Hinblick auf die Fragen nach Name, Eltern und Konfession blieb er gänzlich stumm. Er saß dumm da, kratzte sich, starrte in die Luft oder schickte die Pupille das Regal mit den Folianten entlang. Von einem Kopfstand war der Junge nicht einmal durch Androhung von Schlägen abzuhalten. Als er jedoch so wild Rad zu schlagen begann, dass die Folianten in den Schränken erzitterten, stürzte sich der Bischof in jäher Wut auf ihn und riss Kleid und Tuch von Kopf und Händen.
Vor ihm stand ein etwa sechzehn Jahre alter Junge mit blasser, durchscheinender Haut. Die Gestalt war so schmal und weiß, dass sie an einen mageren Fisch erinnerte. Glatt und flachsfarben war das Haar, die Augen sahen rund und wie Kiesel aus tiefen Höhlen hervor, und darüber formten die Brauen, die zusammengewachsen waren, ein struppiges »M«.
Der Bischof, der Narben im Gesicht erwartet hatte, Entstellungen, kaute enttäuscht auf den Lippen herum.
Bald aber begriff er die merkwürdige Aufmachung. Kaum dass das Tageslicht durch das geöffnete Fenster Gesicht und Hals des Jungen berührte, begann sich dieses im Nu, mit einer hellen, pickligen Röte zu überziehen, und er flüchtete in eine dunkle Ecke.
Der Bischof ordnete die Folianten, dann lockte er den Jungen, in die enge Kammer einzutreten, die in eine Wand der Gelehrtenstube hineingebaut war, ein, wie er sagte, schützendes Dunkel. Kaum war er drin, wurde die Kammer sorgfältig bis auf Weiteres verriegelt.
Anfänglich trat George auf der Stelle, wechselte von einem Bein auf das andere wie ein Tier in einem zu engen Pflock, um die Kälte aus den Gliedern zu vertreiben. Je mehr Zeit verging, desto langsamer wurden seine Bewegungen.
In der zweiten Nacht stand George einfach da. Rücken und Stirn wurden von seinem Gewicht gegen die hölzerne Wand gepresst, Knie und Füße waren schwer. Seine Lunge sog die wenige Luft in sich ein, die durch die Öffnungen der Türränder drang. Splitter bohrten sich aus dem Holz in sein Fleisch. Das Dunkel, das in der Kammer herrschte, war ein anderes Dunkel als das Dunkel der Nacht. Ganz gleich, wie schmal und schwach die Sichel des Mondes war, so kannte sie doch Schatten, Stufen, Grau um Grau. In dem Dunkel der Kammer aber gab es nichts zu sehen und nichts zu spüren. George wusste nicht, was ärger war: das Dunkel, das er vor Augen hatte, oder das, was in ihn Einzug hielt, wenn er sie schloss. Er atmete den Geruch von harzigem Kiefernholz und schmeckte seinen Speichel. Doch erst als eine schläfrige Ameise an der Wand vor ihm hinauf und über sein Gesicht in Richtung Decke kroch, stoben und funkelten die Spiegel in seinem Gedächtnis, und eine feuchte und staubige Erinnerung kehrte wieder. Schnell hob er an, um dagegen anzusingen.
George sang die Genesis und das Buch Hiob, er sang, bis die Ordnung der Laute ihm entglitt. Er sang Worte, die er nie zuvor gesprochen hatte, und dabei sang er sich hinfort von dem Grund, an dem es nur Hunger gab, und Schmerz und Rüben, an denen die schwarze Erde klebte.
Der Bischof, der nicht leicht zu entsetzen war, erschrak zu Tode, als er aus seinem Bett schlich und ein Ohr an das Äußere der Kammer legte. Er erkannte die Wörter »Gott« und »Amen«, und irgendwann wichen auch die Konturen dieser Wörter einem unverständlichen Gesang.
Der Bischof begab sich zurück ins Bett und entschied, die Kerzen brennen zu lassen.
Am Morgen des dritten Tages wurde George aus der Kammer hervorgezogen. Er reckte die Glieder, woraufhin einzelne Knochen einen erstaunten Ton von sich gaben.
Ansonsten aber, staunte der Bischof, gab er keinen Klagelaut von sich. Was musste der Kerl einst für einen strengen Lehrmeister gehabt haben, durchfuhr es ihn.
Er befahl dem Jungen, das Gesicht unverhüllt zu lassen. Das Fensterglas, versprach er, schütze vor Sonnenlicht. Dann erkundigte er sich nach dem, was die Kammer an Einsicht gebracht hatte.
Das Einzige, sagte George, an das er sich erinnere, seien Hunger und Furcht.
Dem Bischof schien diese Antwort zu gewöhnlich, doch erlaubte er dem Jungen aus einem Anfall von Mildtätigkeit, ein Frühstück zu sich zu nehmen. Er setzte ihm Brot vom Vortag und dazu ein gekochtes Ei vor, doch behauptete der Kerl, dass er nichts Gekochtes zu sich nehme, sondern Vergorenes bevorzuge, gerne auch rohen Fisch oder rohes Fleisch, und Früchte, Beeren und Knollen. Als ihm daraufhin zwei faulige Rüben auf den Teller gelegt wurden, überzog der Junge sie mit einer dicken Schicht Salz und Pfeffer, dann nahm er einen Bissen, schluckte die eine Hälfte hinunter und spuckte die andere in seinen Brotbeutel.
Vielleicht, dachte der Bischof enttäuscht, während er den kauenden und spuckenden Jungen betrachtete, hatte er schlicht einen gewöhnlichen Armen vor sich. Eine Laus, der vom brennenden Hunger das Hirn versengt worden war. Wieso dann aber beherrschte diese Laus – Latein?
Als der vom vielen Rätselraten erschöpfte Bischof zur Nachtruhe rief, machte der Kerl neuerlich Ärger. Nicht nur wollte er kein Bett benutzen, er wollte nicht einmal schlafen, sondern, man stelle sich vor, Sonne und Mond anbeten! Aufgeregt zeigte er auf den roten Himmel und sagte, dass die Sonne sich nächtens in den Mond verwandle. Man habe die Pflicht, die Sonne, die man als Mutter aller Lichter besonders verehren müsse, zu begleiten, denn ohne einen schützenden Blick drohe sie sich nicht mehr in ihre Taggestalt zurückverwandeln zu können. Jemand müsse ein Auge darauf haben, dass die Verwandlung glücke. Dort, wo er herkomme, sei dies jungen Männern vorbehalten.
Ja, wo komme er denn her, zürnte der Bischof.
Das wisse er nicht, antwortete George mit trauriger Stimme. Was er wisse, sei, dass der Morgenstern und der Abendstern ein und dasselbe waren.
Der Bischof, dem die Ohren von dem heidnischen Unsinn rauschten, wollte den unbelehrbaren Wicht schon durch Androhung der engen Kammer zum Schlaf bewegen, als er sich eines Besseren besann. Zu sehr ängstigte ihn die Aussicht auf den schaurigen Gesang. Knurrend suchte er das Bett auf. Sogar Georges Bitte, in der Nacht die weißen Handschuhe, die der schlafende Bischof vor dem Zubettgehen abstreifte, einmal selbst anlegen zu dürfen, gab er nach.
Die Sonne sank einen tiefroten Horizont hinab. Als einzig noch der Mond als silbernes Loch am Himmel hing, wanderte Georges Blick zurück ins Innere der Gelehrtenstube. Mit klopfendem Herzen trat er vor das Regal, hob die Hand und strich mit den Fingern über die Buchrücken. Bei einem schließlich machten die Hände halt, und seine Finger tasteten den Rücken entlang. Er zog den verstaubten Band hervor, blätterte die erste Seite um und begann zu lesen.
Noch vor dem ersten Satz hörte er einen anderen darin Atem nehmen. Erschrocken sah er vom Buch auf und horchte auf. Ein Echo durchflutete den Raum. Sogleich lenkte er den Blick in die begonnene Zeile zurück. Ein Herzschlag hatte dort eingesetzt, sein eigener oder der eines anderen. Und mit einem Mal durchfuhr ihn eine Sehnsucht, die gleißend war. George wusste nicht, wie ihm geschah und was er eigentlich las. Aber er las. Von Komma zu Komma trug es ihn, die Lettern funkelten, nahmen einander an die Hand. George las, und irgendwann sah er durch das Papier hindurch ein Eiland vor sich. Es war von solch unerhörter Schönheit, dass ihm schwindelig wurde. Durch das Fenster schimmerte der Mond, und sein Glanz berührte sacht die Träne, die Georges Wange hinunterrollte.
Am Morgen musste der Bischof feststellen, dass der heidnische Unsinn des Vortages in der Nacht um ein Weiteres ergänzt worden war. Während er in eine Rübe biss, hob George kauend an zu einer neuerlichen Fata. Er sei ein Bewohner der Insel Formosa, fabulierte er, was »schöne Insel« bedeute, und die ursprünglich zum Königreich Japan gehört habe. Japan sei ein Land, in dem kaum ein Mensch je gewesen war, denn die Japaner ließen niemanden hinaus und niemanden herein. Auf Formosa waren die Sonne mild und der Mond rötlich. Man schlief am Meer, und wenn man erwachte, gingen freundliche Tiere um einen her. Nichts schmerzte, von nichts ging eine Bedrohung aus. Und wenn einer starb, so kam er wieder. In einer anderen Gestalt.
Der Bischof runzelte die Stirn.
Was für ein Herrscher, rief er, sollte diese sonderbare Religion dulden?
Inzwischen gehöre die Insel dem chinesischen Kaiser, sagte George, doch trieben sich noch immer niederländische Missionare dort herum. Jesuitenbrüder hätten ihn, George, von Formosa entführt und in das katholische Frankreich verschleppt und in den katholischen Glauben zwingen wollen, zum Glück aber habe ihn ein mildtätiger schottischer Bischof mit weißer Hand in den rechten Glauben hinübergerettet.
Dies sagend, reichte George ihm fröhlich ein schmutziges Palmenblatt, wo die Fata, die er gerade zum Besten gegeben hatte, im flüssigsten Latein geschrieben stand.
Dem Bischof von Innes krampfte sich das haarige Herz angesichts dieses Unsinns. Zugegeben aber schmeichelte ihm die formosanische Fata, schließlich war darin eine verlorene Seele durch bischöfliche Hand, die noch dazu seine eigene war, vor dem Fegefeuer bewahrt worden.
Sein Blick fiel auf einen Folianten, in dem der Junge in der Nacht gelesen haben musste. Der Bischof konnte sich nicht erinnern, das Buch überhaupt jemals erstanden zu haben. Der Verfasser war ein holländischer Missionar, ein Jesuitenbruder namens George Candidius, der viele Jahre auf einer nahe dem japanischen Festland gelegenen Insel verbracht und alles dort Erlebte in einem ausführlichen Bericht an seine Vorgesetzten der Dutch East India Company festgehalten hatte. Die Insel, die Candidius beschrieb, trug den Namen Formosa.
Der Bischof schrie auf. Dann wies er den Lügenbold mit fester Stimme an, in die Kammer einzutreten. Nachdem er die Tür verriegelt hatte, ging er hinüber in die Küche, wo er das Jesuitengeschmier schon in den Herd zu schleudern gedachte, als er sich besann. Eine erst heidnisch, dann katholisch verirrte Seele zu befreien war ein Verdienst, dem die Landeskirche gewiss den höchsten Tribut zollen würde. Der Bischof hörte schon die lobpreisenden Worte des Bischofs von London, spürte Küsse auf den Fingerspitzen, sah seine Hände von bunteren Edelsteinen verziert.
Als Japaner, so schwärmte es in ihm, würde der Junge sein Glück zu machen wissen. Wilde waren gerade groß in Mode. Aus dem fernen Amerika hatte es über sogenannte »Indianer« Gerede gegeben, und von dem schwarzen Kontinent wurden Sklaven in die Hauptstadt gebracht. Wilde, hieß es, führten ein besseres Leben. Ein französischer Kopf namens Rousseau, der gerade in aller Munde war, behauptete, dass der Mensch gut sei und erst durch die Gesellschaft verdorben würde. Von Ursünde, Übel, Laster kein Wort! Die Landeskirche tat gut daran, solche Zungen zu bekämpfen.
Eine verirrte Blaumeise fiepte vom Fensterbrett. Im Nu besann sich der Bischof des Anblicks seines Schützlings. Zwar war er sich unsicher darüber, wie ein japanischer Wilder genau auszusehen hatte, doch so wie George gewiss nicht. Gerüchten zufolge trugen Wilde Schwänze oder hatten sonstige Auffälligkeiten vorzuweisen.
Vielleicht, sagte sich der Bischof, waren Japaner ja Wilde der besonderen, womöglich der edleren Art. Ein angestrengtes Nachdenken trat ihm in Form von Schweißperlen auf die Stirn.
Er schlug den Candidius auf und begann zu lesen. Der Jesuitenwicht berief sich immerhin auf den ehrenwerten Marco Polo. Die Japaner seien keinesfalls primitive Wilde, sondern solche, die Tempel bauten und diese mit Gold schmückten. Wie genau ein Japaner aussah, darüber schrieb der Seereisende nichts, und auch der Pater gab über seine Formosen keinerlei Auskunft. Allein Sitten, Gebräuche und Glauben der Bewohner wurden ausgiebig erläutert.
Am Ende des Nachmittags ließ der Bischof die Buchdeckel aufeinanderklappen, und ein Lächeln schlich sich zwischen seine Mundwinkel. Die Fische in der Küche waren verfault, George aber war ein wahrhaft großer Fang.
Bevor er die Kutsche bestieg, versicherte er sich, dass sein Schützling sicher in der Kammer verstaut war.
Das Erste, was der alte Innes von der Hauptstadt sah, war ein Schwein, dem man den Hals durchtrennte. Einst hatte es hier Felder, Gärten und Weinberge innerhalb der Stadtmauern gegeben. Nun war alles, auch die Gesichter der Menschen, von Schmutz und Staub bedeckt. Der Bischof erkannte Wasserträger, Bauchtänzer, Metzger, Betrunkene und Huren. Es roch nach Geschlachtetem, nach Pferdedung, nach Kohle, Bier und Most. Vor nicht allzu langer Zeit hatte es in den Straßen gebrannt, und darin alles Fleisch und alles Vieh. Laut war es außerdem, man hörte Schreie, Trommeln, Hammerschläge, das Scheppern von Glocken, Geschrei, wann immer einer einem anderen den Weg versperrte, quietschende Kutschen, die sich durch enge Straßen zwängten. Immer wieder musste sich der Bischof an eine Häuserwand lehnen, um die Hand schützend vor Augen, Hand und Nase zu legen. Metall, Eisen drangen als Echo in sein Ohr, Stimmen zwängten sich hinein, Menschen, Hühner, Pferde, Kälber, Füße und Hufe, die hart auf das Pflaster traten, ein Chor schwarzen Abschaums, der zu einem Strudel zusammenfloss und die Häuserwände hinaufschwoll.
Erst als der Bischof die Augen schloss, hörte er das helle Läuten von Kirchenglocken, die, in der ganzen Stadt verteilt, aus den verschiedenen Richtungen zusammentrafen und ein leises Lied anstimmten.
Durch Nachfragen und die Herausgabe mancher Münze brachte es der Bischof fertig, in der Hafengegend Reisende ausfindig zu machen, die einige Zeit auf Formosa zugebracht hatten und demnach als Experten gelten konnten. In einer stinkenden Spelunke namens Türkenkopf saß er schließlich einem lispelnden Buckligen, einem einbeinigen Matrosen und einer Jesuitenschwester mit Augenklappe gegenüber. Er erhielt durchaus widersprüchliche Aussagen.
Wenn du, riet ihm der lispelnde niederländische Missionar, einen Formosen siehst, behalt es für dich.
Dabei deutete er auf seinen buckligen Rücken und gab an, von den Einwohnern Formosas gebissen und krumm getreten worden zu sein, als er ihnen das Gebet beizubringen versucht hatte.
Die Männer, behauptete hingegen der Matrose und stampfte dabei mit dem Holzbein auf, trügen in der einen Hand ein Schwert, die Frauen im Haar eine gelbe Blume. Manchmal auch sei es umgekehrt.
Was die Hautfarbe der japanischen Eingeborenen anging, erhielt der Bischof, der sich wiederholt danach erkundigte, neben ratlosem Erstaunen und Achselzucken nur ungenaue Antworten.
Die Jesuitenschwester, die er in seiner Not aufsuchte und der die formosanische Sonne offenbar den Verstand versengt hatte, behauptete, Japaner seien klein und oliv, wusste die Wichtigtuerin zu berichten, wobei sie bedeutsam mit dem verbliebenen Auge klimperte.
Formosen, fiel dem lispelnden Missionar ein, seien von noch dunklerer Farbe als die afrikanischen Sklaven, die im fernen Bristol Woche für Woche an Land gingen.
Nein, widersprach der gebissene und getretene Experte beiläufig, Formosen seien keineswegs oliv, dunkelbraun schon gar nicht, sondern vielmehr gelb wie die Chinesen.
Der Bischof schaute enttäuscht durch die Gesichter der Experten hindurch und erinnerte sich an die Gestalt seines Zöglings. Die Haut des Jungen war so weiß, dass sie im Dunkeln leuchtete. Allein das Licht, grübelte der Bischof, verlieh der Haut eine rötliche Nuance.
Am Ende seiner Reise in die Hauptstadt lag das japanische Königreich als eine Gegend vor ihm, von der sich ein Bild zu machen unmöglich war. Seit sie den Portugiesen und Niederländern als Handelspunkt ausgedient hatte und nun unter dem chinesischen Kaiser verwahrloste, war die Insel Formosa nahezu in Vergessenheit geraten.
Der Bischof entschied, dass vonseiten der Experten nichts zu befürchten war. Alles, was sie zum Besten gaben, waren widersinnige Zeugnisse, fantastische Reden. Mit der Hautfarbe nahm es keiner sonderlich streng. Trat man mit genügend Vorbereitung auf, würde niemand in der Hauptstadt einen echten Japaner von einem falschen Japaner zu unterscheiden wissen.
Zumal ein solcher Exot gerade passend kommen könnte. Allerorts herrschte sichtlich Erleichterung darüber, dass man die katholischen Rebellen niedergestreckt hatte. Die alte, glänzende Ordnung war an ihrem angestammten Platz. Das Blut der vergangenen Tage war von den Straßen gewischt, die letzten Hexen glaubte man verbrannt. König George II. regierte mit träger und nachsichtiger Hand. Nichts deutete auf eine Unterbrechung des Friedens. Der unsinnige Feldzug gegen Spanien war beendet, ebenso der Krieg um die leidige Maria Theresia. Selbst die roten Kreuze, die in einem Haus die Pest anzeigten, waren von den Türen verschwunden, und bald, prophezeite ihm ein Krämer, wäre auch der Letzte im Volk gegen Pocken geimpft. In Kalkutta, so hieß es in einem Sonderblatt des London Chronicle, mochten heimtückische Schwefeladern die Erde zum Beben bringen. Die britische Erde aber stand ehern. So sicher wähnte man sich, dass der schützende Stein des Brutus aus der Cannon Street fort und ins Innere der St. Swithin’s Church gebracht worden war.
Die alte Regel, dachte der Bischof, nach der Menschen bald schon des Friedens überdrüssig würden und es sie nach neuerlichem Krieg, nach der Absetzung ihrer Könige oder der Eroberung fremder Länder gelüstete, hatte für eine Weile in einer Chaiselongue Platz genommen, die von den viele Jahre währenden Kriegen der Vergangenheit erschöpfte Stirn tief in Seidenkissen gebettet. Sie lag und dämmerte und liebte den Fortschritt, der lustvoll unter ihre ehrwürdige Robe gekrochen war.
Die Hauptstadt glich einem summenden Nest, in dem ein jeder nicht Untertan, sondern Bürger war. Dem Bürger galt es als vornehmste Pflicht, sich für die Gesellschaft, in deren Baumkrone er nunmehr emporgeklettert schien, als tätig und gesittet zu erweisen. Dies aber schloss, wie der Bischof angewidert feststellen musste, den Frohsinn nicht aus. Die kaffeebraunen Pflastersteine glänzten im dünnen Licht, und inmitten seiner täglichen Besorgungen und Verrichtungen fand manch einer unabhängig von Stand, Wissen und Können die Zeit für ein Gespräch.
Neben dem König, berichtete ihm die Landlady des Cheshire Cheese, wo der Bischof auf einen Gin einkehrte, hatte ein anderer, ein zweiter Mann die heimliche Herrschaft in der Stadt übernommen. Dieser Mann, der Mr. Johnson hieß, war durch ein satirisches Poem, das jeder auswendig kannte, zu Ruhm gekommen. Der Dichter galt als wahrer Salonlöwe – eine Gesellschaft ohne Mr. Johnson war keine Gesellschaft, hatte der London Chronicle geschrieben – saß aber zugleich tagaus, tagein in den Tavernen, wo er Portwein trank. Man scharte sich um ihn. Noch nie hatte man einen Gelehrten gesehen, der ein ganzes Wirtshaus unterhalten konnte!
Hinter vorgehaltener Hand, sagte die Wirtin, würden die Stadtobersten ihn einen Quälgeist nennen, der zwar Verstand und Moral unter das Volk mischen wollte, selbst aber mit Gesindel verkehrte. Nicht wenige Tage seines berühmten Lebens verbrachte Johnson mit einer durch und durch fragwürdigen Person, dem Dichter Richard Savage, einem vorlauten und liederlichen Betrüger.
Als der Bischof wieder in seiner Kutsche gen Schottland saß, wusste er, dass es dieser Mensch und kein anderer war, dessen Gunst der Junge sich vor allen anderen verdienen muss. Er überlegte. Aber selbst wenn dies gelingen sollte, so konnte die Sache noch keinesfalls als ausgemacht gelten. Der Bischof kämpfte den Jubel, der in ihm aufzog, hinunter. Sicher, die formosansche Fata konnte ihm Münzen, das dazugehörige höhere Amt einbringen, eine schöne, glänzende Marmorkanzel und sittsame Schäfchen. Doch begab er sich in große Gefahr. Auf dem Scheiterhaufen landete man hierzulande nicht mehr. Wer sich aber etwa der Gotteslästerung verdächtig machte, wurde in die königlichen Bleikammern gesperrt oder das Newgate, wo die Gefangenen hungernd und frierend in fauligem Schlamm umherkrochen. Das Gefängnis hockte weithin sichtbar auf dem düsteren Zahn der Stadt wie eine faule Krone, die einem jeden Bewohner finster entgegenfunkelte. Dort, im tiefsten und dunkelsten Kerker, einem fensterlosen Bau, hieß es, gab es Instrumente, die den Körper wie einen Folianten zusammenfalteten.
Als der Bischof über die Schwelle seines Hauses trat, lagen in seiner Rocktasche sieben erzieherische Maßnahmen, die er während der Fahrt verfasst hatte. Diesen würde er den Jungen umgehend unterziehen, sobald man ihn aus der Kammer hervorgezogen, an den Gelenken gelockert und von Staub und Asseln befreit hätte.
Im Zuge einer ersten Maßnahme mussten alle Fata aus Georges Gedächtnis und Seesack getilgt werden.
Sehr zum Zorn des Bischofs erwies sich der Junge als starrsinnig. Einen gesprochenen Satz möge man, wenn es unbedingt nötig sei, zurücknehmen, bitte, aber ein geschriebenes Wort auszustreichen, behauptete der Kerl, gehöre sich nicht.
So blieb dem Bischof nicht anderes, als sämtliche Schriftstücke aus Georges Seesack dem Feuer zu übergeben. Flackernd und knisternd verschwanden die Blätter zusammen mit den Requisiten, schließlich verschwand der Seesack selbst. Natürlich ließ die Laus sich kaum im Haus halten, als sie den Plunder auf dem Hof brennen sah, saß dann aber, als der Beutel immer größere Brandlöcher zeigte und schließlich auseinanderfiel, nur stumm am Fenster und starrte in die Flammen.
Um allen Unrat aus dem Gedächtnis zu verbannen und mit formosanischer Erde anzureichern, entschied der aufgekratzte Bischof, dass hier nicht Strafe, sondern Verlockung angebracht sei.
Was er sich am meisten wünsche, fragte der Bischof.
Er wünsche, sagte George, das Meer zu sehen.
Das Meer komme nicht infrage, sagte der Bischof, das Meer sei ein wüster, finsterer, ein ganz und gar heidnischer Ort.
Dann, sagte George, wünsche er nichts.
Ob er nicht vielleicht ein Dach über dem Kopf und eine schützende Hand wünsche, krähte der Bischof erschöpft.
Ein Dach über dem Kopf, sagte George, ja, das wünsche er sich, und weiße, schützende Hände.
Von seinen Geschichten wollte er dennoch nicht ablassen. Hannibal wollte er heißen, Hector und – man stelle sich vor – Hercule. Der Bischof entschied, dass die kleinste Strafe schon immer mehr getaugt hatte als die größte Verlockung, und entsann sich der empfindlichen Haut des Jungen und band ihn kurzerhand an einem Baum im bischöflichen Garten fest.
Während der Junge in der Sonne briet, trat der Bischof in regelmäßigen Abständen vor die Tür und schrie der schwarz verkutteten Gestalt entgegen:
Japaner sei er! Nach Formosa sei er geflohen! Jesuitenbrüder hätten ihn von dort entführt und zu den Katholiken nach Frankreich verschleppt! Von dort habe ihn ein mildtätiger Bischof in den rechten Glauben gerettet und nach Schottland gebracht!
Während er schrie, klopfte seine Eisenhand laut und rhythmisch gegen den Stamm.
Der Spiegeldraht in Georges Kopf funkelte und stob. Und während sich sein Gesicht mit einer tiefroten, schmerzenden Rinde überzog, hob George zu singen an, und während er sang, sank er hinab zu seinem Namen, der am Grunde seines Gedächtnisses lag und der sich nun mit der formosanischen Fata vermählte.
Als er schließlich losgebunden wurde, wusste George, dass er George hieß. George – war George. Und nur George.
Der Bischof tippelte sich gegen die Lippen. Üblich und artig war der Name. Der Bischof nickte: Das Dach und die Hände würde George bekommen. Dafür, dass er seinen Namen aus der Finsternis emporgezogen habe. Doch dürfe er kein Wort mehr über die anderen Fata verlieren. Nie wieder!
Seine formosansche Fata hingegen solle er ruhig ein wenig ausschmücken. Ein Gott müsse her, ein Staat, auch Tiere und Pflanzen seien erwünscht. Vor allem aber ein König. Von Kopfjägern und Kannibalen sei hingegen abzusehen. Putzig solle es auf Formosa zugehen, wenngleich nicht gar zu heidnisch. Weniger wild als bei den Eingeborenen Amerikas, doch wilder als bei den Schotten. Wenn ihm das gelänge, erwartete ihn das Meer.
George zupfte sich ein Stück Haut vom Ohr und machte sich ans Werk.
Im Zuge der zweiten bischöflichen Maßnahme, die der Erfindung Formosas galt, ließ der Bischof Bücher kommen, die ihm einer der Experten anempfohlen hatte, darunter Bernardus Varenius’ Descriptio regni Japoniae aus dem Jahr 1649, ein Reisebericht von Seyger van Rechteren. Die Schriften eines gewissen Albrecht von Mandelslos sowie eines Jean Baptiste Taverniers enthielten kurze, wenngleich aufschlussreiche Passagen über die Insel. Zwei Niederländer namens Arnoldus Montanus und Olfert Dapper hatten ausführliche Schriften verfasst, einen Atlas Japanensis und einen Atlas Chinensis. Über die Atlanten allerdings konnte man, recht besehen, nur schmunzeln, so weinerlich und schwärmerisch waren sie.
In der Nacht saß George im bischöflichen Sessel über Bücher gebeugt. Oft hielt er inne, hob den Kopf und betrachtete den Mond. Er saß und wartete, und irgendwann zogen vor der stillen gelben Scheibe Muschelhörner und Dörfer auf Schiffen vorüber, Menschen, die nackt gingen und über deren Geschlechtern goldene und silberne Lettern glänzten. Mit allem, was er las und sah und auf seine verbliebenen Papiere schrieb, wuchs die Insel, Kiesel um Kiesel, Vogel um Vogel, sodass schließlich ein duftend rauschendes Eiland vor seinen Augen lag.
Eine dritte erzieherische Maßnahme war die Arbeit an Georges Zungenschlag. So klar, rein und fehlerlos er das Englische schrieb, so ausnehmend schmutzig war sein gesprochenes Wort. Es vereinigte unterschiedlichste Farben der Küstenstriche: das Englisch der Unterschicht, das er mit einem halb deutschen, halb französischen Akzent sprach, sowie harte gälisch oder hebräisch klingende Laute. Der Kerl machte Pausen da, wo keine hingehörten, und er sprach einen jeden Satz mit falscher Melodie. Nur wenn er schrieb oder las oder seine Fata sagte, klang alles weich. Der Bischof ölte diese Melodie Abend für Abend mit einem Trank aus Weihwasser, er selbst genehmigte sich bei der Gelegenheit ein Gläschen des Gins, den er hinter Buchreihen verborgen aufbewahrte.
Wenn sie so bei der bischöflichen Ölung beieinandersaßen, lasen sie gemeinsam die Heilige Schrift. Sie lasen die Genesis, den Exodus, die Bücher Samuels und die der Könige, die Psalmen und das Hohelied. Irgendwann dann glitt George hinüber aus dem Lateinischen in seinen merkwürdig unverständlichen Gesang, vor dem der Bischof zunächst davonlief oder sich die Hand über die Ohrmuschel hielt. Mit der Zeit aber wurde ihm der sonderbare Klang vertraut.
Ein Mensch war er, staunte der Bischof, ein Mensch, und doch gut. Und das, obwohl oder vielleicht gerade weil er nicht einmal wusste, wer er war.
Für den fremden Wohlklang, der selbst ein so haariges altes Herz wie das bischöfliche zu rühren vermochte, aber mussten, so befahl er seinem Zögling, Zeichen erfunden werden, auf dass man dem Klang mit dem Auge folgen und sie auf Geheiß wiederholen konnte. So stand es geschrieben in der vierten bischöflichen Maßnahme, die der Erfindung der formosanschen Schrift und Sprache galt.
Um etwas so Ehrwürdiges wie ein Alphabet zu erfinden, aber reichten die schäbigen Schreibsachen des Jungen nicht aus. Das entschied der Bischof und orderte Papier aus der Hauptstadt. Es war das erste Mal, dass George ein weißes Blatt berührte. Der zerbrochene Bleistift wurde durch eine elegante Feder ersetzt. Sie lag in seiner Hand, fremd und dünn. George wagte lange nicht, das Papier damit zu berühren. Dann aber strich er mit einem Finger über die Fläche und drückte den Kiel beherzt auf das Papier.
Von da an war er nie ohne ein Papierstück anzutreffen.
Seine Feder knisterte und schabte, und unter ihrer Führung nahmen sich die Striche an die Hand, um einen neuen formosanischen Buchstaben zu gebären.
Dann war das Alphabet fertig, und der Bischof trat heran, um es in Augenschein zu nehmen. Die Formen, die der Junge gewählt hatte, waren, wie er zufrieden feststellte, den Lettern des Lateinischen nicht unähnlich.
Zwanzig Buchstaben, lobte ihn der Bischof, waren gut zu handhaben, und die Zwanzig sei überdies eine hübsche Zahl.
Sein Alphabet, erklärte George, könne man in Spalten von oben nach unten schreiben und von rechts nach links lesen.
Der Buchstabe mit Namen Xatara erinnerte an eine Schlange, der Formosen bevorzugte Speise, wie George erklärte. Ein Buchstabe mit Namen Am hatte den Umriss einer Sanduhr. Ein anderer, den er auf den Namen Vomera taufte, stellte ein Dreieck mit scharfen Ecken dar. Ein diagonal in der Luft schwebender Nagel hörte auf den Namen Bagdo. Hamno war ein zweistufiger Treppenabsatz, Kaphi ein zierlicher Engel, Omda ein Bogen, in dem eine Pfeilspitze steckte. Georges liebstes Zeichen war ein Zeichen mit dem Namen Taph. Es zeigte einen Kreis, so rund wie ein Gesicht, und darüber hockte ein waagerechter Strich, der an ein Dach erinnerte.
Der Bischof schüttelte den Kopf über so viele unsinnige Einfälle, die sich verständig gebärdeten, jedoch im Grunde ohne Verstand waren. Spätestens, wenn man eine Übersetzung, eine Kunst, die gerade überall groß in Mode war, von ihm verlangte, wäre der Schwindel enttarnt.
Um sich gegen den Vorwurf der Unsinnigkeit zu wappnen, ersann der Bischof eine Situation, die den Jungen die Kunst des Übersetzens lehren sollte. Und so wurde, zu ihrer beider Sicherheit, die fünfte Maßnahme in Angriff genommen. Dazu schlich sich der Bischof von hinten heran, riss George die Bibel, über der er mit gebeugtem Schopf saß, vom Schoß, kniff die Augen zusammen, tippte mit dem steifen weißen Finger wahllos auf eine Stelle der aufgeschlagenen Seite und befahl, das, was dort stand, aus dem Stegreif ins Formosansche zu übersetzen. George sah auf das Blatt, dann schielte er an dem listigen Bischof vorbei nach draußen und sagte einen Satz.
Der Bischof befahl ihm, dasselbe noch einmal aufzusagen, und natürlich konnte George seine Übersetzung nicht exakt wiederholen. Eine Biene, die zu dieser Jahreszeit rein gar nichts in dem schottischen Örtchen verloren hatte, kam ihm zu Hilfe. Sie senkte ihren Stachel in Georges linke Augenbraue, woraufhin diese erschrocken anschwoll.
Die Zeichen, erklärte George, verschwänden vor seinen Augen, er bedauere zutiefst.
Der alte Innes strich sich mit der eisernen Hand über die runzligen Brauen und wandte sich heimlich lächelnd ab – er konnte nicht anders, als diesem Manöver eine unerhörte Eleganz zu attestieren. Trotzdem entschied er, streng zu sein, und befahl ihm, ein so gewichtiges Werk wie das Vaterunser