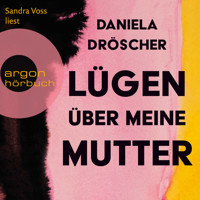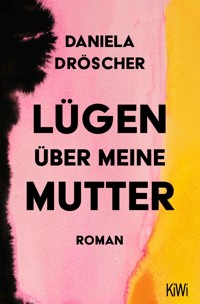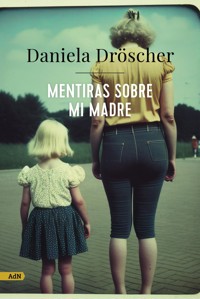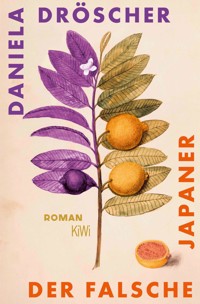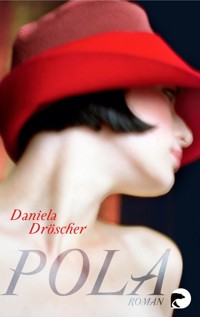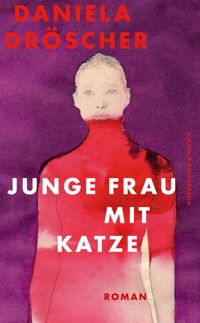
19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Alles ist schwierig, bevor es leicht wird: Daniela Dröscher erzählt so intensiv wie humorvoll von einer Frau, die endlich Verantwortung für das eigene Glück übernimmt. Zeit ihres Lebens stand Ela wortwörtlich im Schatten ihrer Mutter. Deren dicker Körper, so die Überzeugung des Vaters, war für das Unglück der gesamen Familie verantwortlich. Nun ist Ela erwachsen und es ist ihr eigener, ihr kranker, Körper, der sie verzweifeln lässt. Kurz vor dem Abschluss ihrer Promotion erlebt Ela einen Zusammenbruch. Während sie unbewusst mit der Frage ringt, ob sie ihren Platz in der akademischen Welt wirklich verdient hat, rebelliert ihr Körper: der Hals, das Herz, die Haut – Ela steht in Flammen und gerät in immer größere Panik. So wie die Geschichte ihrer Mutter, der Daniela Dröscher ihren großen Romanerfolg »Lügen über meine Mutter« gewidmet hat, ist auch Elas späte Selbstfindung und Selbstermächtigung meisterhaft autofiktional konstruiert, psychologisch mitreißend und hinreißend komisch.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 307
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Daniela Dröscher
Junge Frau mit Katze
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Daniela Dröscher
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Daniela Dröscher
Daniela Dröscher, Jahrgang 1977, aufgewachsen in Rheinland-Pfalz, lebt in Berlin. Promotion im Fach Medienwissenschaft an der Universität Potsdam sowie ein Diplom in »Szenischem Schreiben« an der Universität Graz. Ihr Romandebüt »Die Lichter des George Psalmanazar« erschien 2009, es folgten der Erzählband »Gloria« (2010) und der Roman »Pola« (2012) sowie das Memoir »Zeige deine Klasse« (2018). Sie wurde u.a. mit dem Anna Seghers-Preis, dem Arbeitsstipendium des Deutschen Literaturfonds sowie dem Robert-Gernhardt-Preis (2017) ausgezeichnet. Der Roman »Lügen über meine Mutter« (2022) stand auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Nach ihrem hochgelobten Roman »Lügen über meine Mutter« erzählt Daniela Dröscher erneut so intensiv wie humorvoll von einer Frau, die endlich Verantwortung für das eigene Glück übernimmt. Nach einem Jahr der Veränderungen erlangt sie die Hoheit über ihren Körper, die Idee von Liebe und nicht zuletzt sich selbst – als Frau und als Autorin.
»Daniela Dröscher in einem Atemzug mit Annie Ernaux zu nennen, das ist unbedingt angemessen.« Wiebke Porombka, DLF
»Lustig, komisch und doch mit dem tiefen Ernst, den das Thema braucht. Das ist wirklich ein großartiges Buch. Ich kann das jedem nur ans Herz legen.« Elke Heidenreich über »Lügen über meine Mutter«
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 2025, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung: Barbara Thoben, Köln
Covermotiv: © Marianna Gefen
ISBN978-3-462-31316-1
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Motto
Als Kind habe ich …
1 Ein Geist in der Kehle
2 Lady Lazarus
Meine Mutter hat das Arbeiten immer geliebt …
3 Kalt genug wie Schnee
4 Mein Herz in der Enge
Auch meine Mutter …
5 Die zitternde Frau
Eine Therapeutin hat …
6 Heiße Milch
7 Das Orakel spricht
Meine Mutter hat mir nicht beigebracht …
8 Where is my mind?
So viele Jahre …
9 Ich der Kater
10 Ein Engel an meiner Tafel
In der Verfilmung …
11 Mein Jahr der Ruhe und Entspannung
12 Kokoro
Die Überschriften zitieren Bücher …
Zitat- und Quellenhinweise
Danksagung
Für alle Töchter, für alle Kinder, für alle Mütter
(Für Au., für J., für M.)
»Und wäre der Leib nicht die Seele, was dann wäre die Seele?«
Walt Whitman: Ich singe den Leib, den elektrischen[1]
»Man weiß nicht, was ein Körper kann.«
Spinoza[2]
Als Kind habe ich meine Mutter oft nackt gesehen. Halb nackt, genauer gesagt, sie hatte keinerlei Scheu, ein Oberteil vor mir aus- oder anzuziehen. Ich erinnere mich an ihre Arme, den hellen, von der Sonne unberührten Bauch, die vom BH nur halb bedeckten Brüste. Ihr Unterkörper hingegen blieb stets durch lange Röcke bedeckt, sie trug nie Hosen, nicht einmal die Silhouette ihrer Beine kenne ich.
Für den Philosophen Roland Barthes ist ein Schriftsteller jemand, »der >mit dem Körper seiner Mutter spricht«.[3] Ich habe über viele Jahre das genaue Gegenteil versucht. Ich habe den Körper meiner Mutter verheimlicht – mich für ihn geschämt.
Meinen eigenen Körper habe ich lange Zeit als etwas von meiner Mutter völlig Unabhängiges empfunden. Ein wenig wie in der Zeichentrickserie Tom und Jerry: das kleine Kind, das zwischen hin und her eilenden Erwachsenenbeinen herumirrt – Erwachsenen, von denen weder der Oberkörper noch das Gesicht zu sehen ist. So ungefähr, dachte ich immer, verhält es sich mit uns. Meine Mutter ist dort, ich bin hier, sie ist die sehr Dicke, ich bin die Dünne. Oder in den Worten meines Vaters: Ich bin die Schöne, sie ist die Hässliche.
Es gibt mehr Ähnlichkeiten zwischen uns, als zu vermuten wäre – was nicht erstaunlich ist, hat doch mein Körper lange Zeit im Schatten ihres Körpers gelebt. In ihrem geliebten Schatten, aus dem heraus ich zu ihr aufgesehen habe als Kind (immer mit dem lang gezogenen »wie lieb von diiiiir …« der Serie im Ohr).
Als Heranwachsende mag ich versucht haben, meiner Mutter und ihrem Körper zu entfliehen. Im Schreiben aber kehre ich zu ihm zurück, immer wieder, selbst dann, wenn ich ihn, wie in diesem Buch, ein wenig aus dem Zentrum verrücke. Seine Spuren, seine Blessuren – sie spuken in mir.
Hier, auf dem Papier, kann ich das Unmögliche wagen und versuchen, die Geschichte meines und auch ihres Körpers ein wenig anders zu erzählen. Ich kann schneller schreiben als unsere Schatten und die Uhr zurückdrehen. Zurück in eine Zeit, in der meine Mutter noch nicht so krank war wie heute und ich noch keine Schriftstellerin, sondern eine junge Frau mit Katze. Ich kann Wahrheiten vom Grund emporziehen und Wunder erfinden. Schreibend kann ich versuchen, uns zu retten. So wie mich das Schreiben immer gerettet hat.
1 Ein Geist in der Kehle
Es begann damit, dass es schon früher begonnen haben musste.
Es war Anfang Februar und der dritte Tag in Folge, an dem mein Hals schmerzte. Sogar meine Arbeit am Institut hatte ich abgesagt, ich schonte die Stimme, so gut es ging, und löffelte unablässig Thymian-Honig. Und doch brannte mein Rachen lichterloh.
Da alles nichts half, beschloss ich, mich in einer HNO-Praxis vorzustellen.
»Du musst zum Arzt gehen«, hätte meine Mutter gesagt. Das war ihre Regel. Am dritten Tag ging man zum Arzt.
Aus der Küche erklang das gurrende Miauen meines Katers. Sir Wilson lag ausgestreckt auf dem Boden, sodass man auf dem Weg zum Herd praktisch über ihn stolperte. Ich beugte mich hinab, streichelte sein dickes schwarzes Fell und füllte seine Schale, über die er sich sogleich hermachte.
Während ich Stufe um Stufe aus dem fünften Stock hinunterlief, überlegte ich, was genau ich in dem Patientengespräch sagen würde. Ich wusste, wie wichtig es war, die Praxis als eine halbwegs aufgeräumte Person zu betreten. Ich hätte nicht sagen können, wann ich die Halsschmerzen erstmals wahrgenommen hatte.
Hinter mir lag eine anstrengende Zeit, ich hatte meine Doktorarbeit mit Ach und Krach zu Ende gebracht, immerhin aber ohne größeren Zusammenbruch, doch wie so oft, wenn ich sehr konzentriert arbeitete, hatte ich meinen Körper gleichsam vergessen. Im Anschluss hatte ich die eine oder andere exzessive Party gefeiert. Vermutlich, mutmaßte ich, war ich einfach überlastet.
Ich stapfte durch den Schnee, meine Straße mit den vertrauten Fassaden entlang. In der Nacht hatte es geschneit, ganz still lag alles. Die Kinder der Nachbarn waren in den Winterferien oder schliefen, und die Stadt wirkte so angenehm leer wie sonst nur im Hochsommer. Nach wenigen Metern merkte ich, dass ich an den Füßen fror. Dummerweise hatte ich keine Stiefel, sondern nur Turnschuhe angezogen. Vogelfüße, erinnerte ich mich, waren von Natur aus kalt, sie konnten mühelos über vereiste Seen spazieren.
»Der Kopf und die Füße müssen warm sein«, hörte ich die Stimme meiner Mutter. Gesundheit war »das höchste Gut«, predigte sie immer.
Mützen trug ich aus Prinzip nicht, auch wenn es den äußeren und den inneren Narben an meinem Kopf – oder musste es heißen »im Kopf«? – gutgetan hätte, sie reagierten empfindlich auf Hitze und Kälte.
Mit Anfang zwanzig hatte man einen gutartigen Tumor in meiner vorderen Hirnhälfte entdeckt. Man hatte ihn entfernt, nie aber die Ursache klären können. Meine rechte Schädeldecke bestand aus Hügeln, Kratern. Knochen, Haut und Gewebe waren damals schnell verheilt. Die Narbe war in etwa so groß wie ein Hufeisen und erinnerte auch in der Form an eines. Das Schicksal hatte mir, kaum zwanzigjährig, einen Pferdekuss verpasst.
In der Praxis saßen gerade einmal vier Leute. Ich kam mir vor wie das seltsame Clownswesen in fünfter sein, ein Kinderbuch von Ernst Jandl, das ich Henny, der Tochter meiner Freundin Leo, manchmal vorlas. Darin saß eine Gruppe derangierter Kreaturen in einem Wartezimmer: ein trauriger Pinguin, eine einbeinige Ente, ein Bär mit gebrochenem Arm, ein Frosch mit verpflasterter Stirn und als Letztes eben das Clownswesen, dessen Nase an einem seidenen Faden herabhing. Der Text lautete: »tür auf / einer raus / einer rein / vierter sein / tür auf / einer raus / einer rein / dritter sein«, und so ging es weiter, bis zur letzten Seite: »tür auf / einer raus / selber rein / tagherrdoktor.«[4]
Dann saß ich auch schon auf dem Behandlungsstuhl, und eine freundliche ältere Ärztin nahm meinen Rachenraum in Augenschein.
»Haben Sie Fieber?«
Ich verneinte. Ich hatte nie erhöhte Temperatur, aber das konnte die Frau nicht wissen. Immer wieder wunderte ich mich, dass Ärzte gleichzeitig Fragen stellen und Untersuchungen vornehmen konnten.
Ich spürte, wie sie mir ihren langen Stab unangenehm weit in den Rachen schob.
»Sie haben eine Laryngitis. Eine Kehlkopfentzündung. Und keine zu geringe.«
»Huch. Wie kommt das?«
»Vermutlich durch einen Infekt. Kein Wunder, Sie haben keinerlei Abwehrkräfte.«
Die Frau warf den gruseligen Stab in eine Schüssel mit Desinfektionsmittel.
»Ihnen hat man die Mandeln so grobschlächtig rausgenommen, dass die Keime nur so reinrauschen. Das macht heute niemand mehr, also jedenfalls nicht – so.«
Es war mir neu, dass es derart gewichtige Unterschiede in der Ausführung gab. Meine Mutter war damals dem Rat unseres Hausarztes gefolgt, nachdem sie mich jahrelang mit »Kartoffelwickeln« therapiert hatte. In meiner Generation war es geradezu üblich, wenn nicht gar Mode gewesen, Kindern die Mandeln entfernen zu lassen. Ich erinnerte mich an einen Artikel, in dem jemand sarkastisch fragte: »Wo sind all die Mandeln hin?«
»Ein Infekt also. Aber ich habe gar keinen Schnupfen? Oder Husten?«
»Das ist in der Tat seltsam.« Die Ärztin sah mich genauer an. »Oder haben Sie Sodbrennen?«
Ich verneinte. Nur unglaublichen Durst hatte ich neuerdings.
»Es kann auch von unten kommen. Durch die aufsteigende Magensäure. Das weiß man allerdings noch nicht lange.« Sie hob die Achseln. »Es ist nicht mein Gebiet.«
Ich bekam ein Spray, das antibiotisch wirken würde.
»Vermeiden Sie es, zu viel zu reden. Und vor allem – ruhen Sie sich aus.«
Noch während ich die Arznei in meiner Tasche verschwinden ließ, entschied ich, sie nur im Notfall zu nehmen. Ich mochte keine Medikamente.
Auf dem Rückweg hatte der Straßendienst noch immer nicht geräumt. Mein Blick wanderte über die weiß bedeckte Brache. Ich verspürte den Impuls, mich auf den Boden zu legen und mit meinem Körper einen Schneeengel zu formen, so wie mein Bruder und ich es als Kind oft getan hatten. Ich sah mich um. Alles schlief noch. Niemand würde sich an meinem Engel stören. Schnell ging ich in die Hocke, und noch schneller hatte ich alle viere auf der weißen Fläche ausgestreckt und sah in den hellgrauen Himmel hinauf.
Ich vermisste meinen Bruder, wie so häufig, auch wenn das Vermissen mit den Jahren vergeblicher geworden war und dadurch fast unwirklich. Er lebte in London, wir sahen uns selten. Komischerweise musste ich im Winter häufiger an ihn denken, vielleicht, weil wir früher immer zusammen Schneeglöckchen gepflückt hatten. Ein Satz meiner Mutter kam mir in den Sinn: »Manchmal glaube ich, er ist nur als Junge auf die Welt gekommen, weil Papa unbedingt einen Sohn haben wollte.«
Ich rappelte mich hoch. Sosehr mein Hals auch brannte, ich musste allmählich zurück an den Schreibtisch. Meine mündliche Prüfung stand bevor, die sogenannte »Verteidigung« meiner Doktorarbeit.
»Gegen wen musst du dich verteidigen?«, hatte Henny mit der treffsicheren Weisheit einer Fünfjährigen wissen wollen.
Mir graute vor dem Tag. Das Gespräch konnte schon in drei Wochen stattfinden, womöglich aber auch erst in einem halben Jahr, es hing davon ab, wann die beiden Prüfer sich auf einen gemeinsamen Termin einigten. Dass das Datum noch nicht feststand, machte es nicht besser.
Ich tastete nach meinen Hals. Normalerweise hätte ich in einer Situation wie dieser sofort meine Mutter angerufen. Durch uns Kinder war sie so etwas wie »eine halbe Ärztin« geworden. Zwar verwahrte sie sich manchmal dagegen, »Ferndiagnosen«, wie sie es nannte, zu stellen, gab aber dann doch Auskunft. Damit aber war meine Mutter ein Teil meines komplizierten Angstsyndroms, das ich über die Jahre entwickelt hatte.
»Wenn Sie krank sind, gehen Sie zum Arzt«, hatte meine Therapeutin mich ermahnt. »Und rufen nicht Ihre Mutter an.«
Ich sah auf die Uhr. In Japan war es mitten in der Nacht, für einen Anruf bei meinem Bruder war es zu früh. Wie jedes Jahr pünktlich zum chinesischen Neujahrsfest besuchte er die Familie seines Freundes, die Fotos, die er aus Kyoto schickte, waren zum Weinen schön.
Zu Hause klopfte ich den Schnee von meinen Handschuhen, warf die Kleider von mir, schlüpfte in meinen geliebten hellpinken Bademantel, ein Modell der Marke Juicy Couture, das ich in einem Secondhandladen gefunden hatte, und genauso sah er auch aus: elegant und flauschig.
Ich tastete nach meinem Kehlkopf. Aus irgendeinem Grund stellte ich mir den Mechanismus, mit dem er Luft an die Stimmbänder ließ, vor wie die Klappe einer Klarinette.
Ungeachtet des ärztlichen Ratschlags setzte ich mich an meinen Schreibtisch. Das Thema meiner Verteidigung war ein Hochstapler aus dem 18. Jahrhundert, ein »falscher Japaner«, der zu seiner Zeit einige Berühmtheit erlangt hatte, inzwischen aber völlig in Vergessenheit geraten war.
»Du mit deinem Japan-Fimmel«, wunderte sich Leo immer.
Anders als bei meinem Bruder war meine Japan-Liebe vollkommen imaginär, ich kannte das Land nur aus Büchern und Erzählungen.
Ich beugte mich vor und befühlte die hellgrünen Blätter der beiden Bonsais, die mein Bruder über meinem Schreibtisch aufgehängt hatte. Er war Gärtner und kannte die verrücktesten Sorten mit den verrücktesten Namen, »Falscher Tee«, »Geldbaum«. Meine beiden gehörten zu der Art des »Junischnee«.
Am Anfang meiner Faszination hatte ein Buch von Haruki Murakami gestanden, das mein Ex-Freund mir mit den Worten »Lies. Du wirst es lieben« schenkte, und tatsächlich verliebte ich mich in Mister Aufziehvogel: den Zitronenbonbons lutschenden Erzähler, die geheimnisvollen Zwillinge Kreta und Malta Kano. Wenig später hatte ich die Bücher Yōko Tawadas in einem Seminar entdeckt und sofort mein Herz an sie verloren.
Ich sah, wie Sir Wilson unter mir um die Stuhlbeine strich. Offenbar hatte er schon wieder Hunger. »Von unten« erklang das Echo der Ärztin.
Es ärgerte mich, dass mein Körper ausgerechnet jetzt streikte. Ich hatte meine Dissertation ohne jede Förderung geschrieben, Anfang des Jahres aber die Nachricht von einer Stiftung erhalten. Ein halbes Jahr lang würde ich Geld bekommen, jeden Monat eine hohe dreistellige Summe. Ich hatte sofort besorgt bei der zuständigen Stelle angerufen und mich erkundigt, ob es auch kein Irrtum sei. Es war keiner, und so hatte ich entschieden, die Schichten am Institut zu reduzieren. Zusammen mit dem Stipendium reichte das für Leben und Miete. Meine Dachgeschosswohnung bestand aus einem einzigen Zimmer, einer Wohnküche plus Bad. Es war ein alter Mietvertrag, ein netter Vermieter, ich konnte mich glücklich schätzen.
Als Leo zur Tür hereintrat, trug sie eine müde Henny auf dem Arm. Sir Wilson kam sofort herbeigelaufen, er liebte meine Freundin und ihr Kind. Leo aber mochte keine Katzen, besonders nicht Sir Wilson, sie fand, dass er mir »auf der Nase rumtanzte«. Es stimmte, musste ich zugeben, und zwar wortwörtlich. Manchmal erwachte ich in der Nacht davon, dass er mir seinen Po ins Gesicht streckte, den After nur wenige Zentimeter von meiner Nase entfernt.
Henny verzog sich mit meinem Kater aufs Sofa. Leo drückte mir ein Behältnis mit noch warmer Linsensuppe in die Hand, dazu eine Flasche mit Ingwertee und eine Pillendose, mit Schüßler-Salzen oder Globuli, vermutete ich.
»Mit so einer Kehlkopfentzündung ist nicht zu spaßen.«
»Ach was«, winkte ich ab.
»Kein Wunder, dass du krank wirst. Bei deinem Pensum.«
»Was meinst du? Bei meinem Pensum?«
»Du weißt genau, was ich meine«, mahnte Leo, während sie zur Toilette verschwand.
Kaum dass ihre Mutter aus der Tür war, begann Henny mit ihren üblichen Fragen. Es gab zwei Dinge, die sie gerade beschäftigten. Das eine waren Dinosaurier, das andere war das Phänomen der Wiedergeburt.
»Ela, was passiert, wenn man als Dinosaurier wiedergeboren wird?«
»Wie meinst du?«
»Na ja – dann – dann ist man schon ausgestorben. Oder nicht?«
Derart scharfsinnig kombiniert hatte Henny ihre Interessen noch nie.
Leo kam aus dem Bad zurück. Noch während sie den Rotwein entkorkte, setzte sie sich an meinen Computer. Manchmal musste ich meiner Freundin dabei zusehen, wie sie die ganze Flasche austrank und dabei abwechselnd immer trauriger und immer lustiger wurde und noch mehr redete als sonst.
Leo deutete auf den Bildschirm.
»Dieser ›stille Reflux‹ bedeutet, dass Dämpfe unbemerkt vom Magen hochsteigen. Aber er greift die Schleimhäute genauso an wie der echte. Hier steht, nur ein Magen-Darm-Spezialist kann das abklären.«
Ich schüttelte mich. »Keine zehn Pferde« brachten mich zu einem Vertreter dieses Faches. Löffel um Löffel aß ich genussvoll von den köstlichen Linsen, ich liebte Leos Suppen.
Meine Freundin sah mich aufmerksam an.
»Nicht, dass es wieder in einer Katastrophe endet«, sagte sie mit Blick auf mein Bein, das unter meinem Bademantel hervorsah.
Auf meiner linken Wade prangte ein etwa vier mal vier Zentimeter großes Mal. Der Form nach erinnerte es an das Kap der Guten Hoffnung. Eine Verbrennung zweiten Grades hatte der Arzt diagnostiziert, als ich mich mit sprudelnd heißem Teewasser verbrannt, aber erst Tage später mit einer vereiterten Wunde bei ihm vorgestellt hatte. Die Narbe war wie ein Mahnmal meiner nahezu willkürlichen Arztbesuche. Mal reagierte ich panisch auf das kleinste Ziepen, mal verdrängte ich die Schmerzen, mit dem Ergebnis, dass ich gar nicht zum Arzt ging oder viel zu spät, dafür dann aber exzessiv. Ich verdankte es allein meiner Therapeutin, dass ich nicht mehr alle zwei Monate in der Notaufnahme landete.
»Ich pass schon auf mich auf«, versprach ich.
Inzwischen hatte Leo die Hälfte des Rotweins geleert. Ich trat neben sie und klappte den Rechner zu. Mein Kopf war schwer und wie aufgeheizt.
»Du musst dich schonen. Prüfung hin oder her.«
Leo griff nach meiner Hand. Ich senkte den Blick. Vor ihr konnte ich nichts verbergen. Meine Freundin wusste um das Ausmaß meiner Prüfungsangst. Beide waren wir schon auf die verschiedensten Arten nackt voreinander gewesen in unserem Leben.
»Mach ich. Ich pass auf mich auf. Versprochen.« Ich lächelte, doch Leo sah mich streng an, mit ihrem ›Lehrerinnen-Blick‹, wie ich es bei mir nannte.
»Hast du nicht gesagt, dass es in Japan ein eigenes Wort für so was gibt?«
»Du meinst karoshi?« Ich runzelte die Stirn.
»Karoshi« bedeutete so viel wie »Tod durch Überarbeitung«. Das aber brachte ich mit Arbeitern in Verbindung, deren Körper durch schwere Lasten geknechtet wurden. Oder mit Managern, die nach unzähligen Überstunden kollabierten. Aber doch nicht mit Leuten – wie uns.
»Wir führen sehr wohl ein Manager-Leben. Nur ohne Manager-Gehalt.«
Leo zog eine Grimasse. Sie gähnte.
»Ich muss jetzt.«
Ich sah, wie sie zögerte.
»Meinst du, du kannst trotzdem auf Henny aufpassen? Morgen Nachmittag?«
»Klar«, sagte ich, ohne nachzudenken, Leo arbeitete neuerdings wieder Vollzeit. Sie hatte ihre Dissertation abgebrochen, als sie mit Henny schwanger wurde, inzwischen war sie Grundschullehrerin. Jetzt, wo ich aufgehört hatte zu rauchen, erlaubte sie wieder, dass Henny mich besuchte. Während ich an meiner Promotion schrieb, hatte meine Wohnung im Dauernebel gebadet.
Ich sah in Leos Augen, die noch größer und runder wirkten als sonst. Etwas Ungewohntes flackerte darin.
»Kann ich bei dir übernachten?«, wollte Henny wissen.
Leo verneinte, hob ihr Kind hoch und setzte es auf die Hüfte.
»Heute nicht. Ein andermal.«
Wieder allein, fiel ich erschöpft ins Bett. In meinen Ohren rauschte es. Ich liebte meine Freundin, aber ein Abend mit Leo hatte seinen Preis. Es war wie in der Geschichte von Scheherazade, nur umgekehrt. In Tausendundeiner Nacht ging es darum, dass eine Frau erzählte und erzählte, weil sie versuchte zu überleben. Leos Redeschwall hingegen war tödlich. Sie machte dem Klischee, das sich mit ihrem Beruf verband, alle Ehre.
Auch meine Mutter hatte sich angewöhnt, ohne Unterlass einfach loszureden, wann immer Menschen sie wegen ihres Gewichts taxierten. Ganz so, als könnten Worte, diese luftigen, flüchtigen Wesen, ihren Körper zum Verschwinden bringen. Nur dass ein Körper sich nicht fortreden ließ.
Ich schluckte. Es tat höllisch weh. Ein dumpfer Schmerz pochte in meinen Schläfen.
»Nicht, dass wieder was mit deinem Kopf ist«, mahnte eine leise Stimme in mir.
»jede lebt ihren sommer, wann sie will, du deinen mitten im schnee.«
Yōko Tawada: akzentfrei
2 Lady Lazarus
Ein paar Tage später erwachte ich davon, dass ich laut fluchte, so sehr schmerzte mein Hals. Auch hatte ich solchen Durst, dass ich zwei Gläser Wasser auf einmal hinunterstürzte.
Ich kramte das Medikament hervor. Unschlüssig biss ich auf meiner Unterlippe herum. Dann obsiegte die Gewohnheit. Gegen das ausdrückliche Verbot meiner Therapeutin entschied ich, meine Mutter anzurufen.
Ich wusste, dass der Anruf ein Fehler war, kam aber nicht gegen den Impuls an.
Sofort, als meine Mutter abhob, hörte ich im Hintergrund die beiden Kinder, die sie betreute. Der Große war sechs, der Kleine vier. Meine Mutter klang beschäftigt, aber fröhlich, wie immer, und keineswegs vorwurfsvoll, weil ich mich länger nicht gemeldet hatte. Nur bei meinem Halsweh horchte sie sofort auf.
»Nimm es«, rief sie durch den Hörer. »Nimm das Spray, in Gottes Namen.«
»Gut. Wenn du meinst.«
»Diese Universität«, unkte meine Mutter, während sie einen der Jungen tröstete. Offenbar spielten die drei gerade Mensch ärgere Dich nicht. »Das viele Lernen. Es tut dir nicht gut.«
Die Universität war ein ewiger Streitpunkt. Meine Mutter hatte nie eine Hochschule von innen gesehen, zwar versicherte sie mir immer, dass sie mein Fach »toll« finde, doch fand sie immer alles unterschiedslos »toll«, ganz gleich, was ich in meinem Leben tat oder nicht tat, so froh war sie, dass ich, ihr Kind, am Leben und nicht gestorben war. Wäre es nach ihr gegangen, hätte ich auch als Clown arbeiten können. Ihr war nur wichtig, dass ich gesund blieb. Nicht einmal, ob eine Arbeit »anständig« bezahlt wurde, zählte.
»Wahrscheinlich musst du dich nur ausruhen«, erklang es.
»Ausruhen« war für meine Mutter ein Allheilmittel. Nur dass sie sich selbst niemals ausruhte. Sie schenkte ihre Arbeitskraft stets bereitwillig her, wie der Sterntaler, um dann am Ende mittellos dazustehen.
»Ach Mama«, seufzte ich.
Ich wollte nicht, dass sie sich Sorgen machte, sie hatte genügend eigene.
»Ich mache übrigens Reiki, neuerdings«, hörte ich sie unvermittelt sagen.
Ich staunte. War »Reiki« nicht etwas, das sich nur reiche Menschen leisten konnten? Durch bloßes Handauflegen, erinnerte ich mich, sollten Körperstellen mit neuer Energie versorgt und dadurch geheilt werden.
»Man muss nichts tun. Nur still liegen und atmen. Stell dir vor.«
Ungläubig lauschte ich ihrem Bericht.
»Aha. Und bei wem machst du das?«
»Bei einem netten älteren Mann in der Nachbarschaft. Ela, hör zu, ich muss jetzt auch wieder.«
Ich überlegte, mich nach ihrer Fibromyalgie zu erkundigen, ließ es dann aber. Seit vielen Jahren litt meine Mutter an dieser speziellen Art Rheuma, ihre Schmerzen waren bisweilen so unerträglich, dass sie sich nur in humpelnden Schritten fortbewegen konnte. Vor ein paar Monaten hatte sie sich widerstrebend einen Stock zugelegt. Ihren Job als Nanny schaffte sie gerade eben.
So bereitwillig sie Ratschläge gab, wenn es um meine Leiden ging, so schwer tat sie sich damit, über ihre eigenen zu sprechen. Dinge wie Zahnweh oder Grippe beredeten wir offen. Bei Rückenschmerzen wurde es schon heikler. Zu oft hatten Orthopäden sie ermahnt, Gewicht zu reduzieren.
Wir legten auf. Ich hätte nicht sagen können, was mich mehr irritierte, das Reiki oder der Reikimeister. Es kam einer kleinen Revolution gleich. Der Körper meiner Mutter war ein Schlachtfeld. Niemand durfte an ihn rühren, normalerweise, weder mit Worten noch mit Händen.
Ich ging hinüber an den Küchentisch, zog die weiße Flasche mit dem Spray aus der Schachtel, legte den Zeigefinger auf den Sprühkopf, drückte ihn fest hinunter und inhalierte die nebelige Wolke. Es schmeckte widerwärtig, nach Chemie.
»Igitt«, sagte ich laut in Richtung Sir Wilson, der in einem morgendlichen Anfall seinen Schwanz jagte.
Dann trat ich in den Flur und kurbelte die Dachluke auf, und sofort sprang er auf die kleine Treppe, die mein Bruder ihm gebaut hatte. Von dort gelangte er in ein Gehege aus Draht. Etwa die Hälfte aller Katzen, die in der Stadt lebten und frei auf dem Dach laufen durften, stürzten hinab, weil sie einem Vogel nachjagen wollten. Die alte Regel, die besagte, dass Katzen nur von dort heruntersprangen, wo sie auch hinaufgeklettert waren, verlor in diesem Moment ihre Gültigkeit. Der Jagdtrieb machte den Schutzinstinkt zunichte. Durch das Gehege kam Sir Wilson wenigstens etwas an die frische Luft.
Ich horchte auf meinen schmerzenden Hals. Es würde sicherlich dauern, bis das Medikament wirkte.
Seufzend setzte ich mich an den Schreibtisch und öffnete die Datei mit den Notizen für meine Verteidigung. Doch statt zu lernen, betrachtete ich nur das Bild meines Hochstaplers, ich hatte es über meinem Schreibtisch aufgehängt. Es zeigte einen jungen Mann mit kugelrunden Augen, vollen, schön geschwungenen Lippen, einem sanften Gesicht und lockiger weißer Perücke. Unten dem Namen »George Psalmanazar« hatte er sich als ein Ureinwohner »Formosas«, des heutigen Taiwans, ausgegeben, die Insel aber dem japanischen Königreich zugerechnet. Sogar ein eigenes Alphabet hatte er erfunden und es damit bis nach Oxford geschafft.
Mit einem Mal merkte ich, wie hungrig ich war, mein Magen knurrte bereits. Ich entschied, mir zum Frühstück eine der Miso-Suppen aufzugießen, die mir mein Bruder bei seinem letzten Besuch aus Japan mitgebracht hatte.
Noch immer war es ungewohnt, den Tag so beginnen zu können. All die Jahre hatte ich früh im Büro sein müssen. Am Morgen Zeit zu haben war ein Luxus, der sich fast verboten anfühlte.
Die Suppe war köstlich. Auberginen, Lauch, Morcheln und Tofu schwammen in einer konzentrierten Brühe.
»Hm, lecker«, sagte ich laut.
Kaum hatte ich den Teller leer gelöffelt, bemerkte ich mit einem Mal einen dröhnenden Kopfschmerz. Dumpf pulsierte es in meinen Schläfen. Irgendetwas war sonderbar.
Ich betrachtete den Teller vor mir, aus dessen Mitte mir ein Rest der dunkelbraunen Brühe entgegensah. Eine Ahnung durchzuckte mich. War das – ein Krampf? Hastig lief ich hinüber ins Bad und studierte mein Spiegelbild. Eindeutig. Die Sehnen am Hals waren angespannt. War meine Zunge geschwollen? Ja, das war sie. Oder nicht? Wann hatte ich zuletzt bewusst meine Zunge betrachtet?
Zurück in der Küche faltete ich hastig den Beipackzettel auseinander. Dort stand es, schwarz auf weiß. In seltenen Fällen konnte das Medikament einen allergischen Schock auslösen.
Wie im Zickzack irrten meine Gedanken umher. Oder lag es gar nicht am Spray? War es – die Suppe? Ich stürzte zur Mülltonne, um die Verpackung hervorzukramen, und strich panisch das Papier glatt, doch es sahen mir nur unverständliche japanische Schriftzeichen entgegen. Miso-Paste wurde aus Soja hergestellt, und gegen Soja konnte man allergisch sein. Aber ich hatte keinerlei Allergien, außer eine gegen schwarze Textilfarbe, wenn auch eine sehr heftige.
Worauf reagierte mein Körper? Auf das Medikament oder das Soja? Was für eine unheilvolle Verkettung. Was tun? Einen Notarzt rufen? War das übertrieben? Oder angemessen?
»Ruhig Blut«, raunte ich mir zu und ärgerte mich zugleich, es war ein Ausdruck meiner Mutter, und meine Mutter war gerade die letzte Person, an die ich denken wollte. Nur ihretwegen hatte ich das Teufelsspray überhaupt erst genommen. Aus irgendeinem Grund kam mir unentwegt das Wort »Fugu« in den Sinn. In einer Kurzgeschichte von Kazuo Ishiguro war die Mutter des Erzählers durch einen unsachgemäß tranchierten Fisch, den sogenannten Fugu, gestorben.
Ich tastete nach meinem Hals. Die Spannung in den Sehnen hatte nicht nachgelassen, schien aber auch nicht schlimmer geworden zu sein.
Zu allem Unglück klingelte Henny an der Tür, ihre Kita hatte geschlossen, sämtliche Erzieherinnen des Landes streikten.
»Richtig so«, hatte Leo skandiert und sich den Protesten angeschlossen, aber wie so oft nicht gewusst, »wohin mit dem Kind.«
»Was ist mir dir?« Henny schaute besorgt.
»Es ist nichts«, sagte ich leise. »Mir geht’s gut.«
Dann aber dachte ich plötzlich ein anderes Wort.
»Luft«, dachte ich. Und dann »Fugu«. Und dann wieder »Luft«. Hektisch befühlte ich meinen Hals. Endlich begriff ich.
»Ich kriege keine Luft«, sagte ich leise und wie erstaunt.
»Oh«, sagte Henny.
Ich lief abermals ins Bad. Das, was dort hervortrat, waren keine Sehnen, es waren Gefäße, und sie waren hart und gespannt wie ein Lineal. Erst als ich das verstand – setzte die Panik ein. Das Einzige, woran ich denken konnte, war, dass Henny mich auf gar keinen Fall so sehen durfte.
»Warte, Henny, eine Sekunde«, rief ich betont fröhlich.
Mit zitternden Fingern bestellte ich uns ein Taxi. Dann eilte ich zurück in den Flur, wo Henny stand und mich mit großen Augen ansah. Sie hatte Jacke und Mütze bereits ausgezogen, ich kniete mich hin, und zusammen zogen wir die Kleider wieder an. Ich gab ihr einen kleinen Stups auf die Nase.
»Wir müssen kurz zum Arzt. Es ist nichts Schlimmes. Okay?«
Ich zählte die Sekunden, während das Taxi über die Pflastersteine holperte. Dann standen wir am Empfang meiner Hausärztin, und entweder lag es an Henny, die mit großen Augen meine Hand umklammerte und sehr bestimmt erklärte: »Ela kriegt keine Luft, glaubt sie«, oder an meinem sicherlich leichenblassen Gesicht, jedenfalls kamen wir sofort an die Reihe.
»Sieh an.« Erst umspielte ein Lächeln den Mund meiner Hausärztin. »Lange nicht gesehen.« Dann aber verfinsterte sich ihre Miene.
Meine Ärztin war vor mich getreten, ich sollte den Mund öffnen.
»Die Zunge ist geschwollen«, rief sie besorgt. »Was haben Sie gegessen? Warum rufen Sie nicht den Notarzt, verdammt?«
Sie drückte einen Knopf, eine Schwester stürzte herein, und nach ein paar kurzen Anweisungen rammte sie mir sogleich eine Spritze in den Oberarm. Schon nach wenigen Sekunden beruhigten sich meine Blutbahnen, der Druck und die Enge im Hals ließen nach. Lediglich der fiese chemische Geschmack haftete noch auf meinen Schleimhäuten.
Ich atmete auf. Es war noch einmal gut gegangen.
»Merken Sie nicht, in was für eine Gefahr Sie sich bringen? Mit Ihrer ewigen Angst.«
Es stimmte. Entweder ich eilte von Notaufnahme zu Notaufnahme oder ich unterschätzte die Situationen auf himmelschreiend fahrlässige Weise. Dennoch schaltete ich instinktiv auf Verteidigung, vermutlich einfach, weil ich angeschrien wurde.
»Ich mache eine Therapie«, stieß ich hervor. »Nur, damit Sie es wissen.«
Ich war ein ernst zu nehmendes Subjekt. Ich kümmerte mich um meine Neurosen.
»Ach, und eine Therapie hilft gegen einen allergischen Schock? Und wer – ist das überhaupt?«
Ihr Blick beargwöhnte Henny, die Kaugummi kauend auf meinem Schoß Platz genommen hatte, ihre Füße baumelten knapp über dem Boden. Wie man so klein sein konnte, durchfuhr es mich. Herzzerreißend, dieser Kinderkörper.
»Die Tochter meiner Freundin. Einer Freundin«, korrigierte ich mich, denn ich sah, wie es in ihrem Blick zuckte, bereute es aber sofort. Was ging es sie an, mit wem ich das Bett teilte?
Ich fragte mich, wie oft meine Mutter Blicken wie diesen standhalten musste. Die erste Familie, für die sie als Nanny gearbeitet hatte, war eine schwarze Familie gewesen, und jedes Mal, wenn meine dicke Mutter durch die Fußgängerzone der mittelgroßen Stadt ihrer neuen Wahlheimat ging, hatte man sie, die zwei schwarzen Kinder und die dicke weiße Frau, beäugt und begafft.
Meine Ärztin hatte indes aus ihrer Schublade ein Päckchen mit verschrumpelten Mini-Gummibärchen hervorgekramt. Henny war zu gut erzogen, um nicht Danke zu sagen, aber ich sah, wie sie ratlos das »Geschenk« begutachtete. Meine Ärztin wandte sich mir zu.
»Sie kriegen erst einmal ein Cortison. Wie hieß das Medikament? Auf das Sie reagiert haben? Ich mache mir eine Notiz.«
Sie blätterte durch ihre Unterlagen.
»Und was ist mit meinem Hals?«, hakte ich nach.
»Was meinen Sie?«
»Na, mit der Laryngitis?«
Ich ärgerte mich, dass ich den Fachausdruck verwendet hatte, es klang allzu wissend. Mein Gegenüber zog die Augenbrauen hoch. Ich hielt dem Blick stand. Meine Allergie war das eine. Aber eine Allergie erzeugte keine Kehlkopfentzündung. Oder doch?
»Sie brauchen ein Antibiotikum. Ihr Hals ist feuerrot. Warten Sie – auf dieses eine Antibiotikum haben Sie ja damals auch allergisch reagiert.«
Täuschte ich mich, oder drückte sie gerade ihr Missfallen darüber aus, dass mein Körper die segensreichen Produkte der Pharmaindustrie nicht tolerierte? Ein von ihr injiziertes Antibiotikum hatte damals zu einer so gewaltigen Schwellung meines Unterbauches geführt, dass mich ein Rettungswagen direkt aus ihrer Praxis in ein Krankenhaus hatte bringen müssen. Auch damals hatte ich mich als Störenfried gefühlt, nicht als Patientin.
»Haben Sie Fieber?«
Ich verneinte. Ich hatte mehrfach und ausführlich zu Protokoll gegeben, dass ich nie Fieber bekam. Notierte man sich so etwas nicht in der Patientenakte? Sie hatte mir sogar eine Predigt gehalten darüber, dass es nicht gut wäre, wenn ein Körper das Fieber zurückhielt, statt die Erreger auszuschwitzen.
»Kein Fieber also. Was dann?«
Betont undramatisch leierte ich meine Symptome herunter. Halsweh, Kopfweh.
Die Stirn meines Gegenübers zeigte mit jedem Wort tiefere Furchen. Noch immer umrahmten kleine starre Kringel ihr freundliches, wenn auch immer leicht strenges Gesicht. Meine Ärztin misstraute wohl dem Wahrheitsgehalt meiner Schilderungen.
»Wir machen jetzt erstmal ein Blutbild.«
»Wirklich?« Ich versuchte sachlich zu klingen, doch meine Stimme zitterte hörbar.
»Ja, wirklich«, erklang es streng.
Blut abzunehmen war bei mir in etwa so einfach, als wollte man einen Vampir zu einem Spaziergang im hellen Tageslicht bewegen. Allein schon der Anblick von Nadeln ließ mich erschaudern.
»Blutbild?«, fragte auch Henny interessiert.
Ich hatte Schwierigkeiten, mich auf sie und gleichzeitig auf die Ärztin zu konzentrieren. Wie machte Leo das? Gewöhnte man sich daran, mit der Aufmerksamkeit immer halb bei seinem Kind zu sein?
Ich hoffte, dass wenigstens Schwester Bärbel Dienst hatte. Die Arzthelferin, die inzwischen um die sechzig sein musste, war die einzige Person, die es schaffte, meinen Venen ohne nennenswerte Schmerzen Blut zu entlocken.
Für einen kurzen Moment bettete ich meine Nase in Hennys Scheitel und nahm den Duft wahr, der von ihm ausging, eine Mischung aus Butter und Vanille.
»In jedem Fall schreibe ich Sie krank.«
Nach so vielen Jahren, in denen ich zu ihr kam, hatte meine Ärztin noch immer nicht verstanden, was es bedeutete, in der Ausbildung zu sein.
»Das nützt nichts«, entfuhr es mir. »Ich muss trotzdem arbeiten.«
Auch mein Studienfach, schien mir, missfiel ihr. Literaturwissenschaft – was genau sollte das für ein »weltfremdes Fach« sein? Ich kannte die Vorurteile von meinem Vater.
»Mir scheint, Sie sind schon wieder in der Opferrolle.« Sie rollte mit den Augen.
»Nicht«, meldete sich Henny erschrocken. »Davon bleiben die Augen stehen.«
Für einen Moment war meine Ärztin irritiert. Dann aber wetterte sie weiter.
»Sie müssen aus der Opferrolle, wie gesagt. Und zwar dringend.«
Mit diesem Satz hatte sie mich damals zu einer Therapie verdonnert. Das letzte Mal, als ich die Praxis meiner Ärztin betreten hatte, hatte sie mir erst eine Frühjahrsmüdigkeit, dann einen Burn-out attestiert. Und ja, das Ausgebrannt-Sein war eine passende Metapher für diesen Zustand völliger Leere, die einen mit brennenden Gliedern und schwer wie ein Stein zurückließ. Mit einem Körper, der an ein verlassenes, kaltes und zugiges Haus nach einem erloschenen Feuer erinnerte. Ganze zwei Male schon hatte ich mich derart übernommen, dass ich über Monate unfähig gewesen war, meinen Alltag zu bewältigen. Damals hatte ich den Fehler begangen, meiner Ärztin von dem Tumor zu erzählen, sie hatte grob und ungehalten reagiert.
»Wie, und nach alldem suchen Sie sich keine Hilfe?«
Dabei hatte ich sehr wohl versucht, mir Hilfe zu holen, gleich nach der Operation. Mein damaliger Freund, der Psychologie studierte, hatte die Vermutung einer Posttraumatischen Belastungsstörung geäußert. Aber die Therapeutin, die ich daraufhin aufsuchte, hatte abgewehrt. »So etwas haben Soldaten. Die aus dem Krieg zurückkommen.« Sie hatte mich weggeschickt mit den Worten. »Sie sind ein junger und starker Mensch. Gehen Sie. Leben Sie.«
Ich seufzte. Immerhin verdankte ich meiner Hausärztin meine jetzige Therapeutin. Meine Ärztin war keine schlechte Ärztin, versicherte ich mir. Nur manchmal ein wenig ungnädig, vor allem, was sogenannte »Zivilisationskrankheiten« wie Burn-out betraf.
»Eine Pille gegen den Kapitalismus kann ich Ihnen leider nicht geben.«
Sie streckte mir das Attest ungehalten entgegen.
Ich merkte, dass Henny wie zum Schutz nach meiner Hand griff. Dennoch beschloss ich, mich aus der Deckung zu wagen. Ich hatte mein Gesicht ohnehin schon verloren. In den Augen meiner Ärztin war und blieb ich die ewige Angstpatientin. Mit betont sanfter Stimme erkundigte ich mich nach einem Mittel gegen stillen Reflux.
»Ach, dieses neuartige Sodbrennen? Nichts leichter als das.« Sie griff in die Schublade und holte eine Packung Tabletten hervor. »Hier. Nehmen sowieso alle.«
»Was ist das?«
»Ein Magensäureblocker.«
Meine Ärztin klickte frohgemut in ihrem Computer herum. Sie schien erleichtert, mit der Verordnung zugleich auch eine professionelle Distanz herstellen zu können. Sie hatte ihre Emotionen genauso wenig im Griff wie ich.
»Ach ja«, schickte sie hinterher, als ich schon halb aus der Tür war. »Ziehen Sie ja nicht wieder alleine von Facharzt zu Facharzt. Das endet im Chaos. Sie kommen zu mir – zu mir. Haben Sie gehört?«