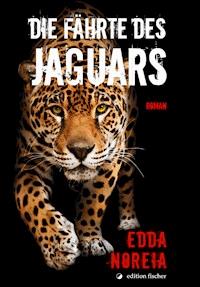Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: edition fischer
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein schweres psychisches Trauma aus ihrer frühen Kindheit scheint Sanya, eine labile junge Frau aus dem Migrantenmilieu, auf die kriminelle Laufbahn gedrängt zu haben. Durch einen fingierten Selbstmordversuch entkommt sie einem neuerlichen Haftvollzug und durchlebt auf ihrer verzweifelten Suche nach dem Mörder ihrer einstigen Freundin und Seelenschwester Olivia eine dramatische Abfolge fantastischer und gefahrvoller innerer und äußerer Abenteuer. Doch welche schockierende, schicksalsverändernde Erkenntnis erwartet sie am Ende dieser selbstauferlegten Mutprobe? Der pralle und bunte Handlungsbogen dieses ebenso spannenden wie tiefgründigen Romans zieht die Leserschaft von der ersten bis zur letzten Seite in seinen Bann.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 493
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edda NoreiaDer Feuerlauf
Edda Noreia
Der Feuerlauf
Roman
edition fischer
Die Handlung dieses Romans sowie die darin vorkommenden Personen sind frei erfunden; eventuelle Ähnlichkeiten mit realen Begebenheiten und tatsächlich lebenden oder bereits verstorbenen Personen wären rein zufällig.
Bibliografische Information der Deutschen National bibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2015 by edition fischer GmbH Orber Str. 30, D-60386 Frankfurt/Main Alle Rechte vorbehalten Schriftart: Palatino 11 pt Herstellung: efc/bf ISBN 978-3-86455-053-9 EPUB
Erster Teil
1. KAPITEL
Eigentlich sollte ich jetzt tot sein. (Kleiner Betriebsunfall hinter Gittern, wenn man so will.)
Aber ich lebe!
Bin mit einem Sprung auf dem Asphalt der Freiheit gelandet! Mitsamt meinem ungebüßten Sündenregister! Was für ein Sieg!
Fast hätte ich diesen meinen Triumph in die Welt hinausgeschrien! Wäre da nicht plötzlich dieses vertrackte Schwindelgefühl, das mir den Kürbis vernebelt! Mich um meine eigene Achse wirbelt! Mich unsanft auf den Hintern setzt!
Mit einiger Mühe stemme ich mich am Mauersockel hoch, taste meine bebenden Glieder ab. Alles in Ordnung? Scheint so. Nur dieses verdammte Eisengitter! Es hat meinen alten Blazer mit einem beachtlichen Riss markiert!
Nun aber Vorsicht! Nur keine verräterische Hast!
Langsam, in Zeitlupe, löse ich mich aus dem Schatten der Umzäunung, schiebe mich, Schritt für Schritt, unter den windzerwühlten Sträuchern vorwärts.
Doch der Boden unter meinen Sohlen brennt wie Feuer. Kein Wunder! Noch hab ich die Gesetzeshüter nicht vollends ausgetrickst. Noch bewege ich mich in ihrem Dunstkreis.
Ich zögere. Die Straße ist menschenleer, die Luft voll morgendlicher Aufbruchsstimmung. Mir aber schlottern noch immer die Knie.
Erst hinter der nächsten Quergasse komme ich allmählich in die Gänge. Durchmesse schließlich im Zickzackkurs unbekannte Häuserschluchten, versuche, schweißnass und mit dröhnender Pumpe, nach und nach meine Fährte zu verwischen.
Aber die Angst fegt jetzt als entfesselter Herbststurm umso gnadenloser hinter mir her! Zerrt mich an den Haaren! Peitscht mein Gestell in den dünnen Klamotten ziellos in eine neue, unbestimmte Zukunft hinein.
Denn noch ist dieser Himmel über mir zu weit! Noch denke ich in zu engen Grenzen! Noch bin ich nichts weiter als eine lädierte Strafgefangene auf der Flucht!
Die Verbände um meine Handgelenke sind verrutscht. Sie werden mich verraten! Also weg damit!
Im Laufschritt ziehe ich an den verräterischen Bandagen.
Die Wunden haben sich bereits verkrustet. Gut so! Aber ob sie bluten oder nicht: Die Weißkittel haben jedenfalls das Nachsehen! Und die Entscheidung über mein Leben liegt wieder bei mir.
Aufatmend schwenke ich in eine Seitengasse ein. Drücke mich, den Kürbis voll widersprüchlicher Gedanken, tiefer ins Laub eines verwilderten Vorgartens. Schließe erschöpft die Augen.
Da hab ich also eine große Nummer abgezogen heute Nacht. Schien tatsächlich so, als wollte ich ernsthaft abkratzen. Doch die Gesetzeshüter waren naturgemäß anderer Meinung. Haben, wie vorausgeplant, meinen grellen Abgang bravourös verhindert.
Dennoch frage ich mich, ob es nur ausgeklügelte Taktik war, die mich zu diesem riskanten Wagnis verleitete. Welche irrationale Hoffnung hat mich dazu verführt, eine Handvoll Tabletten zu schlucken? Mir die Pulsadern aufzuschlitzen? Vor aller Welt die Lebensmüde zu spielen? Theatralisch, plakativ, mit großer Geste und halbem Herzen, wie eine exaltierte Diva?
War das alles wirklich nur Verstellung?
Oder hab ich im Grunde nicht schon längst mein falsch gestartetes, vergeudetes, durch qualvolle, immer wiederkehrende Visionen vergiftetes Dasein abgeschrieben? Es für ungültig erklärt?
Doch was soll’s! Die akribisch vorausgeplante Automatik war nun einmal in Gang gesetzt. Und die zumeist renitente Haftinsassin landete unverzüglich an jenem sterilen Ort, der sie dem Leben oder besser, dem alten Ganovendasein wiedergeben sollte.
Alles lief nach Plan.
Die Weißkittel taten ihr Bestes. Und ich wurde ein neues Mal geboren.
Aber die Zeit tickte bereits in meinen Adern. Zwang mich mit zunehmender Lebenskraft zum Handeln.
Ich machte mir freilich keine allzu großen Illusionen.
Ein Ausbruch, selbst aus einer allgemein zugänglichen Medizinhochburg, ist keine Kleinigkeit.
Vor allem gilt es, den einen, einzig richtigen Augenblick der Unachtsamkeit seiner Bewacher zu nutzen.
Beim Abwärtssprint über den Treppentrakt denkst du zunächst an gar nichts. Erst, wenn es dir gelingt, unerkannt einen Nebenausgang zu passieren, im Eiltempo und ohne die geringste Aufmerksamkeit zu erregen, durch die Gartenanlage hart am Gitter entlang zu pirschen, in einem unbeobachteten Moment die luftige Barriere zu überklettern – selbst wenn dir aller Bammel der Welt in den Gliedern sitzt und dich zittern macht – darfst du es ernstlich wagen, an dein Glück zu glauben.
Also lassen deine Hände los! Und du springst in eine noch unbekannte Welt ohne Schranken, die du dir in deinen Träumen längst selbst erschaffen hast!
Nun noch ein paar lässig hingesetzte Schritte über offenes Terrain! Schon die nächste Quergasse wird dich verschlucken!
Geschafft!
Und jetzt losgelegt! Fort aus der Bannmeile der Bewacher und Weißkittel!
Erneut setze ich mich in Bewegung, durchmesse zielstrebig diesen schicksalsschweren Morgen, lasse alle Selbstzweifel hinter mir zurück.
Nur von Zeit zu Zeit bleibe ich für einen Augenblick stehen, schaue mich mit flüchtigem Bedauern um.
Offenbar hab ich mehr als einen kurzen prallen Sommer hinter den Mauern der Schande verbracht!
In den Schaufenstern der Modetempel ist längst der Winter angekommen: Schwarz, Grau, Braun. Was für ermutigende Farben!
Aber hier! Diese helle, luftige Stofflichkeit in dieser Wühlkiste da! Sie weckt prompt, wie einst in den aufmüpfigen Jahren meiner Kindheit, meine Begehrlichkeit.
Spielerisch, aus purer Gewohnheit, greife ich im Vorübergehen nach diesem pinkfarbenen, flauschigen Top. Spüre seine zärtliche Farbe bereits wie ein Aufatmen auf meiner Haut. Lasse meine Blicke unauffällig in die Runde schweifen.
Gleichgültige Gesichter überall.
Okay! Dann also los!
Automatisch reagieren meine geübten, trotz erzwungener Pause und schmerzenden Handgelenken immer noch ganz brauchbaren Finger. Das zarte Gebilde verschwindet unter ihrem Zugriff.
Doch aufgepasst! Rasch die Stirn gesenkt!
Diese Physiognomie dort drüben! Kenne ich sie nicht von irgendwoher?!
Falscher Alarm! Ohne Hast wende ich mich ab.
Nur weiter jetzt! Und keine Mutproben mehr!
Aufgescheucht falle ich wieder in meinen gehetzten Trott.
Aber wo ist der forsche Schritt des einstigen, ausgeflippten Heimzöglings geblieben? Diese köstliche Unbekümmertheit, die mich stets zügig aus einem gefährlichen und verbotenen Stillstand davongetragen hatte, weiter, immer weiter, bis hinein in meine angestammte Ruhelosigkeit?
Der Takt meiner Füße ist unsicherer denn je, schwingt nicht mehr aus den Hüften.
Noch ein letzter Blick über die Schulter: Tatsächlich! Schwein gehabt! Niemand ist mir auf den Fersen.
Doch dieses Stadtviertel ist zu gefährlich für mich. Mehr noch! Diese gesamte, bei aller Ausdehnung überschaubare Metropole mit ihrer durchlöcherten Anonymität wird mir früher oder später wieder zur Falle werden!
Ich sollte mich schleunigst aus ihr trollen!
Mein Plan für die nächste Zukunft ist zwar nur grob skizziert, angesiedelt zwischen Illusion und Wirklichkeit, mein unmittelbares Ziel jedoch halbwegs festgelegt: Eine einstige Zellengenossin, abgebrüht, verlässlich, verschwiegen, wird mich an einem bestimmten Ort im nördlich der Stadt gelegenen Industriegelände mit dem Notwendigsten, das ich zum Untertauchen brauche, erwarten.
Alles Weitere wird sich finden.
Zügig durchmesse ich die öden Straßenzüge, schiebe mich, ein grauer Schatten, durch die allmählich mit flanierendem Leben erfüllten Geschäftszeilen, unterdrücke Anfechtungen, Ängste und Schmerzen, bin nichts weiter als ein in Marsch gesetzter Wille.
Verdammt weit erscheint mir heute der Weg bis zur SBahn-Station.
Meine Knie wanken. Meine Füße stolpern über die Fahrbahn. Tragen mich ein Stück weit die Häuserzeile entlang.
Ein neuerlicher Schwindelanfall wirft mich plötzlich gegen eine Haustornische. Mit aller Kraft stoße ich mich von der kühlen Mauer ab.
Nur nicht stehen bleiben! Schon legt sich der Schatten des sterilen Medizinbunkers wieder besitzergreifend über mich!
Nach zwei Schritten taumle ich erneut gegen diese Mauer. Ein sich immer schneller drehender Kreisel stürzt auf mich ein, schleudert mich herum, macht mich blind.
Jäh sacke ich in mich zusammen. Hocke eine Weile, mit angezogenen Beinen und baumelndem Kürbis in der Einfahrt.
Übelkeit steigt in mir auf. Speichel rinnt aus meinem Mund.
Verflucht! Die Tabletten! Hab ich diese tödliche Fluchtversicherung nicht restlos ausgekotzt?!
Mit aller Kraft versuche ich, wieder hochzukommen. Aber meine Glieder sind aus Watte, meine Hände greifen ins Leere.
Erschöpft halte ich inne.
Ein kleiner Schwächeanfall! Das geht vorüber!
Verzweifelt schalte ich auf stur. Gebe mir stereotype Instruktionen ein: Tief einatmen! Ausatmen! Kräfte sammeln!
Doch wie auf Kommando drängt sich die dramatische Bilderfolge dieses tollkühnen Ausbruchs noch einmal in mein verschwimmendes Bewusstsein: Die Zelle! Das zerwühlte Bett! Die Aufpasser! Die Weißkittel! Das Blut! Das Erbrochene! Die verwüstete Landschaft meiner Seele!
Mit einem Ruck reiße ich mich hoch!
Es war nur ein Sprung über eine unüberwindlich erscheinende Hürde! Eine kurze Hetzjagd durch den Sturm! Noch bin ich auf dem Weg! Einem unbekannten Ziel entgegen! Ich muss weiter!
Nach zwei, drei Schritten aber gebe ich von Neuem auf. Gehe ruckweise wieder zu Boden. Mein Rücken schürft über das grobe Mauerwerk. In meinem Kopf ist kein Platz mehr für gezielte Strategien.
Dunkelheit beginnt mich einzuhüllen, nimmt mich mitsamt meinem Ausbruch endgültig aus der Zielgeraden.
2. KAPITEL
Undeutliche Stimmen und Geräusche wehen an mir vorbei. Dringen in mich ein. Rütteln an meiner Benommenheit.
Tritte stampfen durch meine Schlaftrunkenheit. Verzweifelt versuche ich, ihnen zu entgehen. Nehme mich krampfhaft aus dem Geschehen.
Das hier bin nicht ich! Das hier ist nur der flüchtige Entwurf eines meiner verirrten Gedanken! Er gaukelt mein physisches Vorhandensein vor!
Tapfer kämpfe ich gegen sie an. Irgendwann aber öffnen sich wie unter einem inneren Zwang meine Augen.
Das kaffeebraune Antlitz eines Mädchens schiebt sich in mein Gesichtsfeld. Dieser leuchtende, bernsteinfarbene Blick! Er scheint die vergessene Welt meiner Kindheit widerzuspiegeln. Ihre stille, unergründliche Traurigkeit.
Olivia?!
Nein! Das hier ist nicht Olivia! Olivia ist fortgegangen! Hat mich für immer verlassen!
Müdigkeit überschwemmt mich von Neuem in riesigen schwarzen Wellen.
Aber ich darf nicht mehr abtauchen! Darf mich nicht ausruhen!
Doch die Bilderfolge meiner Flucht setzt sich erbarmungslos wieder in Gang, rast mit mir durch Jahreszyklen hindurch tiefer hinein in meine Vergangenheit.
Die staatliche Gewalt ist hinter mir her! Wie so oft! Schleppt mich, den aufmüpfigen Zögling, aus der Freiheit zurück ins Heim! (Los! Vorwärts! Und keinen Mucks jetzt! Sonst kannst du was erleben!)
Die gefürchtete Stimme bellt auf mich ein. Lässt mich zusammensacken.
Ich bin zwölf. Bin aus dem Erziehungsheim getürmt, um meine Zimmergenossin zu suchen! Den einzigen Menschen, dem ich vertraue! Olivia! Meine Seelenschwester! Mein anderes Ich! Das mich immer wieder zu trösten und aufzurichten vermochte!
Aber Olivia ist seit einigen Wochen verschollen. Lebt irgendwo in dieser großen Stadt. Ich muss sie finden! Muss bei ihr bleiben dürfen!
Wie lange schon irre ich in den Häuserzeilen umher, verängstigt, mit hochgezogenen Schultern und gesenktem Kopf, immer bereit, mich bei der geringsten Gefahr im nächstbesten Winkel zu verkriechen.
Da! Endlich! Ich kann mein Glück kaum fassen!
Im fahlen Dämmerlicht des Abends, an der langen Automeile, sehe ich die schöne Schwarze stehen – fantastisch, fremdartig gestylt.
Olivia! Ich stürze auf sie zu!
Meine Seelenschwester drückt mich an sich! Küsst mich! Aber ihre Hände wehren mein Betteln ab.
Sie schickt mich weg! Schickt mich zurück!
Ich weine! Ich drohe! Umsonst!
Ein Auto hält an. Olivia beugt sich zur heruntergelassenen Scheibe nieder. Die Wagentür öffnet sich.
Hasserfüllt linse ich in die protzige Karosse. Fokussiere dieses verschattete Profil hinter dem Volant.
Jetzt wendet der Typ den Kopf. Zwei eisblaue Augen unter einer knabenhaften, blonden Tolle heften sich auf mich.
Sonderbar! Ich kenne diese Augen! Sie starren mich geradewegs aus meiner frühen Kindheit an! Starren durch mich und meinen Hass hindurch: Ein unauslöschliches Relikt entglittener Erinnerungen? Ihr suggestiver Blick sinkt bis auf den Grund meiner Seele.
Doch schon werde ich von der Fahrbahn gezerrt! (Los! Beweg dich! Wird’s bald?! Das ewige Herumstreunen hat jetzt ein Ende! Kapiert?! Sonst gehst du endgültig in den Bau! Dort, wo du längst hingehörst! Hinter Schloss und Riegel! Hast du verstanden?!)
Ertappt von den Erziehungsgewaltigen, ausgehungert, zu Tode betrübt, krümme ich mich unter dem Strafgericht. Nehme gerade noch wahr, wie mir dieses Vehikel den einzigen Menschen entführt, den ich liebe.
Aber die geifernde Stimme verliert sich von Neuem im Nebel meines taumelnden Bewusstseins. Verstummt allmählich in der Weite einer mondhellen Sommernacht.
Ich laufe einen endlosen Pfad entlang. Er dehnt sich bis an den Horizont.
Ich muss Olivia suchen!
Noch kann ich sie nirgendwo entdecken!
Aber dort! In der Ferne! Olivia! –
Sie flieht!
Ein Kerl ist hinter ihr her! Sie ist in seinen Wagen gestiegen! Ist mit ihm bis in diese nächtliche Einöde gefahren! Bis zu diesem Waldweg! Nun zeigt er sein wahres Gesicht! Stößt Olivia vor sich her! Will sie töten!
Ich laufe schneller! Laufe mit aufgerissenen Augen und pochenden Schläfen! Laufe durch diese weithin gestreckte Landschaft! Auf diesem überwachsenen Pfad! Mit seinen Grasnarben in der Mitte, dem dichten Strauchwerk links und rechts! (Warum nehme ich plötzlich mit überwacher Klarheit jede Einzelheit wahr?)
Bin ich am Ende selbst das verfolgte Opfer?
Olivias Keuchen in den Ohren, Olivias Todesangst im Blut, so erklimme ich den steilen Schwung eines Hügels. Renne die Mauer eines halb verfallenen Schlosses entlang.
Doch der Verfolger holt mich ein! Packt mich! Schüttelt mich!
Sein Gesicht ist jetzt nahe über dem meinen!
Und da ist er wieder: dieser kalte, eisblaue Blick! Taucht aufs Neue aus den Tiefen einer frühen Kindheitserinnerung auf!
Wo aber ist Olivia? Da bin nur noch ich, Sanya! Der aufmüpfige Zögling! Den ein wüstes Phantom zu verfolgen scheint!
Schon fühle ich, wie es schwarz wird um mich herum! Rieche den scharfen Geruch der Gefahr! Spüre, wie mich die Last einer ächzenden, sich wälzenden Masse Mensch in den Boden zu stampfen droht!
Durchlebe den bis zum Wahnsinn gesteigerten Kampf mit dem Feind! Dem Todfeind! Dem Tod persönlich!
Ertaste blindlings, mit letzter Kraft irgendeine spitze, steinerne Waffe, schlage sie in diese verzerrte, sich über mich neigende Visage!
Mein eigener Aufschrei reißt mich hoch.
Verwirrt richte ich mich auf.
Mein Kürbis dröhnt. Das zerwühlte Haar klebt mir in der Stirn.
Wo bin ich?
Kein Zweifel! Da hocke ich noch immer hier! In diese Haustornische gepresst! Gestrandet auf den Straßen meiner Flucht! Allein! Ein kümmerlicher Rest von Leben!
Oder hab ich am Ende, trotz aller Mühewaltung der Weißkittel, doch noch klammheimlich die Kurve gekratzt? Und halte mich jetzt nur noch als Schatten in einer Schattenwelt an diesen meinen verstörenden Visionen von Flucht und Verfolgung fest?
Vorsichtig tastet mein Blick über meine lädierten Pfoten. Sie tun weh.
Ich scheine also noch unter den Irdischen zu weilen.
Was für ein vielversprechender, zukunftsträchtiger Moment!
Mühsam richte ich mich auf.
Ich bin allein.
Doch diese geheimnisvolle Fremde! Dieses unsäglich vertraute Antlitz! Dieser bernsteinfarbene Blick! War all das auch nichts weiter als eine flüchtige Halluzination? Wie jene beklemmenden, sich jetzt langsam aus meiner Traumverlorenheit schälenden Szenenfolgen?
Egal! Nur weiter! Fort! Die Zeit drängt!
Noch bin ich nicht endgültig im Asyl meines neuen Lebens angelangt.
Tapfer stoße ich mich von der Mauer ab, setze Schritt vor Schritt, trete wieder hinaus auf die Straße, diesem unsicheren Terrain meines Lebens. Suche den Mut von heute Morgen im Takt meiner Schritte
Darf um keinen Preis wieder zum Freiwild meiner alten, rätselhaften, selbstzerstörerischen visionären Ängste werden!
3. KAPITEL
Mit heißen Schläfen haste ich meinem Treffpunkt entgegen.
Werde ich den Zeitplan einhalten können? Und was, wenn nicht?
Die Großstadtwildnis schüchtert mich mehr und mehr ein, und ihr Lärmpegel deckt kaum noch die gehässigen Stimmen in meinem Inneren zu: Sieh dich vor! Noch gibt es für dich keinen endgültigen Ort der Sicherheit!
Mich fröstelt bei dem Gedanken an meine nächste Zukunft. Meine innere Ausweglosigkeit ist durch dieses Fluchtmanöver nicht gerade kleiner geworden. In mir tobt noch immer ein Kampf ungleicher Mächte. Welche meiner offenbar austauschbaren Realitäten wird an diesen Schreckensvisionen endgültig zerbrechen?
Olivias braunes Antlitz steht wieder vor mir. Ich verscheuche es. Ich kann jetzt nicht an meine tote Seelenschwester denken. Zunächst gilt es, diesen ersten Tag meiner so mühsam wieder gewonnenen Freiheit zu überstehen.
Schließlich bin ich so gut wie blank.
Die S-Bahn entlässt mich zusammen mit einem Schwall von Pendlern.
Auf Umwegen, immer auf Deckung bedacht, trotte ich über das flache Gelände. Die verabredete Stelle ist ein aufgelassener Lagerraum.
Aber er ist leer! Kein Wunder! Ich habe mich kräftig verspätet.
Und was nun?
Für einen Fall wie diesen, so wurde vereinbart, soll das Geld und alles Übrige bei Verena deponiert werden.
Kein gutes Omen! Ich ziehe meine einzige, mir verbliebene Freundin nur ungern in meine misslichen Unternehmungen hinein.
Aber die Zeit drängt!
Und vor allem brauche ich dringend die bereitgestellten Moneten!
Also retour!
Und mit klarem Kopf die nächste Etappe gewagt!
Verenas Adresse ist jetzt die einzige Landmarke, die meiner Ziellosigkeit ein vorläufiges Ende setzen kann.
Ohne lang zu überlegen, trampe ich als Schwarzfahrerin bis ans andere Ende des Häuserdschungels. Latsche die Straße der Betonklötze entlang.
Doch das Tor des Wohnturms bleibt trotz meines Sturmläutens heute verschlossen. Weist mich ab, wie diese hoch aufragende, spiegelnde, immer so trostlos unbewohnt wirkende Fensterfront über mir.
Was ist da los?
Erschrocken halte ich inne. Das riecht nach Gefahr!
Ist Verena nicht allein? Hat sie bereits einen ihrer anspruchsvollen Kunden bei sich?
Die Sache ist prekär!
Ich muss schleunigst von hier verschwinden! Verena geht kein Risiko ein.
Dafür sollte ich ihr dankbar sein.
Seufzend mache ich wieder kehrt.
Zwänge mich erneut in die überfüllte U-Bahn, starre, eingeklemmt zwischen fremden Menschen, ins Leere.
In meiner Birne verknoten sich erneut die Gedanken. Heften sich hartnäckig auf so manche unrühmliche Zwischenstation meines Lebens.
Die zahlreichen, auf mein Konto gebuchten Gesetzesübertretungen beschweren mein Gewissen wenig.
Viel ernsthafter beschäftigt mich jedoch die Frage, was sich hinter jenem Dunklen, Rätselhaften verbergen mag, das mir seit meiner frühen Kindheit anzuhaften scheint und das sich noch immer in meinen Albträumen widerspiegelt.
Jenes Bedrohliche, Angsteinflößende, das mich um Hilfe schreien ließ, wenn mich in den diversen Drillanstalten eine ungeduldige Erzieherin zum Medizinmann schleppte.
Das mir den Mund verschloss, wenn die immer gleichen quälenden Fragen während all dieser fruchtlosen Untersuchungen auf mich einhämmerten.
Das mich verzweifeln ließ, wenn die Isolation um mich herum wuchs und wuchs und mich endgültig zur Außenseiterin machte: Dieses Kind ist ganz und gar untauglich für eine Gemeinschaft mit Gleichaltrigen! Es übt einen verstörenden Einfluss auf seine Mitzöglinge aus!
Was halfen da Weinkrämpfe? Zornausbrüche? Tagelanges trotziges Schweigen?
Alle diese Gegenstrategien lieferten nur immer neue Beweise für diese vernichtende Diagnose.
Also gibst du irgendwann deinen inneren Widerstand auf und fängst an, Dinge zu tun, die dein Umfeld moralisch verurteilen und als strafbar erklären muss.
Das macht dich stark und zugleich maßlos zornig!
Du bist weder lasterhaft noch böse! Du bist nur verdammt allein! Schaffst dir aus Notwehr deinen eigenen Rahmen! Deinen eigene Welt! Deine eigene Gerechtigkeit!
Trotz dieser erfolgversprechenden Maßnahmen entgehst du den Spitzfindigkeiten deiner Feinde nicht. Die Justiz hat zumeist den längeren Atem.
Schon die erste Verdonnerung wirft dich in dieser scheinheiligen Welt der Etablierten aus der Bahn.
Doch was soll’s? Du lässt dich von solchen Intermezzi nicht kleinkriegen! Versuchst immer wieder aufs Neue, deinen eigenen Wegen zu folgen.
Irgendwann aber langt es dir!
Und du beschließt, endgültig auf Tauchstation zu gehen, ehe sie dein zwischen Zweifel und Gewissheit schwankendes Ich im Bau oder in irgendeiner Klapsmühle in ein auswegloses Niemandsland verbannen! Wo es sich nicht mehr zurechtfindet! Wo es kapituliert! Wo es schließlich anfängt, sich selbst zu eliminieren!
Aber noch ist der Plan nicht restlos ausgeführt. Noch irrst du durch feindliches Gebiet, immer in Gefahr, wieder hoppgenommen zu werden.
So oder ähnlich könnte meine versaute Biografie bis dato lauten.
Aber ich hasse Selbstbespiegelungen! Sie verleiten zum Stillstand!
Also fort mit dieser wehleidigen Bilanz! Irgendwie muss dieses beschissene Dasein ja weitergehen!
Im Herzen der Stadt spuckt mich die Bahn mitsamt einem Menschenklumpen wieder aus, zwingt mich erneut zu einem winzigen Stopp auf meiner einsamen Flucht.
Das Menschenkarree zerfällt, ballt sich zusammen, fließt dahin: das Ballett der Großstadt. Und ich nehme teil an dieser unsichtbar geführten Choreografie.
Meine Füße finden schließlich wie von selbst ihren Weg. Mein Kürbis wird leer. Meine Blicke streifen mit abwesendem Interesse dieses Abbild einer neuen Wirklichkeit, zu der ich noch nicht gehöre.
Ernüchtert kehre ich nach und nach in meine trostlose Gegenwart zurück.
Aber wo bin ich hier? Und wie bin ich hierhergekommen? In diese Allee? Auf diese Alte-Leute-Bank?
Hat mich ein Rest von Knastfatalismus hierher geschmissen?
Tatsächlich! Da sitze ich und spüre auf einmal unsanft die Härte der Lehne in meinem Kreuz, das kalte Holz unter meinem Hintern, scharre gedankenverloren über den rauen Beton unter meinen Füßen.
Warum bin ich nur so müde?
Die Sprache der Bilder um mich herum wird immer eigenständiger, beginnt mich zu dominieren: Dieses angewelkte Laubdach eines mächtigen Ahorns über mir. Die heftige Brise, die jetzt durch seine Wipfel streicht. Der Blätterregen. Der Schrei eines Vogels. Hilflos schweift mein Blick in die Runde.
Ein leises Klirren schwingt durch mich hindurch, schwillt an, kulminiert in einem betäubenden Zersplittern, das jäh in meinen Ohren zerbirst.
Stöhnend quäle ich mich aus dieser bedrohlichen, mich nicht zum ersten Mal heimsuchenden Halluzination. Springe auf! Taumle aus der Allee!
Finde mich irgendwann auf einer Hauptstraße wieder.
Trotte eine Weile geistesabwesend die Geschäftszeile entlang, verliere mich schließlich im Sog dieser Stadt, deren Lebendigkeit sich irgendwann als eine schützende Hülle über meinen verstörten Seelenzustand stülpen und mich in eine trügerische Sicherheit hüllen wird.
4. KAPITEL
Da und dort heftet sich bereits eine fremde Aufmerksamkeit auf mich. Das ist mir unangenehm. Noch ist mein Ich zu verletzlich. Noch darf es keine eigenen Signale aussenden.
Erst nach stundenlangem Umherstreunen auf den Straßen, unter dem kahlen, blassen Herbsthimmel, werde ich gelassener.
Im Takt meiner Schritte kehren die Gedanken zurück, luftige Entwürfe meiner Seele. Ich lasse sie kommen und gehen.
Zum ersten Mal an diesem Tag erfüllt mich die Illusion einer beinahe vergessenen, unendlich kostbar gewordenen Freiheit.
Mit sträflicher Sorglosigkeit überquere ich weite Plätze, folge engen, verwinkelten Gassen, drehe im Geist meine imaginären Runden durch eine erträumte, in strahlende Farben getauchte Zukunft, kreise um mich selbst.
Die alte Unbekümmertheit hat mich eingeholt. Das Unglück aber bleibt mir auf den Fersen.
Vor einem Lokal reckt sich ein Typ im Lederdress, zündet sich eine Zigarette an. Grinst mir einladend entgegen.
Unwillkürlich schaue ich mich um. Wo bin ich da hingeraten?
Diese Bude da, deren kitschiges Entree Fotos von Nackedeien schmückt, liegt noch im Nachmittagsschlaf.
»Na, Süße? So eilig heute?«
Hastig trotte ich weiter.
Der Kerl macht drei provozierende Schritte hinter mir her.
Mit einem Ruck bleibe ich stehen. Drehe mich um. Starre dem Typ wie eine steinerne Sphinx in die Augen.
Der nimmt langsam die Zigarette aus dem Mund und wirft sie in hohem Bogen fort. Sein Grinsen ist verschwunden.
Mit verbissener Zufriedenheit latsche ich weiter. Halte die Aura der Unberührbarkeit um mich herum fest.
Aber wie soll ich jetzt tatsächlich die kommenden Stunden des Wartens überstehen?
Dieser Tanzschuppen dort drüben! Er kommt mir bekannt vor. War ich nicht schon einmal hier?
Wie lange ist das her!
Mein Zeitbegriff umspannt einen weiter gesteckten Rahmen: Ich lebe und agiere im Grunde in einem Zwischenreich. Durchmesse mit meinen Aktivitäten – so will es mir scheinen – ständig Leben und Tod, die für mich aus unerfindlichen Gründen stets nahe beieinander liegen.
Was bedeutet da schon ein Jahr? Ein Tag? Eine Stunde?
Unschlüssig drücke ich mich vor dem Eingang herum, kämpfe mit der berechtigten Angst vor einer Entdeckung und zugleich mit meiner, in langer Isolation angezüchteten Menschenscheu.
Was hoffe ich dort drin zu finden?
So etwas wie eine unkomplizierte, unbelastete, einfach gestrickte Seele? Deren platte Lebendigkeit mich für eine kleine Weile meine inneren Abgründe vergessen lassen könnte?
Vorsichtig linse ich in den Saal.
In den Nischen hängt die Schalheit der frühen Stunde. Ein eintöniger Sound hat sich der flauen Tageszeit angepasst.
Zwei, drei Figuren bewegen sich träge in seinem vagen Rhythmus, ein paar Halbwüchsige hängen gelangweilt über ihren halbleeren Gläsern.
Ich fühle mich wie ein verirrter Nachtfalter, der es verabsäumt hat, sich rechtzeitig vor dem Tag zu verstecken.
Betreten wende ich mich ab.
Plötzlich streift eine Hand meinen Arm.
Ich fahre herum: Was ist das?! Eine neue Variante meiner irrealen Wahrnehmungen?!
Das Fleckchen Haut brennt noch unter dieser jähen Berührung. Gleich darauf schüttle ich meine Verlorenheit ab.
Dieser Typ sieht aus wie ein Studienkollege aus eben jener Musikhochburg, aus der mich vor einem guten Jemchen mein eigener Übermut hinauskatapultiert hatte.
Er betrachtet mich neugierig.
»Ich kenn dich doch! Bist du nicht Sanya?«
Unwirsch setze ich mich wieder in Bewegung.
»Moment!« Der Typ lässt nicht locker, ist hinter mir her. »Ich bin Ricco. Vom Konservatorium!«
»Na und?« Ich haste weiter.
»Wie geht’s? Alles wieder in Ordnung?«
»Wieso? Was meinst du damit?«
(Unwillkürlich presse ich die Arme an mich, drehe meine Handgelenke nach innen.)
»Du warst doch ziemlich krank. Oder?«
Indigniert bleibe ich stehen. »Wer sagt das?! Wer redet solchen Unsinn!« (Nicht doch! Was hab ich erwartet? Dass mein unfreiwilliger Abgang aus der Musikdrillanstalt so ohne Widerhall an mir vorübergehen wird?)
Aus irgendeinem Grund scheinen meine aggressiven Antworten Riccos Interesse an mir erst recht zu vertiefen. Er legt seine Hand auf meine Schulter.
Ich schüttle sie ab.
»Kommst du mit?«
»Wohin?«
»In die Galerie Reno. Ist hier ganz in der Nähe. Ein betuchter Bekannter meines Onkels sponsert dort eine Fotoausstellung. Hält leider nicht viel von klassischer Musik.« Ricco lacht, versucht offenbar, mich aufzumuntern.
Ich gebe keine Antwort.
Ein Blick auf das Profil meines Begleiters hat mich sogleich wieder mundtot gemacht. Diese allzu kühne Linie von Stirn und Nase! Dieser Typ wirkt plötzlich ziemlich abgehoben auf mich. Und überdies: Was soll ich ausgerechnet in einer Galerie?
Trotzdem gehe ich stumm und unentschlossen neben meinem Begleiter her. Der Gedanke, heute, an diesem denkwürdigen Tag einer noch nicht zu Ende gebrachten Flucht ins Ungewisse mit mir allein zu sein, ist auf einmal ganz und gar unerträglich.
Das Entree des Kunsttempels wird vom Plätschern eines mächtigen Steinbrunnens dominiert: Eine trügerische Oase.
Im Ausstellungsraum schlägt uns eine Explosion aus Gelb und Rot entgegen. Ich schaue in eine Kraterwelt, in ein lebensfeindliches Surrogat aus Feuerfontänen und glühender Lava! Was für ein Katarakt tobender Gefühle!
Ricco scheint nicht weniger betroffen zu sein. Seine Kommentare bleiben einsilbig.
Betroffen wandern wir von Bild zu Bild, und in meinem Kürbis verknoten sich undefinierbare Empfindungen von Hass und Rache.
Zugleich steigt eine Art Nervenbeben von meinen Sohlen aufwärts bis in meine trocken gewordene Kehle.
Beinahe brüsk ziehe ich meinen Begleiter mit mir fort.
»Ricco, hör zu! Kein Wort zu irgendjemandem, dass du mich hier getroffen hast! Geht das klar?«
Ricco scheint an einer Frage zu kauen.
»In Ordnung«, murmelt er schließlich.
Was für ein Unsinn! Natürlich ist nichts in Ordnung! Unsere Begegnung beginnt ins Gefährliche abzudriften.
Aber Ricco stellt keine weiteren Fragen mehr.
Sein fahrbarer Untersatz parkt unweit der Disco.
Ich mache mich so klein als möglich auf meinem Sitz. Habe plötzlich nichts als Schiss, von irgendjemandem erkannt zu werden. Schließlich bin ich nicht zum ersten Mal in diesem meinem abenteuerlichen Leben auf der Flucht.
Ricco scheint meine Gedanken aufzufangen. Er dreht ein paar ziellose Runden durch das Viertel, versucht offenbar, einen Entschluss zu fassen.
Ich liege zurückgelehnt da, schließe für einen Moment die Augen und stelle mir vor, wie es wäre, jetzt einfach abzuheben, um nie mehr wiederzukommen.
Ein alter Wunschtraum. Schon als Kind quälte mich die permanente Sehnsucht, aus meiner Begrenztheit auszubrechen, fortzulaufen, meine Spuren zu verwischen, so als könnten selbst diese Spuren ein schreckliches, unaussprechliches Geheimnis über mich verraten.
Zügig verlassen wir jetzt die Ausläufer der Stadt. Durchqueren stillere Gegenden. Folgen schließlich einer leicht ansteigenden Waldstraße.
Unser Schweigen füllt sich mit unaussprechlichen Fragen. Die Luft zwischen uns fängt an zu vibrieren.
Ich verspüre Riccos Nähe beinahe wie eine Versuchung. Strecke unwillkürlich die Hand nach ihm aus.
Ricco scheint sie nicht zu bemerken.
Was zum Teufel spukt in seinem Kopf herum? Ich brauche Hilfe! Wenn ich auch im Grunde nicht an sie glaube. Dieser Typ da ist mir einfach über den Weg gelaufen. Es hätte genauso gut ein anderer sein können.
Wieder stoße ich mich an diesem ausgeprägten, auf mich irgendwarum arrogant wirkenden Profil.
Nein. Dieser Junge wird nichts kapieren! Wie sollte er auch? Seine Welt ist zu heil, zu abgegrenzt von der meinen. Sprach- und Musikstudium. Und das ehrgeizige Ziel: Musik schreiben. Neue Zeichen setzen! Zu neuen Ufern aufbrechen! Neue Ordnungen schaffen!
Wie würde er vor meinen innerlichen Abgründen zurückschrecken!
Seufzend lasse ich mich wieder in mein abweisendes Schweigen fallen.
Irgendwann halten wir an. Steigen aus, angezogen von einem schmalen, sich zwischen herbstlich überhauchten Sträuchern aufwärts windenden Pfad. Der Sturm hat sich gelegt. Stille steht plötzlich um uns herum.
Eine Kurve verschluckt nach ein paar Schritten unsere Aussicht.
Wir sind jetzt sehr allein.
»Was ist los, Sanya? Willst du’s mir nicht endlich sagen?«
»Es gibt nichts zu sagen.«
»Doch! Irgendetwas Bestimmtes macht dir Angst. Wir sollten darüber reden.«
Ich wende mich ab. Gehe weiter. Dieser Ricco gebärdet sich beinahe wie ein Seelenklempner!
»Haben sie dich falsch behandelt in dieser Klinik?«
»In welcher Klinik?«
Gegen meinen Willen lasse ich mich zu einer Gegenfrage hinreißen.
»Was weißt du über mich? Los! Spuck’s schon aus!«
»Nichts. Ich weiß gar nichts.«
Stumm gehen wir nebeneinander her.
»Ich muss einfach für eine Weile untertauchen«, erkläre ich schließlich barsch. »Das ist alles. Genügt das?!«
»Du kannst bei mir wohnen.«
Überrascht bleibe ich stehen. »Im Ernst?«
»Wenn ich’s dir sage.«
(Wohin jetzt mit meinem Misstrauen?)
Ich überlege. Schüttle dann den Kopf. »Es geht nicht.« (Verdammt! Warum glotzt mich dieser Typ so mitleidig an?)
»Und weshalb nicht?«
»Weil ich dir lästig fallen würde! Darum!«
Ricco legt erneut in beschützerischer Geste seinen Arm um meine Schulter.
Heftig mache ich mich los. Flüchte hinter einen Holunderstrauch. Würge an jenem latenten, mich seit meiner Kindheit quälenden Selbsthass.
Einige Minuten vergehen, ehe ich wieder zum Vorschein komme.
Ricco hat sich abgewandt. Steht wartend da.
Eine leise Verlegenheit macht uns jetzt beiden zu schaffen.
Mit gesenkten Köpfen, in einer Art stillschweigender Übereinkunft trotten wir wieder nebeneinander her, vermeiden dabei, einander anzusehen.
Bald darauf klettere ich erneut in die kleine graue Kiste – stumm, zugemauert, kampfbereit. Nehme endgültig Kurs auf eine brandneue, glasklare Wirklichkeit jenseits aller, mein Selbstbild verzerrender Schreckensvisionen, die von nun an, das ist mein fester Vorsatz, einzig und allein meine zukünftigen Entscheidungen bestimmen soll.
5. KAPITEL
Meine brandneue, glasklare Wirklichkeit! Was für ein Selbstbetrug!
Nach einer halb durchwachten Nacht in Riccos am anderen Ende der Stadt gelegenen Bude, in der ich mich bis zu meinem Treff mit Verena verkriechen wollte, schiebt sich ein neuer blasser Morgen vor meine ungewisse Zukunft.
Ich fühle mich schlecht. Auch meine Worte fühlen sich falsch und gekünstelt an.
Schweigend schlürfen wir unseren Kaffee. Und ich verwünsche meine Unbedachtheit, die mich hierher verschlagen hat.
Die beiden Räume sind halbleer. Die Essensvorräte offenbar nicht allzu reichlich. Auf dem Piano an der Wand häufen sich nebst Stößen von Noten, Büchern und Skripten allerlei Reliquien aus vergangenen Tagen: zersprungene Gläser, vertrocknete Zweige, bizarr geformte Steine, offene Rechungen.
Auch Riccos Existenz wirft Fragen auf. In mir aber ist kein Raum für sie. Schlimm genug, dass ich im Augenblick nichts Konstruktives zum gemeinsamen Haushalt beisteuern kann.
»Sie werden dich suchen«, stellt Ricco fest.
Ich kaue an einem harten Stück Brot. »Wen meinst du mit ›sie‹?«
»Na, die Quacksalber. Deine Familie. Irgendwer eben.«
»Du meinst, die Bullen. Sprich einfach aus, was du dir denkst.«
Es reizt mich, Ricco zu verwirren.
»Wir sollten uns trotzdem einen Plan zurechtlegen«, sagt Ricco nach einer Pause. Noch immer hält er eisern jede direkte Frage an mich zurück. Vermeidet sogar, meine lädierten, nun wieder bandagierten Pfoten allzu ostentativ anzuklotzen.
Das amüsiert mich.
In aller Ruhe wickle ich mir die neuen Lappen, die mir Ricco noch gestern Abend aufgedrängt hatte, fester um meine Wunden.
»Man wird mich nicht finden«, erkläre ich mit Bestimmtheit. »Egal, wer nach mir sucht.«
Ricco schweigt zu dieser Eröffnung. Begnügt sich offenbar auch weiterhin damit, die Wahrheit über meine Person in kleinen Dosen aus mir herauszufiltern.
Er stellt seine Tasse hin.
»Muss mich langsam auf die Socken machen.«
Richtig! Der Typ hat noch einen Nebenjob. Gibt irgendwelchen unbedarften Leuten Klavierunterricht. Seine Tageseinteilung ist dennoch beeindruckend. Nie scheint er wirklich Stress zu haben.
»Ich räume inzwischen das Geschirr weg«, beeile ich mich zu sagen. Aber ich tue noch ein Übriges: Mit ein paar Handgriffen ist diese kümmerliche Bleibe aufgeräumt.
Ordnung und ein gewisses Maß an glättender Optik ist mir bereits im Vorschulalter in den diversen Erziehungsanstalten eingetrichtert worden.
Nun mache auch ich mich ausgehfertig.
Aber da gibt es nicht viel zu verschönern.
Meine Knastkluft ist ziemlich dürftig. Abgetragene Jeans. Der Blazer viel zu dünn für diese Jahreszeit. Und zu allem Überfluss seit heute Morgen, bei meinem Sprung in die Freiheit, auch noch mit diesem langen Riss verziert.
Aber da ist ja nun dieses rosarote Wollgebilde.
Kleinlaut betrachte ich mein Spiegelbild in Riccos Waschnische. Kein Wunder, dass die Augen dieses Jungen mit einem fast abstrakten Ausdruck auf mir ruhten. An mir haftet der Gefängnismief. Ich strahle Beunruhigung und Aufmüpfigkeit aus.
Vermutlich hat dieser unfreiwillige Kumpel bereits bedauert, mich auf gut Glück bei sich aufgenommen zu haben.
Vorsichtig schlängle ich mich wenig später durch das schwere Haustor auf die Straße hinaus.
Ein heftiger, vor Feuchtigkeit triefender Windstoß erfasst mich, treibt mich vor sich her.
Der Vormittag ist noch jung.
Ich werde Verena aus dem Schlummer wecken! Ich muss sie endlich wiedersehen! Muss mein jüngstes visionäres Erlebnis vor ihr ausbreiten dürfen.
Die feindliche Linie ist schließlich erfolgreich durchbrochen worden! Ich bin wieder vorhanden! Bin wieder unter den Lebenden! Und ich brauche dringend die Moneten!
Vor einem Billigladen bleibe ich stehen.
Diese schicke Herbstjacke da könnte ich gut gebrauchen! Genau meine Größe!
Unauffällig halte ich nach allen Richtungen Ausschau. Ziehe das schmucke Ding langsam vom Bügel. Aber es ist sperrig. Verflucht! Da ist eine Schlaufe! Sie hat sich am Haken verheddert! Meine Finger gleiten ab.
Aus dem Dunkel des Ladens fixieren mich ein paar scharfe dunkle Augen. Jetzt tritt eine feiste Person in den Türrahmen. »Kann ich Ihnen helfen?«
Ich setze ein schiefes Lächeln auf und schwinge mich davon.
Was für eine Stümperei!
Der wachsame Blick scheint jetzt meinen Rücken zu durchbohren. Ich wetze um die Ecke.
Seit wann kann man nicht mehr in Ruhe gustieren? Was ist das für eine pingelige Gegend hier?!
Früher als ich wollte, trudle ich wieder bei Ricco ein. Bis zu Verena hab ich es trotz meiner finanziell angespannten Lage nicht mehr geschafft.
Es ist Mittag. Ricco ist bereits zu Hause. Sieht mir mit hochgezogenen Brauen entgegen.
Mein gehetzter Gesichtsausdruck scheint für sich zu sprechen.
»Was ist los? Hat dich jemand gesehen?«
»Wie kommst du darauf?«
»Hör zu: Ich könnte dich zu einem Verwandten aufs Land bringen, wenn du willst. Wenigstens für eine gewisse Zeit.«
Verblüfft lasse ich mich auf Riccos einzigem Stuhl sinken.
Ist dieser Vorschlag zielbringend für mich? Und womit soll ich einen solchen Freundschaftsdienst bezahlen?
Ich schüttle schweigend den Kopf. Denke nach. Wäre jetzt nicht der Zeitpunkt gekommen, um endlich Klartext zu sprechen? Um damit vielleicht sogar einen Verbündeten zu gewinnen?
Ich wage es nicht. Noch nicht.
»Danke«, sage ich schließlich. »Aber ich muss mich allein durchschlagen. Wenigstens in den nächsten paar Tagen. Dann werden wir weitersehen.«
Ich rede, nur um diese feindselige Stille in mir zu übertönen.
»Überleg es dir.« Ricco scheint mich zu durchschauen.
Doch wir überspielen diese prekäre Situation, lassen den Augenblick vorüberziehen.
Ricco ordnet seine Notenblätter, übt Passagen aus dem ›Wohltemperierten Klavier‹. Nimmt sich ein paar Skripten vor. Scheint auch mich zu irgendeinem sinnvollen Tun animieren zu wollen.
Ich aber brüte vor mich hin. Fasse einen Entschluss. Entwerfe im Geist den Ablauf einer neuerlichen Flucht:
Zunächst heimlich ins Haus meines Vaters schleichen. Das Notwendige zusammenraffen. (Schließlich besitze ich nur das, was ich gerade am Leib trage.) Und da ist auch noch etwas Geld in meiner Kommode. (Den bei Verena gebunkerten Zaster werde ich mir später zu beschaffen wissen.)
Nur eines ist jetzt wichtig: Fortgehen! Untertauchen! Meinetwegen bei diesem Verwandten! Aus dem Dunstkreis der Gefahr verschwinden! Ruhe finden! Nachdenken! Einen neuen Lebensplan schmieden! Meinem Ich – so unwahrscheinlich es mir auch heute noch erscheinen mag – eine neue Identität verpassen!
Vorsichtig teile ich Ricco meinen Entschluss mit.
Der ist einverstanden. Ist willfährig. Zeigt dabei keinerlei Emotionen.
Aus diesem Typen werde ich einfach nicht schlau.
Wir beschließen, morgen, zur angemessenen Tageszeit, meinen Plan durchzuführen. Noch am selben Abend instruiert Ricco seine Leute.
Die Nacht verwandelt sich in eine zerrissene, steinige Landschaft, voll heimtückischer Hindernisse und schwarzer Gräben.
Ich stolpere, ohne innezuhalten, über sie hinweg. Stürze am Ende in eine bodenlose Galaxie. Schwebe im schwerelosen Raum. Mit ausgebreiteten Armen und leerem Herzen. Eine Ewigkeit lang.
Und erwache mit Herzklopfen.
Es dauert eine Weile, ehe ich Riccos leere Schlafstelle wahrnehme.
Wo ist er? Hat er sich aus der Affäre gezogen? Ist heimlich weggegangen? Hat mich am Ende verraten?
Ricco hantiert in seiner Kochnische. Brüht Kaffee auf. Stellt zwei Tassen neben mir auf den Boden. Lässt sich ebenfalls nieder.
Beschämt lasse ich ihn gewähren.
Wir sehen einander an.
Vielleicht ist es für lange Zeit der letzte Morgen, der uns zuzulächeln scheint.
Zwei Stunden später halten wir am Ende der Allee.
Nur noch ein paar Schritte sind es bis zu meiner bisherigen, selten benutzten Wohnadresse.
Katjas Vehikel ist nicht mehr zu sehen. Die Lebensgefährtin meines Vaters muss heute schon früher als sonst aus dem Haus gegangen sein. Aber da ist noch Vaters alte Kiste.
Es währt eine gute Weile, ehe ich Vater aus der Gartenpforte treten sehe. Wie rasch und sicher er sich mit seinen Krücken bewegt! Ein stattlicher, etwas gebeugter Mann.
Aufatmend sehe ich ihn ins Auto steigen. Sehe ihn wegfahren, sehe ihn hinter der nächsten Kurve verschwinden.
Wohlan! Jetzt ist es Zeit!
Ich schlängle mich aus Riccos fahrbarem Untersatz, renne die Straße entlang, stoße die Gartentüre auf, stöbere nach dem zumeist in einem Blumentopf versteckten Zweitschlüssel zur Eingangstür, halte ihn wie eine Waffe in der Faust.
Aber die Tür ist unverschlossen.
Vorsichtig stehle ich mich in den Vorraum, eile geräuschlos die hölzerne Treppe zu meiner Kemenate empor.
Rasch! Die Tasche gefüllt! Den Zaster aus seinem Versteck geholt!
Fertig!
Noch ehe ich das Haus verlassen kann, fühle ich mich plötzlich am Arm gepackt und zu Boden gezerrt.
Aufschreiend starre ich in Katjas geweitete Augen.
Dieses überbordende Erschrecken! Diese laute, unecht wirkende Bestürzung!
Wie ich dieses ermüdende, schon zu oft strapazierte Brimborium um meine unerwünschte Gegenwart kenne!
Diese Frau ist nichts weiter als meine erklärte Feindin! Instruiert von der Polizei! Begierig darauf, mich zu demütigen! Mich auszuliefern!
Wütend strample ich mich frei.
Aber dieses vierschrötige Hindernis verstellt mir den Weg! Vergeblich renne ich gegen diese geballte Abwehr an!
Heule am Ende los!
Als hätte diese neuerliche, verhasste Barriere auf meinem Weg in die Freiheit plötzlich alle meine Kräfte blockiert und stattdessen irgendwelche verborgene Schleusen in mir geöffnet, so stürme ich laut flennend durchs Haus und in mein Zimmer hinauf! Sperre mich ein. Knalle meine Glieder aufs Bett! Zerknülle Decken und Polster in ohnmächtigem Hass! Weise mit wüster Entschlossenheit alle familiären Annäherungsversuche von mir, überwältigt von einer nunmehr echten, bitterernsten, unbändigen Sehnsucht nach Tod und Vergessen!
6. KAPITEL
Schließlich muss die unverzüglich anrückende Staatsgewalt zu drastischen Mitteln greifen: Ich hatte mir mit einer Schere wahllos Verletzungen zugefügt.
Also schalten unter polizeilicher Präsenz medizinische Aktionen kurzerhand mein ramponiertes Bewusstsein aus.
Das Erwachen ist ein grauenvolles Déjà-vu: Die wohlbekannte Anstaltssterilität umgibt mich wieder! Nein! Schlimmer! Nun ist sie tatsächlich Wirklichkeit geworden! Die Klapsmühle! Die Zwangsverwahrung! Noch dazu unter dem belastenden Titel der Rückfälligkeit!
Ich tobe nicht mehr. Ich heule nicht mehr. Eine fast metaphysische Hoffnungslosigkeit beginnt sich in mir auszubreiten. Und mit jeder Tablette, die ich unter Aufsicht hinunterschlucke, mit jeder Spritze, die mir die Birne leer und meine Glieder schlaff und gefügig macht, schwindet die Möglichkeit, mich aus diesem mir aufgezwungenem Korsett aus Chemie und Abhängigkeit zu befreien.
Die Zeit fließt unbegriffen um mich herum.
Ich erdulde ihre leise, unmerklich das revoltierende Selbst gefügig machende Therapie, ergebe mich in mein offenbar unumkehrbares Schicksal.
Und bezeuge am Ende sogar wieder Interesse für das Leben. Oder gebe mir zumindest den Anschein, es zu tun.
Die Folgen dieser erfreulichen Entwicklung sind vorprogrammiert: Nach einer geraumen Zeit der Abgeschiedenheit verlasse ich dieses Niemandsland verwirrter Seelen und kehre zur Verbüßung meiner restlichen Haftstrafe in den Bau zurück.
Die Besuchstage aber fordern mehr als meinen guten Willen heraus. Sie werden zur Nagelprobe für mein zukünftiges Leben.
An einem dieser Termine lässt sich Vater bei mir blicken. Es ist dies unsere erste Wiederbegegnung nach meinem ruhmlosen Ausriss.
Ich spüre den Versuch einer versöhnlichen Geste: Vater lächelt mir ermunternd zu.
Ich erschrecke dennoch.
Was erwartet dieser Mann von mir? Doch wohl keine unaufrichtigen Erklärungen, verspäteten Reuebekundungen, die – wie bisher – unverzüglich in einem Morast von Gegenargumenten und Unverständnis ertrinken würden.
Vater überrascht mich jedoch mit einer Ankündigung: »Hör zu: Ich habe ein interessantes Angebot für dich.«
(Auch das noch! Interessante Angebote fordern zumeist Interesse ein, Begeisterungsfähigkeit, und – wenn es ganz schlimm kommt – sogar Dankbarkeit. Ich bin noch nicht bereit für Beglückungen dieser Art!)
»Ein guter Bekannter von mir bietet dir an, nach deiner Entlassung ein paar Wochen in seinem leerstehenden Sommerhaus in den Tiroler Bergen zu verbringen.«
Ich schweige zu dieser Eröffnung. Bleibe passiv. Denke nur so nebenbei, dass dieser gute Bekannte ein seltsames Interesse an uns und unserem Wohlergehen zu haben scheint. Schon öfters war nämlich von einem solchen namenlosen Wohltäter die Rede gewesen. Merkwürdig nur, dass er bei all seinen guten Taten noch immer kein Gesicht für mich hat, dass er unsichtbar bleibt.
Doch der Tag meiner Entlassung ist noch fern.
Also versuche ich, eigene geplante Aktivitäten und meinen augenscheinlich wiedererwachten Lebensmut ins Spiel zu bringen.
Rede von Neuanfang. Von einem geregelten Job, den ich anstreben werde, sobald die Folgen meiner verirrten Daseinsbewältigung erst einmal ausgestanden wären.
Vater lässt mich reden. Fügt meinem verlogenen Monolog nur lakonisch hinzu, dass sich mir in meiner gegenwärtigen Lage vermutlich nicht sobald berufliche Chancen eröffnen würden, mit diesem Angebot zugleich aber eine Art Beaufsichtigung über das Anwesen verbunden sei. Gegen gute Bezahlung natürlich.
Ich bin erstaunt.
Soviel Vertrauensvorschuss? Für eine notorische Diebin?
Worauf will diese Aktion hinaus? Und was ist die Triebfeder dieser ungewohnten väterlichen Bemühungen?
Die darauf folgenden Nächte verbringe ich mit den altbekannten Albträumen von einer nicht enden wollenden Verfolgung.
Ich bin wieder Olivia. Und bin dennoch ich, Sanya. Und ein Kerl ist hinter mir her.
Wieder laufe ich durch diese weithin gestreckte Landschaft, auf diesem überwachsenen Pfad. Quäle mich einen Hügel hinauf. Renne an der Mauer eines halb verfallenen Schlosses entlang. Verberge mich hinter einem Vorsprung.
Umsonst! Der Verfolger hat mich eingeholt! Packt mich! Schüttelt mich! Wieder ist sein Gesicht jetzt nahe über dem meinen. Und wieder taucht er blitzartig aus den Tiefen einer frühen Kindheitserinnerung auf! Dieser zornige, eisblaue Blick!
Ich schrecke auf!
Die Zeit scheint sich in meinen Träumen ebenso im Kreis zu drehen, wie in meinem wachen Zustand.
Aber was verbirgt sich hinter diesen Bildern, mit denen ich mich beständig durch mein Dasein quälen muss? Und wer bin ich wirklich? Nur die unverbesserliche, ruhelose Ganovin? Der es nicht gelingen will, sich selbst und ihrem dunklen Geheimnis zu entfliehen?
Aber weshalb diese unaufhörliche Flucht?
Hat nicht jener Schatten, der über meine frühe Kindheit gefallen ist, längst schon sein furchtbares Geheimnis für immer aus meinem Gedächtnis gelöscht?
Tief aufatmend schließe ich dann wieder die Augen.
Erneut stürzen Farben, Formen, Düfte aus unwirklich gewordenen Tagen auf mich ein.
Die wehende Fülle einer Frühlingswiese etwa. Warmes Gras. Sonnenkringel in den Büschen. Ein fächelnder Duft aus Erwachen und Neugier …
Selbst im Traum wehre ich mich noch gegen solche verführerischen Erinnerungen! Ich darf sie nicht wecken!
Aber da bin ich! Lebendig! Beharrlich! Winzig klein inmitten dieser hohen schwankenden Gräser! Verzückt nach dem taumelnden Wippen eines Schmetterlings greifend! Er hat blaue Flügel.
Und da ist Mutter! Und ein fremder Mann!
Er neigt sich zu mir herab. Legt eine Puppe in meinen Schoß. Sie hat schwarze Haare und braune Augen. Ihr pinkfarbenes Kleid leuchtet in der Sonne.
Doch die Gesichtszüge dieses Mannes gleichen demjenigen aus meinen Schreckensvisionen! Das Antlitz des Verfolgers! Des Mörders!
Ich erschrecke vor dem Blick dieser eisblauen Augen! Versuche, diesen Armen zu entfliehen! Die mich mitsamt der Puppe packen und forttragen wollen! Fort von Mutter!
Schließlich fange ich laut zu weinen an.
Erst allmählich scheinen sich die Traumbilder in diesem enervierenden Geschrei zu verlieren, das kein Ende nehmen will, das mehr und mehr anschwillt, sich in ein ohrenbetäubendes, zerberstendes Klirren und Zersplittern verwandelt! Ein Geräusch, das, wie schon so oft, alle meine sonstigen Wahrnehmungen zersprengt und mein erwachendes Bewusstsein in eine Hölle aus Panik und Verzweiflung stößt!
Ächzend fahre ich zumeist aus solchen Traumattacken hoch. Warte, schweißgebadet, mit jagendem Puls auf den Anstaltsmorgen, während das Bett unter meinen schlotternden Gliedern wie unter Stromstößen erbebt.
Tage und Wochen ziehen über mich hinweg.
Hilflos, wie ich mich fühle, verstecke ich mich hinter einer Art oppositioneller Selbstkritik. Ziehe Bilanz über mein Leben. Verliere mich in Grübeleien. Verfluche das Schicksal, das uns immer wieder mattsetzt! Das keinen Fehltritt vergisst, während wir uns vergeblich an das Vergessen klammern!
Das uns grausam werden lässt! Und sprachlos! Und sinnlos leidend in unserer Ohnmacht! In unserem Hass!
Meine Gedanken kreisen hartnäckig um mein eigenes familiäres Desaster: offenbar Ursache und Ausgangspunkt meiner seelischen Instabilität.
Warum, so frage ich mich dann gepeinigt, musste unter tausenden und abertausenden von Menschen ausgerecht einem ganz bestimmten jungen, begabten Leichtathleten und Flüchtling aus dem kriegsverwüsteten Osten Europas, der sich während eines internationalen Sporttreffens in eine junge thailändische Dolmetscherin verliebte, sie vom Fleck weg heiratete und mit ihr eine Familie gründete, ein tragischer Autounfall widerfahren, an dessen Folgen er trotz seines guten Gewissens bis an sein Lebensende leiden wird?
Nein! Vater trifft keine Schuld an diesem Unglück! Es geschah durch eine tragische Verkettung schlimmer Zufälligkeiten! Wie könnte es auch anders sein?!
Ich klammere mich geradezu an diese von mir festgeschriebene Unschuld! Obwohl oder vielleicht gerade weil ich die genauen Hintergründe dieses schrecklichen Ereignisses niemals wirklich erfahren habe.
Aber warum sich überhaupt mit Fragen über Schuld und Unschuld quälen? Sie bleiben ambivalent angesichts des Todes: denn eine junge Frau war tot! Vaters große Liebe war tot!
Mutter war tot!
Ließ uns allein zurück! Einen Krüppel! Und ein dreieinhalbjähriges Kind!
Vorbei die Sportkarriere! Vorüber das idyllische Leben zu dritt!
In selbstquälerischer Akribie taste ich an die ersten behüteten Jahre meiner Kindheit.
Und an das Danach! Dieses schwarze Nichts! Diese große Leere! Niemandsland verschollener Erinnerungen! Unergründliches Vergessen einer zutiefst verstörten Kinderseele. Eingebettet in das grässliche Gefühl, schutzlos zu sein, jeder Willkür preisgegeben.
Und an die alsbaldige Unterbringung in einer Erziehungsanstalt. An den tristen Heimalltag. Die kargen Ferienwochen. Abstrakte Farbkleckse in diesem stereotypen Bilderreigen des Schreckens. In denen sich das fremd gewordene Kind aufmüpfig und verstockt der einen oder anderen Gefährtin seines Vaters stellt.
Bis heute belasten mich die einstigen hilflosen Versuche dieses mir fremd gebliebenen Mannes, so etwas wie Frohsinn und Normalität in die kurze Zeit unseres Zusammenseins zu zaubern.
Und zuweilen scheine ich gegen mein besseres Wissen immer noch hemmungslos Ersatz für etwas einzufordern, das ich bis heute nicht in Worte fassen kann.
In trostloser Abfolge wandern immer wieder jene trüben Bilder, Restposten einer verdrängten familiären Lebenskrise, an mir vorüber. Rühren erneut diese inneren und äußeren Spannungen einer verblassten Kindheit in mir auf, kreisen um die mich bis heute quälende Frage, warum Vater so ängstlich darauf bedacht war, mich in all diesen Jahren von seinem persönlichen Lebensumfeld fernzuhalten.
Nun ist es offenbar zu spät für uns beide.
Das Kind ist erwachsen geworden.
Und ein kaum mehr als erduldetes, beinahe sprachlos gewordenes Nebeneinander ist alles, was uns beiden geblieben ist.
Es muss irgendwann in meinem letzten Internatsjahr gewesen sein, als eine Landsmännin namens Katja festen Schrittes ins Leben meines Vaters trat. Und eigentlich wäre ihr endgültiger Abgang längst überfällig.
Doch wozu weitere Gedanken an sie verschwenden?
Diese Frau von einigen vierzig Jahren, mit ihrem leidlich annehmbaren Äußeren, ihrer Überredungskunst, ihrer Geschäftstüchtigkeit und ihrem Ehrgeiz, wird sich vermutlich für lange, vielleicht sogar für immer bei uns einzunisten verstehen.
Auch gut!
Ich für meinen Teil werde Vaters Glück jedenfalls nicht im Wege stehen. Werde es irgendwann vielleicht oder vielleicht auch nicht schaffen, mein eigenes Leben in bürgerliche Bahnen zu lenken. Egal! Wer, außer mir selbst, wird sich in Hinkunft je darüber Gedanken machen?
Nur diese eine, bisher unbeantwortet gebliebene Frage nach dem Warum von Vaters rätselhaftem, ambivalentem Verhalten mir gegenüber, beginnt immer mehr von mir Besitz zu ergreifen.
Was verbirgt er vor mir und der Welt? Welches dunkle, in den Tiefen seiner Seele versenkte Geheimnis? Ist es persönliche Schuld? Eine nie wieder gutzumachende Verstrickung? Die verbunden ist mit meinem eigenen physischen Vorhandensein?
Was für ein überstiegener, aus seelischen Defiziten zusammengebrauter Verdacht!
Warum aber geht er mir ausgerechnet jetzt, nach dieser unserer ersten, ernüchternden Wiederbegegnung seit dem Tag meines erfolglosen Ausbruchs, nicht mehr aus dem Sinn?
7. KAPITEL
Die Knastmonate sind abgesessen: Ein Spätherbst ohne Farben und Fülle, ein langer Eiszeitwinter, mit einem zugefrorenen Himmel über dem Gefängnishof, und ein verpasster Frühlingsanfang, auf den ich noch immer warte.
Die letzte Nacht in diesem gastlichen Etablissement ist angebrochen.
Seit dem frühen Morgen starre ich durch den Fensterausschnitt in den aufsteigenden Tag. Ein unbestimmter Duft, Vorbote der nahenden Freiheit, weckt längst vergessene, dumme Sehnsüchte in mir. Sie passen zu dieser Stunde.
Nicht Vater, Katja wird mich am Tor erwarten.
Ich aber sehne mich nach Verena und der Erfüllung ihres einstmals in einem intimen Moment leidenschaftlich hingeflüsterten Versprechens: »Gib nicht auf! Ich schwör dir, ich hol dich aus diesem Seelenschlamassel heraus!«
Gut. Wir werden einander anderswo wiedersehen. Aus taktischen Gründen halte ich es zudem für klüger, eine Begegnung zwischen Katja und Verena an einem Ort wie diesem zu vermeiden. Diese beiden Frauen bewegen sich in zu verschiedenen Welten.
Der erste Schritt in die Freiheit symbolisiert ein unscheinbares Ausfalltor. Aber die Luft schmeckt nach Neubeginn.
Katjas Wagen parkt dort drüben.
Ohne Umschweife werde ich von ihr in Empfang genommen und mitsamt meinem bescheidenen Gepäck in ihre Kiste verfrachtet.
Doch die unrühmliche Vergangenheit folgt mir auf den Fuß: ein zuverlässiger Schatten. Ich werde mit ihm leben müssen.
Im Haus riecht es nach Sauberkeit.
Ich betrete dieses bescheidene Domizil, das vorläufig noch immer mein Zuhause ist, mit gemischten Gefühlen.
Vater ist nicht da. Aber was soll’s? Es steht einer mehrmals vorbestraften Tochter nicht an, darüber enttäuscht zu sein. Vater muss eben seine Bürostunden absitzen. Muss seinen Platz behaupten. Seiner Gefährtin, der Halbtagsbeschäftigten, gelingt es leichter, sich ein paar Stunden für mich freizunehmen.
Wir trinken Kaffe, essen selbstgebackenen Kuchen.
Katja kaschiert geschickt die Peinlichkeit des Augenblicks, erzählt amüsante Begebenheiten aus ihrem Berufsleben. (Warum zum Kuckuck gibt sie sich so viel Mühe auf einmal?)
Auch ich trage ein wenig zur Unterhaltung bei. Schildere, etwas geschönt und aufpoliert, ein paar Streiche aus meiner Internatszeit, lasse keine Pausen in unserem Geschwätz aufkommen.
Innerlich aber bin ich abwesend, fühle mich überflüssig und fehl am Platz.
Die morgendliche Euphorie ist verflogen.
Ich bin müde. Müde des Wartens auf eine ganz bestimmte, vollkommene Art von Freiheit und Selbstbestimmtheit, die ich immer noch ersehne und an die ich an einem Tag wie dem heutigen weniger denn je glauben kann, müde des Nachdenkens über mich selber, müde der Scham über meine noch immer so hoffnungslos passive Lage.
Es ist früher Nachmittag.
Meine Quasistiefmutter eilt an ihren Arbeitsplatz zurück. Und auch ich will mich nützlich machen, will fürs Abendessen sorgen.
Ich begleite Katja bis zur Gartenpforte. Lege Dankbarkeit in meinen Blick. Und stelle mir dabei vor, wie es wäre, wenn Ricco jetzt hier stünde.
Dieser Gedanke treibt mir die Schamröte ins Gesicht.
Oben in meinem Zimmer lasse ich mich vorerst einmal gehen. Strecke mich auf meiner Jungmädchenliege aus. Verdöse diese blaue Stunde mit erschlafften Gliedern und leerem Herzen.
Neben mir, auf dem Kopfpolster, liegt ein kleiner, halb verblühter Ginsterzweig. Gedankenverloren drehe ich ihn zwischen den Fingern.
Wer hat ihn hierhergelegt? Vater?
Irgendwann wird draußen an der Gartenpforte geläutet.
Ich schrecke auf.
Besuch?!
Automatisch taumle ich hoch, schlüpfe in meine Jeans, fahre mit dem Kamm durchs Haar.
Doch halt! Was tue ich da? Ich bin für niemanden zu sprechen! Ich werde nicht öffnen! Um keinen Preis! Ich bin noch gar nicht richtig zu Hause!
Die Glocke ertönt ein neues Mal.
Ich überlege. Hat etwa ein Bote irgendetwas abzugeben?
Ohne Hast steige ich die Treppe hinunter.
Ein Fremder steht bereits vor der Eingangstür. (Zu dumm!
Ich habe vorhin vergessen, das Gartentor abzuschließen!) Ein Name wird genannt: Marc Fabrini.
Ich öffne zögernd. Nehme zunächst nur die Silhouette eines groß gewachsenen Kerls wahr.
Der nennt noch einmal seinen Namen. Er wolle nicht stören. Bloß ein paar Worte mit Ivo Pavic sprechen. In einer geschäftlichen Angelegenheit.
Ich vernehme diese Erklärungen nur mit halbem Ohr.
Mein Blick gleitet an einem flotten Jackett empor, tastet an ein sonnengebräuntes Gesicht unter einer blonden Tolle, verfängt sich in zwei eisblauen Augen, wandert über eine blassrosa Narbe an der linken Backe, bleibt an einem winzigen Muttermal seitlich am Kinn hängen.
Ob er hier auf Ivo warten dürfe? Der sei nämlich telefonisch nicht zu erreichen gewesen.
Ich starre noch immer geistesabwesend in diese lächelnde Visage, ausgesetzt einem Schwall von Erinnerungsfetzen, die jetzt ungebremst auf mich einstürzen und vorerst keine vernünftige Reaktion zulassen.
Automatisch trete ich zur Seite, gehe meinem Besucher voran ins Wohnzimmer, führe ihn zu dem noch immer gedeckten Jausentisch.
Jetzt erst komme ich zu mir.
Ein dunkles, unbestimmtes Grauen nimmt von mir Besitz. Setzt sich mir in den Nacken.
Benommen deute ich auf einen Stuhl.
Der Typ nimmt Platz, lehnt sich zurück, schlägt die Beine übereinander, fängt an, mich mit einem provokanten Grinsen zu fixieren.
Auffallend locker ist sein Benehmen. Versucht er mich einzuschüchtern?
»Ich weiß nicht, wann Vater nach Hause kommt«, erkläre ich hastig.
Der Gast verzieht keine Miene. Nagelt mich mit seinen Blicken fest.
»Kann ich Ihnen etwas anbieten? Eine Tasse Kaffee vielleicht?«
»Gern.«
Ich agiere, wie es offenbar von mir erwartet wird. Hole schweigend Tasse und Untertasse aus dem Buffet, gieße Kaffee ein, schiebe Milchkanne und Kuchenteller zurecht.
»Sie sind Sanya. Richtig? Ich habe Sie schon gekannt, da waren Sie noch sooo klein.« Der Typ hält die flache Hand wenige Zentimeter über dem Boden und lacht.
Ich schweige zu dieser launigen Mitteilung.
Undeutlich taucht das Bild einer schwarzhaarigen Puppe vor mir auf.
»Ich erinnere mich an eine Puppe«, sage ich schließlich, ohne zu wissen, warum.
»Tatsächlich?« (Der Eindringling reagiert überraschend lebhaft auf diese meine linkische Bemerkung.) »Sie hatte Mandelaugen wie Sie. Stammte aus Indonesien. Wie schön, dass Sie sich daran noch erinnern können! Nach so vielen Jahren! Aber ich störe Sie«, unterbricht er plötzlich seine eigene Suada. »Verzeihen Sie. Es war aufdringlich von mir.«
Er hat sich elastisch erhoben. Sein Blick wird indiskret. Er scheint meine Verlegenheit zu genießen.
Nun tritt er dicht an mich heran. Streicht mit dem gebogenen Zeigefinger über meine Wange.
»Was für ein hübscher Teint.«
Ich weiche einen Schritt zurück.
Wir sehen einander in die Augen.
Ist es blanke Aversion oder bloß eine Art geringschätziges Wohlwollen, was mir da aus diesem zwielichtigen Blick entgegen springt?
»Hat man Ihnen mein Angebot ausgerichtet?«
Ohne meine Antwort abzuwarten, redet er weiter, überträgt mir eine Nachricht an Vater. Wendet sich schließlich mit einer eleganten Drehung zum Gehen.
Ich folge ihm wortlos.
An der Tür ergreift der ungebetene Besucher meine Rechte, zwingt mich zu sich hin und raunt mir ein paar Abschiedsworte ins Ohr.
Federnd geht er sodann aus meinem Revier und schlägt die Gartenpforte hinter sich zu.
Ich aber stehe da und spüre noch immer den leisen Druck seiner Hand in der meinen.
Was war das? Was hat mir dieser Typ da soeben zugeflüstert?
Irgendeinen banalen Satz wie: »Danke für die freundliche Bewirtung?«
Nein. Da war noch etwas anderes, das er von sich gab. Es klang wie eine hingehauchte Beschwörung: »Wir werden uns sehr bald wiedersehen. Aber das bleibt unter uns. Einverstanden?«
Eine abgeschmackte Bemerkung, nichts weiter.
Warum aber empfinde ich sie plötzlich wie eine verschlüsselte Bedrohung?
8. KAPITEL
Über dem Stadtviertel wölbt sich ein bedeckter, regenschwerer Maihimmel. Die halb verblühten Fliederbüsche atmen noch einmal ihre vergängliche Schönheit aus. Die Gräser sind über Nacht hochgeschossen. Eine Amsel steckt mit herzergreifenden Tönen ihr Territorium ab.
Es ist Sonntag. Und der Ehrentag der Mütter.
Wie jedes Jahr pilgere ich zu Mutters Grab. Leere die mit einer brackigen Flüssigkeit gefüllte Vase über dem Rasen aus, fülle sie am Brunnen mit frischem Wasser und stelle meinen Blumenstrauß hinein.
Was noch? Richtig! Die Laterne! Ich öffne sie und zünde eine Langzeitkerze an. Immer die gleichen Verrichtungen!
Die Stille um mich herum legt sich wie eine besänftigende Hand um meine Schläfen. Ich starre über den Grabstein hinweg in ein Niemandsland, mit blinden Augen und weit geöffnetem Herzen.
Und spüre sie beinahe körperlich, diese ausweglose metaphysische Einsamkeit, der ich offenbar nicht entkommen kann.
Ohne es zu wollen, rede ich mit einer lautlos sich nähernden Seele, stammle Dankesworte, und bin doch geistesabwesend, verloren, in einer tiefen Melancholie verfangen.
Der Schrei einer Krähe weckt mich auf.
Über einer trauernd sich neigenden Nymphe wippen blütenbedeckte Zweige. Die naiv pathetische Welt vergangener Tage greift mir ans Gemüt.
Im Geist umarme ich Mutter, oder das, was ich unter diesem Synonym verstehe, drücke sie an mich, schaue in das unruhig flackernde Kerzenlicht und schließe verloren die Augen.
Hinter dem Grabstein flimmert ein heller Schein. Neugierig trete ich näher. Das Licht stammt von einer Kerze. Ein Kind trägt sie vor sich her, mit erhobenen Armen. Es wendet den Kopf und sieht mich an.
Es ist ein Mädchen. Kaum älter als drei oder vier Jahre. Seine Züge bleiben verschwommen. Nur die großen ernsten Augen treten deutlich daraus hervor.
Ich lächle ihm zu. Aber das fremde Mädchen erwidert dieses mein Lächeln mit keiner Geste. Es wandelt mit seiner Kerze zwischen den Gräbern dahin, eine seltsam bizarre Erscheinung.
Und noch immer hält sein Blick den meinen fest.
Ich drücke die Finger auf meine Lider. Blinzle. Schüttle den Kopf.
Die Gestalt ist verschwunden. Aber ein eigenartiger Duft schwingt jetzt über den Grabhügel hinweg, steigt mir in die Nüstern, hüllt mich ein.
Ein heftiger, zersplitternder, zerklirrender Laut zerbricht plötzlich die Stille.
Ich gehe zu Boden. Presse die Hände an die Ohren.
Das betäubende Geräusch verebbt nur ganz allmählich. Zieht sich in mein Blut zurück. Mein Puls jagt. Der Tag verdunkelt sich vor meinen Augen.
Aufgewühlt, panisch verlasse ich wenig später diesen magischen Ort einer offenbar noch lange nicht zu Ende gelebten Trauer.
Zweifel und Aufmüpfigkeit begleiten mich auf meinem Rückweg durch die weithin gestreckte Oase der Toten. Vor mir liegt ein langer Nachmittag. Und ich weiß nichts Rechtes mit ihm anzufangen.
Mit Unbehagen erinnere ich mich an Katjas heimliche Ermahnung, trotz Vaters Verbot nicht auf die noble Nachmittagseinladung zu vergessen. Sigrid, ihre Chefin, die Boutiquebesitzerin, hat uns zur Jause gebeten. Die Mondäne vermeint offenbar, ausgerechnet an ihrem Festtag als Mutter das mutterlose, auf Abwege geratene Gör in ihren Familienclan integrieren zu müssen.
Katja hat für solche Marotten nur ein amüsantes Lächeln übrig. Dennoch: Man gibt seiner Arbeitgeberin keinen Korb. (Von ihren eigenen Kindern spricht Katja Markovic nie. Vermutlich, weil sie diese in ihrer alten Heimat wie ein Attribut an ihr altes Leben zurückgelassen hat.)
Nervös kurve ich durch die Straßen dieses noblen Viertels. Kämpfe mit dummen Hemmungen. Seit meinem folgenschweren Ausriss aus der Klinik war mein Kontakt zur Außenwelt gleich Null. Was für eine Figur werde ich nun in diesem meinem aufgewühlten Zustand bei einer mir völlig fremden Familie machen?
Mit einer Mischung aus Tapferkeit und Resignation parke ich schließlich mein winziges Vehikel (eine günstige Anschaffung und Geschenk meines Vaters anlässlich meines positiven Internatsabschlusses, wie es offiziell heißt) in der Nähe der Villa.
Auf der Straße dehnt sich die sonntägliche Leere eines Vorortes. Ich schlendere die Gitterzäune entlang, betrachte die undurchdringlichen Mauern aus immergrünen, streng geschnittenen Hecken und lege mir für mein verspätetes Erscheinen ein paar Notlügen zurecht.
Die Gartenpforte springt unmittelbar nach meinem Läuten auf. Automatisch folge ich mit meinem, am Friedhofseingang erstandenen Blumenstrauß dem schmalen Betonweg, der beidseitig das stolze Gebäude umsäumt, und erblicke schon von Weitem den grellbunten Sonnenschirm über dem runden Gartentisch. Ein melodisches Lachen schlägt an mein Ohr. Die Jause ist also noch in vollem Gang.