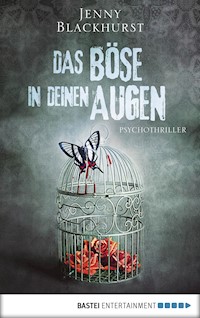9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Eine kalte Herbstnacht in den Cotswolds. Als Detective Rebecca Dance das gepflegte Cottage des erfolgreichen Schönheitschirurgen Luke Whitney betritt, bietet sich ihr ein grauenvoller Anblick: Luke liegt erstochen am Boden, neben ihm kniet seine Ehefrau Anna, ihre Kleidung getränkt von seinem Blut. Der Fall scheint schnell gelöst, denn Anna gesteht die Tat sofort. Doch warum kann sie sich dann an kein Detail des Mordes erinnern? Je mehr Rebecca über das Opfer herausfindet, desto klarer wird ihr: Hinter der Kulisse dieser allzu perfekten Ehe verbergen sich dunkle Abgründe - und mehr als eine Frau hätte einen Grund gehabt, Luke Whitney zu töten ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 364
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über das Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Widmung
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
Danksagung
Über das Buch
Eine kalte Herbstnacht in den Cotswolds. Als Detective Rebecca Dance das gepflegte Cottage des erfolgreichen Schönheitschirurgen Luke Whitney betritt, bietet sich ihr ein grauenvoller Anblick: Luke liegt erstochen am Boden, neben ihm kniet seine Ehefrau Anna, ihre Kleidung getränkt von seinem Blut. Der Fall scheint schnell gelöst, denn Anna gesteht die Tat sofort. Doch warum kann sie sich dann an kein Detail des Mordes erinnern? Je mehr Rebecca über das Opfer herausfindet, desto klarer wird ihr: Hinter der Kulisse dieser allzu perfekten Ehe verbergen sich dunkle Abgründe - und mehr als eine Frau hätte einen Grund gehabt, Luke Whitney zu töten …
Über die Autorin
Jenny Blackhurst ist seit frühester Jugend ein großer Fan von Spannungsliteratur. Die Idee für einen eigenen Roman entwickelte sie nach der Geburt ihres ersten Kindes; inzwischen ist sie eine erfolgreiche Autorin, deren Thriller in mehreren Sprachen erscheinen und fast alle zu SPIEGEL-Bestsellern wurden. Die Autorin lebt mit ihrem Ehemann und ihren beiden Kindern in Shropshire, England.
Weitere Titel der Autorin:
Die stille Kammer
Das Mädchen im Dunkeln
Das Böse in deinen Augen
Mein Herz so schwarz
Das Gift deiner Lügen
Dein dunkelstes Geheimnis
Der finstere Pfad
Die dunkle Spur
Jenny Blackhurst
THE Sie ist nicht die Erste. FINAL Doch sie wird die Letzte sein. WIFE
Thriller
Übersetzung aus dem Englischen von Michael Krug
Vollständige E-Book-Ausgabedes in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Deutsche Erstausgabe
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2025 by Jenny Blackhurst
Titel der englischen Originalausgabe:
»The Final Wife«
Originalverlag: Canelo, London
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2025 by
Bastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6 – 20, 51063 Köln, Deutschland
Vervielfältigungen dieses Werkes für das Text- und Data-Mining bleiben vorbehalten. Die Verwendung des Werkes oder Teilen davon zum Training künstlicher Intelligenz-Technologien oder -Systeme ist untersagt.
Textredaktion: Anne Fröhlich, Bremen
Covergestaltung: Kirstin Osenau
Covermotiv: © Magdalena Russocka/Trevillion Images
E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-7517-8421-4
Sie finden uns im Internet unter luebbe.de
Bitte beachten Sie auch: lesejury.de
An meine ewige erste Leserin Laetitia. Lass uns alles noch mal machen, ja?
1
Gegenwart
So viel Blut. Warm und glitschig pulsierte es durch meine Finger, während ich auf die klaffende Wunde an seinem Bauch drückte und versuchte, rückgängig zu machen, was bereits in Gang war. Aber es war zu spät. Er würde sterben. Natürlich war das der Plan gewesen, nur hatte ich keine Vorstellung davon gehabt, was es bedeutete und wie es aussehen und sich anfühlen würde, wenn das Leben aus seinen Augen wich. Wie könnte man auch so vertraut mit jemandem sein und dennoch keinen Schmerz bei dem Gedanken empfinden, dass er nicht mehr auf der Welt ist? Ich fragte mich, wer ich künftig sein würde, ohne meine Liebe zu ihm und ohne meinen Hass auf ihn. Beides hatte mich im Leben verankert.
Er hat uns das angetan, zwang ich mich zu denken, bevor Bedauern in mir aufsteigen konnte. Reue war nutzlos. Sie würde weder sein noch mein Leben retten. Seine Entscheidungen haben uns an diesen Punkt geführt, nicht meine.
Aus seiner Kehle drang ein Gurgeln, als würde er an seinem eigenen Speichel ersticken. O Gott, ich würde es nicht ertragen, wenn er mich mit Blut bespuckte. Das wäre zu brutal, zu viel.
»Luke?« Ich beugte mich über ihn, um ihn verstehen zu können. »Was ist?«
Die Steinplatten fühlten sich kalt und hart unter meinen Knien an. Früher hatte ich diesen Boden geliebt. Mir hatte alles an diesem Ferienhaus in den Cotswolds gefallen, von der rustikalen Küche mit den marineblauen Schränken und den massiven Arbeitsplatten aus Eichenholz über den schwarzen AGA-Herd, über dem wir nach Wanderungen in den schlammigen Hügeln unsere Socken trockneten, bis hin zu den Kupferpfannen, die von der Decke hingen. Perfekt durchgestylt, wie alles in Lukes Leben – äußerlich. Sogar die Zimmerpflanzen waren unecht, obwohl man das erst merkte, wenn man sehr nah an sie herantrat und feststellte, dass sie keinen Duft verströmten und die Blätter oder Blüten nicht rissen, wenn man sie zwischen den Fingern rieb.
»Was ist?« Ich streichelte seine Stirn und beugte mich zu ihm. »Luke?«
Seine Lippen waren jetzt dicht an meinem Ohr. Ich rechnete damit, von ihm zu hören, dass er mich immer lieben würde, ganz gleich, was ich getan hatte. Trotz allem, was wir durchgemacht hatten, wusste ich, dass er mich liebte. Er gehörte zu mir und ich zu ihm. Das hatte er mir in den Hügeln, die dieses Haus umgaben, mehr als einmal versprochen. Für ihn gab es nur mich, hatte er gesagt. Zumindest zählte nur ich für ihn. Aber er hatte damals, genau wie immer, gelogen. Uns allen gegenüber. Er hatte uns allen dasselbe erzählt. Und nacheinander hatten wir uns alle in seinem Geflecht von Täuschungen verstrickt. Irgendjemand von uns hatte den Bann brechen müssen.
Meine stummen Tränen tropften in sein dunkles Haar. Was habe ich getan?
»Das Spiel …« Lukes Stimme klang heiser und war kaum lauter als ein Flüstern. Als er hustete, spritzte mir Blut auf die Wange. »Das Spiel ist aus.«
Ja. Aber noch nicht ganz. Als sich seine Lider schlossen, bettete ich seinen Kopf auf den kalten Boden. Ich hatte zu tun.
2
Rebecca
Ich bin schon wach, bevor mein Telefon klingelt und der schrille Ton die frühmorgendliche Stille zerreißt. Als ich in der Dunkelheit danach taste, lässt Jimmy ein vulgäres Schnauben vernehmen und rollt sich herum, ohne die Lider zu öffnen.
»Dance«, melde ich mich und gebe mir keine Mühe, leise zu sprechen. Jimmy ist so gut wie unmöglich zu wecken, erst recht, wenn er so viel getrunken hat wie gestern Abend.
»Willst du tanzen?«, lautet die vorhersehbare Erwiderung. Wie auch alles andere ist ein solcher Scherz um diese Uhrzeit noch weniger lustig als sonst. Ich sehe nach – es ist zwei Uhr fünfundvierzig. Herrje, kein Wunder, dass es noch so dunkel ist.
»Was ist los?«
»Häusliche Messerstecherei. Matthews fährt direkt zum Tatort und will, dass du dort zu ihm stößt.«
»Verdächtige Person in Gewahrsam?«
»Auf dem Weg dorthin.«
»Gut.«
Nachdem er eine Adresse heruntergeleiert hat, lege ich ohne Verabschiedung auf. Ich rolle mich aus dem Bett und stupse Jimmy an. »He. He!«
Als Jimmy endlich reagiert und das linke Auge öffnet, habe ich mir bereits die widerspenstigen dunkelbraunen Locken zurückgebunden, mich gewaschen und angezogen und schlüpfe in meine Stiefel.
»Hm?«
»Zieh dich an«, sage ich zu ihm. »Ich muss zur Arbeit.«
»Wie spät ist es?«, Jimmy reibt sich verwirrt die Augen. Nebenbei bemerkt: Jimmy schaut selten anders als verwirrt drein. »Kann ich nicht einfach hierbleiben, bis es hell wird?«
»Nein. Steh auf.« Ich habe den ersten Stiefel zugeschnürt und beginne mit dem anderen. »Du hast Zeit, bis das Kaffeewasser kocht. Dann bin ich weg, und du bist vor der Tür. Mit oder ohne Hose.«
Ich rühre gerade das dritte Stück Zucker in meinen Kaffee, als Jimmy in der Tür auftaucht, zerzaust und noch im Halbschlaf – aber wenigstens angezogen.
»Wieso kann ich nicht im Bett bleiben und später allein aus dem Haus gehen?«, jammert er. Ich reiche ihm einen Becher mit so starkem Kaffee, dass ein Löffel aufrecht darin stehen könnte. »Ist ja nicht so, als würde ich dir den Fernseher klauen.«
»Kapierst du’s nicht, Jimmy? Ich bin Polizistin. Es geht nicht, dass du dein Zeug von meiner Wohnung aus verhökerst. Und spar dir die Mühe, es zu leugnen«, komme ich seinem Protest zuvor. »Ist mir scheißegal, wenn du in deiner Freizeit ein bisschen Gras vertickst. Ich will nur nicht, dass du’s von meiner bescheidenen Bude aus machst, klar?«
Jimmy grinst. Sein Lächeln ist einer der Gründe, warum ich immer wieder mit diesem nichtsnutzigen Idioten im Bett lande. Er fährt sich durch das dunkle Haar. »Ja, ist klar. Kannst du mich wenigstens nach Hause bringen? Ein hübscher Junge wie ich sollte um diese Zeit nicht allein durch die Straßen gehen.«
»Du bist nicht allein«, erwidere ich, greife mir meinen Schlüsselbund und deute mit dem Kopf zur Tür. »Hast ja dein gewaltiges Ego als Begleiter. Aber könntest du jetzt in die Gänge kommen? Ich will nicht riskieren, dass meine Nachbarn uns zusammen sehen.«
3
Rebecca
Wir erreichen das Cottage in den Cotswolds, bevor sich die Sonne hat blicken lassen. An einem gewöhnlichen Herbsttag würde es noch ein paar Stunden dauern, bis ich ans Aufstehen auch nur denken würde. Wohlig warm würde ich entweder im Bett oder auf dem Sofa liegen, je nachdem, ob ich überhaupt Schlaf gefunden hätte. Jedenfalls würde ich davon träumen, wie ich mit fast dreißig längst Detective Chief Inspector wäre – oder eine erfolgreiche Unternehmerin –, wenn ich nur die Willenskraft besäße, den Hintern sofort aus dem Bett zu schwingen. Und dann joggen zu gehen und dabei irgendwelche Motivationssprüche vor mich hin zu murmeln, dass mein perfekter Tag nur eine Sache der richtigen Einstellung sei, und dann masochistisch kalt zu duschen. Stattdessen schaffe ich es immer – ausnahmslos jeden Morgen –, mir einzureden, ich hätte mir nach der Woche, die hinter mir liegt, zusätzliche zehn Minuten unter der Decke verdient. Wer weiß schon, was an diesem Tag auf mich zukommt? Da ist es am besten, gut ausgeruht zu sein.
Aber heute ist es anders. Mr und Mrs Whitney hatten nämlich nicht den Anstand, ihren Streit zu einer vernünftigen Tageszeit auszutragen. Deshalb gähne ich herzhaft, als wir nach einer vierzigminütigen Fahrt bei ihrem Ferienhaus in den Cotswolds eintreffen. Wenigstens bin ich unterwegs nicht eingeschlafen und habe auf das Autofenster gesabbert.
»Ich lass es lieber jetzt raus«, erkläre ich, als mich mein Detective Chief Inspector – Derek Matthews – mit hochgezogenen Brauen ansieht. »Nicht, dass wir unprofessionell rüberkommen, oder?«
»Gott bewahre«, erwidert er und lässt das Auto mitten auf der Auffahrt stehen. Hoffentlich muss niemand von der Spurensicherung zu einem Notfall, bevor wir fertig sind.
Büsche überwuchern die Fassade des Steinhauses, Efeu rankt sich um die Eingangstür. Aber die Rasenflächen sind makellos – sogar die verwilderten Pflanzen wirken wie bewusst platziert. Für bunte Blütenpracht ist es zu spät im Jahr, und obwohl das Haus ein Nebenwohnsitz ist, hat jemand bereits Herbstdekor angebracht, einen Kranz in Schattierungen von Orange, Grün und Braun an der salbeigrünen Haustür, die ein kleines herzförmiges Fenster hat. Es sieht aus wie auf Fotos in der Zeitschrift Country Home. Kürbisattrappen liegen überall herum. Neben der Eingangstür stapeln sich Holzscheite. Von außen ein rundum idyllisches Ferienhaus ohne den kleinsten Hinweis darauf, was drinnen passiert sein könnte.
Ein uniformierter Kollege kommt uns entgegen. Der Kies knirscht unter seinen schweren Stiefeln. Obwohl er ziemlich jung zu sein scheint, tritt er selbstbewusst auf.
»Sir«, sagt er, schüttelt Derek die Hand und nickt mir zu. »Police Constable Mason Hinds.«
»Womit haben wir’s zu tun?« Dafür, dass Matthews in der Regel kein Morgenmensch und erst recht keine Nachteule ist, wirkt er überraschend frisch und munter. Er hat sogar die Zeit gefunden, sich das dichte graue Haar zu frisieren und sein Hemd in die Hose zu stecken, über einem Wanst, der im vergangenen Jahr zunehmend sichtbarer geworden ist. Der Thermosflasche nach zu urteilen, die er wie den Heiligen Gral in der Hand hält, hat er es geschafft, seine Frau Rita zu wecken, damit sie ihm zum Abschied einen Kaffee kocht. Ich stelle mir vor, wie Jimmy aufsteht, um mir einen Kaffee für die Arbeit zu machen. Schön wär’s. Wieder sehe ich auf die Uhr. Es ist vier Uhr vierzig. Inzwischen wird Jimmy sich in seiner Bude verkrochen haben und frühestens daraus auftauchen, wenn die Uhrzeit im zweistelligen Bereich liegt. Falls noch Zweifel bestehen, Jimmy ist nicht der nächste Tony Robbins – oder wer auch immer bei den Kids heutzutage auf TikTok angesagt ist. Scheiße, er ist nicht mal der nächste Walter White. Jimmy ist wie ein Paar bequemer Pantoffeln, die man nicht wegwerfen will, obwohl sie schon vor Löchern strotzen. Aber man weiß, dass einem irgendwann keine andere Wahl bleibt, als sie zu ersetzen.
Der Police Constable liest aus seinem Notizbuch vor wie von der Speisekarte eines Schnellrestaurants. »43-jähriger Mann namens Luke Whitney, bei Ankunft nach häuslichem Messerangriff tot aufgefunden. Die Ehefrau, Anna Whitney, ist in Gewahrsam. Ein klarer Fall. Das hier ist das Ferienhaus des Ehepaars. Mrs Whitney hat die Polizei gerufen und ausgesagt, dass sie ihren Mann erstochen hat. Als wir eingetroffen sind, war er bereits im Krankenwagen, und sie saß von seinem Blut verschmiert auf dem Boden. Sie hat die Tat nicht geleugnet und ist umgehend verhaftet worden. Seither hat sie nichts mehr gesagt, aber es war sonst niemand auf dem Gelände.«
Matthews hat sichtlich Mühe, nicht aufzustöhnen – häusliche Gewalt ist sein Albtraum und eindeutig nicht das, worauf er gehofft hat. Insgeheim frage ich mich, was für ein Mord für ihn akzeptabel gewesen wäre. Vielleicht will er inzwischen nur noch für bestialisch tötende Serienkiller früh aufstehen. Er nippt an seinem Kaffee, bevor er fragt: »Womit hat sie ihn erstochen?«
»Moment«, werfe ich ein, und mein Dauerstirnrunzeln, das ich mittlerweile wie ein Accessoire trage, vertieft sich. »Wir gehen also davon aus, dass sie die Täterin ist? Was ist mit ›keine voreiligen Schlüsse ziehen‹, Chef?«
Ich merke, dass er sich ein Seufzen verkneift. In unserem Umfeld gelte ich als nervige Klassenstreberin, die immer die Hand hebt und den Lehrer daran erinnert, dass er vergessen hat, Hausaufgaben aufzugeben. Wenn ich auf einen vermeintlich klaren Fall stoße, bin ich geradezu zwanghaft der Sand im Getriebe, das ewige Haar in der Suppe.
»Na schön, ich ziehe keine voreiligen Schlüsse. Warten wir ab, was Jack zu sagen hat.«
»Zwei Autos in der Einfahrt«, merke ich an und notiere mir die Kennzeichen. »Meinst du, sie sind getrennt angereist?«
»Vielleicht hatte sie vor, sich aus dem Staub zu machen, nachdem sie ihn um die Ecke gebracht hatte«, brummt Matthews.
»Aber sie hat sich dafür entschieden, die Polizei anzurufen und sich zu stellen.«
An der Eingangstür werden wir in Empfang genommen und mit unseren Strampelanzügen ausgestattet. Fast sofort stößt Jack Brady zu uns, einer der besten Tatortleiter, mit denen ich je zusammengearbeitet habe. Es gibt keine neue Technologie, Testmethode oder Theorie, über die Jack nicht bereits Monate vor ihrer Veröffentlichung Bescheid weiß.
»Jack, hast du den Fall schon gelöst?«, fragt Derek und nickt ihm freundlich zu.
Jack runzelt die Stirn. »Merkwürdige Geschichte hier. Du wirst sie lieben.« Er dreht sich mir zu und senkt die Stimme. »Wird er nicht. Aber du wahrscheinlich.«
»Inwiefern merkwürdig?« Derek wirft mir einen finsteren Blick zu, als wäre es meine Schuld, dass die Beweismittel, die ich noch nicht mal gesehen habe, unserem besten Tatortleiter rätselhaft sind.
»Sag nichts«, bitte ich ihn schnell. »Ich muss es unvoreingenommen angehen.«
Wir betreten die Diele, die ebenfalls vor Hochglanzperfektion strotzt. Links eine dunkle Holzkommode, darauf drei gerahmte Fotos von Luke und Anna Whitney. Auf allen lachen sie in die Kamera oder lächeln einander an, jeweils vor einem imposanten Hintergrund – ein Strand, ein Berg, das Haus, in dem wir uns befinden. Anna ist wunderschön, Luke eine Augenweide – wüsste ich nicht, wer diese Leute sind, würde ich denken, die Fotos wären schon beim Kauf in den Rahmen gewesen.
An der Wand rechts sind vier Kleiderhaken, allerdings hängen daran nur eine wasserdichte Jacke und zwei Schals. Neben zwei Paar sauberen Gummistiefeln lehnt ein Regenschirm.
»Ich komme also rein«, sage ich zu Matthews und mache demonstrativ einen Schritt nach vorn. »Und ich hänge meine Jacke an den Haken. Aber von Anna ist keine da.«
»Vielleicht ist sie nicht so ordentlich wie du«, erwidert Matthews.
Hätte er meine Wohnung schon mal gesehen, wüsste er, wie lächerlich diese Äußerung ist. Aber gut, vielleicht hat Anna ihre Jacke nicht gleich nach dem Reinkommen ausgezogen. Vielleicht hängt sie über einem der Küchenstühle oder in einer speziellen Garderobe, wie vornehme Leute sie haben. Menschen verhalten sich nicht immer so, wie man es erwarten würde, das ist mir klar.
»Okay, sie hat die Jacke also noch an. Es ist schon die ganze Woche eiskalt – sie muss eine Jacke getragen haben.«
Wir kennen den genauen Ablauf der Ereignisse des vergangenen Abends noch nicht, haben keine Ahnung, ob Anna und Luke direkt in die Küche oder erst nach oben gegangen sind, um Sex zu haben. Vielleicht haben sie auch bis fünfzehn Minuten vor dem Mord zusammen ferngesehen. Derek Matthews wollte sofort zum Tatort, nachdem wir erfahren hatten, dass die Spurensicherung schon da war, noch bevor wir mit Anna gesprochen hatten. Wir haben nur vierundzwanzig Stunden Zeit, um sie entweder anzuklagen oder freizulassen. Entscheidend dabei ist, zu überprüfen, ob die Hinweise am Tatort zu dem passen, was sie uns erzählt.
Der Großteil der Aktivitäten konzentriert sich auf die Küche, wo Luke gefunden wurde. Matthews zeigt in die Richtung.
»Kann ich’s jetzt sagen?« Brady klingt wie ein ungeduldiges Kind, das es nicht erwarten kann, seine Weihnachtsgeschenke auszupacken.
»Na gut«, erwidere ich. »Nur nicht zu schnell, sonst verwirrst du den Boss.«
»Spielverderberin«, brummelt er. »Aber gut. Kann ich mit der Mordwaffe anfangen?«
Er führt uns zu einem Haufen Glasscherben am Boden. Auf der Kücheninsel liegt eingetütet der abgebrochene Hals einer Flasche Budweiser. Er hebt die Tüte an einer Ecke hoch und hält sie zur Begutachtung vor uns.
»Was sehe ich da?«, fragt Matthews. »Und sag jetzt nicht, eine kaputte Flasche Bud – so schlau bin ich selbst.«
»Ich kann dir sagen, was du nicht siehst«, antwortet Brady. »Fingerabdrücke. Es ist kein einziger drauf. Natürlich wird die Flasche noch gründlich analysiert, aber ich erkenne eine gesäuberte Mordwaffe, wenn ich eine sehe.«
»Da ist doch Blut auf dem abgebrochenen Ende.«
»Ding-Dong!« Dass niemand auch nur von seiner Tätigkeit aufschaut, als Jack seinen albernen Laut von sich gibt, zeigt, wie sehr das Team an ihn gewöhnt ist. »Es wurden also nur die Abdrücke beseitigt. Man hat nicht versucht, die Waffe zu verstecken, sondern nur, die Identifikation zu verhindern. Dasselbe gilt für das Telefon.«
»Das Telefon?«
»Das Festnetztelefon wurde sauber gewischt.«
Ich ziehe die Augenbrauen hoch. »Oh. Interessant.«
»Interessant, klar«, wirft Matthews barsch ein. »Sie wählt den Notruf, um den Mord zu gestehen, und wischt dann ihre Fingerabdrücke vom Telefon und der Mordwaffe? Was soll das?«
»Vielleicht hat sie gewusst, dass ein Geständnis nicht ausreicht, um sie zu verurteilen«, schlägt Brady vor.
»Warum dann überhaupt ein Geständnis? Sie war voll von seinem Blut, und niemand sonst war hier.« Matthews seufzt. »Weiter, was noch?«
»Geh und wirf einen Blick ins Spülbecken.«
Matthews stürmt geradezu hin und späht hinein. »Was ist damit?«
»Verdammt, Boss, es riecht wie ’ne Weinbar«, bemerke ich stöhnend. »Da hat jemand mindestens eine Flasche Wein reingekippt.«
»Vielleicht schmeckt edler Wein beschissen.«
»Oder jemand wollte betrunkener rüberkommen, als er in Wirklichkeit war«, meint Brady.
»Ich glaube, das weiß er«, flüstere ich, bevor Matthews ausrasten kann. Er kann schon meine vorlauten Bemerkungen nur mit Mühe ertragen – zu zweit laufen wir Gefahr, ihn ernsthaft zu verärgern.
Ich schaue nach unten, um nicht neben die silbrigen Bodenplatten zu treten, die um die Tatortkennzeichnungen herum platziert worden sind. Dabei entdecke ich einen blutigen Fußabdruck.
»Äh, Jack?«
Ich zeige darauf, und er nickt.
»Darauf wollte ich gerade kommen. Wir haben Größe fünfundvierzig gemessen. Das einzige Schuhwerk des Opfers, das wir gefunden haben, ist ein Paar Gummistiefel in Größe siebenundvierzig an der Tür.«
»Sonst keine Schuhe vom Opfer?«, hake ich nach. »Merkwürdig. Also glaubst du, wir haben es mit einem männlichen Unbekannten am Tatort zu tun?«
Jack nickt. Er hatte recht, das ist ein interessanter Tatort. Leider scheint er mehr Fragen aufzuwerfen als Antworten zu bieten, und das kann Matthews nicht ausstehen. Ihm ist alles zuwider, was nicht ordentlich zusammenpasst. Und vorläufig ergibt hier gar nichts einen Sinn. Außer für mich. Mir ist sonnenklar, was los ist, denn ich wusste schon in dem Moment, als ich reingekommen bin, dass dieser Tatort inszeniert ist.
4
Anna
Wenn ich mir früher The Bill angesehen habe, ging mir immer durch den Kopf, wie unbequem Arrestzellen aussehen. Ich habe mich gefragt, wie Gefangene auf diesen schmalen, harten Pritschen schlafen und stundenlang dieselben kahlen Mauern anstarren können. Jetzt weiß ich es. Natürlich hat man keine andere Wahl. Die Polizei interessiert es nicht, dass jemand noch nie unbequemer untergebracht war als in einem Marriott Hotel oder dass jemand von einer harten Matratze Nackenschmerzen bekommt. Aber eigentlich spielt nichts davon wirklich eine Rolle. Wenn man in einer solchen Zelle landet, sind einem die Dinge bereits entglitten. Was würde eine bequeme Matratze daran ändern, dass mein Ehemann meinetwegen tot ist? Würden ein Frühstücksbuffet und ein Bademantel aufwiegen, dass ich den Rest meines Lebens allein verbringen werde?
Und doch fühle ich mich überraschend abgestumpft. Am seltsamsten finde ich, dass ich mich nicht mal fürchte. Hätte mich irgendwann in meinem Leben jemand gefragt, wie verängstigt ich wohl wäre, wenn ich unter Mordverdacht in einer Zelle säße, hätte ich geantwortet, eine umfassende Panikattacke samt Zittern am ganzen Leib und Erbrechen zu erwarten. Und jetzt bin ich hier, starre auf die dreckige Wand und empfinde gar nichts. Vielleicht liegt es am Schock. Kann man unter Schock in vollständigen Sätzen denken? Oder vielleicht bin ich einfach nur froh, dass es vorbei ist. Ich muss nicht mehr über alles rätseln, was mein Ehemann tut, jedes seiner Worte analysieren und darauf warten, dass er mir den Boden unter den Füßen wegreißt, wie er es bei Rose gemacht hat. Ich habe mich für so viel schlauer, so viel besser als sie gehalten. Ist das nicht witzig? Für mich war sie immer eine hirnlose Tussi, die nicht die Weitsicht oder den Verstand hatte, um einen Mann wie Luke zu halten. Tatsache ist, dass Männer wie Luke immer die Oberhand behalten, denn, ob es uns gefällt oder nicht, unter dem Strich läuft es stets auf Geld hinaus. Man heiratet anständig und denkt, man wäre finanziell abgesichert. Nur gibt es keine finanzielle Sicherheit, wenn man von jemandem abhängig ist. Die Dynamik ändert sich, wenn einer der Partner das gesamte Einkommenspotenzial besitzt. Derjenige, der die Hand nach Almosen ausstreckt, sieht dann jeden Streit, jede Meinungsverschiedenheit anders, misst solchen Dingen mehr Gewicht bei. Und am Ende steckt man zurück. Denn auch, wenn es dem anderen vielleicht nicht bewusst ist, hat man stets im Hinterkopf, wie leicht man abserviert werden könnte, wie unbekümmert er die letzte Ehe hinter sich gelassen hat, ohne je zurückzuschauen. Rückblickend denke ich, dass Luke deshalb nie Kinder wollte. Jeder weiß, dass Kinder den Frauen eine gewisse Macht verleihen – natürlich müssen Väter für ihren Nachwuchs aufkommen. Ohne Kind ist eine Hausfrau entbehrlich. Gut, man kann eine angemessene Abfindung vereinbaren. Aber mit einer einmaligen Zahlung kann jemand, der jahrelang nicht gearbeitet, sondern zu Hause gekocht und gebügelt hat, keine großen Sprünge machen, oder? Doch ich schweife ab. Liegt wohl am Schock. Oder vielleicht stimmt es, wie man mich einschätzt – vielleicht habe ich wirklich den Verstand verloren.
Aber zum ersten Mal seit langer Zeit kann ich wieder frei atmen. Ich muss nicht mehr meine nächsten Schritte planen oder die von Luke vorhersehen. Natürlich kämpfe ich jetzt um meine Freiheit, allerdings möchte ein gar nicht so kleiner Teil von mir, dass man sie mir entzieht. Dass man mich einsperrt, mir meine Pflichten nimmt. Dann müsste ich mich den Rest meines Lebens nicht mehr darum scheren, was die hochnäsigen Arschlöcher im Golfklub über mich denken. Man würde mich im Handumdrehen vergessen. Eine Zeitlang wäre ich vielleicht noch eine Anekdote nach dem Abendessen, letztlich jedoch niemand mehr. Ein Geist. Allein den Gedanken finde ich ziemlich ansprechend.
Wie bin ich hier gelandet? Wer uns vor sechs Monaten gesehen hat, hätte gedacht, dass uns die Welt zu Füßen liegt. Jetzt habe ich genug Zeit, um die ganze Geschichte zu erzählen. Eine Geschichte über Verrat, Mord und die Spielchen, die wir mit Menschen treiben, die wir lieben. Allerdings ist die Warnung angebracht, dass ich nur eine Seite der Geschichte erzählen kann. Und wie man weiß, gibt es immer drei Seiten. Seine, meine und die Wahrheit.
-
Das erste Mal sah ich Luke und Rose Whitney an einem Freitagabend Anfang Oktober vor sieben Jahren. Damals war ich achtundzwanzig. Tagsüber arbeitete ich als Sekretärin, abends übernahm ich die Nachtschicht im Benicio’s, einem gehobenen Restaurant in Faringdon, um genug für die Anzahlung für eine eigene Wohnung zusammenzusparen. Nach dem Tod meines Vaters war sein Vermieter so nett gewesen, mich seinen Mietvertrag übernehmen zu lassen. Jeden Morgen bereitete ich mir mein Frühstück in der Küche zu, in der sich mein Dad das Leben genommen hatte. Dabei fühlte ich mich ziemlich elend. Ich arbeitete nicht zuletzt deshalb so viel, weil ich nicht zu Hause sein wollte. Was den Nebeneffekt hatte, dass ich allmählich genug Geld zusammenbekam, um bald den Ort meiner Kindheit und die beschissenen Erinnerungen hinter mir lassen zu können. Abgesehen davon mochte ich es, Leute zu bedienen. Ich betrachtete es weniger als Job, sondern mehr wie ein Spiel. Als wäre ich noch eine Sechsjährige, die spielt, sie müsse eine Uniform tragen und von links servieren und von rechts abräumen. Ich war gut darin, im Wesentlichen unsichtbar für die Gäste zu bleiben, die schnell ihr Essen bekommen wollten, ohne bei ihren Gesprächen gestört zu werden. Ich vergaß nie, wer was bestellt hatte. Wenn ich Teller zu einem Tisch gebracht oder Wein eingeschenkt hatte, musste mich nie jemand zurückrufen, um sich zu beschweren. Die Köche mochten mich. Manchmal ließen sie mich die Desserts anrichten, und sie gaben mir immer eine Mahlzeit mit nach Hause. Das taten sie nicht für jeden.
Damit zeichne ich wohl nicht gerade ein Bild von Reichtum und Privilegien, wie man es bei einer Frau mit einem Ferienhaus in den Cotswolds erwarten würde, auch wenn man ihr Mord vorwirft. Tatsache ist, dass ich vor meiner Begegnung mit Luke eine Frau auf dem Weg ins Nirgendwo war, eine, die sich vergeblich abstrampelte, wie mein Vater es ausgedrückt hätte. Im Nachhinein habe ich mich oft gefragt, was Dad von Luke gehalten hätte. Wäre er genauso von ihm eingenommen gewesen wie alle anderen? Hätte er mich dazu beglückwünscht, wie gut ich es getroffen hätte? Als wären Schweiß, Blut und Tränen nötig gewesen, um mir einen wohlhabenden Chirurgen zu angeln und meine finanzielle Zukunft zu sichern, statt bloß zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein?
Die Wahrheit lautet, dass weder ein Liebesblitz noch Amors Pfeil eingeschlagen hat, als ich Luke Whitney zum ersten Mal sah. Von Liebe auf den ersten Blick keine Spur, zumindest nicht bei mir. Allerdings ist mir später klar geworden, dass etwas an mir etwas in ihm ausgelöst hat. Ich habe nie ganz verstanden, was genau. Jedenfalls hat er an jenem ersten Abend wohl beschlossen, dass er mich wollte. Und wie immer in seinem Leben war er fest davon überzeugt, dass er bekommen würde, was er wollte. Wäre ich damals ein bisschen welterfahrener gewesen, hätte ich vielleicht frühzeitig erkannt, was er vorhatte. Dann wären bestimmte Dinge womöglich anders gelaufen. Mein gesamtes Leben hätte sich anders entwickelt, denn auch, wenn Rose es abstreiten würde – was mir egal ist –, steht eines fest: Ich hatte nie auch nur eine Sekunde lang die Absicht, mir ihren Ehemann zu krallen. Oder sonst irgendeinen verheirateten Mann. Sie kennt mich nicht, sonst wüsste sie, warum; obwohl es wohl kaum viel daran ändern würde, wie sie über mich denkt. Sie wird mich immer hassen, und ich kann ihr nicht einmal wirklich einen Vorwurf daraus machen.
An jenem Freitag war das Benicio’s rappelvoll, wie wir es nannten, wenn sämtliche Tische besetzt waren. In der Küche ging es besonders heiß und laut her, und der Küchenchef hatte üble Laune, sogar mir gegenüber, die er sonst ausgesprochen freundlich behandelte. Ich sehnte mich danach, mich nach draußen davonzustehlen und eine zu rauchen, doch wir waren im Service nur zu viert, Abby, Ellen, Tom und ich. Keine Chance auf eine Pause in absehbarer Zeit. Zwei Leute waren einfach nicht zur Arbeit erschienen, und es hatte sich niemand gefunden, der an einem Freitagabend in letzter Minute einspringen konnte. Die Idioten waren nicht mal ans Telefon gegangen. Also gaben wir vier unser Bestes – oder eher drei von uns. Abby stellte sich wie üblich dumm an, verwechselte Tischnummern, benutzte auf den Bons ihre eigenen statt der vereinbarten Kürzel und ließ Brötchen fallen, die wie winzige Bowlingkugeln durch den Saal kullerten. Meinen künftigen Ehemann sah ich zum ersten Mal, als ich seiner damaligen Frau eine Mahlzeit servierte, die sie hätte umbringen können.
»Äh, ist da Sojasoße drin?«
Ich hatte mich bereits von dem Tisch abgewandt und schaute zurück zu der Frau, von der die Frage kam, beachtete sie zum ersten Mal richtig. Dabei sprang mir auf Anhieb ins Auge, wie unnatürlich sie wirkte. Nicht unattraktiv – im Gegenteil. Etliche Männer hätten sie bestimmt unglaublich anziehend gefunden. Nur schien jedes bisschen ihrer Schönheit gekauft zu sein. Am auffallendsten an ihr war das chemisch gefärbte und geglättete platinblonde Haar. Es umrahmte ein faltenfreies Gesicht. Durch ihre zu perfekten Bögen gezupften Brauen wirkte ihre Miene permanent verdrossen – doch in dem Moment war sie tatsächlich stinksauer. Gedanklich hakte ich die Behandlungen ab, denen sie sich mit Sicherheit unterzogen hatte, während ihre Stimme mit jedem ihrer Sätze um eine Oktave anstieg.
Botox, eindeutig …
»Ich habe dieser verpeilten Kuh, die unsere Bestellung aufgenommen hat, klipp und klar gesagt, dass ich allergisch gegen Soja bin.«
Aufgespritzte Lippen, keine Frage …
»Ich habe gemerkt, dass sie mir nicht zugehört hat. Deshalb habe ich es extra wiederholt …«
Brustimplantate? Wahrscheinlich, aber es wäre zweifellos unhöflich gewesen, einen direkten Blick zu wagen, wo die arme Frau dem Tod doch gerade so nah gekommen war. Nun, da ich ihr zuhörte, war ich mir beinah sicher, dass Abby das Soja absichtlich nicht weggelassen hatte.
»Es tut mir so, so leid«, fiel ich ihr ins Wort, als sie für meinen Geschmack genug geredet hatte, und nahm den Teller. »Ich lasse beide Gerichte neu zubereiten und kümmere mich darum, dass Ihnen nichts dafür berechnet wird. Bitte nehmen Sie unsere aufrichtige Entschuldigung an.«
»Ehrlich gesagt, bin ich mir nicht sicher, ob mir Ihre aufrichtige Entschuldigung reicht …«
»Rose, bitte«, fiel ihr Mann ihr ins Wort, bevor sie wieder in Fahrt kommen konnte. Ihn hatte ich gar nicht beachtet, während ich seine Frau gemustert hatte. Als ich es jetzt tat, stellte ich fest, dass er auf wesentlich natürlichere Weise attraktiv war – auf die Art »wie guter Wein gereift«, sodass sich selbst eine Frau noch nicht einmal mittleren Alters neben ihm alt und schäbig vorkommen musste. Er sah aus wie Ende dreißig, also war sie das vermutlich auch, aber was sie an sich hatte machen lassen, ließ sie leider sechs bis sieben Jahre älter wirken. Ihn dagegen machten die Lachfältchen und das an den Schläfen ergrauende dunkle Haar nur noch heißer. »Ich wüsste nicht, was sie noch tun könnte, außer sich zu entschuldigen und uns die Rechnung zu erlassen«, sagte er zu ihr. »Du hast nicht davon gegessen, wirst nicht sterben, also ist nichts passiert.«
Er ließ ein herzliches Lächeln in meine Richtung aufblitzen. Es wirkte zugleich entschuldigend und vermittelte, dass er nur allzu gut wusste, wie seine Frau sein konnte. Ich hatte den Eindruck, dass er nicht zum ersten Mal nach einer ihrer Schimpftiraden die Wogen glätten musste. Der Arme.
»Entschuldigung noch mal.« Bevor die Frau erneut loslegen konnte, eilte ich mit den Tellern davon.
»Die hier sind unbrauchbar.« Ich hielt dem Küchenchef die beiden Teller hin, bevor ich das Essen in den Mülleimer kippte. »Bestellung 464. Die Frau ist allergisch gegen Soja.«
»Und warum hat die dämliche Kuh das nicht schon beim Bestellen erwähnt? Wir sind hier kein beschissenes McDonald’s, wo der Fraß vom Fließband kommt.«
Ich bemühte mich, angesichts seiner Wortwahl keine Miene zu verziehen, und zuckte mit den Schultern. »Keine Ahnung. Muss sie wohl vergessen haben.«
Eine Stunde später, als es ein wenig ruhiger zuging, nahm ich Abby beiseite. »Du hättest um ein Haar einen Gast umgebracht«, zischte ich. »Hör in Zukunft hin, wenn jemand das Wort ›allergisch‹ benutzt, ja?«
Wie üblich schaute Abby zerknirscht drein. »Mist, tut mir leid, Anna. Was soll ich jetzt machen?«
Ich schüttelte den Kopf. »Keine Sorge, diesmal hab ich es geregelt. Nur sei vorsichtiger, okay, Abs? Und spring mal eben zehn Minuten für mich ein, während ich eine rauchen gehe.«
Abby nickte. »Kein Problem.«
Als ich an der Kasse vorbeiging, leerte ich das Trinkgeldglas und zählte die Scheine und Münzen zusammen. Es waren knapp vierhundertfünfzig Pfund. Das war ein Vorteil daran, in einem solchen Lokal zu arbeiten – die Gäste erwarteten zwar vom Service eine höhere Qualität, aber wenn er ihre Erwartungen erfüllte, belohnten sie ihn mit großzügigem Trinkgeld. Und trotz Abbys gelegentlichen Patzern bekamen sie in der Regel, was sie wollten. Ich nahm mir meinen Anteil, legte ihn schweren Herzens in die Kasse und buchte die Rechnung für Bestellung 464 aus, bevor ich meine schwarze Schürze ablegte und für eine Zigarettenpause durch den Notausgang hinaushuschte. Verdammt. Über hundert Pfund für meinen Fluchtfonds waren flöten gegangen. Aber Abby hatte nur diesen einen Job, und sie brauchte das Geld entschieden dringender als ich.
Während ich den Rauch tief einatmete, schloss ich die Augen und stellte mir die heiße Dusche vor, die ich mir in wenigen Stunden genehmigen würde. Ich würde mir den Essensgeruch vom Leib waschen und die von der körperlichen Arbeit angespannten Muskeln lockern. Und da der Samstag vor der Tür stand, würde ich ausschlafen können, vielleicht sogar …
»Entschuldigung …«
Beim Klang der männlichen Stimme riss ich die Augen wieder auf. Es war nicht wirklich verboten, für eine Zigarettenpause nach draußen zu gehen – die meisten Manager rauchten selbst und sahen darüber hinweg, um nicht selbst darauf verzichten zu müssen. Dennoch ließ die unerwartete Gesellschaft jähe Schuldgefühle in mir aufflammen. Ich brauchte einige Sekunden, um den super attraktiven Ehemann der Allergikerin zu erkennen.
»Tut mir leid, stimmt wieder etwas nicht?« Ich bemühte mich, nicht allzu irritiert zu klingen, aber es war praktisch unübersehbar, dass ich Pause hatte, weil ich eingepfercht zwischen zwei Mülltonnen stand und qualmte. War er mir nach draußen gefolgt, um sich erneut zu beschweren?
»Doch, alles in Ordnung.« Er hielt mir ein paar zusammengefaltete Geldscheine hin. Sie sahen nach Zwanzig-Pfund-Noten aus, und nach mehr als nötig. »Als ich Ihrem Manager für den effektiven Umgang mit unserem Missverständnis danken wollte, hatte er keine Ahnung, wovon ich rede. Er schien zu denken, wir hätten unsere Rechnung selbst beglichen.«
O Gott. Wenn Pete herausfand, dass Abby schon wieder Mist gebaut hatte, würde er sie diesmal vielleicht wirklich feuern. Vor allem bei einem Fehler mit Allergien, was im Service – aus gutem Grund – als Kardinalsünde galt. Ich seufzte. »Was haben Sie ihm gesagt?«
»Ich habe mich entschuldigt und vermutet, dass meine Frau bezahlt hat, während ich auf der Toilette war.«
Erleichtert atmete ich aus. »Abby hatte schon ihre letzte Warnung«, erklärte ich ihm. »Sie kann nichts dafür, ist einfach schusselig, aber harmlos. Na ja, abgesehen davon, dass sie Ihre Frau fast umgebracht hätte. Das tut mir aufrichtig leid.«
Ich stieß mich von der Wand ab und klopfte mir den Staub von der Kleidung. Plötzlich wurde mir nur allzu bewusst, wie attraktiv Mr Soja-Allergie war, und ich hoffte, dass ich nicht nach Müll roch.
Er grinste. »Zerbrechen Sie sich nicht weiter den Kopf darüber. Sie ist zwar leicht allergisch, aber nicht annähernd so sehr, wie sie es gern darstellt. Ein, zwei Tage lang ein kleiner Ausschlag, und damit hat es sich. Die Stimme verliert sie leider nicht.«
Ich lächelte höflich, wollte mich nicht in einen häuslichen Zwist hineinziehen lassen. Er hielt immer noch die Zwanzig-Pfund-Noten in der Hand und streckte sie mir entgegen.
»Hier. Es wäre mir entsetzlich unangenehm, wenn Sie für unser Essen bezahlen – es hat fantastisch geschmeckt, und es war noch nicht mal Ihr Fehler. Sie wollen mir doch keine schlaflosen Nächte bereiten, oder?«
Ich bin auch nur ein Mensch, deshalb nahm ich das Geld an. Dabei ertappte ich mich bei dem Gedanken, dass ich nichts dagegen hätte, Mr Allergie ein paar schlaflose Nächte zu bereiten.
Danach vergaß ich ihn fast sofort wieder. Sicher, er sah gut aus, aber das Restaurant wurde von etlichen attraktiven älteren Männern besucht. Natürlich habe ich später, wenn wir uns gegenseitig Geschichten über unsere Anfangszeit erzählten, immer behauptet, ich hätte ihn wochenlang nicht aus dem Kopf bekommen. Wer will schon hören, dass kaum ein zweiter Gedanke an ihn verschwendet wurde? Es hatte nichts mit ihm persönlich zu tun, ich hatte zwei Jobs, die mich vereinnahmten, und wenn ich Gelegenheitssex brauchte – was eigentlich nicht oft vorkam –, holte ich ihn mir von Dan, meinem Ex, den ich irgendwie nicht loswurde. Mir ist bewusst, dass ich mich wiederhole, aber ich hatte wirklich nicht vor, ihn Rose auszuspannen – ich ahnte nicht einmal, dass ich ein besseres Leben wollte, bis Luke mir einen Vorgeschmack darauf bot. Ein solches Dasein, mit »Ja, Ma’am« und »Wie kann ich zu Diensten sein?« von allen Seiten, ist wie eine Droge. Eine Kostprobe, und ich war süchtig danach. Ich hatte keine Chance.
Auch wenn die Zeitungen es anders darstellen werden. Ich weiß, in welches Licht man mich rücken wird – in ein blutrotes. Für die Welt werde ich die »andere Frau« sein, die Rose Whitney zuerst den Ehemann gestohlen und ihn dann umgebracht hat. Ich kann mir schon vorstellen, wie Rose die Möglichkeiten der Publicity ausschlachten wird – »Mordverdächtige hat unsere Ehe zerstört«. Beim Gedanken an ihr bepinseltes Gesicht und ihr gebleichtes Haar kommt mir das Kotzen. Nur ist meine Zelle ziemlich klein. Der Gestank wäre unerträglich. Wie zum Teufel bin ich hier gelandet? Wie konnte ich es so weit kommen lassen? Habe ich den größten Fehler meines Lebens begangen?
5
Rebecca
Mir ist bewusst, dass ich auf dem Rückweg von den Cotswolds zum Polizeirevier Oxford ungewöhnlich still bin. Mittlerweile habe ich gelernt, Matthews meine Theorien nicht um die Ohren zu hauen, bevor er seinen vierten Kaffee hatte, und im Moment habe ich ohnehin nichts Handfestes, um meinen Verdacht zu untermauern. Wenigstens habe ich gemerkt, dass Jack meine Meinung teilt – mit dem Tatort stimmt etwas nicht. Jetzt muss ich nur Matthews zu derselben Schlussfolgerung bringen.
»Mrs Whitney ist in Zelle drei«, informiert uns der Beamte am Empfang, als wir eintreten. »Ihr Anwalt ist unterwegs. Er reist aus der Londoner Innenstadt an.«
Ich werfe einen Blick auf die Uhr. Er wird mindestens eine Stunde brauchen. »Können Sie uns bitte ein Transkript des Notrufs besorgen, während wir warten?«
Der Officer schaut zu DCI Matthews, der dazu nur vage nickt, als wolle er sagen: Tun Sie ihr den Gefallen. Ich beiße mir auf die Unterlippe, als ich wieder mal zu spät erkenne, dass ich solche Anweisungen eigentlich dem Boss überlassen sollte.
Da ich neugierig auf unsere Verdächtige bin, werfe ich im Vorbeigehen einen Blick durch den Beobachtungsschlitz in der Zellentür von Anna Whitney. Die Frau sieht aus, als wäre sie für Halloween kostümiert. Ihr langes, aschblondes Haar ist zu blutigen Strähnen verklumpt, ihr Kaschmirpulli ist so voller Blut, dass man kaum erkennen kann, dass er einmal pastellblau war. Stocksteif sitzt sie da, starrt die Wand an und rührt sich auch nicht, als ich die Abdeckung wieder vor den Schlitz ziehe. Schockzustand, vermute ich. Tja, wenn sie jetzt schon unter Schock steht, dürfte ihr nicht gefallen, was als Nächstes ansteht. Man wird ihr die Kleidung abnehmen und ihren Körper abtupfen, um sie auf Abwehrverletzungen zu untersuchen. Danach beginnt das Verhör. Der eigentliche Schock steht Mrs Whitney noch bevor.
Wir gehen in die Kantine, um uns mit Kaffee zu versorgen, während wir auf die Ankunft des Anwalts warten. Es ist gerade erst sieben Uhr morgens. Der Mann wird aus dem Bett gezerrt worden sein, musste wahrscheinlich noch duschen, seine Morgenroutine erledigen – Anwälte machen so was, schinden gern Zeit, lassen einen warten. Es ist immer dasselbe, aber im großen Ganzen spielt es kaum eine Rolle, wir werden mühelos eine Verlängerung bekommen. Deshalb bin ich doch ziemlich überrascht, als wir noch kaum unsere Becher aufgefüllt haben und das junge, beflissene Gesicht von Police Constable Fellows vor uns auftaucht. Er ist ein netter Bursche und werdender Familienvater. Früher hat er aus dem Wohnzimmer seiner Großmutter gefälschten Designerkram verhökert, bis seine Schwester unschuldig in eine Schießerei zweier Gangs geraten ist. Da hat er beschlossen, Polizist zu werden. Natürlich habe ich auf dem Revier niemandem von der gefälschten Ware erzählt. Oder wie viel davon ich bei ihm gekauft habe. »Entschuldigen Sie die Störung. Mrs Whitneys Anwalt ist hier.«
Ich sehe Derek an, und er zieht die Augenbrauen hoch. »Dann mal los, Dance. Und vielleicht lässt du mich auch mal zu Wort kommen, ja?«
Anna schaut auf, als Derek und ich zusammen den Verhörraum betreten. Ihr Gesicht ist aschfahl, die grünen Augen sind gerötet. Ihr Haar klebt am Kopf, verkrustet vom Blut ihres Ehemanns. Jetzt trägt sie einen hellrosa Pullover und schwarze Leggings – anscheinend ist ihr Anwalt so teuer, dass sein Honorar mit einschließt, seiner Mandantin um sieben Uhr morgens Designerkleidung zu bringen. Eine solche Vorzugsbehandlung habe ich bisher nur bei einem einzigen Verdächtigen erlebt, und der war Boss eines Drogenkartells. Allerdings können die schicken Klamotten ihr Aussehen kaum verbessern, und abgesehen von den Blutschlieren ist sie blass und hat verquollene Augen. Ich schiebe mir eine verirrte Strähne meines dunkelbraunen Haars hinters Ohr und fühle mich neben Mrs Whitney geradezu glanzvoll – obwohl mir klar ist, dass das gestern noch völlig anders gewesen wäre. Sie wirkt mitleiderregend jung und verletzlich. Außerdem fällt mir auf, dass sie für die Ehefrau eines Schönheitschirurgen unglaublich natürlich aussieht. Obwohl Anna Whitneys Mann tot ist und sie wegen Mordverdachts verhaftet wurde, macht sie einen gefassten Eindruck. Eine dieser Frauen, die sich immer im Griff haben, hätte meine Mutter gesagt. Es könnte an ihrem Schockzustand liegen, doch aus irgendeinem Grund kann ich mir bei dieser Frau keinen Gewaltausbruch vorstellen – oder sonst irgendeinen Ausbruch von Emotionen.
»Hallo, Anna.« Ich setze mich der Verdächtigen gegenüber. Derek nimmt zu meiner Linken Platz. Er sieht Anna Whitney an, als wäre sie bereits verurteilt worden. »Hat man Sie über Ihre Rechte aufgeklärt?«
Ein kaum merkliches Nicken von ihr. Der Kopf bleibt gesenkt.
Annas Anwalt, ein unglaublich großer, dünner Mann mit einer Stimme, die für seine Statur zu tief klingt, ergreift das Wort. Ich bin ihm noch nie begegnet – die meisten unserer üblichen Verdächtigen können sich die Kanzlei, für die er arbeitet, nicht leisten. Er heißt Patrick Tate. »Ich sollte Ihnen wohl mitteilen, dass ich meiner Mandantin geraten habe, sich nicht zu äußern, bis sich ihr emotionaler Zustand gebessert hat.«
»Oder bis Sie Zeit hatten, ihr einzutrichtern, was sie sagen soll«, brummelt Matthews.
»Das ist nicht nötig. Zu schweigen, meine ich«, sagt Anna leise, sieht Derek an und meidet meinen Blick. Es wirkt beinah, als würde sie ihn anflehen, ihr zu glauben. Vielleicht denkt sie, bei einem Mann damit erfolgreicher zu sein. »Ich habe Ihren Kollegen schon gesagt, dass ich es war. Ich habe es getan.«
»Diese Aussage hat meine Mandantin ohne den ihr zustehenden Rechtsbeistand und noch vor der Belehrung über ihre Rechte getätigt. Ich werde beantragen, sie als Beweismittel nicht gelten zu lassen«, wirft Tate mit monotoner Stimme ein.
»Und wiederholen Sie diese Aussage jetzt, Anna? Nachdem Sie einen Rechtsbeistand bekommen haben und umfassend über Ihre Rechte aufgeklärt wurden?« Derek sieht unablässig Tate an, während er redet. Anna hingegen ignoriert ihren Anwalt, der sich demonstrativ räuspert.
»Ja«, sagt sie schnell, bevor Tate das Wort ergreifen kann. Sein Pokerface verrät zwar nichts, aber ich weiß, dass er stinkwütend ist. Kein Kommentar