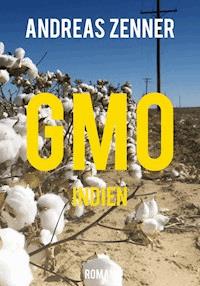9,49 €
Mehr erfahren.
Im 18. Jahrhundert lernen sich Rachel und Horatio Bamforth auf Madagaskar kennen. Sie ist als reiche Witwe eine gute Partie für Horatio und kurz entschlossen heiraten die beiden. Seine Beziehung mit der einheimischen, feurigen Geliebten endet ohne Aussprache. Nach ihrer Rückkehr ins geliebte England ereilt Horatio eine heimtückische, unerklärbare Krankheit. Trotz der Bemühungen seines Arztes verschlechtert sich sein Zustand dramatisch. Der Doktor schlägt als letzten Ausweg eine Kur am Meer vor. Auf dem Weg nach Swanage verunfallt die Kutsche und Horatio zieht sich eine schwere Lungenentzündung zu. Als diese glücklich überstanden ist, bessert sich sein Zustand. Die lebenshungrige Rachel stürzt sich in eine Affäre mit dem behandelnden Arzt. Die Liaison endet jedoch abrupt und das Ehepaar kehrt nach Hause zurück. Dort erkrankt Horatio an denselben Symptomen erneut. Der Doktor vermutet: die Ursache seines Siechtums ist auf Madagaskar zu finden. Der Verdacht auf einen ungewöhnlichen Mordanschlag steht im Raum. Wird es dem Ehepaar gelingen, den Attentäter zu überführen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 335
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Andreas Zenner
Der Fluch des Merina-Amuletts
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Prolog
Der Kranke
Der Arzt
Die Geliebte
Eine Reise
Nosy Sainte Marie
Der Antrag
Das Unglück
Swanage
Erster Kuss
Post
Verführung
Am Cembalo
Ein Ausflug
Bitteres Ende
Geheimnisse
Geständnisse
Streit
Der Bote
Entlarvt
Epilog
Übersetzung einiger Flüche aus dem Indischen
Impressum neobooks
Prolog
Aus dem Stundenbuch der Polizeiwache in Oldham, 24. August 1785
Heute kurz nach 18 Uhr, die Turmuhr hallte noch, wurden zwei völlig aufgelöste grauhaarige Herren auf der Wache vorstellig. Sie erstatteten Anzeige wegen einer Straftat, waren wohl selbst, nach eigenen Aussagen nicht betroffen. Einer der beiden Männer ist der stadtbekannte und allseits beliebte Arzt Doktor Raeburn. Der andere wies sich mit seinen Papieren als ein gewisser Doktor Turnbull aus Manchester aus. Ihrem hastig, immer wieder durch den anderen unterbrochenen konfusen Bericht konnte ich kaum folgen. Aus der wirren Schilderung der beiden ließ sich kein klarer Tathergang ableiten. Anfänglich klang ihr Bericht eher wie aus einem Abenteuerroman, erst allmählich entwickelte sich ein Fall für die Polizei daraus. Mir scheint dies der wohl seltsamste und verzwickteste Fall meiner Laufbahn als Constable zu sein. Um mir ein genaues Bild zu machen, werde ich morgen das Anwesen der Familie Bamforth aufsuchen. Dort soll sich das Verbrechen zugetragen haben. Ich werde das betroffene Ehepaar und die Bediensteten befragen, um weitere Ermittlungen anzustellen. Unmittelbare Gefahr scheint nicht mehr zu bestehen, da nach den Angaben der Herren der Täter flüchtig ist.
Eigenartig nur, vor ein paar Monaten wurde ich schon einmal zu Ermittlungen in einem Todesfall auf das Anwesen gerufen.
Der Kranke
Ein bestialischer Gestank sprang Rachel an, als sie die Tür zum Schlafzimmer ihres Mannes öffnete. Die Ausdünstungen reizten sie jedes Mal zum Würgen, betrat sie notgedrungen den Raum. Wie stickiger Nebel hafteten Schwaden aus Blut, Stuhl und klebrigem Schweiß an den Wänden, den Möbeln, den Vorhängen.
„Wie in einem Schlachthaus“, dachte Rachel. „So riecht der Tod.“
Trotz des ekelerregenden Brechreizes in der Kehle zwang sie sich das Zimmer zu betreten.
„Morgen“, nuschelte sie und versuchte den Atem anzuhalten bis Sterne vor ihren Augen tanzten. Rasch schritt sie zum Fenster, schob die schweren Vorhänge zur Seite und riss beide Fensterflügel weit auf. Sie sog die frische Luft tief in ihre Lungen, drehte sich endlich um und wandte sich ihrem Mann zu.
„Wie hast du geschlafen?“
Er antwortete nicht, grunzte unverständlich, kniff geblendet vom Licht die Augen zu. Rachel starrte auf den im Bett liegenden kachektischen Körper. Seine Konturen zeichneten sich fast nicht mehr unter dem dicken Plumeau ab.
„Er ist nur noch ein Schatten seiner selbst“, dachte Rachel, „dabei war er vor wenigen Wochen noch ein kraftstrotzender Hüne, der keine Auseinandersetzung mit einem Widerpart fürchtete.“
Seit Wochen lag ihr Mann hohlwangig mit tief eingefallenen Augen regungslos in seinem Bett. Ein kratziger Stoppelbart umrahmte das hippokratische Gesicht, einem Totenschädel ähnlich. Rachel stand an die Fensterbank gelehnt und beugte sich zurück soweit es ging. Die Krankheit ihres Mannes wirkte wie ein unwirklicher Spuk auf sie. Manchmal träumte sie, er würde, ganz der Alte, plötzlich aus dem Bett springen und sie lüstern in seine ehemals kräftigen Arme reißen. Doch sie sah selbst, dass dies ein abwegiger Wunsch bleiben musste.
„Du musst essen“, sagte sie und versuchte ihrer Stimme einen bestimmenden Klang zu geben, allein sie konnte ein Zittern nicht verbergen.
„Ich kann nicht“, wisperte es aus den Kissen. Er machte eine abwehrende Handbewegung. „Ich bin zu schwach.“
„Papperlapapp“, wies sie ihn resolut zurecht. „Wenigstens eine Kleinigkeit. Ich werde den Koch anweisen, dir ein leichtes Frühstück zuzubereiten. Er soll es am Bett servieren.“
Horatio stöhnte gequält. Er dachte an die schneidenden Bauchschmerzen, die auch der kleinste Bissen unweigerlich nach sich ziehen würde. Ganz zu schweigen von den schwächenden, blutigen Durchfällen, die ihn noch Stunden später plagten und die ihm umso unangenehmer waren, da er nicht mehr alleine auf die Toilette schleichen konnte. Vor zwei Wochen war er, als er des Nachts versuchte zur Toilette zu gelangen, zusammengebrochen und hilflos auf dem Boden liegen geblieben. Niemand hörte seine Hilferufe. Erst nach einer Stunde befreite ihn das Zimmermädchen aus seiner misslichen Lage. Seither wagte er sich nicht mehr aus dem Bett. Zu groß war seine Angst wieder einen Schwächeanfall zu erleiden. Spürte er den Stuhldrang, zog er heftig an der Glocke und dann musste ihm Rachel oder eine Bedienstete eine Bettpfanne unterschieben. Er schämte sich ob seiner Hilflosigkeit, betrachtete seine Krankheit als persönliches Versagen. Allein ihm fehlte die Kraft sich zu verstellen und sein sonst übliches grinsendes Lächeln aufzusetzen.
„Ein Toastbrot mit etwas Schinken und ein Ei hat noch niemandem geschadet. Dazu eine gute Tasse Tee aus Assam, das weckt die Lebensgeister“, entschied Rachel.
Er war zu schwach, um zu widersprechen.
Frischer Morgenwind fuhr in das Zimmer, bauschte die Vorhänge und nahm den entsetzlichen Dunst mit sich. Rachel wagte sich weg vom Fenster. Sie setzte sich an das Bett ihres Mannes, ergriff die eiskalte Hand und strich leicht mit dem Daumen über die hervorstehenden Knochen des Handrückens.
„Das wird schon“, sprach sie ihm Mut zu, doch obwohl sie ihre Sorgen geschickt verbarg, waren ihre Zweifel unüberhörbar. Er schüttelte matt den Kopf. Welchen Sinn hatte sein Leben noch? Mit ihm ging es zu Ende, er fühlte sich sterbenselend. Wäre er doch in einem Scharmützel gestorben, von Kugeln durchsiebt oder von einem Säbel durchbohrt. An eine Genesung vermochte er nicht mehr zu glauben. Ihm fehlte die Kraft gegen den schleichenden Verfall anzukämpfen. Zu lange schon litt er an dieser merkwürdigen Krankheit. Sogar das Denken fiel ihm schwer. Seine Lebenskraft tropfte aus ihm heraus, unaufhaltsam wie Wein aus einem löcherigen Fass. Tropfen für Tropfen sickerte sein Blut in die Toilette.
Vor dem Fenster über dem Park, dessen Ausläufer sich bis an den Fuß der Hügel in der Ferne erstreckten, lachte ein stahlblauer Frühlingshimmel. In den kahlen Bäumen über dem kurzgeschorenen Rasen summten vereinzelt frühe Hummeln. Erste Buschwindröschen spitzten aus dem Boden, wiegten ihre Blüten im Wind. Im Schatten der Hecken schmolzen letzte graue Schneehaufen dahin. Ein Tag wie geschaffen, um sich an all der Schönheit der erwachenden Erde zu erfreuen. Im Stall scharrten die Pferde ungeduldig mit den Hufen, warfen mit übermütigem Wiehern die Köpfe zurück. Sie witterten den nahenden Frühling und brannten darauf über die Wiesen zu galoppieren, durch das weite Tal mit den gerundeten Hügeln zu beiden Seiten und dem Fluss, der sich von Weiden gesäumt durch den feuchten Grund schlängelte. Vorbei an den grasenden Schafherden, die das trockene Moorgras des letzten Jahres rupften.
Freilich waren Mr. Bamforth und seine ihm erst vor einem halben Jahr angetraute Frau schon lange nicht mehr ausgeritten. Eine rätselhafte Krankheit zwang den Hausherrn ins Bett und seine junge Frau verspürte keine Lust alleine über die Wiesen zu galoppieren. Das half ihrem Mann zwar nicht, allein Rachel verzehrte sich vor Sorgen und verließ das Haus lediglich, wenn es unbedingt nötig war und auch dann nur mit schlechtem Gewissen.
„Später kommt Doktor Raeburn und sieht nach dir“, versuchte sie ihn aus seiner Lethargie zu reißen. Vergeblich, Horatio rührte sich nicht. Nicht einmal die geschlossenen Lider hoben sich. Mit einem tiefen Seufzer erhob sich Rachel. Sie musterte ihren Mann, der mehr einem Toten glich denn einem Lebenden und eine verirrte Träne rollte über ihre Wange.
So hatte sie sich ihre Ehe nicht vorgestellt. Damals, als sie vor sechs Monaten in Madagaskar geheiratet hatten, schien ihr diese Verbindung mit dem schmucken, wenn auch etwas ungehobelten Offizier noch eine glückliche Fügung zu sein, auch wenn die Beziehung nicht standesgemäß war. So sahen es jedenfalls die Nachbarn, die sich über die unterschiedliche Herkunft der beiden das Maul zerrissen. Doch Rachel durfte nicht wählerisch sein. Als Witwe standen ihre Aussichten für eine weitere Ehe nicht eben günstig. Horatio war um einiges älter als sie, aber er stand noch voll in seiner Kraft und Rachel konnte seinen Mut, seine Tatkraft mehr als einmal bewundern. Ihr Mann hatte sein Geld im Dienste der Ostindien-Kompanie gemacht. Zusammen mit dem Vermögen, das sie von ihren Eltern und ihrem verstorbenen ersten Ehemann geerbt hatte, ermöglichte ihnen das Sümmchen ein behagliches Leben auf dem Lande. Arbeiten mussten sie nicht, ihre Dienstboten umsorgten sie, wie es sich für einen hochherrschaftlichen Haushalt gehört.
Horatio stöhnte leise, das Gesicht schmerzverzerrt.
„So schlimm heute“, bedauerte ihn Rachel und strich über seine schweißnasse, klebrige Stirn.
Er streifte sie mit einem dankbaren Blick.
Bald nach der in aller Stille gefeierten Hochzeit zog es sie zurück nach England. Auf Madagaskar herrschten unruhige Zeiten. Immer wieder brachen Aufstände aus und unversehens konnten die Europäer in die Scharmützel hineingezogen werden. Das Hauspersonal in Toamasina tuschelte hinter vorgehaltener Hand von einem Massaker an dreizehn französischen Frauen, die sich im Süden der Insel verheiraten wollten. Aus Eifersucht angezettelte Morde der, angezettelt von den madagassischen Geliebten der Bräutigame. Diese hatten ihre Gespielinnen, mit denen sie jahrelang das Bett geteilt hatten, verstoßen, um eine standesgemäße Beziehung eingehen zu können. Dieses Risiko wollten die beiden frisch Verliebten nicht eingehen. Kein Europäer verstand wirklich, was in den Herzen der Madagassen vorging. Auch machte sich niemand die Mühe nachzuforschen. Wozu auch. Die Europäer zählten die Eingeborenen ohnehin zur Rasse der primitiven Wilden.
Der Arzt
Horatio fröstelte, ein Schauer lief über seine unbedeckten knochigen Schultern. Rachel zog fürsorglich die Bettdecke nach oben, bis nur noch die Nasenspitze aus den Federn lugte. Das Fenster zu schließen, dazu konnte sie sich nicht aufraffen.
Ihr Mann war kein Kostverächter, was Frauen betraf, das hatte sie bei ihrem Aufenthalt in Madagaskar schnell begriffen. Sicher versüßte ihm eine Geliebte unter dem Hauspersonal die schwülen Nächte, da unterschied er sich nicht von den anderen europäischen Kaufleuten. Welche der vielen Hausangestellten jedoch seine Gespielin war, interessierte sie nur am Rande. Sie forschte nicht nach. Das war vor ihrer Zeit. Mehr als eine flüchtige Liebelei zwischen den beiden konnte sie sich nicht vorstellen. Er, ein Europäer, der sich aus kleinen Verhältnissen in der Armee hochgedient hatte, mit einer ungewaschenen Eingeborenen. Bei diesem Gedanken schüttelte Rachel sich. Eine solche Beziehung war für sie undenkbar, und hatte er das Mädchen nicht verstoßen, um sie heiraten zu können? So behauptete Horatio wenigstens mit dem Brustton der Überzeugung. Rachel glaubte ihm. Sicher hatte er ihr eine großzügige Abfindung zukommen lassen, um sie loszuwerden. Für ein einfaches Hausmädchen sicher ein Vermögen.
Rachel sog die feuchte Morgenluft tief ein, dachte damit das beklemmende Gefühl, welches sie von Zeit zu Zeit beschlich, weg zu atmen. Sie konnte die düstere Ahnung, die aus dem Dunkel aufwallte, nicht einordnen. Doch was sie fürchtete, erfüllte sie mit schierer Angst. Sie schob diese Gedanken auf die Krankheit ihres Mannes.
Gewaltsam riss sie sich von ihren Vorahnungen los, wandte sich mit einem Ruck um, griff nach dem Klingelband und zog heftig. Sofort öffnete sich die Tür und Becky, das Hausmädchen huschte ins Zimmer. Sie wirkte, als habe sie hinter der Türe gelauscht. Rachel bedachte sie mit einem missbilligenden Blick.
„Geh in die Küche“, wies Rachel die junge Frau an. „Rabesa soll ein leichtes Frühstück für Mr. Bamforth zubereiten: Eier, gebratenen Schinken, einen Toast und eine Kanne schwarzen Tee. Aber hurtig.“
Das Mädchen knickste und verschwand geräuschlos, froh den kranken Ausdünstungen entronnen zu sein.
Rachel trat wieder ans Fenster, ließ ihren Blick über das erste zarte Grün des Gartens schweifen. Sie seufzte, gerne wäre sie zwischen den Hecken spazieren gegangen, statt untätig bei ihrem Mann zu sitzen.
Minuten später klopfte es. Der madagassische Koch balancierte das Frühstück auf einem Silbertablett. Das Essen appetitlich angerichtet. Der Geruch von gebratenem Speck zog durch die muffige Schlafkammer des Hausherrn, überlagerte für Sekunden die üblen Gerüche. Rabesa schob das Tablett vorsichtig auf den Beistelltisch, schenkte den dampfenden schwarzen Tee ein. Der Koch trat einen Schritt zurück und beobachtete Horatio lauernd aus den Augenwinkeln. Rachel vermeinte kurz ein gehässiges Grinsen in seinem Gesicht zu sehen. Aber da konnte sie sich täuschen.
„Es ist gut, Rabesa“, sagte sie, „du kannst dich entfernen.“
„Jetzt wird gegessen“, kommandierte Rachel und bestrich eine Scheibe Toast mit gesalzener Butter. Sie legte den knusperig gebratenen Speck darauf und schnitt das Brot in kleine Stückchen, wie für einen zahnlosen Greis. Die Brocken spießte sie auf eine Gabel.
„Mund auf“, befahl sie und kam sich lächerlich dabei vor. Schließlich war ihr Mann kein kleines Kind mehr, das gefüttert werden musste. Gehorsam öffnete Horatio den Mund einen Spalt, gerade so viel, dass Rachel das Brot hineinschieben konnte. Er kaute lustlos auf dem Bissen herum, würgte ihn schließlich mit einem Schluck Tee hinunter. Ohne sich um seinen matten Protest, das angeekelte Gesicht zu kümmern, stopfte sie ihm ein zweites Stück in den Mund. Horatio brauchte unendlich lang, bis er auch diesen Brocken geschluckt hatte. Zwischendurch löffelte Rachel ihm ein wenig vom Ei in den Mund. Weichgekocht schluckte es sich leichter als das trockene Brot. Sie ließ nicht locker, bis ihr Mann ein halbes Toastbrot gegessen hatte. Eine mühsame Angelegenheit und ohne Rachels sanften Druck wäre Horatio wohl elendiglich verhungert. Angewidert schob er schließlich den Teller zurück, presste die Lippen fest zusammen. Vor Erschöpfung fielen ihm die Augen zu und ein kurzer Schauer rann über seinen geschwächten Körper. Rachel gab auf.
„Ruh dich aus. Später sieht Doktor Raeburn nach dir.“
Sie strich ihrem Gatten über die wachsbleiche Stirn, versuchte dabei ein heiteres unbeschwertes Gesicht zu ziehen. Es wurde ein verzogenes Grinsen daraus. Die Anspannung der letzten Wochen hatten sie gezeichnet. Zu deutlich sah man ihr an, dass sie sich schreckliche Sorgen machte. Nachdem Horatio sich nicht rührte, nicht einmal mehr die Augen öffnete, schlich sie auf Zehenspitzen aus dem Raum. Draußen holte sie erst einmal tief Luft. Ihre mühsam aufrecht erhaltene Fassung fiel in sich zusammen und ihre Gesichtszüge entgleisten. Nicht mehr zurückzuhaltende Tränen kullerten über ihre Wangen und tropften auf die frisch gestärkte Bluse.
Marjorie, die Hausdame eilte über den Flur. Mit einem Blick erfasste sie, wie es um Rachel bestellt war.
„Meine arme kleine Lady“, sagte sie und schloss Rachel in die Arme. „Wein ruhig ein bisschen.“
Marjorie hatte Rachel mit großgezogen, auf sie aufgepasst, wenn die Eltern zu einer Gesellschaft aufgebrochen waren. Dann saß das kleine Mädchen auf dem Schoß der Hausdame und ließ sich mit Leckerbissen füttern. Marjorie liebte Rachel wie ein eigenes Kind. Später dann als erwachsene Frau vertraute sie der Hausdame noch immer all ihre großen und kleinen Geheimnisse an. In Marjories Armen fühlte sich Rachel geborgen. Nachts, wenn sie sich schlaflos im Bett von einer Seite auf die andere wälzte, litt sie am meisten unter der erzwungenen Einsamkeit. Da konnte ihr die Vertraute nicht helfen.
Gegen Mittag fuhr der Einspänner von Doktor Raeburn vor. Rachel hörte es am Knirschen des Kieses in der Einfahrt und dem Bellen der Hunde. Der rundliche Doktor kletterte behände vom Kutschbock und griff sich seinen Arztkoffer, der neben ihm auf dem Bock stand. Sonnenstrahlen spiegelten sich auf dem fast kahlen Schädel, als er seinen Zylinder abnahm und sich mit einem Taschentuch den Schweiß von der Stirn wischte. Er übergab dem Stallburschen die Zügel und sprang mit jugendlichem Schwungeiner Beweglichkeit die Treppe hinauf, den hatte man ihm gar nicht angesehen.
Lady Bamforth erwartete ihn bereits im Foyer.
„Ein herrlicher Morgen, heute“, begrüßte der Doktor die Hausherrin vergnügt. „Wie geschaffen für einen ersten Ausritt.“
Rachel reichte ihm die Hand, er küsste sie galant. Die Dame des Hauses überragte den Doktor um Hauptesbreite. Sie trug und ein schwarzes bodenlanges Kleid im Empirestil, das in allen Nuancen von Schwarz changierte. Die toupierten schwarzen Haare, betonten ihr blasses Gesicht. Rachel war noch immer eine Schönheit, auch wenn der Kummer Falten in die Stirn und um die Mundwinkel gegraben hatte. Der Doktor verehrte die Frau heimlich, ließ sich aber nichts anmerken.
„Wie geht es unserem Patienten heute?“, erkundigte sich der Arzt jovial. Es betrübte ihn, Rachel leiden zu sehen.
„Ach“, seufzte sie, „nicht gut. Er wird von Tag zu Tag schwächer. Inzwischen ist er so hinfällig, dass er kaum mehr essen mag. Heute habe ich ihn mit Mühe und Not mit einem halben Toastbrot gefüttert. Dabei hat er früher so gerne und so viel gegessen.“
„Die Krankheit Ihres Mannes ist mir rätselhaft,“ sinnierte der Doktor. „So einen progredienten Verlauf habe ich in all meinen Praxisjahren noch nicht gesehen. Ich vermute, Ihr Mann hat sich auf Madagaskar eine bislang unbekannte Tropenkrankheit zugezogen.“
„Und warum habe ich dann keine Symptome?“, fragte Rachel.
Der Doktor zuckte mit den Achseln, sah sich überfragt.
„Wird er sterben?“
„Das kann ich beim besten Willen nicht sagen. Aber wenn das Siechtum weiter so schnell fortschreitet, kann ich das nicht ausschließen. Wir müssen uns, wenn nicht ein Wunder geschieht, auf das Schlimmste gefasst machen.“
Rachel zuckte zusammen. Natürlich konnte sie sich ein eigenes Bild vom Zustand ihres Mannes machen und sie hatte sich gewappnet. Trotzdem traf sie die unverblümte Antwort des Arztes wie ein Messerstich mitten ins Herz.
„Kopf hoch“, sprach ihr der Doktor Mut zu. „Sie sind eine tapfere Frau. Jetzt sehen wir uns erst einmal unseren Patienten an.“
„Eine Tasse Tee vorher?“
„Später, später“, lehnte Doktor Raeburn ab. „Erst die Arbeit, dann das Vergnügen.“
Sie stiegen nebeneinander die Treppe zum ersten Stock hinauf. An den holzvertäfelten Wänden hingen Bilder mit heiteren Landschaften: Bauern bei der Ernte, in der Ferne ein sich durch die Auen schlängelnder Fluss, am Himmel zog sich ein Gewitter zusammen. Der Doktor klopfte und betrat, nachdem er nichts hörte, das Krankenzimmer. Trotz des sperrangelweit geöffneten Fensters stach ihn der Geruch von frischem Blut und vergorenem Stuhl in der Nase.
„Morgen, Sir“, begrüßte der Arzt den Hausherren. „Wie geht es uns denn heute?“
Horatio Bamforth öffnete die Augen, machte eine schwache, wegwerfende Handbewegung.
„Schon wieder dieser blutige Durchfall?“
Mr. Bamforth nickte und streckte die Finger in die Luft. Seine Stimme versagte.
„Fünf Mal“, registrierte der Doktor. „das ist nicht gut, gar nicht gut.“
Er öffnete seinen Koffer, holte sein hölzernes Hörrohr heraus und hörte den Patienten ab. Horatio folgte ihm mit glanzlosen Augen.
„Meine Mittel haben nichts gebracht?“
Horatio schüttelte den Kopf. Der Arzt kratzte sich ratlos am fast kahlen Kopf.
„Einen so hartnäckigen Fall von Diarrhoe habe in meiner ganzen Laufbahn noch nie gesehen.“
Der Doktor wiegte sorgenvoll den Kopf.
„Meine Diätvorschriften haben Sie eingehalten?“, wandte er sich an die Hausherrin.
Rachel nickte stumm.
Der Arzt untersuchte den Patienten gründlich, hörte die Lunge ab, das Herz und die Darmgeräusche. Er konnte keinerlei Anzeichen einer Besserung feststellen. Im Gegenteil. Die Rippen des Kranken stachen hervor wie bei einer halbverhungerten Ziege. Die lederige Haut schien das knöcherne Skelett nur noch mühsam zusammen zu halten.
„Nehmen Sie die Medizin weiter“, sagte er schließlich. Es klang hilflos.
„Ich sehe in drei Tagen wieder nach Ihnen“, verabschiedete er sich und zuckte kaum merklich mit den Schultern.
Auf der Treppe musterte Mrs. Bamforth den Arzt mit einem erwartungsvollen Blick. Sie ahnte, der Doktor hätte keine guten Nachrichten für sie.
„Ich bin ratlos“, sagte dieser, seine Stimme klang kratzig. Er sprach seine Einschätzung nicht gerne aus. Aber sie entsprach der Wahrheit und er hielt nichts davon seine Patienten zu belügen.
Sie setzten sich in den Salon und Rachel ließ aus der Küche eine Kanne schwarzen Tee kommen. Ihre Hände zitterten, als sie die Tassen füllte.
„Wenn Ihr Mann weiter so abnimmt, gebe ich ihm kein Vierteljahr mehr.“
Der Doktor blies über den heißen Tee, nahm einen winzigen Schluck, fürchtete sich die Zunge zu verbrennen. Rachel Bamforth erschrak.
„So schnell“, flüsterte sie und wurde leichenblass.
Der Gedanke nach nicht einmal einem Jahr erneut Witwe zu werden verstörte sie.
„Was die Behandlung betrifft, bin ich mit meinem Latein am Ende.“
Er versuchte Rachel die schreckliche Tatsache so schonend wie möglich beizubringen, aber Lady Bamforth las die Wahrheit in seinem Gesicht.
Sie schlug die Hände vor das Gesicht. Ein kaum hörbares unterdrücktes Stöhnen entrang sich ihrer Kehle.
„Die Diät spricht nicht an“, fuhr der Doktor leise fort. „Die Stärkungsmittel scheinen wirkungslos. Die Durchfälle könnte Ihr Mann vielleicht noch verkraften, vorausgesetzt er trinkt genügend, der anhaltende Blutverlust jedoch bringt ihn über kurz oder lang um.“
Er rührte mit dem silbernen Löffel in der Teetasse, versuchte ein Stück braunen Kandis aufzulösen, dieser zerfiel nur langsam. Sie schwiegen eine Weile ratlos.
„Wie gesagt“, setzte er wieder an, „wenn nicht bald ein Wunder geschieht, müssen wir uns auf das Schlimmste gefasst machen.“
Rachel konnte ihre Tränen nicht mehr zurückhalten, dabei hatte sie sich geschworen, die Contenance zu bewahren. Sie schluchzte wild auf, unterdrückte jedoch diese unziemliche Gefühlsaufwallung sogleich.
„Was schlagen Sie vor?“, fragte sie und versuchte mühsam die Fassung wieder zu gewinnen. Ihre Stimme flatterte, klang wie die eines verängstigten Vögelchens im Herbstwind.
Der Doktor wiegte den Kopf.
„Vielleicht könnte ein Ortswechsel Ihrem Mann helfen. Viel verspreche ich mir nicht davon, aber einen Versuch wäre es wert. Ich denke an einen netten kleinen Badeort an der Südküste. Ruhig gelegen, mit einem kräftigenden Meeresklima.“
Rachel schüttelte ungläubig den Kopf, die schwarzen Locken fielen ihr ins Gesicht, verbargen ihre verschreckten Augen.
„Das überlebt er nicht.“
Der Doktor wiegte das Haupt.
„Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ein Versuch wäre es wert. Immer noch besser als hier im Bett zu verfaulen.“
Rachel nickte.
„Wie bringen wir ihn da hin? Und wer würde ihn dort medizinisch betreuen?“
Sie konnte sich nicht vorstellen ihren Mann, selbst mit Hilfe eines kräftigen Dienstboten, aus dem Bett zu wuchten.
„Der Transport erscheint mir das größte Problem. Er müsste liegend gefahren werden. Zum Sitzen ist er zu schwach. In der Betreuung vor Ort sehe ich kein großes Problem. Ich habe einen jungen tüchtigen Kollegen, einen ehemaligen Assistenten von mir im Kurort Swanage in Dorset. Er verblüffte mich immer wieder durch sein fundiertes Wissen und seine Intuition.“
Er schmunzelte.
„Einer der seltenen Fälle, in denen der Schüler den Lehrer übertrifft. Bei ihm wären Sie in besten Händen. Ich denke, Ihr Mann würde sich an der Küste wohlfühlen.“
„Wenn Sie es sagen“, zweifelte Rachel. „Was bleibt mir anderes als Ihnen blind zu vertrauen.“
„Kopf hoch“, munterte sie Doktor Raeburn auf. „Ich schreibe, sobald ich zu Hause bin, einen Brief an meinen Freund Doktor Balmar und kündige Sie an. Er ist mir noch einen kleinen Gefallen schuldig. Er soll Ihnen ein nettes kleines Gasthaus suchen, in dem Sie unterkommen können und gut versorgt werden. Natürlich nur, wenn Sie einverstanden sind. Im Frühjahr ist in Swanage noch nicht viel los.“
Froh der lähmenden Untätigkeit entronnen zu sein, stellte der Doktor die Tasse auf den Tisch und sprang auf. Er verabschiedete sich mit einem Handkuss von Lady Bamforth.
„Jetzt muss ich weiter. Wenn ich eine Rückäußerung habe, wissen wir mehr“, rief er, den Zylinder in der Hand.
Er hoffte in der Zeit der Abwesenheit des Ehepaares ein wenig Abstand von diesem verzwickten Fall zu gewinnen. Die rätselhafte Krankheit seines Patienten überforderte ihn und nichts hasste der gute Doktor mehr als seine eigene Hilflosigkeit.
Manchmal ist es besser einen Fall rechtzeitig abzugeben, dachte er.
Rachel begleitete ihren Gast zur Tür und winkte ihm nach, bis seine Kutsche in die frühlingskahle Allee einbog.
Die Sonne strahlte warm vom Himmel. Rachel verspürte Lust einen kleinen Spaziergang durch den noch halb im Winterschlaf liegenden Garten zu machen. Sie schlang sich einen wollenen Schal um den Hals. Draußen sog sie die nach feuchter Erde und modrigem Laub duftende Brise tief in ihre Lungen, so als könnte sie die trüben Gedanken weg atmen. Kohlmeisen hüpften durch die kahlen Zweige und begrüßten mit ihrem hellen Tivitt, Tivitt den erwachenden Frühling. Die beiden Lakeland Terrier sprangen schwanzwedelnd auf sie zu, freuten sich über den Spaziergang. Rachel bemerkte sie kaum.
„Warum“, haderte sie, „warum trifft es gerade mich?“ Statt festliche Bälle und Konzerte zu besuchen, war sie ans Haus gefesselt, dazu verurteilt ihren siechen Mann zu pflegen. Wahrlich nicht das Leben, das sie sich bei ihrer Heirat erträumt hatte.
In Gedanken versunken fand sie sich auf ihrer Wanderung vor der Kate des Gärtners wieder. Sie schreckte aus ihren Gedanken auf, nahm ihre Umgebung wieder wahr. Die drei Kinder des Gärtnerehepaars kickten einen zerfetzten Ball hin und her. Schrien dabei und schienen Rachel nicht zu bemerken. Rachel sah ihnen zu. Sie liebte Kinder, hätte gerne ein eigenes umsorgt, doch aus einem unerfindlichen Grund wurde sie einfach nicht schwanger. Sie seufzte, ein warmes Gefühl überrollte sie. Sie hätte so gerne auch ein Kind in ihren Armen gehalten, ihm Schlaflieder vorgesungen, ihm das Reiten auf einem Pony beigebracht.
Etwas beunruhigte die Hunde, sie sprangen kläffend auf die Kinder zu und bauten sich zähnefletschend vor ihnen auf. Die Kinder schrien in Todesangst. Rachel erschrak. Mit einem scharfen Befehl pfiff sie die Hunde zurück.
„Tut mir leid“, flüsterte sie.
Sie fröstelte trotz der wärmenden Sonnenstrahlen und lenkte ihre Schritte eilig wieder in Richtung des Landsitzes. Die übermütigen Hunde packte sie fest am Halsband.
Die Geliebte
Horatio Bamforth wälzte sich in seiner Matratzengruft wie im Fieber unruhig hin und her. Er fror erbärmlich, seine Hände zitterten kachektisch vor Kälte, obwohl ihm das prall gefüllte Plumeau bis zur Nasenspitze reichte. Auf seiner Stirn stand kalter Schweiß. Durch die Krankheit geschwächt, empfand er das milde Frühlingslüftchen, das leise in den schweren Samtvorhängen spielte, wie einen körperlichen Angriff, gegen den er sich nicht wie in seinen besten Zeiten mit dem Säbel zur Wehr setzen konnte. Er war zu abgezehrt, um aufzustehen und das Fenster zu schließen.
Im Delirium huschten seine Gedanken wirr durcheinander. Er konnte nicht mehr unterscheiden: war seine Krankheit nur ein böser Alptraum oder beängstigende Wirklichkeit. Der Bezug zur Realität schien ihm verloren gegangen zu sein. Er taumelte durch bunte Bilder, schlingerte zwischen Vergangenheit und Gegenwart hin und her. Schwach wie er war, schien es ihm unmöglich Ordnung in seine geißbockähnlichen Gedankensprünge zu bringen. Er hasste diesen Zustand. Schließlich ergab er sich mit einem Seufzer und überließ sich den durcheinanderwirbelnden sich überlagernden Erinnerungen.
Er torkelte durch seine Jugend. Durch die ärmlichen Verhältnisse, in den vor Schmutz starrenden Straßenschluchten von Manchester. Die Luft voller Gestank aus den Kaminen und auf dem Katzentisch zu Hause niemals genug zu beißen. Seine kleinen Geschwister krabbelten auf dem Boden durcheinander, die Windeln verkackt. Sie balgten sich unter dem Tisch mit den räudigen Katzen um die Wette, stritten sich um einen abgenagten Knochen. Der Vater trank, anders konnte er sein tristes Dasein nicht ertragen. Kam er sturzbetrunken gegen Mitternacht aus dem Pub nach Hause gewankt, ließ er die Wut über sein verpfuschtes Leben an seiner Frau und den Kindern aus.
Er schlug sie so lange, bis er erschöpft auf dem Bett zusammenbrach und wegdämmerte. Da half kein Weinen, kein trotziges Dagegenhalten. Die Mutter hatte sich in ihr Schicksal ergeben. Sie kannte es nicht anders. Klaglos ertrug sie jede Misshandlung. Lediglich wenn er zu heftig auf die Kinder einschlug, warf sie sich dazwischen. Ängstlich lauschten die Kinder den Schnarchgeräuschen des Vaters. Oft lag der kleine Horatio weinend im Bett, das er sich mit seinem jüngeren Bruder teilen musste und hielt sich den brennenden Hintern. Die Mutter kauerte zusammengekrümmt in der Ecke. Tränen liefen ihr über die schmutzigen Wangen. Sie konnte ihm nicht helfen. Der Vater schlug mit einem Lederriemen, den er eigens für diesen Zweck zurechtgeschnitten hatte, auf alles, was ihm unter die Augen kam. Sogar die Katzen verschonte er nicht, doch die verkrochen sich schneller als die Kinder. Über den Anlass der täglichen Schläge rätselte der Junge. Wenn ihn der Hunger in den Eingeweiden zu sehr plagte, stahl er beim Bäcker ein trockenes Brötchen oder auch hin und wieder ein wenig Süßkram beim Gemischtwarenhändler um die Ecke. Heißhungrig schlang er die Beute sofort hinunter. Er wurde nur selten erwischt. Wenn er sich doch einmal ungeschickt angestellt hatte, packte ihn der Krämer am Ohr. Die Bestrafung folgte auf dem Fuße, direkt im Laden und sie fühlte sich nicht anders an als der Lederriemen des Vaters, nur dass der Kaufmann seinen Gürtel benutzte. Der jähzornige Vater konnte unmöglich davon gehört haben, allenfalls die Mutter, die ihn dann einen Tag lang mit vorwurfsvollen Blicken verfolgte.
So rasch wie die Erinnerung aus dem Dunkel auftauchte, verschwand sie auch wieder. Andere, schönere Bilder schälten sich aus dem Dunkel des Vergessens.
Er sah sich durch die Prachtstraßen von Toamasina schlendern, den Strohhut gegen die sengende Sonne tief ins Gesicht gezogen, der war allemal besser als der Tropenhelm, den er bei der Armee tragen musste. Kleine Schweißperlen rannen aus den Achseln in seinen blendend weißen Tropenanzug. Sein Blick wanderte an den Fassaden der prachtvollen Kolonialbauten entlang. Er bummelte über die eindrucksvolle Uferpromenade, genoss die Aussicht auf den endlosen leicht gekräuselten, immer türkisblauen indischen Ozean. Er hielt inne und beobachtete wie die Segelschiffe im Hafen be- und entladen wurden. Die Flüche der Matrosen, die Befehle der Offiziere hallten zu ihm herüber. Der zarte Duft von Vanille und Nelken in den Jutesäcken kitzelte ihn in der Nase. Braungebrannte Fischer landeten ihren schuppigen Fang an. Es roch nach Tang, totem Fisch und nassem Segelzeug.
In Toamasina, der bedeutendsten Hafenstadt Madagaskars prallten Händler, Abenteurer und ehrbare Kaufleute aufeinander. In den Gassen herrschte geschäftiges Treiben. Händler feilschten um ihre Ware und die Bauern des Umlandes priesen schreiend ihr Obst und Gemüse an, das sie vor sich in kunstvollen Türmen auf Binsenmatten aufgestapelt hatten. Horatios Kontor lag in der Rue de Commerce, wenige Schritte vom Hafen entfernt.
Dort machte er es sich hinter dem breiten Schreibtisch aus glänzendem Ebenholz bequem. Die wenigen Frachtpapiere waren rasch durchgesehen. Ein angestellter Schreiber fertigte die notwendigen Briefe, Formulare und Ladeverzeichnisse für ihn an. Das tropisch feuchte Klima war für ihn als Europäer gewöhnungsbedürftig. Doch in Indien herrschte ein ähnliches Klima wie in Madagaskar. Wurde es ihm wirklich einmal zu heiß, ging er hinüber ins Le Neptune und nahm einen kühlen Drink zu sich, bevor er wieder an seinen Schreibtisch zurückkehrte. Oder er bummelte durch die Gassen der Stadt, hielt mit Händlern oder Kollegen ein Schwätzchen. Seine Anstrengungen hielten sich in Grenzen. Als Angestellter der Ostindien-Kompanie musste er eigentlich nur arbeiten, wenn eines der großen bauchigen Segelschiffe der Kompanie auf dem Weg von oder nach Indien im Hafen anlegte. Dann überwachte er das Verschiffen der Beladung, meist einheimische Gewürze, besonders Vanille, oder er kontrollierte die gelöschte Ladung auf dem Weg ins Lagerhaus. Eigentlich ein langweiliges Leben, aber Horatio war das Warten vom Militär her gewöhnt und es machte ihm nichts aus. Er genoss das Leben eines Müßiggängers. Als Europäer würde er sich niemals mit körperlicher Arbeit die Hände schmutzig machen. Dafür gab es Bedienstete und Tagelöhner zu Hauf, die an jeder Straßenecke herumlungerten. Es war schon schlimm genug, dass verräterische Schweißflecken unter seinen Achseln seinen weißen Anzug beschmutzten. „Mora, mora“, lachten die Eingeborenen. „Langsam, langsam.“
Daran gewöhnten sich die wenigen Europäer schnell, ebenso wie die Soldaten der Besatzungsmacht. Die Hälfte des Tages war es einfach zu schwül für jedwede schweißtreibende Tätigkeit. Allenfalls konnte man noch um einige Lieferungen Gewürze feilschen oder ein paar Berichte und Briefe diktieren, ansonsten beschränkte sich Horatios Arbeit darauf Kaffee zu trinken, den ihm der Boy jeden Tag unaufgefordert für ein kleines Trinkgeld pünktlich servierte. Er kontrollierte die Eingeborenen bei der Arbeit. Diese hatten die für Horatio schwer erträgliche Angewohnheit, sobald er nicht hinsah, ihr Werkzeug fallen zu lassen und zu einem Schwätzchen die Köpfe zusammenzustecken.
„Mora, mora.“
Der weiße Herr konnte sich nicht vorstellen, was die Farbigen den ganzen Tag zu bekakeln hatten. Es interessierte ihn auch nicht wirklich.
Im europäischen Club, zu dem die Eingeborenen keinen Zutritt hatten, verkehrte er regelmäßig. Dort herrschte weihevolles Schweigen, das ihn an die Offiziersmesse in Indien erinnerte. Sprach wirklich einmal jemand bei einem Handel zu laut, was selten genug vorkam, so wurde er mit einem missbilligenden Blick zurechtgewiesen. Für die Geschäfte, die die Herren an diesem Ort abwickelten, gab es extra einen Nebenraum, in den sich die beiden Händler mit ihren Getränken zurückziehen konnten.
Horatio seufzte leise. Was für eine schöne unbeschwerte Zeit war das auf Madagaskar, viel besser als der Dienst in der Söldnerarmee der Kompanie. Allein, er wollte nicht undankbar sein. Erst sein abgeleisteter Dienst bei der Armee der Kompanie ermöglichte ihm diese geruhsame Stellung auf Madagaskar. In der Verwaltung erfahrene Soldaten waren gesucht bei der Ostindien-Kompanie, denn Erfahrungen im Umgang mit Eingeborenen, auf welchem Kontinent auch immer, waren ein unschätzbarer Vorteil für die Karriere. In den stillen Abendstunden aber sehnte er sich zurück nach England, nach den nebeligen Wiesen bei Tagesanbruch, den sanften grünen Hügeln und dem herrlich frischen Landregen. Eine Luft, in der er frei atmen konnte, die brütende Hitze ihm nicht schon beim Frühstück den Schweiß auf die Stirn trieb. Oft hatte er diesen wohltuenden Zauber nicht erlebt, lediglich, wenn er an den seltenen Tagen mit den Eltern aufs Land fahren durfte, um entfernte Verwandte zu besuchen. Doch die Erinnerung an die hügelige Landschaft, das satte Grün der Wälder hatte sich ihm für immer eingeprägt.
Die Tür öffnete sich mit einem feinen Knarren. Rachel huschte in den Raum, eingehüllt in einen Schwall Frühlingsdüfte aus dem Garten. Sie setzte sich ans Bett ihres Mannes. Er starrte sie aus den tief in den Höhlen liegenden Augen an. Kleine Schweißperlen glitzerten auf seiner Stirn. Er war zu schwach die Hand, die sie ihm entgegenstreckte, zu ergreifen. Rachel legte ihre Rechte auf seinen knochigen Handrücken.
„Doktor Raeburn schlägt eine Kur am Meer vor“, eröffnete sie ihrem Mann den Vorschlag des Arztes.
Horatio Bamforth schloss gequält die Lider.
„Wie soll das gehen? Ich bin viel zu schwach, komme ohne fremde Hilfe kaum mehr aus dem Bett“, wisperte er.
„Der Doktor kennt einen Kollegen, den er uns empfehlen kann. Wir könnten zwei bis drei Monate bleiben. Vielleicht tut dir die Luft an der Küste gut und du erholst dich ein wenig.“
Rachel versuchte zuversichtlich zu wirken, allein die Zweifel in ihrer Stimme blieben unüberhörbar.
„Glaubst du ich schaffe die Fahrt?“, flüsterte er ihr ins Ohr. „Lieber sterbe ich hier in meinem Bett.“
Sie überhörte den letzten Satz, obwohl er sie bis ins Mark erschütterte. So hatte er noch nie gesprochen. Bis vor kurzem schimmerte immer noch ein Fünkchen Hoffnung aus seinen Worten. Fast klang es als habe Horatio sich aufgegeben. Das sah ihm gar nicht ähnlich.
„Wir könnten in Etappen reisen. Nur wenige Stunden am Tag und ich würde dich liegend transportieren.“
Er nickte unmerklich mit dem Kopf, zu schwach um Widerstand zu leisten.
„Das Personal müssten wir zu Hause lassen. Es muss sich um das Haus, den Garten und die Tiere kümmern. Aber in einem feinen Gasthof wird gut für uns gesorgt. Wir brauchen uns um nichts zu kümmern. Jetzt im Frühjahr ist es nicht so überlaufen. Für ein kleines Trinkgeld sind die Bediensteten noch dankbar. Außerdem sind sie, wenn wenig zu tun ist aufmerksamer.“
Horatio stöhnte, dachte er an die Strapazen, die diese Reise mit sich brachte. Andererseits gefiel ihm der Gedanke, womöglich ein allerletztes Mal seinen Blick über das Meer schweifen zu lassen, dem Brausen der Wellen zu lauschen und dem Klacken der aneinanderstoßenden Steine am Strand. Er könnte dem Schrei der Möwen zuhören, dem melodischen Pfeifen des Windes. Eine salzige Brise im Gesicht, der Gedanke allein erinnerte ihn an vergangene Zeiten.
„Wenn du einverstanden bist, leite ich die Vorbereitungen in die Wege. Doktor Raeburn hat sich angeboten uns zu helfen. Es wird etwas dauern, bis alles geregelt ist.“
Mr. Bamforth beschränkte sich auf eine schlaffe, zustimmende Handbewegung, kraftlos schloss er die Augen.
„Wir nehmen einen Rollstuhl mit, den kann uns Doktor Raeburn besorgen, dann kann ich dich auf der Uferpromenade spazieren schieben und du musst nicht laufen. Sollte die Kur anschlagen, du vielleicht wieder zu Kräften kommen, könnten wir vielleicht sogar ein kleines Stückchen gehen.“
Er reagierte nicht mehr, deutete mit dem Finger auf die Wasserkaraffe, die auf dem Nachttischkästchen stand. Sie schenkte ein paar Schlucke ein, setzte den Kristallbecher mit dem goldenen Rand an seine Lippen. In kleinen Schlucken, eher wie ein Spatz, benetzte er seine trockene Mundschleimhaut. Ein dünner Faden rann ihm aus dem Mundwinkel und tropfte auf sein Nachthemd. Selbst zum Schlucken war er zu kraftlos.
Als Rachel ihn so sterbenselend liegen sah, kamen ihr Zweifel, ob er die Reise überhaupt durchstehen könnte. Was, wenn er unterwegs durch einen plötzlichen Schwächeanfall stürbe? Dann säße sie mutterselenalleine in einer fremden Umgebung. Wer würde ihr helfen? Ganz zu schweigen von dem grässlichen Gedanken in so kurzer Zeit zum zweiten Mal Witwe zu werden. Sie verbot sich diese zersetzenden Bedenken energisch. Solche Grübeleien führten zu nichts. Viel lieber wollte sie an den Erfolg der Kur glauben. Sie klammerte sich an das Fünkchen Hoffnung wie eine Ertrinkende. Was blieb ihr anderes übrig. Verfiele auch sie in Trübsal, wäre keinem geholfen. Dann lieber alles Leid durchstehen und auf ein glückliches Ende hoffen. Panische Angst befiel sie, wenn sie daran dachte auch ihren zweiten Mann zu verlieren. Diese Furcht verfolgte sie von Anbeginn der Krankheit ihres Mannes. Sie nahm sich fest vor die Hoffnung nicht aufzugeben.
Horatio Bamforth war nicht Rachels große Liebe, aber bei einer zweiten Ehe durfte sie nicht wählerisch sein. So heiratete sie sogar einen Mann, der nicht ihrem Stand entsprach. Immerhin stammte Rachel aus dem niederen Landadel und durfte sich Lady nennen. Marjorie, die treue Seele, missbilligte diese Verbindung, doch sie behielt ihre Kritik für sich. Das Leben ist ungerecht, dachte Rachel. Bei einem Mann fragt keiner danach, wie oft er geheiratet hatte. Für eine Frau dagegen war es nicht einfach als Witwe ein weiteres Mal einen passenden Mann zu finden, selbst wenn man wie Rachel ein erkleckliches Vermögen geerbt hatte. Wie es im Moment aussah, konnte sie auch ihren Kinderwunsch begraben. Das schmerzte sie am meisten. Mit der Gesundheit ihres Mannes stand es nicht zum Besten, das sah jeder und seinen ehelichen Pflichten konnte Horatio schon lange nicht mehr nachkommen. Dabei sehnte sie sich so sehr nach einem Baby, dass es ihr des Nachts fast das Herz zerriss.
Die Zeit für eine Schwangerschaft zerrann ihr unter den Fingern. Mit 40 noch ein Kind zu gebären konnte sich Rachel trotz des brennenden Wunsches nicht vorstellen. Trotz allem war Mr. Bamforth ein guter Mann. Er gebärdete sich weder besonders herrisch, was man bei einem altgedienten Soldaten eigentlich erwarten könnte, noch trank er über die Maßen, oder frönte einem anderen der manchmal seltsam anmutenden britischen Hobbys. Natürlich stand sie tausend Ängste aus, wenn er vorhatte auf die Jagd zu gehen. Zu tief saß der Schock über den Tod ihres ersten Mannes noch in ihren Knochen. Aber damit musste sie leben. Außerdem war ein Jagdausflug, seit sie zurück in England waren noch nicht vorgekommen. Seine Krankheit, die schon bald nach ihrer Rückkehr ausbrach, hinderte ihn daran diesem Vergnügen zu frönen.
Wäre er doch nur ein Stückchen gesünder, seufzte sie, was für ein schönes Leben könnten sie führen. Rachel vermisste die prunkvollen Bälle, die die Nachbarn reihum gaben, die Konzerte oder auch nur die vertraulichen Gespräche am prasselnden Kaminfeuer mit einem Glas Portwein in der Hand. All das blieb ihr verwehrt, stattdessen sah sie sich gezwungen stundenlang am Bett ihres Mannes auszuharren. Sie hatte sich fest vorgenommen eine tadellose Ehefrau zu sein.
Rachel jammerte lautlos, befreite sich dann resolut aus dem klebrigen Spinnennetz ihrer trübsinnigen Gedanken.
„Ich schicke dir nachher eine leichte Suppe nach oben. Soll ich dich füttern?“
Er wackelte verneinend mit dem Kopf. Es war ihm peinlich seinen schleichenden Verfall, den seine Gemahlin so hautnah miterleben musste, zu zeigen.
„Ich werde Becky bitten, dir zu helfen.“
Er nickte und überlegte, wie lange er nun schon an sein Bett gefesselt lag. Die Krankheit hatte sein Zeitgefühl aufgefressen. Vor nicht allzu langer Zeit stand er als Mann mit Bärenkräften noch in der Blüte seiner Jahre. Er konnte einem durchgehenden Pferd in die Zügel fallen und es zum Stehen bringen. Es schien ihm als sei sein Siechtum schon Jahre her, allein es handelte sich nur um wenige Monate. Kurz nachdem sie in England gelandet waren, hatte ihn diese rätselhafte Krankheit befallen. Heimtückisch wie ein Angriff aus dem Hinterhalt, gegen den er machtlos war. Die Krankheit ließ ihn von Tag zu Tag ein Stückchen mehr dahinsiechen. So, als sickere seine Lebenskraft aus ihm heraus, unmerklich aber stetig.