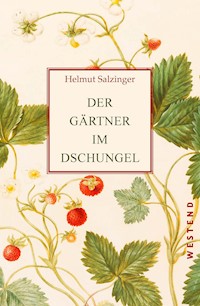
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Westend Verlag
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Helmut Salzinger war Literaturkritiker der "Zeit" und hatte Bücher über Walter Benjamin("Swinging Benjamin") und über Musik geschrieben, als er sich Anfang der 1970er Jahre auf das Land zurückzog, um sich fortan möglichst biodynamisch mit Lebensmitteln zu versorgen. Wie bei einem Stadtmenschen und Intellektuellen naheliegend, ging das Unterfangen schief. Aber es bescherte dem Autor statt reichlich Gemüse tiefgehende Erkenntnisse - und machte ihn zum "Gärtner im Dschungel". Seine Erkenntnis: "Wenn wir etwas vom Wesen des Menschlichen begriffen haben, dann dieses: dass der Mensch als Natur und Lebewesen von keinerlei Bestimmung über die Erde gesetzt ist, sondern dass er von gleicher Art ist wie alles Lebendige."
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 283
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Ebook Edition
Helmut Salzinger
Der Gärtner im Dschungel
»Der auf die Sterne hereingefallene Mensch.« (Aragon, Le Paysan de Paris)
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.westendverlag.de
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig.
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
ISBN 978-3-86489-723-8
© Westend Verlag GmbH, Frankfurt/Main 2018
Umschlaggestaltung: Buchgut, Berlin
Satz und Datenkonvertierung: Publikations Atelier, Dreieich
Inhaltsverzeichnis
© Michael Kellner
Helmut Salzinger (1935 - 1993) war Literaturkritiker der ZEIT und Schriftsteller (Swinging Benjamin, Rock-Power oder Wie musikalisch ist die Revolution?) und zog sich Anfang der 1970er-Jahre auf das Land zurück, um sich fortan möglichst bio-dynamisch mit Lebensmitteln zu versorgen.
Schreiben wie die Maus buddelt
Vorwort von Mathias Bröckers
»Was sind das für Zeiten, wo ein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist. Weil es ein Schweigen über so viele Untaten einschließt!«
Bertolt Brecht An die Nachgeborenen
Helmut Salzinger (1935-1993) war Literaturkritiker der Zeit und Schriftsteller (Swinging Benjamin, Rock-Power oder Wie musikalisch ist die Revolution?) und zog sich Anfang der 1970er-Jahre auf das Land zurück, um sich fortan möglichst bio-dynamisch mit Lebensmitteln zu versorgen. Das ging – wie bei einem Stadtmenschen und Intellektuellen kaum anders zu erwarten – ziemlich schief. Doch Der Gärtner im Dschungel, ein Jahr vor Salzingers Tod erschienen, erzählt nicht nur die Geschichte dieses Scheiterns, sondern auch den daraus resultierenden Erkenntnisgewinn: Aus dem Herrn und Meister der Natur wird eine Mitkreatur, die den Wesen um sich herum beim Wachsen zuschaut.
Was das Verfassen von Büchern angeht, hat der Philosoph Gilles Deleuze (Kafka. Für eine kleine Literatur) einmal eine Art Mimikry empfohlen: Schreiben, wie eine Ratte sich durchs Schilf schlängelt, wie eine Maus ihr Loch buddelt. Doch wie hätte ein solches Kleinwerden der Literatur auszusehen? Kann man wirklich schreiben wie eine buddelnde Maus? Und kann man vermeiden, dabei wie Kaninchen, der eitle Besserwisser in Pu der Bär, zu wirken? Man kann. Und Der Gärtner im Dschungel ist ein solches Buch. Kein schweres, philosophisches, sondern ein kleines, weises. Sein Verfasser, Helmut Salzinger, hat mit der Nomadologie von Deleuze und Guattari vielleicht überhaupt nichts zu tun – und doch wiederum sehr viel; er hat geradezu das Gegenteil von nomadischer Literatur geschrieben – ein Gartenbuch nämlich. Und doch scheint diese Karte eines Mikrokosmos die gesamte Welt zu enthalten. Nicht zuletzt den Übergang vom Nomadischen zum Sesshaften. Mit dem ersten Spatenstich fing nämlich alles an:
»Auf der Erde ist jeder menschliche Zugriff ein Angriff (auf etwas, das bereits vorher bestand). Und im Garten speziell bedeutet jeder Handgriff nicht nur Eingriff, sondern zugleich auch Übergriff. Jede Pflegemaßnahme bewirkt Störung und Zerstörung – neben aller Pflege. Wenn ich das total verunkrautete Stück der Himbeeren säubere, damit Licht und Luft herankommen und der Boden abtrockne, dann rennen auch hier nach allen Seiten Spinnen und Käfer weg. Der Igel sieht sich entdeckt, und die Braunelle wippt nicht mehr auf den Stützdrähten für die Himbeerranken. Überall – wörtlich: Überall lebt irgendwer. In diesem Sinne ist praktisch der gesamte Planet Erde von einer wimmelnden Hülle aus Leben umgeben, und da ist es unausweichlich, dass einer, wohin er tritt, einen anderen tottritt, jedenfalls als Mensch, zumindest tendenziell. Wer dabei nicht mittun will, wird es schwer haben in seinem Leben.«
Wer zwar brillante Essays über Walter Benjamin schreiben konnte (Swinging Benjamin, 1972) und als »Jonas Überohr« in der Zeitschrift Sounds Meilensteine der Musikkritik setzen – doch von Natur eigentlich keinen Dunst hatte und sich dennoch aus theoretischen und praktischen Gründen fortan aus dem eigenen Garten ernähren will, ist absehbar zum Scheitern verurteilt. Und die Geschichte dieses Scheiterns ist eine der Ebenen von Salzingers Buch. Eine andere ist der Erkenntnisgewinn, der aus dem Scheitern resultiert, aus dem potentiellen bio-dynamischen Selbstversorger wird ein Gärtner im Dschungel:
»Seither ist immer was los, selbst wenn nichts geschieht. Mein Zeitgefühl hat sich verändert. Zeit ist ein gleichmäßiger Fluss geworden. Mein Blick weitet sich, ich bekomme ein Gefühl für natürliche Rhythmen. Das Jahr schließt sich zu einer zyklischen Einheit zusammen, einer Vegetationsperiode von Wachsen, Vergehen und Ruhe. Dann eine neue Runde. Jede Pflanze nimmt daran teil, und ich nehme allmählich wahr, dass auch ich selber, wenn ich es nur zulasse, an diesem rhythmischen Kreislauf beteiligt bin. Ich gehe zwischen den Lebewesen im Garten herum und habe gelegentlich das Gefühl, selber ein solches Lebewesen zu sein. Ein Wesen wie alle, von ihrer Art und Natürlichkeit. Das Empfinden, das sich dabei zuweilen einstellt, erinnert mich an so etwas wie Glück.«
Der Gärtner im Dschungel ist eine Geschichte der Wahrnehmung – der Wiedergewinnung eines Gespürs für die Ganzheit und pulsierende Allgegenwart des Lebens, der unmittelbaren Wechselwirkungen von Mikro- und Makrokosmos, von Kleinstlebewesen und Gesamt-Biosphäre. Während einst der Garten ein Stück Kultur war, das gegen die Wildnis verteidigt werden musste, gerät er nun, gegen die flächendeckende Planierung durch die Zivilisation, zu einem Asyl für die Wildnis. Und der Macher des Gartens hofft, irgendwann »zum Bewohner des Gartens geworden zu sein und recht eigentlich zu seinem Bewuchs zu gehören, wie die kleinen Käfer und Spinnen unterm Gras dazugehören.«
Auch dies, die Wandlung vom Experimentator zum Teil des Experiments ist eine der Ebenen des Buchs: Natur nicht mehr als zugerichtetes (und zunehmend zugrunde gerichtetes) Objekt, sondern als Gesamtzusammenhang, in den sich der Mensch, wie die Maus und die Laus, zu fügen hat. Ein solches, möglichst mannigfaltiges Gefüge versucht Salzinger in seinem Wildgarten zu schaffen – und als seine Frau unterm Haus den Horror aller Kleingärtner, ein Schlangennest, entdeckt, mischt sich in die Freude darüber auch »eine Spur von Stolz«.
Bei all dem ist dieses Buch keine neo-romantische Wildnisschwärmerei, kein Öko-Idyll aus dem stillen Winkel. Salzinger bastelt sich keinen neuen lieben Gott zurecht, um biologische Vorgänge zu erklären: »Zwar, Gott ist tot, das stimmt. Doch hat dieses säkulare Ereignis den Menschen nicht zu jenem Übermenschentum befreit, das Nietzsche sich erträumte. Wenn wir etwas vom Wesen des Menschlichen begriffen haben, dann dieses: dass der Mensch als Natur und Lebewesen von keinerlei Bestimmung über die Erde gesetzt ist, wie es manche von den alten Mythen lehren, sondern dass er von gleicher Art ist wie alles Lebendige auch und dass, worin er sich unterscheidet – wenn er es denn tut –, nicht seine Fähigkeit ist, die Erde zu beherrschen, sondern die, sie zu hegen und zu pflegen wie einen Garten.«
Was im Rahmen von Umweltkonferenzen und Klimagipfeln nicht stattfindet – die Formulierung einer neuen, umfassenden Bioethik – hier, in diesem einfachen Bericht aus einem Garten, nimmt sie Gestalt an. Weniger in programmatischen Sätzen als in den alltäglichen Beobachtungen, den mit offenen Sinnen eingefangenen Wechselwirkungen dieses unendlich vielfältigen, verzweigten Universums der Gräser, Büsche, Blätter und Bäume. Und in der geschärften Wahrnehmung für alles, was mit und zwischen ihnen lebt, einschließlich des Gärtners selbst, dem der Garten nicht nur zum Wohnort, sondern, indem er ihn anschaut, auch zum Meditationsraum wird: »Mein selbstgemachtes, kleines Paradies dachte ich manchmal. Und dachte weiter: aber alles geklaut.« Wobei der Diebstahl, die hemmungslose Aneignung von Natur, noch eines der geringsten der Vergehen ist, das der Gärtner sich und seiner Spezies, dem »Töterich« Mensch, ankreidet. Mit einem immer bloß nachträglichen Naturschutz, mit einer allein auf die Menschengesundheit fixierten Umweltpolitik wird eine Überwindung der globalen Krise nicht zu haben sein.
Und so sind Salzingers ökologie- und zivilisationskritische Überlegungen auch nicht geeignet, die grassierende Öko-Schmuse-Welle zu stärken, den naiven Glauben an eine Rettung durch Umwelttechnik, die bloß richtig eingesetzt werden muss, und alles wendet sich zum Besten. Der Gärtner im Dschungel hat keinen grün getünchten Seelenfrieden zu verkaufen, seine in praktischer Auseinandersetzung mit der Erde, mit der Natur gewonnenen Erfahrungen konfrontieren den Leser eher mit dem Gegenteil: Ohne eine Weltrevolution der Seele, ohne eine Veränderung des Innersten, des Bewusstseins, ohne eine radikale Umwertung aller Werte und vor allem seines, des Menschen, Wert als »Maß aller Dinge«, muss jede globale Versöhnung mit der Natur ein frommer Wunsch bleiben.
»Die städtische Intelligenz hat unterm Schock von Tschernobyl die Natur wiederentdeckt und ist gegenwärtig dabei, sich ihrer als Gegenstand der Betrachtung und Reflexion zu bemächtigen, wobei sie herausgefunden hat, dass es sich gar nicht um die so gern und lange geschmähte Idylle handelt, die sie sonst unausweichlich mit dem Begriff Natur assoziiert hatte. Sie entdeckt vielmehr, dass es da auf Leben und Tod zugeht, nutzt aber diesen epochalen Fund lediglich dazu, die alte Scheinfront wieder aufzubauen. Als sei es um »richtig« oder »falsch« verstandene Natur zu tun, wobei, nachdem sie endlich »richtig« verstanden worden sei, endlich auch wieder die Frage aufgeworfen werden könnte, wie sich ihr gegenüber der Mensch zu behaupten habe. Was sie einfach nicht wahrhaben will, diese Intelligenz, ist die Einsicht, dass es der Fragen nach dem Menschen endlich genug und die Zeit der Antwort gekommen ist. Wer sie weiterhin stellt, betreibt auch weiterhin den Ausverkauf der Natur, es sei denn, er akzeptiere die untergeordnete Rolle des Menschen im ökologischen Zusammenspiel des Lebens, die möglicherweise darin besteht, eine bestimmte Spielart aktiver Intelligenz auf der Erde auszuprobieren, möglicherweise aber auch nur darin, das ökologische Gleichgewicht auf der Erde zu stören, zu wessen Gunsten auch immer. Wenn schon nicht zum Nachteil des Ganzen. Es geht um nichts weniger als um die Verabschiedung des Menschen aus der Geschichte.«
In Passagen wie diesen mag Pessimismus vom Schlage eines E. M. Cioran durchschimmern, demzufolge die Natur, als sie den Menschen zuließ, einen Anschlag auf sich selbst verübte; dennoch reiht sich dieses Buch nicht in jene Reihe von »Schwarzbüchern« der Menschheit ein, die als einzig wirksamen Naturschutz für die Selbstabschaffung des »Krebsgeschwürs Mensch« plädieren. Salzingers praktische Erfahrungen mit Un-Kraut und Un-Geziefer, mit der wuchernden und wimmelnden Intelligenz der Biosphäre führen eher zu dem Schluss, dass es mit der Intelligenz des Menschen nicht sehr viel weiter her ist als mit der einer Laus. Und dass er nur überleben kann, wenn er sich seiner Läusehaftigkeit wieder erinnert, und dabei alles, was kreucht und fleucht und krabbelt, als grundsätzlich gleichwertig anerkennt. Menschenrechte für Pflanzen und Tiere – in seinem Garten hat Helmut Salzinger versucht, sie zu gewährleisten, ohne seine Rechte als Mensch dabei aufzugeben. Wenn die Lust auf Stachelbeeren siegte, muss, bei aller Ehrfurcht vor dem Leben, durchaus mal die biologische Giftspritze her, um der Läuseplage Herr zu werden.
Ich scheue mich nicht, dieses kleine Gartenbuch große Literatur zu nennen. Nicht nur, weil es das fundamentale Thema schlechthin behandelt – mit dem ersten Spatenstich begann alles, was wir heute Kultur nennen, die Kultivierung und Kontrolle des Territoriums und des Lebens –, sondern weil es dies aus praktischer Erfahrung tut, und in einem klaren, transparenten Stil, der die aus der Anschauung von Mikro-Ereignissen gewonnenen großen und tiefen Einsichten ohne Pathos vermittelt. Als Sachbuch enthält es mehr Information über die Natur als viele naturwissenschaftliche Werke; als kulturgeschichtlicher Essay verhandelt es nicht weniger als die Grundbedingungen des Menschseins; als Gartenbuch enthält es eine Vielzahl praktischer Tipps; und als einfacher Bericht von einem, der auszog, auf dem Lande zu leben, ist es beste, weil Geschichten erzählende Literatur. »Unkraut«, meinte einst Henry Miller, »ist die weiseste aller Lebensformen«. Helmut Salzinger hat einiges davon abbekommen. Und so hat er geschrieben wie eine Feldmaus buddelt – nicht nur Stadtratten können viel bei ihr lernen.
Für Klaus Modick,
der mich ermutigte, dies Buch zu beginnen,
und für Eugen Pletsch,
der mich ermunterte, es abzuschließen.
Von Mo – Eine Geschichte
Einmal gab es zwei Krötenfamilien in meinem Garten. Zwei dicke Mutterkröten, behäbig und besonnen, und unzählige Kinderkröten, die mir oft vor Schreck bei meinem plötzlichen Erscheinen auf die Füße sprangen.
Das war ein schönes Jahr.
Der Gärtner im Dschungel
Ich kenne ein Gartenbuch, dessen Verfasser hat nie im Leben Hacke oder Spaten in der Hand gehabt, geschweige damit im Garten gearbeitet. Noch dazu erhebt es den Anspruch, Anleitungen für ein ›anderes‹, ein ›alternatives‹, biologisch oder ökologisch schonendes Gärtnern, selbstverständlich ›ohne Gift‹, zu geben.
Soweit ich es beurteilen kann, ist alles, was in diesem Buch steht, richtig. Dennoch ist es unbrauchbar, eben weil, wie ich gehört habe, der Verfasser noch nie im Leben einen Spaten oder dergleichen in der Hand gehabt hat. Es fehlt dem Buch ganz entschieden an jeglichem praktischen Wissen in der Gärtnerei. Es liest sich, als seien sämtliche objektivierbaren Sachverhalte, die es über Gärten zu wissen gibt, an einen Computer verfüttert und von diesem anschließend wieder ausgeschissen worden.
Es gibt andererseits auch Gartenbücher, deren Verfasser ihr ganzes Wissen aus persönlicher Erfahrung im eigenen Garten geholt haben und die dennoch unbrauchbar sind, jedenfalls für mich, hier, weil die hiesigen Witterungs- und Bodenverhältnisse sich von denen in der Region, wo die Verfasser dieser Gartenbücher ihre Erfahrungen gesammelt haben, stark unterscheiden, was gelegentlich zur Folge hat, dass ihre gärtnerischen Anweisungen oder Ratschläge, von mir hier angewandt, zu totalen Misserfolgen führen.
Ein gutes Gartenbuch kommt allein aus der Erfahrung. Mit entsprechenden Konsequenzen für die Handlungsanweisungen, die gewöhnlich auf die Empfehlung hinauslaufen, die eigenen Erfahrungen gefälligst selber zu machen.
Es ist ja auch immer noch die Frage, warum einer einen Garten macht. Das klassische Statement meiner Nachbarin, als sie den ihren aufgab »Aldi ist billiger!«, ist ja wahr. Ohnehin kann meine Nachbarin Qualität sich nur in Form von sehr großen Mengen vorstellen. Dennoch war nicht dies der wirkliche Grund, warum sie ihren Garten aufgab. Der lag vielmehr in der Tatsache, dass sie dermaßen dick geworden war, dass sie aus eigener Kraft nicht wieder hochkam, wenn sie sich mal gebückt hatte. Und ohne sich zu bücken, geht im Garten nichts.
Es gibt ein paar weltberühmte Beispiele für Schriftsteller mit Gärten, in denen gut zu betrachten und zu denken war, auch übern Zaun und die sonstigen Begrenzungen des eigenen Gartens hinaus. Bei Goethe und Hesse wird man indessen bald gewahr, dass sie höchstens wie der berühmte Adenauer, der allerdings kein Schriftsteller war, mit der Rosenschere herumgegangen sind, Triebe stutzten und Blüten schnitten, um sie alsdann zu betrachten. Fürs Grobe im Garten gab’s dienstbare Geister, die das erledigten. Ernst Jünger hingegen, in seinem Gemüsegarten zu Kirchhorst, hat selber zugefasst und umgegraben und auch die Schweißtropfen auf seiner Stirne nicht verschwiegen, – ohne sie überzubewerten. Sie gehören seit alters her zur Sache und sind daher erwähnenswert.
Jünger, Hesse und Goethe erweisen sich nur als die Spitzen eines Eisbergs. Genau genommen steht ein Buch über Land- und Gartenbau (was damals, gegen 700 vor Christus, noch nicht säuberlich unterschieden zu werden brauchte) am Beginn der schriftlich festgehaltenen abendländischen Literatur: Hesiods Lehrgedicht Werke und Tage. Obwohl Hesiod hier durchaus als Praktiker spricht, wendet er sich doch an Leute, die lesen können, welche Fähigkeit vor zweitausendsiebenhundert Jahren bei der Landbevölkerung wohl kaum vorausgesetzt werden darf, so dass ausgerechnet der Stand des Bauern und Gärtners aus seinem Publikum ausscheidet. Vielleicht ist dieser Verlust ein Indiz für eine weniger starke Praxisbezogenheit des Werkes als ihm gewöhnlich beigemessen wird. Es wäre dann doch weit mehr Dichtung als Lehr- und Handbuch, und die Spannung zwischen diesen beiden Polen bestimmt die reiche abendländische Gartenliteratur bis auf den heutigen Tag.
Ein Großteil der antiken Werke über den Land- und Gartenbau von Nikander (2.Jh.v.Chr.) über Cato d.Ä. (234-149), Varro (116-27) und Vergil (70-19) bis Columella (1.Jh.n.Chr.) und Palladius (4.Jh.n.Chr.) ist von Intellektuellen verfasst worden, deren Kenntnisse über den Gegenstand teils auf ihrer bäuerlichen Herkunft oder ihrem Stand als Grundbesitzer, teils aber auch auf dem Studium der einschlägigen Literatur beruhte. Auch Walahfrid Strabo (808/9-849), Abt der Reichenau und Verfasser eines lateinischen Gedichts über den eigenen Kräutergarten im Kloster, war ein Intellektueller, und zwar einer der hervorragendsten seiner Zeit; doch im Unterschied zu allen früheren Autoren betont er die Rolle der eigenen Erfahrung an seinem Werk: »… nicht landläufiger Rede Erkenntnis/Und nicht allein Lektüre, die schöpft aus den Büchern der Alten:/Arbeit und eifrige Neigung vielmehr … / … haben dies mich gelehrt durch eigene Erfahrung« (Vers 15-19).
Strabos Hortulus beschreibt nicht bloß den Anbau, sondern auch die Anwendung der Kräuter, vornehmlich zu medizinischen Zwecken. Parallelen zu anderen zeitgenössischen Werken wie beispielsweise dem Capitulare de villis Karls des Großen, einer Art Verwaltungserlass über die Bewirtschaftung der Krongüter, deuten darauf hin, dass sich hier ein bestimmter Pflanzenkanon ausbildete, der für das spätere Mittelalter grundlegend wurde und den Rang der Klostermedizin begründete.
Das Prinzip der Prüfung von Überliefertem durch eigene Erfahrung hat sich bis heute bewährt und gehalten. Die Klosterfrauen der Abtei Fulda, die in den Notzeiten nach dem letzten Krieg zum Gartenbau, und zwar einem – wie man heute sagt – strikt biologischen, gefunden haben, machen alles selber, auch ihre Bücher über den Gartenbau, in denen alles nach den Regeln der Kunst ausprobiert ist. Das macht, dass die Gartenbüchlein der Abtei Fulda in praktischer Hinsicht unübertroffen sind.
Während ich noch dabei bin, die Arbeit dieser geistlichen Gärtnerinnen zu loben, hat mein Garten, der ihren Gartenbüchern eine Menge zu verdanken hat, begonnen sich zu verselbständigen. Was auf diesem Fleckchen Erde wachsen will, das darf hier wachsen. Inzwischen ist es längst dabei, die Grenzen des engeren Gartenverständnisses zu überschreiten und ein Platz für allerlei Getier zu werden. Eins von diesen Tieren bin ich selber, der Bücherschreiber, ein Wurm.
Es gibt einen Käfer, der heißt Buchdrucker und macht Bäume tot. Daran ist ja was Wahres. Damit Bücher gedruckt werden können, müssen Bäume sterben. Zwar werden sie inzwischen eigens zu diesem Zwecke angebaut, doch wird auch dadurch die natürliche Vegetation beeinträchtigt, die sich entwickeln würde, wo jetzt die Pappelplantagen sich erstrecken: ein lebendiger, artenreicher Mischwald vielleicht, urwaldartig. Und es ist ja heute bekannt, dass der tropische Regenwald nächst den Ozeanen das artenreichste Ökosystem (man kann es auch Lebewesen, Organismus nennen) der Erde ist. Diese selbst ist ein solches lebendiges System, Lebewesen, was immer Nietzsche in der Fröhlichen Wissenschaft dagegen eingewendet haben mag: »Hüten wir uns, zu denken, dass die Welt ein lebendiges Wesen sei. Wohin sollte sie sich ausdehnen? Wovon sollte sie sich nähren? Wie könnte sie wachsen und sich vermehren? Wir wissen ja ungefähr, was das Organische ist: und wir sollten das unsäglich Abgeleitete, Späte, Seltene, Zufällige, das wir nur auf der Kruste der Erde wahrnehmen, zum Wesentlichen, Allgemeinen, Ewigen umdeuten, wie es jene tun, die das All einen Organismus nennen? Davor ekelt mir.« (109).
Wir sind inzwischen, wo nicht klüger, so doch vorsichtiger geworden, manche von uns. Und wenn wir unsern Planeten Erde als ein lebendiges Wesen erkennen, dann deuten wir ihn mitnichten »zum Wesentlichen, Allgemeinen, Ewigen« um, wie Nietzsche unterstellt, sondern erblicken gerade sein ›unsäglich Abgeleitetes, Spätes, Seltenes, Zufälliges‹, das aber zugleich auch sein Zerbrechliches und Hinfälliges ist, sein Zeitliches und Vorläufiges von unserer eigenen Art. Wir haben den Begriff des Ewigen aus unserem Denkinventar getilgt und können Nietzsches verzweifelten Optimismus bezüglich des Menschen und seiner Möglichkeiten grundsätzlich nicht teilen.
Zwar, Gott ist tot, das stimmt. Doch hat dieses säkulare Ereignis den Menschen nicht zu jenem Übermenschentum befreit, das Nietzsche sich erträumte. Wenn wir etwas vom Wesen des Menschlichen begriffen haben, dann dieses: dass der Mensch als Natur- und Lebewesen von keinerlei Bestimmung über die Erde gesetzt ist, wie es manche von den alten Mythen lehren, sondern dass er von gleicher Art ist wie alles andere Lebendige auch und dass, worin er sich unterscheidet – wenn er es denn tut –, nicht seine Fähigkeit ist, die Erde zu beherrschen, sondern die, sie zu hegen und pflegen als Garten.
In meinem Garten kommt der Buchdrucker nicht vor. Die Bäume, die ich pflanze, befällt er nicht. Dafür wohnt hier ein Buchfink. Durch glückliche Umstände bin ich in den Besitz eines halben Hektars Land samt darauf befindlichen Gebäuden gekommen. Ich hatte eigentlich nur ein Haus gewollt, und das Land wurde mir bald zur Last, da ich es zu halten versuchte wie einen herkömmlichen Rasen, zumindest kurz. Was angesichts meines beschränkten Maschinenparks bald zur Quälerei wurde. Meine Rasenmäher sind sämtlich für eine Wiese dieses Ausmaßes ein paar Nummern zu klein gewesen und zu schwach, und die herkömmliche Sense zu schwingen, das muss einer erst mal gelernt haben. (Inzwischen gibt es Motorsensen, die jeder Idiot bedienen kann und alles niedermachen, was Beine hat.)
Man hat sich diesen unsern oder meinen Garten nicht als das bekannte schwarzerdige Viereck vorzustellen, durch welches schnurgerade Reihen von bestimmten Pflanzen sich ziehen, die nichts als Frucht tragen und das unablässig, sondern einfach als ein Stück Land, auf dem es, nämlich irgendwas, irgendwie wächst. Ein diffuses Phänomen.
Dieser Garten ist weithin ein Produkt des Zufalls. Wir haben bei seiner Anlage keinerlei gartenkulturelles Hintergrundwissen verarbeitet, es sei denn die zufälligen Brocken eines solchen, die sich beiläufig in uns anfanden. Diese Tatsache sollte zur Erkenntnis seiner Besonderheit und Eigentümlichkeit im Bewusstsein gehalten werden.
Nach unserer Absicht wächst und entsteht dieser Garten als Lebensraum für allerlei Pflanzen und Wesen, zugleich als Meditationsraum für mich, der ich ihn anschaue. Darüber öffnet zugleich und verschließt sich mir die Welt. Das Land liegt offen vor meinem Fenster, von dem aus ich einen viele Kilometer weiten, ungehinderten Aus- und Rundblick habe. Diesen Blick in die Weite, in einen Raum, der Himmel und Erde umfasst und weiter so gut wie nichts enthält, wird der aufkommende Garten verwandeln, verengen und verschließen, von einem Ausblick in die Welt zu einem Einblick in dieselbe ummünzen.
Wenn alles gut geht und sofern es mir gelingt, all das zu sehen, was sich zeigt.
Die von einem Außenraum zu einem Innenraum sich verwandelnde Welt bleibt dennoch dieselbe; was sich jedoch verändert, ist nur der Blick, ist mein Verhältnis zu ihr. In einer Welt, die nichts als Außen ist, ein Raum, kann ich mich bloß verlieren, in einer Welt, die innen ist, aber auch finden.
Ein halber Hektar Land, das sind zwei Morgen, fünftausend Quadratmeter, und das ist gar nicht wenig, wenn man Hand anzulegen, diesem Stück der ganzen Erde mit seinen eigenen zwei Händen zu Leibe zu gehen gedenkt, sozusagen jedem Morgen mit einer. Eine sogenannte Resthofstelle ist eine aufgegebene Landwirtschaft, nämlich die Gebäude samt dem Land, auf dem sie stehen und das sie unmittelbar umgibt. Auf diese zwei Morgen Land waren wir nicht gefasst. Wir hatten bloß ein Haus gesucht und waren jetzt damit beschäftigt, es für unsere Bedürfnisse, die wir ja auch erst mal finden mussten, herzurichten. Das brauchte seine Zeit. Also überließen wir das Land zunächst seiner herkömmlichen Bestimmung, nämlich der, von Kühen abgeweidet zu werden. In diesem Fall nicht von eigenen, sondern von denen des Nachbars.
Es war die erste Phase der ›Landflucht‹, anfangs der siebziger Jahre.
Landflucht erwies sich als doppelsinniges Wort. Und als doppelsinniges Phänomen. Für die Leute vom Land bedeutet es Flucht von demselben in die Städte, wo das Leben leichter schien und abwechslungsreicher. Für die Städtebewohner bedeutete es Flucht dorthin. Wir sind als Flüchtlinge hierhergekommen; doch muss ich sagen: wir sind als Nachbarn aufgenommen worden.
Wenn ich hier immer wir sage, dann sind das A., die Frau, und ich, der Mann: und wenn ich immer hier sage, dann ist das Odisheim im Lande Hadeln, im nördlichen Teil des Weser-Elbe- Dreiecks gelegen.
Das sogenannte Weser-Elbe-Dreieck wird durch die Unterläufe und Mündungsbereiche von Elbe und Weser gebildet, sowie durch die Linie Bremen – Hamburg als Grundlinie (große Lösung) beziehungsweise durch die Linie Bremerhaven – Otterndorf (kleine Lösung), jeweils mit Cuxhaven als Spitze. Dieser Landstrich war 1970 die einzige Gegend in Deutschland, die von der Welle der fliehenden Städter noch nicht überschwemmt war, so dass es hier noch zu einigermaßen erschwinglichen Preisen Häuser zu kaufen gab. Der natürliche Grund war der, dass keiner hierhin wollte, und zwar wegen des Klimas. Die Leute gingen lieber in den Süden, wo es wärmer, oder wenigstens nach Ost-Holstein, wo es trockener war.
Nachdem wir uns im Sietland – das ist eine einstige Moorsenke am Rande des Hadler Landes, die heute von den Gemeinden Wanna, Ihlienworth, Steinau und Odisheim besiedelt ist, wo man jahrhundertelang seine liebe Not damit hatte, das Wasser wieder loszuwerden, das von den umgebenden höher liegenden Gebieten hineinlief und sich hier unten sammelte – einigermaßen eingelebt hatten, versuchten wir es selber mit der Landwirtschaft, wenn auch bloß in der einigermaßen beschränkten Form der Schafhaltung.
Schafe bedeuten Zäune, und zwar feste Zäune. Mit den hierzulande üblichen Elektrozäunen, die aus einem einzigen unter Strom gesetzten Draht bestehen und das Rindvieh einigermaßen zurückzuhalten imstande sind, lässt sich gegen Schafe nichts ausrichten. Die sind durch ihre dicke Wolle gegen die Stromschläge geschützt. Schafe haben die Eigenart, beim Fressen einfach geradeaus zu gehen, und sind nur durch unüberwindliche Hindernisse davon abzuhalten, den Platz, auf dem sie sich befinden, zügig zu verlassen. Weil wir so arm waren, konnte ich nur die allerbilligste Art von Zaun errichten, nämlich einen solchen aus Fichtenschwarten, die es bündelweise beim Sägewerk gab, die aber nach einem Jahr im nassen Gras verrottet waren. Zuletzt waren sie so schwach, dass ein Schaf, welches seinen Kopf hindurchgesteckt hatte, um außen an das üppigere Grün zu kommen, und dann einfach weiterging, den Zaun oder Teile von ihm als Halskrause mitschleppte, während sich die anderen freudestrahlend durch die dergestalt entstandene Lücke im Gemüsegarten verteilten, wo sie den frischen Salat abzupften.
Die Schafhaltung erwies sich als recht beschwerlich. Die Schafe vermehrten sich rasch und ungehemmt, während unsere zwei Morgen blieben, wie sie waren. Das heißt, so stimmt das nicht. Sie blieben keineswegs, wie sie waren, sondern wurden rasch kahl gefressen. Jedenfalls reichte es nicht für den Winter. Und als dieser kam, hatten wir für unsere Schafe kein Futter. Nicht zuletzt deswegen, weil mir mein Nachbar schon im Sommer zugesagt hatte, ich könne mich an seiner Silage nach Bedarf bedienen. Auch Heu könne ich von ihm bekommen.
Und so geschah es. Als ich dann einmal in Geschäften verreisen musste, oblag es A., die Schafe zu versorgen. Eines Morgens ging sie, um Heu zu holen, mit der Karre zum Nachbarn hinüber, glitt auf dem Eis aus, stürzte und brach sich das Bein. Da lag sie auf dem Hof, und kein Mensch hörte ihre Hilferufe. Die Fahrer der wenigen vorbeifahrenden Autos, denen sie sich durch Winken bemerkbar zu machen versuchte, winkten freundlich zurück und hielten sie wohl für schon frühmorgens betrunken. Als zufällig nach einer halben Stunde oder so der Bauer des Weges kam, war sie zwar noch bei Besinnung, aber schon beträchtlich unterkühlt.
Ich wurde telefonisch benachrichtigt, und während der Rückfahrt reifte mein Entschluss, unsere sechs Schafe abzuschaffen. Rachsüchtigerweise wollte ich sie alle schlachten lassen, um sie in die Kühltruhe zu stecken. Zum Glück machte unser Schlachter das nicht mit. Zu mehr als dreien ließ er sich nicht herbei, weil er merkte, dass ich nur von Rachegedanken geleitet war. An die drei Alttiere wollte er sowieso nicht heran, und die drei Lämmer, die zu schlachten er sich bereitgefunden hatte, seien, so beklagte er sich bei mir, noch viel zu klein, um schon geschlachtet zu werden. Noch nicht »schlachtreif«, wie er sich ausdrückte. Ihm ging das ganze Unternehmen offensichtlich gegen sein Schlachterethos, und er machte es nur, weil er gerade gewaltig investiert hatte, um sich als Hausschlachter selbständig zu machen. Die drei Muttertiere mussten wir jedenfalls verkaufen, wenn wir sie los sein wollten. Käufer fanden sich rasch, und damit war das Kapitel Schafe für uns erledigt. (Dabei denken wir noch heute wehmütig an Lotte, unser ältestes Mutterschaf, die eine geborene Führernatur war und wahrscheinlich in der neuen Herde nach kurzem Zögern gerufen hatte: alles hört auf mich, woraufhin alles auf sie gehört hatte, womit wir uns zu trösten versuchten. Wiedergesehen haben wir sie nie.)
Folge dieser Unternehmung war, dass ich vom nächsten Frühjahr an wieder gut zwei Morgen Gras kurz zu halten hatte, wenn ich einigermaßen den Überblick behalten wollte, und hierzulande ist das eine Menge Gras.
A. hatte sich zusätzlich zum Küchengarten, der gleich neben dem Haus lag, im äußersten Westen unseres Landes ein Stück Wiese pflügen lassen, um dort einen Gemüsegarten anzulegen, und mir war es verboten, ohne ihre ausdrückliche Genehmigung oder Aufforderung das eine oder das andere Stück zu betreten, geschweige irgendeinen gärtnerischen Handschlag darin zu tun. Sie brauche einen Platz für sich, sagte sie, wo sie tun und lassen konnte, was sie wollte, ohne dass es irgendeinen verdammten Kommentar von mir dazu gab. Wir hatten eine Menge Platz, wenn man berücksichtigt, dass wir nur zu zweit waren, doch es schien immer noch zu wenig zu sein.
Das Ende vom Lied war, dass ich mir mein eigenes Gärtchen nur für mich alleine anlegte, wo ich dann allerdings niemals davor sicher sein konnte, von A. aufgespürt zu werden. Zum Beispiel bei der Ernte.
Oder auch beim Nichtstun.
Ich hatte einen Platz für Beerenbüsche angelegt. Stachel- und Johannisbeere, vor allem schwarze, die wir beide besonders schätzten. Ich hatte diesen Platz mit bloßen Händen freigelegt, die Grasnarbe ausgerissen, um den Büschen Gelegenheit zu geben, sich ungehindert zu entwickeln. Da erwies es sich aber bald als zweckmäßig, den blanken Boden zu mulchen, da er sonst allzu rasch austrocknete, was besonders den schwarzen Johannisbeeren abträglich ist. Sie schätzen einen gut durchfeuchteten Boden, den sie mit reichlich Duft nach Läusen und dicken Früchten danken.
Wenn nicht irgendwas anderes dazwischen kommt, das es verhindert. Im Garten weiß man das nie. Jedenfalls war es ein guter Platz, an dem ich mich gerne aufhielt, und sei es auch nur, dass ich am Grabenrand unterm Wacholder im Gras lag, vorm kalten Ostwind geschützt und von der Frühlingssonne durchwärmt.
Mein selbstgemachtes kleines Paradies, dachte ich dann manchmal. Und dachte weiter: Aber alles geklaut!
Seit jenen Vorgängen im Garten Eden, in deren Verlauf unsere Ureltern samt all ihrem künftigen Nachwuchs offiziell auf ewig verbannt wurden, des Gartens verwiesen, nach draußen gejagt, ins Freie, Offene, Distelige, damit sie dort im Schweiße ihres Angesichts ihr Brot äßen, haftet allem Paradiesischen auf Erden etwas Unverdientes an, als sei es, wenn vorhanden, widerrechtlich erworben, zu Deutsch: geklaut.
In der Tat ist unter uns Liebhabern des Gartens die Unsitte des Ausgrabens und Mitnehmens von anderswo Gewachsenem beinahe schon wieder zur Sitte geworden. Ausgegraben mit allen den Würzlein, wie es schon bei Goethe heißt, wird es zum stillen Haus getragen und dort am mehr oder weniger stillen Ort wieder eingepflanzt, wo es dann meist eingeht. Es muss gar nicht immer der Friedhof oder ein fremder Vorgarten sein, der so geplündert wird; auch das Entnehmen von bestimmten Pflanzen aus der freien Landschaft ist unter Umständen nicht bloß töricht, da die begehrten seltenen Pflanzen einem gewöhnlich zur Zeit der Blüte ins Auge stechen, die aber zu einem derartig brachialen Vorgang wie dem Umpflanzen am wenigsten geeignet ist, nämlich gar nicht (was meinen heftigen Zweifel an der gärtnerischen Sachkunde Goethes in dessen berühmtem Gedicht »Gefunden« nährt), sondern auch, und zwar aus guten Gründen, verboten.
So muss ich gestehen, in den Gründerjahren unseres Gartens sieben junge Kiefern dem entnommen zu haben, was ich damals für freie Landschaft hielt oder richtiger: was ich dafür zu halten mir selber vorgab. In aller Eile schleppte ich sie ins Auto und fuhr damit nach Hause, wo ich sie schön verteilt auf die Wiese pflanzte.
Wie zum Beweis, dass unrecht Gut nicht gedeiht, gingen bis auf eine, die dann allerdings, um das moralisierende Sprichwort Lügen zu strafen, sehr gut gedieh, alle ein. Dies als direkte Folge meines schlechten Gewissens bei der Tat. Ich hatte mir nicht die nötige Zeit genommen, und anstatt, wie es bei Kiefern angebracht ist, die Bäumchen sorgfältig mit dem ganzen Wurzelballen auszugraben, hatte ich sie nur hastig mit dem Spaten gelockert und dann ausgerissen. Damit war der Fall im Grunde schon erledigt. Ich hätte sie gar nicht mehr einzupflanzen brauchen. dass dennoch eine anwuchs, war das unverdiente Glück des Anfängers.
Ein wenig anders verlief es mit den Weidenzweigen, die ich am nahen Seeufer schnitt. Diese, als Stecklinge am Rand der beiden Entwässerungsgräben, die unser Land nach Süden und Norden begrenzen, in den Boden gebracht, entwickelten sich prächtig und bildeten schon im zweiten Jahr die grüne Wand gegen neugierige Blicke, die ich mir von ihnen versprochen hatte. Ganz im Verfolg paradiesischer Vorstellungen gedachten wir solche Wände als Sichtschutz zu brauchen, um auf unserer Wiese nackt in der Sonne liegen und faulenzen zu können, ohne bei etwaigen Beobachtern Anstoß zu erregen.
Dass es auf die Dauer auch mit diesen gesteckten Weiden nicht gut gegangen ist, steht auf einem anderen Blatt. Es ist eine Geschichte, die nichts mit unrechtmäßigem Erwerb zu tun hat, dafür aber mit Mord und Totschlag. Doch davon später.
Zunächst einmal war ich dabei, einigermaßen rat- und planlos über unser Grundstück zu laufen, um mit Hilfe eines kleinen, mittels mehrerer zusammengestöpselter Verlängerungskabel in seinem Wirkungsbereich erweiterten Elektromähers das jahrzehntelang vom Vorbesitzer durch regelmäßige und reichliche Gaben von Kunstdünger übermäßig angeregte Wachstum des Grases im Zaume zu halten.
Es geschah dies keineswegs aus Freude an einem kurzgeschorenen Rasen, sondern in Erinnerung der Quälerei, die es mir einmal verursacht hatte, die ausgewachsene Wiese mit meinem kleinen Wölffchen, das eigentlich wohl nur zur Behandlung einer städtischen Vorgartenwiese von nicht viel mehr als zwei Quadratmetern Fläche bestimmt war, zu mähen. Seither gab ich mir Mühe, das Gras nicht allzu hoch werden zu lassen, wobei mir oft genug das Wetter einen Strich durch die Rechnung machte, indem ein tage-, nicht selten auch wochenlanger Regen das Graswachstum sozusagen beflügelte, das rechtzeitige Schneiden aber dadurch verhinderte, dass das nasse Gras, geschnitten, die Auswurföffnung verklebte und die Drehung des Messers alsbald erstickte.
So musste ich auf besseres Wetter warten und sah mich dann, sobald es gekommen war, wieder einmal zwei Morgen saftigen Grases gegenüber, das, nachdem es in mehrstündigem Hin- und Herzerren des zwar kleinen, aber mit der Zeit immer schwerer werdenden Schneidegerätes endlich niedergemacht war, auch noch zusammengerecht werden musste, was sich der Unebenheiten des Bodens wegen (schließlich handelte es sich ja eben nicht um einen englischen Rasen, sondern um eine ehemalige Viehweide) gleichfalls als recht beschwerlich erwies. Und am Abend, sofern alles gutgegangen war und nicht vorher der Regen wieder angefangen hatte, stand ich vor einer nicht unbeträchtlichen Menge von Grasschnitt, für die es keinerlei Verwendung gab, da – wie ich mich hatte belehren lassen müssen – auch die Kälber dieses Gras nicht fressen. Also ließ ich es, zu einem großen Haufen zusammengekehrt, erst einmal liegen.





























