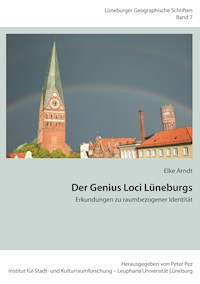
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
'Identität' hat viele Seiten. Eine offensichtlich immer wichtiger werdende Facette beleuchtet die räumlichen Aspekte dieses Themenfeldes: die raumbezogene Identität. Die vorliegende Arbeit untersucht im Rahmen einer qualitativen Studie die Beschaffenheit der raumbezogenen Identität für die Stadt Lüneburg. Die Individualidentität eines Menschen mit ihrem Beitrag für diese raumbezogene Identität und die Ortsidentität, die wiederum einen starken Einfluss auf die persönliche Identität eines Menschen haben kann, sind dabei zu unterscheiden. Wie stellt sich diese Wechselwirkung im Raum Lüneburg dar? Gibt es einen 'Genius Loci' - einen Geist des Ortes - der Lüneburg einzigartig macht? Und zunächst: Wie kann der Begriff der raumbezogenen Identität überhaupt griffig und differenzierend dargestellt werden? Welche historischen und sozialen Strömungen umfasst er und lässt er sich grundsätzlich anwenden? Um Antworten zu finden, begab sich die Verfasserin auf die Suche nach diesem besonderen Geist der Stadt. In Interviews mit Lüneburgerinnen und Lüneburgern wurde sie fündig. Die Autorin selbst ist Wahl-Lüneburgerin und immer wieder erstaunt über die augenscheinlich so homogene Lesart der Stadt und all die positiven Konnotationen, die Bewohner und Besucher gleichermaßen der Stadt zuschreiben. Während ihres Studiums der Kulturwissenschaften mit dem Schwerpunkt Culture, Arts & Media fand die Autorin immer mehr den Zugang zu geographischen und lokal relevanten Themen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 201
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorwort
Einleitung
Forschungsstand und theoretische Verortungen
2.1 Kultur und Stadtkultur
2.2 Identität
2.3 Raumbezogene Identität und ihre Ausprägungen
2.4 Identifikation
2.5 Der Genius Loci
Untersuchungsraum, Methodik und Umsetzung
3.1 Untersuchungsraum
3.2 Bisherige Studien in Lüneburg
3.3 Methodischer Hintergrund
3.4 Aufbau des Samples
3.5 Durchführung
3.6 Auswertungsstrategie
Ergebnisse
4.1 Auswertung nach Dimensionen und Kategorien
4.2 Auswertung nach Interviewten
4.3 Vergleich mit vorherigen Studien in Lüneburg
4.4 Ergebnisse der Interviews in Bezug auf die theoretischen Annahmen
Fazit
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis
Quellenverzeichnis
Anhang
Vorwort
Lüneburg gilt als eine städtebauliche „Perle“ Norddeutschlands. Es war in Mittelalter und früher Neuzeit durch den Salzhandel groß und bedeutend genug, um eine Struktur auszubilden, die heute eine vergleichsweise großflächige Altstadt bildet. Lüneburg war dann während des Zweiten Weltkrieges klein genug, um nicht zum Hauptziel alliierter Bombergeschwader zu werden, wie viele andere deutsche Städte, wodurch die Altstadt zunächst erhalten blieb. Lüneburg war nach dem Weltkrieg aber auch arm genug, damit nicht – wie eigentlich insbesondere angesichts der Senkungsschäden im Salzstockbereich geplant – großflächiger Abriss das Zentrum der Stadt schließlich doch einem Kahlschlag zugeführt hätte. Von der großen städtebaulichen Wende vom Modernismus zur Wertschätzung und zum Erhalt gewachsener (Alt-)Stadtstrukturen ist im Band 6 dieser Schriftenreihe unter Hervorhebung des Wirkungsfeldes der Privatsanierer die Rede. Im nun vorliegenden Beitrag entfernt sich das Augenmerk von den direkt per Beobachtung feststellbaren Raumeinheiten hin zum subjektiven Empfinden der Bewohner_innen. Was verbinden sie mit der Stadt, in der sie leben? Was schätzen sie an ihr? Fühlen sie sich überhaupt wohl und identifizieren sie sich mit ihrer Stadt? Dabei spielt nicht unbedingt nur das Stadtzentrum eine Rolle, allerdings konzentrieren sich im „Herzen der Stadt“ natürlich viele Tätigkeiten der Lebenssegmente Beruf, Einkauf und Freizeit. Hat Lüneburg in dieser Hinsicht einen eigenen Charakter, einen Genius Loci, der eine emotionale Bindung, ein Heimatgefühl schafft? Und woran lässt sich das festmachen? – Fragen, denen die vorliegende Studie auf den Grund geht. Reizvoll daran ist nicht nur das Objekt der Analyse, Lüneburg, sondern auch der Gedanke, dass hiermit ältere und neuere geographische Perspektiven nahtlos miteinander verknüpft werden können. Die Frage nach den Faktoren regionaler Identität beschäftigt die Geographie und die raumorientierte Soziologie schon seit langer Zeit. Mit der temporären Dominanz quantitativ-empirischer Methoden seit Ende der 1960er- und den 1970er-Jahren geriet jedoch die sozio-emotionale Komponente des Raumes stark in den Hintergrund. Mit dem Aufkommen qualitativ-empirischer Methoden, die sich besonders in einer jeweils überschaubaren Zahl von Tiefeninterviews statt Ankreuzbefragungen mit möglichst vielen Personen niederschlagen, änderte sich das Bild; man könnte plakativ formulieren: Es geht nun um „Relevanz statt Repräsentativität“. Mitunter wird vom Methodik-turn gesprochen, in geographischer Perspektive ist eher eine Rückbesinnung und erneute Wertschätzung festzustellen für etwas, das es als Erkenntnismethodik eigentlich immer gegeben hat: das intensive Gespräch. Der methodische Wandel lief parallel mit einer Besinnung darauf, dass die Sichtweise und Bewertung des Raumes ein sozial-emotionaler Prozess ist und deshalb bei einzelnen Personen zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen führen kann. Der Konstruktivismus (insbesondere in seiner interaktionistischen Ausprägung) zeigt auf, dass der „Behälterraum“, d. h. die Erfassung seiner Strukturen und Ausstattungselemente (architektonisch, Nutzungsgelegenheiten, Freiräume, Begrünung u. v. m.) kein hinreichendes Abbild dessen liefern kann, was der Raum für den Menschen bedeutet. Lassen sich trotz der prinzipiellen Unterschiedlichkeit menschlichen Raumerlebens dennoch gemeinsame Züge herauskristallisieren, die als Kennzeichen eines Genius Loci dienen können? Die vorliegende Schrift gibt am Beispiel von Lüneburg hierauf eine Antwort.
Peter Pez
Lüneburg, Januar 2019
1 Einleitung
Seit der Antike war es von existenzieller Bedeutung, mit dem Genius eines jeden Platzes in Einklang zu kommen, an dem das Leben stattfand. Durch den Geist des Ortes, wie Genius Loci übersetzt beschrieben wird, wurde die Kultur der Menschen maßgeblich mitbestimmt.1 Auch heute noch hat man an einigen Orten und in einigen Gegenden das Gefühl, als hätten diese einen besonderen Ortsgeist inne und als wäre es an einigen Plätzen einfacher, mit diesen in Einklang zu kommen, als an anderen. Bei Gesprächen mit Menschen in Lüneburg2 bekommt man schnell den Eindruck, als wäre die Stadt ein solcher Ort, der es einem einfach macht, und als gäbe es etwas Einzigartiges in und an der Stadt, was sie für ihre Bewohner einen ganz besonderen Stellenwert haben lässt. Dazu passt unter anderem der Internetauftritt der Leuphana Universität Lüneburg, auf deren Seiten folgender Text zu lesen ist:
„Lüneburg: Hanseatische und lebendige Stadt. Tausend Jahre Tradition. Lüneburg nimmt Menschen jeden Alters durch seine besondere Atmosphäre für sich ein. Manche sagen von der Stadt, sie erfrische nicht nur durch ihre klare Luft, sondern auch durch den Humor der Einwohner. So bietet Lüneburg den perfekten Wohnort für alle, die zum Arbeiten eine konzentrierte Atmosphäre brauchen und in ihrer Freizeit auf ein lebendiges Flair nicht verzichten wollen.“3
Zwar richtet sich diese leicht übertriebene und stark werbende Beschreibung deutlich an potenzielle Studierende und hat damit einen speziellen Fokus, dennoch wird klar, dass es sich um einen besonderen Ort zu handeln scheint. Jede Universität wirbt für ihren Standort und Lokalpatriotismus gibt es überall, könnte man entgegnen. Dennoch scheint die Sympathie, die die Bewohner Lüneburgs ihrer Stadt entgegenbringen, eine ungewöhnlich starke Ausprägung zu haben – sie bezieht sich nicht nur auf diejenigen, die in dieser Stadt geboren wurden, sondern auch auf viele zugezogene Einwohner. Alle scheinen voll des Lobes zu sein, egal ob Touristen, Studierende, Pendler oder Einheimische. Genau eine solche vermeintliche Selbstverständlichkeit ist es, die im kulturwissenschaftlichen Kontext einer Untersuchung bedarf. Ist die Lesart der Stadt und ihrer Besonderheiten tatsächlich so einseitig positiv und so homogen? Wie funktioniert räumliche Identifikation, im Speziellen hier in und mit Lüneburg? Welchen Anteil hat diese an der Identität der Menschen und welche Rolle spielt die Identität der Stadt selbst dabei? An diese Fragen soll sich in der vorliegenden Ausarbeitung angenähert werden. Dafür wird unter anderem das Bild des Genius Loci beschrieben – welcher Art dieser in Lüneburg ist und wie ihn seine Bewohner empfinden.
Die Verbreitung des Themas Identität in gesellschaftlichen Diskursen ist zudem stets eine Reaktion auf Umbruch-, Befreiungs- und Verlusterfahrungen, die die Menschen gemacht haben. Identität wird dann viel thematisiert, wenn nicht mehr klar ist, was der Begriff eigentlich meint oder für den Einzelnen bedeutet. In geradezu prismatischer Form bündelt das Thema die Folgen der vergangenen und aktuellen Modernisierungsprozesse für die Individuen. Besonders gegen Ende der 1980er-Jahre wurde dem Gebiet viel Aufmerksamkeit gewidmet: Hier zeichneten sich bereits die gesellschaftlichen Umbrüche und sozialen Veränderungen ab, die in den folgenden Jahren die Diskussion beherrschen sollten. Sie blieben nicht folgenlos für das Individuum und sein Selbstverständnis. Eine Diskurskonjunktur zum Thema Identität hat immer auch mit den sich wandelnden gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zu tun, denn in Zeiten stabiler Gegebenheiten hält sich dieses Feld eher im Hintergrund.4 Dass das Jahr 2016 ebenfalls in einen solchen Zeitraum fällt, kann vor der aktuellen politischen Lage5 kaum bezweifelt werden.
Ziel dieser Arbeit ist es, sich über eine theoretische Verortung des Themas diesem Phänomen zunächst anzunähern und daran anschließend konkret und explorativ herauszufinden, wie die Beschaffenheit der raumbezogenen Identität in Lüneburg geartet ist. Eine solche Ausarbeitung kann nicht nur für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler interessant sein, die in der Sozialgeografie beheimatet sind, sondern auch für Entscheider und Planer der Stadt selbst: sei es in den Bereichen des Stadtmarketings und Tourismus, in der Stadt- und Verkehrsplanung, der Stadtentwicklung, in den sozialen Fachbereichen oder anderen Verwaltungsstellen. Aspekte dieses Teilbereiches der menschlichen Identität können genutzt werden, um die Bindung an einen Raum zu erhöhen, zu erhalten, die Partizipation an demselben zu stärken und darüber hinaus neue Bürgerinnen und Bürger zu gewinnen.
Um Aussagen über raumbezogene Identität treffen zu können, muss zunächst definiert werden, worum es sich dabei handelt. Dabei ist von Interesse, wie dieser Begriff bisher rezipiert und erforscht wurde, wie er sich zu anderen, ähnlichen Begriffen abgrenzt und wie die Verfasserin ihn für ihre Studie nutzbringend deutet und anwendet. Bei dem Terminus handelt es sich um ein breites, eigenständiges Forschungsfeld, welches bereits von verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen erforscht wurde. Umso wichtiger ist es, klare Ein- und Ausgrenzungen vorzunehmen, um die extrahierten Kernaussagen und Implikationen hinterher gewinnbringend auf die Ergebnisse der explorativen Studie mit Lüneburgerinnen und Lüneburgern anwenden zu können. Da der Forschungsstand zum Themenfeld der raumbezogenen Identität bereits sehr ausdifferenziert ist, wird die Autorin also zusammenfassend die Erkenntnisse zu den wichtigsten Begriffen aus diesem Gebiete darlegen, jedoch keine vollständige Präsentation der gesamten Materie liefern. Zentrale Arbeiten haben in diesem Feld unter anderem PETER WEICHHART, ROBERT HETTLAGE, DETLEV IPSEN und GRABRIELA B. CHRISTMANN vorgelegt, auf die im Folgenden zurückgegriffen wird.
Konkret wird also zunächst ein Überblick über den theoretischen Forschungsstand zum Thema gegeben (Kap. 2), in welchem die wichtigsten Schlagworte aus dem Feld hergeleitet und erklärt werden. Dies beginnt mit dem grundlegenden Verständnis der Autorin von Kultur und Stadtkultur (Kap. 2.1), gefolgt von dem Oberbegriff Identität, dem Grund für seine Konjunktur sowie einem Überblick über seine Entstehung und die damit verbundenen Probleme. Dazu gehört ein Abschnitt über die verschiedenen Ebenen im Identitätsbildungsprozess und die Unterschiede zwischen personaler und kollektiver Identität (Kap. 2.2). Daran anschließend wird konkret auf das Konstrukt der raumbezogenen Identität mit ihren Ausprägungen eingegangen (Kap. 2.3). Die Autorin differenziert hier zwischen dem Anteil, den die raumbezogene Identität an der Individualidentität des Menschen hat (städtische Identität genannt) und der Identität, die eine Stadt selbst innehaben kann (Stadt- oder Ortsidentität genannt). In Kapitel 2.4 wird das Konzept der Identifikation untersucht – welches als Prozess grundlegend für die Identitätsbildung ist – und auf den Raum bezogen. Dazugehörig wird ein Blick auf das Identifikationspotenzial geworfen, welches Räume innehaben können. Abschließend erfolgt ein Überblick über den Terminus Genius Loci (Kap. 2.5), welcher von den dort vorgestellten Autoren aus verschiedenen Perspektiven hergeleitet und untersucht wurde.
Den nächsten Abschnitt bilden Erläuterungen zum Untersuchungsraum (Kap. 3.1), zu bisherigen Studien in Lüneburg (Kap. 3.2) sowie zur angewandten Methodik der vorliegenden Untersuchung: Methodischer Hintergrund, Aufbau des Samples, die Durchführung und schließlich die Auswertungsstrategie werden in den Kapiteln 3.3 bis 3.6 vorgestellt. Die zentralen Forschungsfragen lauten:
Wie und worüber wird raumbezogene Identität im Sinne der Individualidentität in Lüneburg hergestellt?
Wie und worüber wird raumbezogene Identität im Sinne der Ortsidentität in Lüneburg hergestellt?
Wie verbinden sich Ortsidentität und Identität der Bewohner Lüneburgs?
Zusammengefasst handelt es sich um eine explorative Studie, die mithilfe von leitfaden-gestützten, teilstrukturierten Interviews zum Thema raumbezogene Identität in Lüneburg durchgeführt wurde. Diese Interviews wurden im Rahmen der qualitativen Inhaltsanalyse nach MAYRING kategoriengestützt ausgewertet, interpretiert und auf die theoretischen Vorüberlegungen angewendet.
Ab Kapitel 4 werden die Ergebnisse präsentiert. Diese werden entsprechend des verwendeten Kategoriensystems zunächst in drei Dimensionen eingeteilt: Dimension 1 dient der Beschreibung der Individualidentität der Befragten, in Dimension 2 wird raumbezogene Identität als städtische Identität und in Dimension 3 raumbezogene Identität als Ortsidentität ausgewertet und interpretiert (Kap. 4.1.1 bis 4.1.3). Dies wird ergänzt durch eine Auswertung nach Interviewten selbst unter Kapitel 4.2, um inhaltliche Widersprüche aufzudecken und Besonderheiten einzuordnen. Hieran schließt sich eine Einordnung und ein Vergleich mit den bisherigen Studien an, die bisher mit ähnlichen Themen in Lüneburg durchgeführt worden sind (Kap. 4.3). Darauf aufbauend werden im nächsten Abschnitt (Kap. 4.4) die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung in den theoretischen Befunden und Annahmen, die zu Beginn aufgestellt wurden, verortet. Dafür werden noch mal die drei Forschungsfragen herangezogen und entsprechend der Resultate ausgewertet und beantwortet (Kap. 4.4.1 bis 4.4.3).
Abschließend wird eine Zusammenfassung der Ergebnisse und ein Ausblick präsentiert, in welchem unter anderem mögliche interessante Anknüpfungspunkte für zukünftige, weiterführende Studien genannt und relevante Bezugs- und Zielgruppen beschrieben werden (Kap. 5).
1 Vgl. NORBERG-SCHULZ, Christian (1982): Genius Loci. Landschaft, Lebensraum, Baukunst. Stuttgart, 18 f.
2 Da eine gendersensible Sprache in der Wissenschaft gängige Praxis ist, werden geschlechtsspezifische Zuschreibungen in den Formulierungen dieser Arbeit weitestgehend vermieden. Wo sie dennoch erfolgen, geschieht dies aus Gründen der Abwechslung und der flüssigen, besseren Lesbarkeit. Die Verfasserin weist hier jedoch ausdrücklich darauf hin, dass auch in solchen Fällen selbstverständlich alle Geschlechter – nicht nur männlich und weiblich – gemeint sind.
3 KRAHN, Dörthe (2016): Lüneburg: Hanseatische und lebendige Stadt. Homepage der Leuphana Universität Lüneburg.
URL: http://www.leuphana.de/universitaet/lueneburg.html, Stand: 13.09.2016.
4 Vgl. GÖSCHEL, Albrecht (2006a): Der Forschungsverbund ‚Stadt 2030‘: Planung der Zukunft – Zukunft der Planung. In: Deutsches Institut für Urbanistik (Hg.): Zukunft von Stadt und Region. Band 3: Dimensionen städtischer Identität. Beiträge zum Forschungsverbund ‚Stadt 2030‘. Wiesbaden, 15; KEUPP, Heiner ET AL. (2008): Identitätskonstruktionen. Das Patchwork der Identitäten in der Spätmoderne. Rowohlts Enzyklopädie. Reinbek bei Hamburg, 8 f.
5 Themen wie die ‚Eurokrise‘, die Debatte um Geflüchtete und den Zuzug von Migranten, die diversen internationalen Konflikte und kriegerischen Auseinandersetzungen sowie die veränderte Parteienlandschaft in Deutschland sind nur ein paar Beispiele für den Wandel, in dem sich die Gesellschaft zur Zeit befindet – in Deutschland, aber auch europa- und weltweit. Dennoch wird sich hier aufgrund des Fokus auf die Stadt Lüneburg nur auf die deutsche Gesellschaft beschränkt.
2 Forschungsstand und theoretische Verortungen
Beschäftigt man sich mit dem Feld der raumbezogenen Identität, so müssen – wie bereits angedeutet – zunächst die zugehörigen Begrifflichkeiten mit ihrer jeweiligen Herkunft geklärt sowie Definitionen und Abgrenzungen geliefert werden. Dafür wird hier vorweg ein Überblick über den aktuellen Forschungsstand gegeben. Auch wenn mit diesem kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben wird, da es sich um ein enorm großes Forschungsfeld handelt, so können die folgenden Ausführungen doch dazu beitragen, die wichtigsten und für diese Arbeit relevantesten Ansätze aus den Diskussionen der vergangenen Jahre zu erhellen.
2.1 Kultur und Stadtkultur
Da diese Arbeit zum Abschluss eines kulturwissenschaftlichen Studiums erfolgt, ist es sinnvoll, kurz den hier zugrunde liegenden Kulturbegriff zu erläutern. Nach CHRISTMANN bezeichnet auch die Verfasserin Kultur als ein in kommunikativen Handlungen konstruiertes Gefüge immaterieller und materieller Objektivierungen. Mit materiellen Objektivierungen sind Dinge wie Kleidung, Kunst, Waffen, Technik, Architektur oder Denkmäler gemeint, mit immateriellen Objektivierungen werden Sprache, Wissen, Normen, Religion oder soziale Beziehungen bezeichnet. Kultur funktioniert identitätsstiftend: Sie wird einerseits vom Menschen erschaffen, andererseits erschafft sie den Menschen in seiner jeweiligen Eigenart und Distinktion. Mitglieder einer Kultur können aus der gemeinsamen Vergangenheit Sinn für ihre Existenz beziehen.6
Insofern, als dass Kultur vom Menschen erschaffen wird, können nicht nur Individuen oder Gruppen Kultur oder Kulturen besitzen, sondern auch Räumen wird eine jeweils spezielle Kultur zugeschrieben. Jede Stadt besitzt eine Stadtkultur, die in den übergreifenden kulturellen Kontext von Region und Nation eingebunden ist und der seinerseits wiederum Einfluss auf die Stadtkultur hat. Noch größeren Einfluss auf die Stadtkultur haben stadtinterne Entwicklungen, in deren Rahmen sich eine spezifische Stadtkultur entwickelt. Dies geschieht in einem zeitlichen Ablauf: Die Stadt durchlebt Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, sie ist ein Produkt von Handlungen und kommunikativer Konstruktion. Auch eine Stadtkultur bildet sich mit und durch immaterielle und materielle Objektivierungen sowie durch solche Objektivierungen, die zwischen diesen beiden Polen liegen (beispielsweise Institutionen oder Organisationen).7
Für diese Arbeit ist es relevant, bereits hier den entscheidenden, wenn auch prinzipiell einfach ersichtlichen Unterschied zwischen zwei Bereichen abzustecken: Eine Stadtkultur und daraus sich entwickelnd eine Stadt- oder Ortsidentität, eine Identität der Stadt auf der einen Seite und städtische Identität, die sich in Beschreibungen über die raumbezogene Identität der Stadtbewohner, deren personale, kollektive oder soziale Identität – später auch Individualidentität genannt – manifestiert, auf der anderen Seite. Diese Unterscheidung wird im weiteren Verlauf noch genauer differenziert, auch wenn – wie ebenfalls noch klarer gezeigt werden wird – diese beiden Elemente Überschneidungen und Zusammenhänge besitzen.
2.2 Identität
Zunächst wird weiterführend ein Überblick über das Konstrukt der Identität allgemein gegeben, um die Herleitung zu raumbezogener Identität und ihren Implikationen zu erschließen. Anschließend wird im Speziellen auf die raumbezogene Identität eingegangen.
2.2.1 Konjunktur des Identitätsbegriffes
Identität ist ein Begriff, der seine spezifische Trennschärfe in den letzten Jahren – insbesondere seit den 1980er-Jahren – immer mehr verloren hat. In beinahe allen Abhandlungen zu diesem Thema wird zunächst auf diese Offensichtlichkeit hingewiesen. KEUPP ET AL. schreiben dazu, dass sich der Begriff „in den diffusen Schnittmengen diverser Fach- und Alltagsdiskurse schillernde Bedeutungshöfe eingehandelt“8 habe. Gerade deshalb ist es notwendig zu klären, welche Bedeutungen des Terminus für diese Arbeit zentral sind und an welche Definitionen sich angelehnt wird. Zu dem mehrdimensionalen Gegenstand bestehen interdisziplinär viele Zugänge: philosophisch, psychologisch, soziologisch, kulturwissenschaftlich, historisch, politologisch, kommunikationswissenschaftlich oder geografisch, um nur einige zu nennen.9
Die klassische Frage der Identitätsforschung formulieren KEUPP et AL. wie folgt: „Wer bin ich in einer sozialen Welt, deren Grundriss sich unter Bedingungen der Individualisierung, Pluralisierung und Globalisierung verändert?“10
Dass über das Selbst nachgedacht wird, ist prinzipiell nicht neu. Bereits Sokrates konstatierte: ‚Erkenne dich selbst‘ und rief damit zu einer Reflektion über das Selbstverständnis des Menschen auf.11 Die gesellschaftlichen Prozesse seit Anfang des 20. Jahrhunderts und ihr tiefgreifender Wandel trugen jedoch in besonderem Maße dazu bei, dass sich ein Fokus auf den Begriff der Identität richtete. Sie führten zu persönlichen Brüchen und Identitätszweifeln, da Altbewährtes und lang als stabile Konstante Angesehenes plötzlich nicht mehr zu gelten schien. Aus einer Veränderung des Geschichts- und Fortschrittsverständnisses ergaben sich Statusunsicherheit und ein weniger werdendes Standesbewusstsein der Menschen. Instabilere Zeit- und Raumerfahrungen führten zu immer mehr Außenreizen, die auf den Menschen einwirkten. Es entstanden unpersönliche, offene Verstädterungsräume und eine Unterordnung des rational ordnenden Bewusstseins unter libidinöse Energien, also das sogenannte Lustprinzip. Letzteres bedeutete, dass sich Anreize, Ängste, Ideale und Bedrohungen plötzlich wieder den inneren Triebbedürfnissen unterzuordnen hatten, was seit den Zeiten der Aufklärung als überwunden galt. Dazu kam der Übergang von einer liberalen zu einer staatlich geregelten Marktgesellschaft, was wiederum zu neuen Aufstiegsmöglichkeiten und Grenzverwischung zwischen sozialen Schichten führte.12 Menschen sahen sich immer größeren Identitätsproblemen ausgesetzt, die unter anderem durch Multiperspektivität, Ortlosigkeit, ein steigendes Kontingenzbewusstsein, die Suche nach Erleben und Genießen, Melancholie und Tristesse gekennzeichnet waren. Diese Probleme hingen stark damit zusammen, dass es einen Verlust an stabilen Trägergruppen und sozialen Milieus gab: Über lange Zeit hatten sie das Selbstverständnis der Menschen bestimmt und gefestigt – und ihnen enge Grenzen gesetzt.13
Die Verbreitung und Diskurskonjunktur des Themas ist also, wie in der Einleitung schon angerissen, immer auch eine Reaktion auf die gesellschaftlichen Umbrüche, die die Menschen mitgemacht haben. Handelt es sich um Zeiten mit stabilen Gegebenheiten, kommt es kaum in der öffentlichen Debatte vor.14
2.2.2 Entstehung von Identität
Philosophisch betrachtet wird Identität oft als ein ‚Gleich-sein mit sich selbst‘ beschrieben, abgeleitet vom Ego des Menschen. Sozialwissenschaftlich hingegen wird sie abgeleitet von einer Gruppenzugehörigkeit, die in soziale Interaktionen eingebunden ist.15 Taucht man tiefer in die Forschung dazu ein, so scheinen beide Konstrukte ihre Berechtigung zu haben, denn Identität kann immer nur in der Synthese zwischen der eigenen Individualität auf der einen und den gesellschaftlichen Anforderungen auf der anderen Seite erarbeitet werden. Der Psychologe MEAD formulierte das mit ‚I‘ und ‚Me‘ und es etablierte sich die Erkenntnis, dass „das eigene Selbst erst in einem gegenseitigen Prozess der Kenntnisnahme und Anerkennung der jeweils bedeutsamen anderen (‚selves‘) erfahren wird.“16 Eine Gesamtidentität ist der Dialog zwischen den beiden Instanzen, dem ‚I‘ und dem ‚Me‘, welche ständig von diesen beiden bearbeitet wird. Es entstehen stetig Spannungen, wegen der eine stabilisierende Ordnung in einem selbst gefunden werden muss.17
HETTLAGE erklärt, dass Identität weder ein historisch-biografisches noch von ihren Bestandteilen her einheitliches Gebilde ist. Sie befindet sich in einem andauernden Veränderungsprozess, in welchem stetig auf-, ab- und umgebaut wird, weshalb es besser sei, von Identitäten im Plural zu sprechen.18 Auch für LOTH ist Identität nichts Abgeschlossenes, sie ändert sich stetig im Laufe des Lebens und anhand der vielen Kontexte und Rollen, die Menschen einnehmen. Sie ist dabei das Resultat vergangener Identifikations- bzw. Identifizierungsprozesse19, die je nach Situation und Lebensalter unterschiedlich starke Prägekraft entwickelt haben. Die Biografie, die Werte einer sozialen Gruppe und die Kultur einer Zeit müssen analysiert werden, um umfassenden Zugang zur Identität eines Individuums zu erhalten.20
Für KEUPP ET AL. ist Identität ein subjektiver Konstruktionsprozess, in dem Individuen auf der Suche nach einer Passung zwischen äußerer und innerer Welt sind. Sie müssen unterschiedliche Lebensfelder zu dem Patchwork einer passförmigen Identitätskonstruktion verknüpfen, diese sinnhaft in ihrer Welt verorten und dadurch handlungsfähig werden. Um Identität herzustellen, braucht es spezifische Materialien aus psychischen, sozialen und materiellen Ressourcen. Identitätsbildung ist nicht beliebig, sondern ein aktiver, wenn auch risikoreicher Prozess, der – zumindest in der heutigen Zeit und der westlichen Welt – die Chance zu einer selbstbestimmten Konstruktion enthält.21 Das Versprechen von Identität ist das Gefühl von Kontinuität und Realitätssicherung, sie „akzentuiert sich in einem fortlaufenden Konflikt- und Differenzierungsprozess zwischen sozialer Erwartung und personaler Einzigartigkeit immer wieder neu.“22
Insbesondere in dem Verhältnis der Ich-Identität – also der oben genannten personalen Einzigartigkeit – gegenüber der Wir-Identität – also der Zugehörigkeit zu Familie, früher Stamm oder Dorf – zeigen sich die Veränderungen, die sich im Laufe der Zeit in der Identitätsausbildung der Individuen ergeben haben. In vormodernen Gesellschaften war die Ich-Identität von der Wir-Identität, die weiter unten als kollektive Identität bezeichnet werden wird und noch sehr viel mehr Gruppengefüge mit einschließt, stark überlagert und geprägt. Heute hat sich dieses Verhältnis beinahe umgekehrt. Trotzdem ist die Wir-Identität nicht ganz aufgelöst.23 In einem ersten Individualisierungsschub lösten sich die Einzelnen der heutigen sogenannten westlichen Welt mehr und mehr aus traditionellen Verbänden heraus und vertrauten auf ihre eigene planerische Vernunft. HETTLAGE formuliert das so:
„Je mehr sie [die Einzelnen; Anm. d. Verf.] aus dem Schatten einer ethnischen Identität heraustreten, desto mehr können diese Bindungen […] zurücktreten. Je größer der Spielraum für verschiedenartige Lebenserfahrungen wird, desto ausgeprägter ist auch die Chance der Selbstprofilierung.“24
Die wir-lose Ich-Identität ist der vorherrschende Sozialtypus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts geworden, sie definiert den isolierten Menschen in seiner gewollten oder ungewollten Vereinsamung. Diese Aussage hat auch im beginnenden 21. Jahrhundert nicht an Aktualität verloren. Der Konflikt besteht darin, dass Menschen einerseits Gefühlsbeziehungen zu anderen suchen, sich aber durch die gestiegene Impermanenz vieler Wir-Beziehungen dabei ständig überfordert oder verängstigt fühlen. Die Konsequenzen sind eine immer höhere Selbstkontrolle, verringerte Spontaneität und ein stärkerer Konflikt mit dem Wunsch nach einer gelungenen Wir-Identität.25
Das ungelöste Orientierungs- oder Sinnproblem in der Moderne und der sogenannten Postmoderne erklärt, warum wir heute so unablässig nach dem Was, Woher und Wohin unserer Identität fragen müssen.26 Die Postmoderne beschreibt HETTLAGE so:
„[Die] Hinwendung zum gesellschaftlichen laissez faire, zur Schranken- und Bindungslosigkeit sowie zur Fragmentierung und zum Nihilismus kommt […] einem Verlust der Wirklichkeit oder einem Verzicht auf deren Rahmung gleich.“27
Identität lässt sich aber „nur über die Definition, also die Eingrenzung, Einfassung und Darstellung des Selbst in der Interaktion, gewinnen.“28 Jene Wirklichkeit und ihre Rahmung inklusive aller Abgrenzungstendenzen sind also zentral für die Herausbildung einer Identität.
Das ‚Wer bin ich‘ aus der klassischen Identitätsforschungsfrage muss genau aus diesem Grund immer mehr mit einem ‚Wo bin ich‘ verbunden werden, denn die sich auflösenden Strukturen und die vermehrten Ungewissheiten führen dazu, dass man sich stetig neu vergewissern, verorten und vergegenwärtigen muss. Zugespitzt benennt WÖHLER Ort und Raum als das neue Zentrum der eigenen Identitätsbildung.29 Für die vorliegende Studie bildet diese Herangehensweise die Grundlage, auch wenn für eine umfassende Konzeption von Identität weitere Aspekte als notwendig erachtet werden. Denn psychische und soziale Zugehörigkeit werden durch räumliche Zugehörigkeit stark mitgeprägt. Der erlebte Raum ist die Projektionsfläche für Sentiment und Ich-Identität.30
2.2.3 Ebenen im Identitätsbildungsprozess
Es existieren nach HETTLAGE verschiedene Schichten im Identitätsbildungsprozess. Dazu gehören unter anderem die Familie, die ethnische Abstammung oder moderne, nationalstaatliche und überstaatliche Zusammenschlüsse. Selten sind diese deckungsgleich miteinander. Die Stärkung der einen Schicht bringt nicht automatisch eine Schwächung der anderen, sondern teilweise sogar die Stärkung einer anderen Identitätskomponente mit sich. Sprachgewohnheiten, Abstammung, Religion, Territorialität, historische Kontinuität und kulturelle Eigenarten sind nicht einfach unter eine übergreifende Zentralidentität unterzuordnen, sie können häufig nicht konfliktlos absorbiert werden. Im Gegenteil: Die Balancierung und Integration der verschiedenen Teil-Identitäten im Zeitverlauf ist ein vielfältiger und komplexer Vorgang.31
SCHMITT-EGNER bezeichnet diese Schichten einer humanen Identität als Dimensionen, die durch verschiedene Prozesse entstehen und aufeinander aufbauen. Er geht von der personalen Identität als wichtigster Grunddimension aus, gefolgt von der sozialen Identität, die wiederum von der kollektiven Identität und diese von der kulturellen Identität überlagert wird. Darauf aufbauend entwickeln sich eine historische und schließlich eine territoriale Identität.32





























