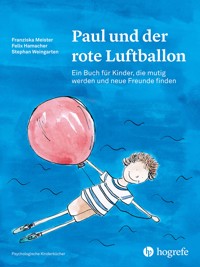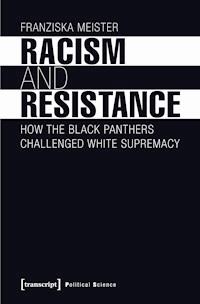19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: zeitkind
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als Paul aus dem Koma erwacht, ist nichts mehr wie zuvor: Sein Freund Joshua ist tot. Und er, Paul, soll dabei gewesen sein, als es geschah. Doch er kann sich nicht erinnern. Dissoziative Amnesie lautet die Diagnose im Unispital Zürich, wo er bis vor kurzem selber als Arzt gearbeitet hat. Damals, bevor ihn der Tod seiner Schwester ein erstes Mal aus der Bahn geworfen hat. Dann lernte er den US-Amerikaner Joshua kennen und begann wieder Fuss zu fassen… Jetzt klammert er sich, von Flashbacks geplagt, an seinen alten Studienfreund Dominik. Doch der ist mehr auf die eigene Karriere fixiert und darauf, LSD in der Psychotherapie zum Durchbruch zu verhelfen. Und wie soll ausgerechnet Florence, Joshuas Schwester, zu Pauls Rettungsanker werden? Auch sie ist verstrickt in diesen Strudel aus Paranoia und Schuld. Es öffnen sich für alle drei biografische Abgründe, aus denen sie sich längst befreit glaubten. Es gibt keinen festen Grund in dieser Geschichte, auch für Florence und Dominik nicht, die wie Paul aus ihrer je eigenen Perspektive erzählen und dabei ein Beziehungsnetz aufspannen, in dem sie sich zunehmend verheddern. Im Kern verhandelt der Roman, was Freundschaft bedeutet und wie fragil sie ist, weil sie auf Vertrauen beruht, das stets aufs Neue enttäuscht, missbraucht und verraten wird – und trotz allem Bestand haben kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 299
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Franziska Meister
Der Geruchvon Lehm
Roman
Unterstützt von:
zeitkind und Autorin danken.
1.Auflage 2025
E-ISBN 978-3-907724-05-7
©2025 zeitkind Verlag, Meilen
Alle Rechte vorbehalten
Cover, Gestaltung und Satz: imholzdesign, Meilen
Coverfoto: 123rf
Lektorat: Valentin Herzog, Basel
E-Book: Bookwire
zeitkind Verlag GmbH
Burgstrasse 86, 8706 Meilen, CH
zeitkind-verlag.ch
Produktsicherheit:
GVA Gemeinsame Verlagsauslieferung Göttingen GmbH & Co. KG
Anna-Vandenhoeck-Ring 36
37081 Göttingen. D
Inhalt
Intensivstation Ende März
Dominik 27. März
Florence 24. April
Paul 24. April
Polizeistation 27. April
Dominik 29. April
Paul 2. Mai
Florence 5. Mai
Polizeistation 9. Mai
Paul 6. Mai
Florence 14. Mai
Paul 18. Mai
Dominik nach Mitte Mai
Florence 6. Juni
Polizeistation 7. Juni
Paul 10. Juni
Polizeistation 9. Juni
Dominik 10. Juni
Florence 22. Juni
Paul 22. Juni
Florence 23. Juni
Dominik 2. Juli
Florence 2. Juli
Paul 2. Juli
Polizeistation 4. Juli
Florence 5. Juli
Dominik 5. Juli
Paul 4./5. Juli
Dominik 5. Juli
Paul 5. Juli
Florence 5. Juli
Intensivstation Im Oktober
IntensivstationEnde März
Vor mir steht ein Junge, in oranges Tuch gewickelt, kahlgeschoren. Blickt mich aus schwarzen Augen an. Sein Mund öffnet sich, formt Ellipsen, Kreise, presst sich zu einem Strich zusammen. Von weit her kommt ein Klopfen, rhythmisch, hell, sind es Klangschalen? Ihre Tonfarbe ändert sich, wird zu einem melodiösen Zweiklang, vertraut wie die weibliche Stimme, die darauf folgt. »Altstetten, Ihre nächste Verbindung: Gleis drei, S zwölf nach Brugg, Abfahrt null Uhr zwanzig…« Wie klein er wirkt, der Junge, als sei er geschrumpft in seinen Tüchern, noch gar nicht fähig, sich in ganzen Sätzen auszudrücken. Dafür hebt er jetzt seine Hände, sie sind zu einer Schale geformt. Daraus wuchern Drähte in bunten Farben, ineinander und um zylindrische Stangen geschlungen, von Klebeband zusammengehalten und mit einem altmodischen Wecker verbunden. Das Tuch des Jungen nimmt ein immer dunkleres Rot an, wird durchtränkt von diesem Rot, tik – tak, es tropft von den Rändern, tik – tak, quillt zwischen den Falten hervor, und mit jedem Ticken wickeln sich die Drahtschlingen eng und enger, schnüren mir die Kehle zu.
- Gleich vorbei, bleiben Sie ruhig, Herr Bärtsch, bleiben Sie ruhig.
- Ich geh wieder auf RASS minus fünf.
- Wir sollten wohl häufiger absaugen.
- Überprüf noch mal die Intubation. Was macht der Blutdruck?
- 98 auf 50.
- Schraub das Artenerol hoch, 40 Mikrogramm.
Schon wieder Regen. Dicke Tropfen – von wegen vierzig Mikrogramm. Sie prasseln auf das Blätterdach hoch über mir, und mir ist, als wäre meine Haut dort oben aufgespannt, nass und löchrig. Seltsame Tropfen. Aus ihnen dringen Laute, als flüsterten sie, aber ihre Stimmen ergeben keinen Sinn. Und warum hängt da zwischen den Baumwipfeln ein Gesicht? Ein gigantisches Oval aus Stein, die Augen geschlossen, in den Mundwinkeln ein Lächeln. Unheimlich wirkt es, und doch vertraut. Die Lider sind zu, aber es starrt mich an, zurrt mich fest… schwillt an, als wolle sein Blick sich in den meinen schrauben…
- Bin spät dran. Fünf Zentimeter Neuschnee über Nacht, und die Stadt versinkt im Chaos. Wann war die letzte Kontrolle der Analgosedierung?
- Vor einer Stunde, durch Reiben am Sternum. Wir sind immer noch auf RASS minus fünf.
- Hm, die Entzündungswerte gefallen mir gar nicht. Wie lange liegt er jetzt schon mit offenem Bauchraum da?
- Die Not-OP war in der Nacht von Samstag auf Sonntag… heute ist Mittwoch.
- Was wissen wir nochmal über den Patienten?
- Paul Bärtsch, 43. Von der Sanität kurz vor ein Uhr morgens eingeliefert, zusammen mit einem zweiten Verletzten. Beide lagen bewusstlos hinter dem Bahnhof Altstetten.
- Was ist mit dem andern?
- Exitus auf der Notaufnahme.
Dieses Gesicht… ich kann nicht wegschauen, muss zusehen, wie sein Mund sich langsam öffnet, die Wangen hohl werden, höre, wie auch der Klang sich wandelt, sich hochschraubt, piept, vibriert, bis dem Mund nurmehr ein Röcheln entschlüpft, ein letztes Fauchen, bevor er an den Rändern zu bröckeln beginnt… Exitus… Joshua! Blut! Warum ist da so viel Blut in deinem Gesicht?… Und an meinen Händen auch…
- Behalte das Propofol weiterhin auf 320 Milligramm pro Stunde. Das Sufentanil kannst du auf 64 Mikrogramm erhöhen, mir scheint, er hat noch immer Schmerzen.
Schwarz. Um mich ist dämmrige Schattenwelt, es tropft und rinnsalt die engstehenden Wände herab. Fahle Strahlen dringen durch Lücken und Löcher, vor mir erahne ich die Umrisse von Quadraten, sie reihen sich aneinander, klein und eng, ein sich verjüngender Korridor, der auf einen hellen Fluchtpunkt zuläuft. Und ich weiß mit einer Gewissheit, wie ich sie noch nie zuvor gespürt habe: Dort muss ich hin.
- Puls?
- Negativ.
- Kammerflimmern. Schnell, den Defi –
Meine Beine sind schwer, so schwer. Sie fühlen sich an wie taub. Verklumpt mit dem Untergrund. Muss kämpfen. Was ist bloß da unten – Adiletten? Wie Kletten klammern sie sich an den Füßen fest… Oh nein, was ist das… als erwachte die Gruft um mich herum. Ich spüre sie atmen, da ist ein Knirschen, ein Ächzen und Würgen im Gestein, und auch ich atme plötzlich modriges Lehmbraun. Ein Schleier, der sich senkt, er legt sich auf die Haut, sickert durch sie durch wie durch ein Sieb, rieselt in Lungenbläschen, schwemmt Rachen, Nase, Mund und Zunge zu. Alles lähmender Lehm.
- Und nochmal: Drei, zwei, eins –
Ist das Joshua, der dort vorne im Licht steht? Fast durchsichtig wirkt er, und winkt…
- Was ist mit Angehörigen?
- Nur der Vater, ich habe ihm nach der Reanimation vor drei Tagen erneut auf Band gesprochen. Er hat nicht reagiert. Aber dieser Lüscher von der Kripo war gestern wieder da und wollte mit dem Patienten sprechen.
- Schick ihn zu mir, wenn er wieder kommt.
Warm. Mir ist so warm. Als wäre ich in Watte gepackt. Umhüllt und eins geworden mit dem Wald wie die Ruinen, sie sind mir wohlgesonnen, ich spürs in den Gesichtern auf den Türmen. Alles so leicht, so licht. Orange… wo ist eigentlich der Junge?
- Wie war die Spontanatmung in der letzten Aufwachphase?
- Stabil. Auch die Entzündungswerte kommen runter. Willst du noch einen Blick auf die Wunde werfen?
- Schöne Naht. Dann beenden wir jetzt die Intubation. Das Propofol kannst du auch ausschleichen.
Grün. Warum schimmern die Augen des Jungen auf einmal in diesem Grünton? Als blickte ich in einen Spiegel… als wäre dies… der Dschungel, die Bäume, die Ruinen… Alles um mich beginnt zu tanzen, wird zum pulsierenden Rhythmus, der über den wippenden Wipfeln und im Schädel dröhnt. Reiß die Augen auf! Der Junge steht wieder da. Diesmal spielt ein Lächeln um seine Mundwinkel, gütig, wie das der steinernen Gesichter der Tempel ringsum, sie blicken mir aus den Augen des Jungen entgegen. Zwei Pillen liegen in seiner ausgestreckten Hand, eine rot, eine blau.
- Herr Bärtsch?
Rot, blau, macht alles keinen Unterschied. Ich schlucke keine bunten Pillen.
- Herr Bärtsch, guten Morgen. Es ist Montag, kurz vor acht Uhr. Wir befinden uns hier auf der Intensivstation im Unispital Zürich. Sie lagen acht Tage im künstlichen Koma. Schön, sind Sie wieder da.
Dominik27. März
Später, als es längst kein Zurück mehr gab, fragte ich mich immer wieder, wie sich die Dinge entwickelt hätten, wenn ich nicht durch diese Tür getreten wäre. War die doppelt gezogene rote Linie am Boden nicht Warnung genug gewesen? Im Traum hätte ich sie gleich als solche erkannt. Berufsironie, sozusagen.
Wir hatten uns längst aus den Augen verloren. Aber die Nachricht, Paul liege auf der Intensivstation, hatte meine Schritte gleich hierher gelenkt. Jetzt rutschte ich eine gefühlte Ewigkeit auf diesem Stuhl herum, eingequetscht zwischen blubberndem Aquarium und beblumten Toilettentüren, und wartete darauf, dass der andere herauskäme – herein, vielmehr, in diese Zwischenzone im Südtrakt B des Universitätsspitals, die mich zermürbte wie der Umstand, dass man Besucher auf der Intensivstation nur tröpfchenweise zu den Kranken ließ. Ja, ich war gekränkt, dass man auch mich warten ließ, als Psychiater, der von derselben Universität angestellt war. Etwas überempfindlich offenbar, mein Berufsego war ohnehin angekratzt, aber durfte ich es deswegen gleich über die Sorge um einen Menschen stellen, der mir einst nahe gestanden hatte? Das hier war doch kein Pflichtbesuch. Und trotzdem schürte das Warten meinen Missmut, ich spürte ihn wachsen mit jeder Minute, als zöge ich meine Runden wie die Buntbarsche in ihrem gläsernen Käfig, in Endlosschlaufe und immer gegen den Strom. Beruf: Buntbarsch. Aktuell nötigte man mich erst zu einer Zusatzschlaufe in meiner Karriere. Und dann? Was, wenn es ein Fehler gewesen war, von der renommierten Johns Hopkins University in Baltimore zurück nach Zürich zu wechseln, wo die Professur nur als unverbindliches Versprechen vom akademischen Himmel winkte?
Die Aussicht, aus dem Labor in Baltimore herauszukommen, war einfach zu verlockend gewesen. Ich hatte mich verrannt, gebannt gleichermaßen von Apparaten, die mich tief in das menschliche Gehirn blicken ließen und Psychedelika wie LSD und Psilocybin, deren Wirkung ich dort verfolgte, bis hinein ins Claustrum, die letzte terra incognita, um dem Rätsel des menschlichen Bewusstseins auf die Spur zu kommen. War hereingefallen, letztlich, auf das Versprechen, alles messen, aus Daten pressen und in Modelle fassen zu können. Stets hatte ich mir für meine Untersuchungen aus einem Reservoir begeisterter Freiwilliger die Gesundesten und Geeignetsten herauspicken können, hatte Studie an Studie gereiht, in hochrangigen Fachzeitschriften publiziert, und hätte umgekehrt ob all der Weiterbildungen in Neurobiologie, Philosophie und Psychologie fast vergessen, was ich eigentlich war – ein Arzt, der kranken Menschen helfen, sie heilen wollte.
Gut, ich stand im Hörsaal jetzt, immerhin, vor Studierenden, die statt am Smartphone an meinen Lippen hingen, wenn ich meine Laborexperimente extrapolierte. Wenn ich ihnen mikrodosiert in historischen Miniaturen von der amerikanischen Überheblichkeit erzählte, die Militär und Geheimdienst im Kalten Krieg davon träumen ließen, Lysergsäurediethylamid als Waffe zur Gedankenkontrolle einzusetzen, nur, um den Stoff postwendend zu verbieten, als Timothy Leary ihn in den Sechzigerjahren als Mittel zur geistigen Befreiung zu propagieren begann. Was war das letzte Woche für eine Gaudi im Hörsaal gewesen, als ich Filmausschnitte einspielte, von Kompanien, stramm stehenden, die sich aus der Luft mit LSD besprühen ließen, später sah man sie aufgelöst kichernd über den Exerzierplatz torkeln. Die Studierenden sollten den Zynismus spüren, der sich hinter dem politisch motivierten Verbot von damals verbarg. Es hatte sämtliche Forschungsleinen in der Psychiatrie so radikal gekappt, dass selbst hierzulande, an ihrem Nabel sozusagen, die Forschung auf Jahrzehnte hinaus zwangshibernierte und ihre bahnbrechenden Resultate in Vergessenheit gerieten.
Meine Mission war klar: Ich wollte alles daran setzen, diesen Tiefschlaf endgültig zu beenden, angefangen mit ein paar Lektionen zu den Folgen von Albert Hofmanns Selbstversuch anno 1943 und einem Schweizer Pharmakonzern, der den halluzinogenen Stoff großzügig und gratis an alle verteilte, die damit experimentieren wollten – mit spektakulärem Erfolg: Mehr als tausend Studien mit Zehntausenden von Menschen bezeugten in weniger als zwei Jahrzehnten, dass LSD von Angststörungen und Depressionen, Sucht und Zwangsneurosen befreit. Ein paar Hartnäckige hatten ihre Untersuchungen im Labor nach dem quasi globalen Verbot fortgeführt, sich für Therapiemöglichkeiten engagiert, vor allem in der Schweiz, und waren so zu Pionieren einer neuen Generation gewachsen. Die Konkurrenz schlief nicht länger. In den USA hatten mich die Kollegen beneidet, würde ich mit meinen Laborerfahrungen doch dort andocken können, wo therapeutische Ansätze mit Psychedelika am weitesten fortgeschritten waren.
Und jetzt sollte ich erneut erst einmal mit gesunden Freiwilligen arbeiten. Man ließ mich mit LSD nicht zu den Patienten, dazwischen baute sich im Gegenteil eine wachsende Phalanx juristischer und bürokratischer Hürden auf, die zu nehmen man offenbar mir überließ. Warum begriffen sie in der Klinikleitung nicht, dass ich die richtigen Studien aus den USA mitbrachte, um ihnen den Durchbruch in die Praxis zu ermöglichen? Dass ich fähig wäre, wenn man mich nur ließe, die individuell optimierte Dosis zu ermitteln, das maßgeschneiderte Musikprogramm für den perfekten Trip mit dem nachhaltigsten Effekt?
Schritte kamen näher, endlich, und rissen mich aus dem Bann der Buntbarsche im Aquarium. Um die Ecke trat ein kleiner, drahtiger Mann, dessen flinke Augen sich sogleich auf mich fixierten.
»Sie wollen zu Paul Bärtsch?«
Es klang nicht wie eine Frage.
»Mein Name ist Lüscher, Kriminalpolizei Zürich. In welcher Verbindung stehen Sie zu Herrn Bärtsch?«
»Hören Sie, ich habe ihn seit über sechs Jahren nicht mehr gesehen, ich war im Ausland…«
»Verwandt?«
»Wir haben zusammen studiert.«
»Befreundet also.«
»Wie gesagt, wir hatten lange keinen Kontakt mehr.«
Ich war nicht sicher, ob ich mochte, was da eben über meine Lippen gekommen war, noch ob mir gefiel, was es über mich aussagte. Und ich war verwirrt. »Worum geht es hier überhaupt?«
»Herr Bärtsch wurde beim Bahnhof Altstetten neben einem anderen Mann schwer verletzt aufgefunden. Der andere ist tot und Bärtsch behauptet, sich an nichts erinnern zu können. Mir würde nur schon helfen, wenn Sie, Herr –«
»Castell«
»Wenn Sie also, Herr Castell, wüssten, mit wem er sonst noch in Kontakt stand: Familie, Freunde, Arbeitskollegen – bis jetzt konnten wir niemanden ausfindig machen. Außer dem Vater, der die Beziehung zum Sohn aber schon vor Jahrzehnten abgebrochen habe, wie er uns wissen ließ. Vielleicht kennen Sie ja die Hintergründe?«
Ich massierte mir noch den Bart, da war er längst gegangen, hatte mir nur seine Visitenkarte in die Hand gedrückt, auf die ich nun starrte, nachdem ich zu keiner seiner weiteren Fragen mehr als die Schultern hatte hochziehen können. Warum saß ich überhaupt hier vor der Intensivstation? An Paul, und das irritierte mich gerade, hatte ich kein einziges Mal gedacht, seit ich wieder in Zürich lebte. Bis gestern, am Rand einer Konferenz, Jespersen auf mich zugekommen war, inzwischen Leiter der Neurochirurgischen, wo Paul und ich damals einen Teil unserer Weiterbildung zum Facharzt durchgestanden hatten. Eine Tortur war es gewesen, das martialische Bohren und Sägen, dann der Anblick dieser gräulichen, glibberigen Masse, viel zu intim, und seltsam abstoßend, zumindest für mich. Paul hingegen war im OP hängengeblieben, war erst Assistenz-, später Oberarzt im Team von Jespersen geworden. Bevor ihn dieser, Jespersen hatte im Gespräch um passende Worte gerungen, hatte beurlauben müssen.
Gehen Sie ihn besuchen, Castell, hatte er gesagt, Sie waren doch sein Freund.
Und jetzt löcherte mich dieser Polizist mit dem unangenehm stechenden Blick mit Fragen, zu denen sich weitere gesellten, meine, ich spürte sie im Bauch rumoren und wagte doch nicht, sie auch im Kopf auszuformulieren. Sollte ich mich da wirklich mit hineinziehen lassen? Nur diese Glastür trennte mich von Paul, doch mein damaliger Freund – falls wir das überhaupt gewesen waren: Freunde – rückte gerade in immer weitere Ferne, begann sich aufzulösen in eine nurmehr blasse Vorstellung, die ich bewahren könnte, auch wenn ich mich jetzt abwandte und wegginge.
Der Körper, den ich zwischen Rollgestellen mit technischen Apparaten, Monitoren, Plastikbeuteln und Dutzenden von Schläuchen entdeckte, lag kleiderlos und doch nicht nackt, denn da rankten sich Riemen pneumologischer Stützstrümpfe von den Knöcheln über die Knie bis hoch zum einzigen Stück Stoff über der Scham, unter dem ein Katheterschlauch wegführte, und auf der Brust verteilten sich EKG-Elektroden wie bunte Ansteckknöpfe. Wie heiß es war hier drin, und wie fremd mir alles schien, trübe Reminiszenzen aus ferner Ausbildungszeit. Vom Nebenbett, notdürftig abgeschirmt mit einer mobilen Stellwand, schwappte ein vielstimmiges Piepen, Fauchen und Flüstern von Apparaten und Menschen herüber.
Das Gesicht wirkte käsig, aufgedunsen. Ich spürte meinen flachen Atem, zählte gegen das Sirren in den Ohren an, die sich anbahnende Übelkeit, warum ging ich nicht einfach wieder? Der Mann im Bett hielt die Augen geschlossen, er schien mir unendlich fremd. Bis mein Blick sich in einem dieser braunen Haarbüschel verfing.
Struppig. Es war das erste Wort, das mir damals eingefallen war, als dieser Bursche vor unserer WG-Tür im Seefeld stand, ein streunender Straßenköter in Menschengestalt, der den falschen Klingelknopf erwischt hatte. Aber er wollte tatsächlich das Zimmer sehen, eine bessere Abstellkammer eigentlich nur, für die keiner von uns Verwendung besaß. Warum hatten wir ihn überhaupt reingelassen, ihm ein Bier angeboten, das er ablehnte? Er passte nicht in unsere Welt, schon wie er durch die Wohnung schlich, immer der Wand entlang, kaum einen Blick riskierte, als könnten ihn die goldgerahmten handsignierten Grafiken oder der antike Perserteppich im Flur mit einem Bann belegen. Uns, die wir seit unserm zwölften Lebensjahr in einem hochalpinen Privatinternat aufs Repräsentieren eingeschworen worden waren, fielen sie nicht länger auf. Umso mehr dafür diese kuriose Erscheinung, die in abgewetzter Manchesterhose auf unserm Ledersofa herumrutschte und vergeblich diesen Haarschopf zu bändigen versuchte, der wirkte, als hätte ihr Träger vor dem Spiegel selbst mit einer Schere an sich herumgeschnippelt. Geld für die Miete besäße er keins, zumindest vorläufig nicht, gestand er gleich zu Beginn, die Nachtwachen im Spital würden erst die teuren Medizinbücher finanzieren müssen. Als er vorschlug, für Kost und Logis den Haushalt zu besorgen (dabei kam doch zweimal die Woche eine Reinigungsfrau vorbei), sagten wir aus lauter Tollkühnheit zu und Paul zog ein, gleich am Tag darauf, mit nichts als einer Matratze, Stuhl und Tisch. Ein Mann half ihm beim Transport, der Vater, dachte ich, aber er war es nicht, und er kam nicht wieder.
Ich hielt ihn für einen Sonderling, einen komischen Kauz, so, wie er sich immer hinter seinen Büchern verkroch. Eines Abends schließlich, wir andern waren vor dem Fernseher versammelt und verfolgten ein Champions-League-Spiel, klopfte ich an Pauls Zimmertür, zwei Bierflaschen in der Hand. Es reicht, sagte ich, du kommst jetzt raus und schaust mit uns Fußball. Paul drehte sich um, langsam, und mit einem Ausdruck im Gesicht, von dem ich nicht sicher war, ob sich darin Überraschung spiegelte, Erstaunen, oder Ungläubigkeit. Und dann hatte er den Stift zur Seite gelegt, war aufgestanden und hatte mit einem flüchtigen Lächeln nach dem Bier gegriffen.
Das sanfte Klacken der gekreuzten Flaschenhälse echote von fern an mein Ohr, ein Jingle aus der Vergangenheit zwischen all den piependen Apparaten hier auf der Intensivstation, der von früheren Banden kündete, von gemeinsam über Büchern durchzechten Nächten, die sich fortsetzten, auch nach dem Studium… hatte ich sie vermisst?
Hatte ich Paul vermisst? Dieses verquollene Gesicht im Kissen, es berührte mich seltsam, unangenehm, ich suchte auf dem Monitor, über den die Vitaldaten bunte Bahnen zogen, nach Hinweisen, wie ich mich verhalten sollte. Noch konnte ich mich davonschleichen, auch wenn ich im Grunde wusste, wie unsinnig dieser Gedanke war.
»…Nik?«
Fast hätte ich das stimmlose Krächzen überhört, zumal ich nicht sicher war, ob die Laute überhaupt meinen Namen formten. Aber die Unsicherheit verschaffte mir noch die Sekunden, die ich brauchte, um mich innerlich zu sammeln und zu rüsten für den Moment, in dem unsere Augen sich treffen würden.
»Hey… was machst du bloß für Sachen.« Die Worte kamen mir sanfter über die Lippen, als ich beabsichtigt hatte, und prompt drang aus Pauls Kehle ein Röcheln, zu dem sich ein Zucken um die Mundwinkel gesellte, das mich peinlich berührte, weil ich ahnte, dass es kein Lächeln ankünden könnte.
»Komm, wir richten dich mal ein wenig auf.« Mit ein paar Schritten hatte ich Kabel und Knopfleiste erreicht, das Motörchen surrte Pauls Oberkörper aus der Waagrechten.
»Möchtest du etwas trinken?«
Natürlich verschluckte er sich, nach Tagen mit diesem fetten Intubationsschlauch im Rachen, der seinen Muskel lahmgelegt hatte. Ich zog mir einen Hocker auf Rollen heran, ich mochte nicht von oben herab wirken, wenn ich mit einem Kleenex den Speichelfaden wegwischte, der Paul aus dem Mund hing. Wollte ganz Arzt sein, der wusste, dass ein postkomatöser Patient oft zu kraftlos war, um auch nur den Arm zu heben, und zählte gleichzeitig darauf, dass auch mein Gegenüber im Bett meine Geste als eine professionelle erkannte.
»Wie fühlst du dich?«
Atmen.
»Schmerzen?«
Eine leichte Kopfneigung nach links und wieder zurück, uneindeutig. Ich versuchte mich im Gewirr von Verlaufskurven und blinkenden Zahlen auf den Monitoren zu orientieren. Gab es hier denn gar keine analogen Unterlagen mit Patientendaten mehr? Wüsste ich um die Medikalisierung der letzten Tage, hätte ich zumindest abschätzen können, wie stark die Schlaf- und Schmerzmittel Paul noch das Hirn vernebelten. Opiate wie Sufentanil wirkten tausendmal stärker und auch länger als Morphin. Sufenta, Remifenta, oder Keta – irgendwann hatte ich das alles mal selber ausprobiert, jedenfalls nicht allein, und auf keinen Fall mit Paul, der hatte sich stets verweigert; ob aus Angst davor, die Kontrolle zu verlieren oder weil er fürchtete, erwischt und vom Studium ausgeschlossen zu werden, hatte ich nie herausgefunden.
»Du machst Sachen«, wiederholte ich jetzt, und realisierte im selben Moment, wie viel mehr ich damit implizierte, angefangen bei einem traumatischen Erlebnis vor einem halben Jahr, von dem ich nichts wusste als die paar Worte, die Jespersen dazu verloren hatte. Von einem Todesfall in der Familie hatte er gesprochen, und wie er Paul hatte zittern sehen, ihm erst das Operationsbesteck aus den Händen genommen und wenige Tage später den Zutritt zum OP ganz verweigert hatte. Eine vorübergehende Maßnahme nur, aber Paul sei daraufhin abgetaucht. Und ich saß jetzt da und sah Paul abstürzen, in Zeitlupe, sah ihn fallen, immer tiefer, bis zum Aufprall vor wenigen Tagen. Wo würde Paul beginnen, wenn ich ihn jetzt fragte, wie das alles passiert sei?
Der Kommissar hatte behauptet, Paul würde sich nicht erinnern. Woran? An den Vorfall in jener Nacht beim Bahnhof Altstetten, der ihn hierhin gebracht hatte, oder auch die Minuten, vielleicht sogar Stunden davor? Pauls Blick schimmerte glasig hinter schweren Lidern, solange die Medikamente nicht aus seinem Kopf geschwemmt waren, würde er kaum die Sprache wiederfinden. Aber wenn die Kriminalpolizei ermittelte, hieß das doch wohl, dass ein Verbrechen geschehen war. Ein Raubüberfall, ein tätlicher Angriff. Es gab ja auch einen Toten. Bloß von Dritten, so wurde mir plötzlich bewusst, hatte der Kommissar nicht gesprochen. »In jener Nacht«, diese eine Frage musste ich einfach noch stellen: »Warst du da allein unterwegs?«
In Pauls Augen veränderte sich etwas, ein kurzes Flackern nur, das die Brauen ins Wallen brachte, sich in seismischen Wellen über die Stirn ausbreitete und bis in die Haarbüschelspitzen fuhr, bevor es ihm die Zähne aufeinanderklappte, zwischen denen, ich beugte mich unwillkürlich näher, nur eine Silbe durchdrang: »… Josh…«
Ich brauchte einen Moment, bis ich begriff.
»Der andere… du kanntest ihn?«
Nicken. Und nochmals, unter großer Anstrengung hervorgepresst: »Joshua.«
»Ihr wart befreundet?«
Nicken.
Und dann löste sich Pauls Gesicht auf.
»Genug jetzt«, ein Pfleger trat ans Bett, ein Team an jungen Weißkitteln im Schlepptau. »Bitte gehen Sie.«
»Ich bin Arzt«, sagte ich sinnloserweise, erhob mich trotzdem, und konnte doch den Blick nicht von Paul wenden.
Draußen, bedeutete mir der Pfleger mit einer Kopfbewegung, und ich fand mich vor dem Aquarium wieder, bevor ich mich noch hätte verabschieden können, abgesehen von einer zum Gruß leicht gehobenen Hand, eine Geste so bedeutungslos, dass ich mich im nächsten Augenblick für sie schämte.
Der Pfleger hatte Paul während der vergangenen Woche regelmäßig betreut und berichtete umschweifslos: vom stumpfen Bauchtrauma, Resultat massiver Gewalteinwirkung, dessentwegen Paul nach der Operation auf die Intensivstation gekommen war, den Bauchraum offen und so instabil, dass sie ihn gleich ins künstliche Koma versetzt hatten; in den ersten Tagen wiederholt auf RASS minus fünf, die tiefste Sedationsstufe, mit Sufenta teilweise am Dosierungslimit. Einmal hatte er reanimiert werden müssen. Im ersten Anlauf konnte der Bauchraum nicht geschlossen werden, Leber und Milz noch zu geschwollen, Paul kam offen aus dem OP zurück. Vitalwerte seit drei Tagen endlich stabil, Entzündungswerte sinkend; heute Morgen dann wurde er extubiert und die Aufwachphase eingeleitet, in Anwesenheit des Polizisten, der Paul vorhin ein erstes Mal befragt hatte. Sufenta weiterhin hoch, Kreislauf noch instabil, den ersten Delircheck werde er gleich anschließend machen. Zur Beobachtung behielten sie Paul sicher für ein paar weitere Tage auf der Intensivstation, hier kümmerten sich auch Physio- und Ergotherapeutinnen um eine erste Remobilisierung. Danach Verlegung in die Bettenstation, weiterhin Physio, Ergo, eventuell Reha nach der Entlassung…
Ich hörte nur noch mit halbem Ohr hin. Paul musste vor wenigen Minuten erst vom Kommissar erfahren haben, dass sein Freund Joshua tot war. Und dann kam ich und stocherte gleich in der Wunde herum. Warum hatte ich Paul nicht einfach gesagt, dass ich mich freute, ihn wieder zu sehen? Von meiner Rückkehr in die Schweiz hätte ich erzählen können, von meinen Zukunftsplänen, davon, dass wir, sobald es ihm besser ginge, gemeinsam etwas unternehmen würden. Durch den Zoo spazieren oder im nahegelegenen Wald ein paar Stunden verlorengehen. Danach irgendwo in einer Beiz einkehren, weit weg von Bellevue und Bahnhofstrasse, ich wusste, wo Paul sich wohlfühlte, an Orte wie die Kronenhalle hatte ich ihn schon früher nie mitgenommen.
Die Wahrheit war, dass ich nicht wusste, ob ich das auch wirklich wollte. Sein Gesicht im pastellkarierten Kissen schwebte wieder vor mir, war neben mir, noch, als ich draußen begierig die kühle Frühlingsluft in meine Lungen sog.
Florence24. April
Ich mochte die Vorstellung, dass ich mir meinen eigenen Zugang geschaffen hatte. Auch wenn er nur zum Friedhof führte. Die schmale Gittertür wartete verborgen hinter herabhängenden Ästen einer majestätischen Tanne und offenbarte sich nur jenen, die bereit waren, sich zu bücken.
Und da fing das Problem schon wieder an. Was, wenn es eine jahrhundertealte Konditionierung war, über Generationen weitergegeben, die meine Schritte zum separierten Seiteneingang gelenkt hatte? Eine innere Stimme, die mir riet, Vordereingänge und Hauptstraßen zu meiden, weil die nicht gemacht wären für Menschen wie mich. Natürlich benutzte ich sie trotzdem, und achtete dabei umso mehr darauf, sie stets hoch erhobenen Hauptes zu betreten. Aktuell war mir nicht danach zumute. Noch immer spürte ich seine Gegenwart durch meine Adern pulsieren, aber Joshua lag hier, sechzig Zentimeter tief unter der Erde, tot.
Heftig, wie mich heute alles umfing, angefangen beim Duft der blühenden Fliedersträucher und Judasbäume, die jetzt, Ende April, ihre ganze Pracht entfalteten. Satt auch das Grün der Kastanien, die schon großzügig Schatten spendeten in den gekiesten Alleen des Sihlfelds. Der Park war einer meiner liebsten Flecken in dieser Stadt. Warum hatte ich Joshua nie mitgenommen?
An einem warmen Frühlingstag wie heute hätte ich mich, in einem anderen Frühling, auf eine Decke mitten ins hohe Gras gesetzt und in einem Buch gelesen, das vielstimmige Zwitschern der Vögel ebenso im Ohr wie das Summen der Insekten. Nur ein gelegentliches Hupen oder das Klingeln der Straßenbahn erinnerte an die Alltagswelt jenseits der Mauer. Bislang war es mir leicht gefallen zu vergessen, dass unter mir die Gebeine von Toten ruhten, längst zu Staub zerfallen. Einzig beim Anblick der Familiengräber, diesen historischen Mausoleen mit ihren Putten und Stelen, die sich im Dunkel der mächtigsten und ältesten Bäume des Friedhofs versammelten, beschlich mich manchmal ein leises Schaudern.
Heute hielt ich mich ihnen fern, hielt mich fest an die rechtwinkligen Alleen, mied auch den Blick in die Holzkreuzzeilen und suchte stattdessen Halt im Burgunderrot der Zwergahornreihen. Lange hatte ich die Trauer nicht zugelassen, jetzt fröstelte mich im milchigen Licht der Sonne. Es war nichts mehr zu tun. Die Hektik der vergangenen vier Wochen war einer bleiernen Leere gewichen. Geblieben war die Wut auf meine Eltern. So überstürzt, wie sie aus Philadelphia angereist kamen, waren sie nur Tage darauf wieder zurückgeflogen – die Gerichtsmedizin gab Joshuas Körper nicht frei, aus ermittlungstechnischen Gründen, wie es hieß – und hatten mich mit allen weiteren Abklärungen und Formalitäten allein gelassen. Wir hatten uns noch auf eine Einäscherung geeinigt, uns für eine Bestattung im Gemeinschaftsgrab entschieden. Und dann, mein Bruder lag kaum eine Woche unter der Erde, in einer ungebrannten tönernen Urne, die selbst zerfallen und zusammen mit der Asche aufgehen würde im Humus rundum, hatten die Eltern mich mitten in der Nacht angerufen. Sie wollten Joshuas Überreste nun doch heimholen nach Philadelphia, ich solle mich doch bitte darum kümmern. Natürlich war das nicht möglich, die Totenruhe dauerte mindestens zwanzig Jahre und durfte nicht gestört werden, so beschied man mir im Bestattungsamt. Ich verstand nicht, weshalb die Eltern weiter insistierten. Im letzten Telefonat, die Verbindung war schlecht gewesen, hatte zwischen all dem Knistern und Kratzen auch der Vorwurf mitgeschwungen, ich würde mich zu wenig kümmern.
Das hatte mich getroffen. Wie unfair, einmal mehr von mir als Schwester zu erwarten, dass ich mich kümmerte, dabei war ich fast sechs Jahre jünger als mein Bruder. Natürlich verfolgte mich seit diesem Telefonat die Vorstellung, ich könnte mich vielleicht tatsächlich zu wenig um Joshua bemüht haben. Nicht jetzt, wo er tot war, sondern als er noch gelebt hatte. Es raubte mir den Schlaf.
Mehr als fünf Jahre waren ein großer Altersunterschied. Er hatte unsere gemeinsamen Lebenswelten außerhalb der elterlichen Erziehungsstrenge bereits früh beschnitten. Selbst zusammen Schulbus fahren war uns nicht vergönnt gewesen. Jeden Morgen saß ich allein auf diesem klebrigen roten Plastikpolster, bis meine Freundin Amari in Upper North Philly zustieg. In unserem Viertel hätte ich zu Fuß zur Schule gehen können. Aber die Eltern insistierten auf diesem Busprogramm, für das sie als Jugendliche in der Bürgerrechtsbewegung gekämpft hatten, weil die Schulen im Stadtteil Roxborough angeblich besser waren als in North Philly. Schon Joshua hatte seinen Hintern in denselben Schulbuspolstern abgewetzt, aber wenigstens nicht allein; in meiner Erinnerung war er als Bub immer im Rudel unterwegs, er war beliebt, und die Jungs schützten sich so, unser Viertel galt als raues Pflaster. Ich hingegen war doppelt fremd geblieben, in der Schule nie von Amaris Seite gewichen, manche Lehrer hatten uns beide für Zwillinge gehalten, vielleicht auch einfach kein Interesse gehabt, uns auseinanderzuhalten. Amari zuhause zu besuchen, wagte ich nur selten, ich scheute das Spießrutenlaufen durch die Straßen unserer Nachbarschaft, in der die anderen Kinder mich mit feindseligen Blicken bedachten, mir Sprüche nachriefen, Quotenkind, hältst dich wohl für was Besseres. Wie oft hatte Joshua ein blaues Auge davongetragen im Versuch, mich vor den Pöbeleien zu beschützen.
Er hatte sich für die Armee entschieden, da war ich fast noch ein Kind gewesen. Viel später erst begriff ich, dass er strategisch gewählt hatte, die Armee war sein Sprungbrett, um sich abzusetzen: von den Strukturen der Straßen, der Stadt, des Staates – sie hielten kein Versprechen auf die Zukunft bereit. Auch ich hatte die USA verlassen, was allerdings mehr dem Zufall geschuldet war, der Liebe, eigentlich; war meinem Freund vor über zehn Jahren in die Schweiz gefolgt. Als er mich für eine andere verließ und ich zum ersten Mal in meinem Leben wie ein Hase in Schockstarre verfiel, war Joshua aus dem Nichts mit einem Wohnungsschlüssel vor mir aufgetaucht. Zürich käme ihm als Basis beruflich gerade recht, hatte er gesagt. Seither teilten wir diese Altbauwohnung mitten im hippsten Quartier der Stadt miteinander, allerdings schickte Joshua häufiger Postkarten, als er selber da war. Sie kamen aus Norwegen, Mali, Kambodscha, er war längst für das State Department tätig, auf geheimer Mission, so scherzte er jeweils, wenn ich nachfragte, top secret alles. Aber an den Stangen in seinem Schrank reihten sich dunkle Anzüge und zeitlos langweilige Krawatten, wie sie Beamte des diplomatischen Dienstes wohl überall auf der Welt tragen. Joshua war schon immer ein smooth talker gewesen, einer, der stets die passenden Worte fand, um Vertrauen aufzubauen und Herzen zu erobern. Wahrscheinlich schüttelte er also Hände an Konferenzen und schlichtete Konflikte am kalten Buffet. Doch war er da, bei mir, füllte sich die Wohnung mit seinem unbeschwerten Lachen, ich erzählte gern und viel, um es zu hören, und die Ecken strahlten danach noch für Tage warm zurück, bevor die Stille sich wieder über alles senkte.
Das Krächzen einer Krähe katapultierte mich jäh zurück in die gekiesten Alleen des Friedhofs. Ich wickelte mich noch enger in das mitgebrachte Tuch. Am Himmel waren Wolken aufgezogen, sie hatten den Park aller warmen Farbe beraubt. Bald würde ich mir eine neue Wohnung suchen müssen, mein Bibliothekarinnengehalt reichte nicht für die Miete. Für einen Moment glaubte ich, der Boden unter meinen Füßen gäbe nach, als wankte ich im Wind wie eine dieser filigranen weißen Kugeln, die vor meinen Augen über der Wiese zu schweben schienen. Beim letzten Besuch hatten sie noch in profanem Löwenzahngelb zwischen dem Grün der Gräser gehangen. Vielleicht sollte ich mir so auch die Verwandlung meines Bruders vorstellen. Es wäre ein Bild, an dem ich mich festhalten könnte.
Anders als jene Bilder, die sich in meinen Kopf stahlen, wenn ich nicht aufpasste. Düstere Szenen voller Blut, einer gebrochenen Nase, zugeschwollenen Augenlidern. Bilder, die allein meiner Vorstellungskraft entsprangen, für die es keine Karteikarten gab, keine Fotos, die man hätte ablegen und wegschließen können. Ich hatte Joshua nicht mehr sehen dürfen nach der Obduktion. Ob auf Anweisung dieses Polizisten, wusste ich nicht. Allein der Gedanke an ihn ließ diese Ohnmacht wieder in mir aufsteigen, vielleicht war es auch Wut, eine ohnmächtige Wut, genährt aus Generationen der immergleichen Erfahrung mit blauen Uniformen. Sie machte etwas mit den Menschen, diese Uniform, auch hier, in der Schweiz.
Seinen Worten hatte ich von Anfang an misstraut, den seltsamen Fragen, die er stellte, dieser Kommissar, der mich an ein Wiesel erinnerte. Ich war vage geblieben in meinen Antworten, abweisend sogar. Oft hatte ich nicht gewusst, worauf er hinauswollte. Mein Bruder wurde mir fremd in diesem ganzen Spiel, das keines war, und wenn doch, dann wars eins mit mir und ging auf meine Kosten.
Beinahe wäre ich mit dem Dreikäsehoch zusammengeprallt, der auf seinem Laufrad über den Weg kurvte. Ich befand mich ja bereits auf dem Abschnitt entlang der Schrebergärten, der die beiden Friedhofsteile miteinander verband. Gleich erreichte ich das Eingangstor zum hinteren Sihlfeld, das den Blick unweigerlich auf diese dickbauchige, nach unten spitz zulaufende Urne am Wiesenrand lenkte. Von dort waren es nur noch wenige Schritte bis zu den Gemeinschaftsgräbern am oberen Ende des Friedhofs. Ich brauchte noch etwas Zeit und schlug den Weg entlang der Wiese hinauf zum Obelisken ein. Als hätte jemand eine Decke ausgebreitet lag sie da, gesprenkelt mit Hahnenfuß und Gänseblümchen, hier und dort ein Tupfen Tulpenrot. Und unter ihr lag Joshua, wo genau, wussten nur die Friedhofsverwalter. Ich war mir nicht einmal sicher, ob die Menschen, deren Namen links und rechts von ihm auf der langgezogenen Inschrifttafel eingraviert waren, auch unter dem Boden seine Nachbarn waren. Je näher ich kam, desto schmuckloser schien mir dieses steinerne Verzeichnis der Toten, das sich schräg vom Boden weg stemmte, viel zu nah an die Wohnblöcke jenseits des Friedhofs gedrückt, die jetzt, da die Sonne endgültig hinter dunklen Gewitterwolken verschwunden war, noch abweisender wirkten. Aus schwarzen Fensterlöchern starrten sie auf die Rücken der Trauernden, die sich zur Tafel hin bückten.
Der Mann, an dem ich vorbeigehuscht war auf dem Weg zur Stelle, wo mein Bruder in Buchstaben aufgereiht zwischen zwei Sternen hing, kauerte noch immer vor der Tafel. Minuten waren seither verstrichen. Seine Lippen bewegten sich, als spräche er zur Inschrift. Oder buchstabierte er einen Namen? Die Finger seiner rechten Hand glitten einer Gravur entlang, mit einer Zärtlichkeit, die mich rührte. Seltsam berührte, ich spürte meinen Blick zwischen der knochigen und doch feingliedrigen Hand und dem zerzausten Haarschopf hin und her wandern, spürte eine Vertrautheit, die ich noch nicht benennen konnte. Die Erinnerung kam erst beim Nähertreten, natürlich, er war in letzter Zeit häufiger bei mir am Bibliotheksschalter erschienen, hatte sich irgendwann sogar vorgestellt: Hallo, Florence M., ich bin übrigens Paul B., so finden Sie meine Bestellung sicher leichter. Es war eine Anspielung auf mein Namensschild, das mich zum Freiwild für Duzfreunde machte, und sein schüchternes Lächeln, das verriet, wie unsicher er war, ob seine Kritik an den Zumutungen meiner Vorgesetzten auch deutlich genug durch die Ironie schimmerte, hatte ihn mir sogleich sympathisch gemacht.
Aber da war noch etwas anderes. Paul B.… wofür stand schon wieder dieses B? Und was drängte mich so nach Gewissheit, dass ich fast über ihn stürzte beim Versuch, den Namen unter seinen Fingern zu entziffern? Jedenfalls zuckte er zusammen, worauf ich sogleich zu einer Entschuldigung ansetzte, die immer wortreicher wurde, während er sich hochzurappeln begann, schwerfällig und so unsicher, dass ich ihn unwillkürlich am Ellbogen festhielt. Als er mir sein Gesicht zuwandte, erschrak ich. Aschfahl war es, die Haut wächsern, fast durchsichtig.
»Paul! You look terrible.«
Es war mir einfach herausgerutscht, in meiner Muttersprache noch dazu, Florence, you idiot! Er schien es mir nicht übel zu nehmen, im Gegenteil, um seine Mundwinkel formte sich ein Lächeln, als fühlte er sich ertappt.
»Tut mir leid.«
Seine Stimme klang dunkler, rauer als in meiner Erinnerung.
»Sie haben mich erst vor ein paar Tagen aus dem Spital entlassen.«