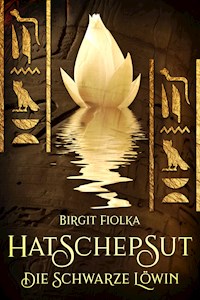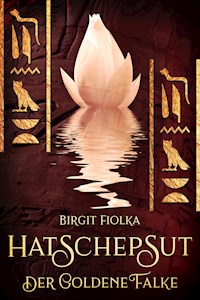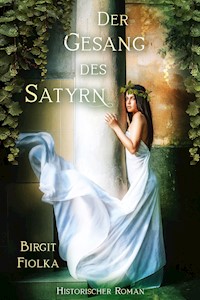
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Überarbeitete Fassung mit neuem Cover, neuem Textsatz und Illustrationen Berührend ... Intensiv ... Authentisch! Korinth, ca. 390 v. Ch., wird die sechsjährige Neaira von ihrer Mutter an ein Hurenhaus für gehobene Gäste verkauft. Wo das Kind Neaira sich zuerst in eine Fantasiewelt voller Satyrn und Sagengestalten flüchtet, bemerkt das Mädchen schnell, dass der Weg in die Freiheit nur über jene Herren führen kann, welche sich ihres Körpers bedienen. Mit einer Mischung aus Klugheit und Schamlosigkeit erlangt sie schließlich Berühmtheit in Korinth und Athen. Eine schicksalhafte Leidenschaft verbindet sie mit dem geheimnisvollen Phrynion. Der Traum von der lang ersehnten Freiheit wird jedoch für Neaira erst greifbar, als sie den Athener Stephanos kennenlernt. Doch Neaira wird von ihrer Vergangenheit eingeholt. Phrynion lässt sie in sein Haus verschleppen und verlangt, dass sie erneut ihren Platz an seiner Seite einnimmt. Die bewegende Lebensgeschichte der Hetäre Neaira, überliefert aus antiken Gerichtsakten – der Pseudo Demosthenes § 59 gegen Neaira Erstmals als Romanbiografie!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 626
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Birgit Fiolka
Der Gesang des Satyrn
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
Epilog
Impressum neobooks
Prolog
Das gleißende Licht der Mittagssonne fiel durch die Fensteröffnung und ließ den Staub der Straße gleich winzigen Flocken im Raum schweben. Es war ein schmuckloser Raum, die Wände in kühlem weißen Putz gehalten, auf den Böden nur einige Webteppiche und vor der Fensteröffnung ein Tisch aus Pinienholz mit einem zierlichen Stuhl, dessen einzige Extravaganz eine geschwungene Lehne war. Jener Stuhl war eines der wenigen Erinnerungsstücke, welche die Herrin dieses Raumes aus ihrer Vergangenheit zurück nach Megara begleitet hatten. An einem heißen Sommertag wie diesem hatte sie diesen Raum bezogen, hatte ihn mit den Erinnerungen ihres Lebens gefüllt, und an einem ebenso heißen Sommertag würde sie ihn verlassen – jenes letzte Heim in ihrem Leben, in dem es so viele Wohnstätten - gute wie schlechte - gegeben hatte. Sie war damals alleine gekommen, doch in den folgenden Jahren selten allein geblieben auf ihrer Kline. Doch in der gedrückten Stille des frühen Mittags, durch den nur dumpf die Geräusche der Straße zu ihr drangen, an jenem letzten Tag ihres Lebens war sie erneut allein, und nur ihre Sklavinnen waren bei ihr. Bald würde dieser Raum bereit für eine neue Schicksalsgeschichte sein. In dieses Haus der geflüsterten Geheimnisse kamen nur die Müden und Gescheiterten - jene, die ihre besten Zeiten bereits gelebt hatten. Hier lag das Ende ihrer Reise, verborgen unter muffigen Laken, aufdringlichen Duftessenzen und getrockneten Tränen.
Von der Schlafkline in der Mitte des Raumes drang ein leises Geräusch. Sofort ließen die beiden Sklavinnen, wie sie es ihr ganzes Leben auf ein Zeichen ihrer Herrin hin getan hatten, von ihrer Arbeit ab und wandten sich ihr zu. Sie war alt geworden, müde und runzelig, trocken und staubig wie das Haus, und mit ihr waren auch ihre Sklavinnen gealtert.
„Thratta, Kokkaline“, erklang die brüchige Stimme der Herrin, welche ihren melodiösen Klang nie ganz verloren hatte; wie der Nachhall eines schönen Festgesangs schien er das Bild des Alters und Zerfalls verhöhnen zu wollen. „Kommt und setzt euch zu mir, denn dieses ist der letzte Tag meines Lebens. Ich will ihn mit euch verbringen, die ihr mich besser kennt, als je ein Mann mich gekannt hat. Ihr seid die Einzigen, welche sich der großen Hetäre Neaira und der Frau, die ich stets bemüht war zu sein, erinnern werden. Denkt immer daran, wenn mein Leib zu Staub geworden ist und ich mich nicht mehr wehren kann, so oft sie meinen Namen auch mit Verachtung aussprechen.“
Thratta schluchzte. Sie war schon immer die sanftmütigere und sensiblere der beiden Sklavinnen gewesen. Kokkaline nahm ihre Hand, wie sie es einst getan hatte als Thratta in die Dienste der Herrin gekommen war, und drückte sie. Dann gingen sie gemeinsam zur Lagerstatt und ließen sich neben ihr auf dem Boden nieder. Die Stille des Augenblicks war von einer Endgültigkeit gezeichnet, die vor allem Thratta nicht ertrug. „Sollen wir dir Früchte oder eine Schale Wein bringen, Herrin?“ Thratta hatte Mühe, ihre Stimme nicht zittern zu lassen. Die Herrin verneinte. Ihr Gesichtszüge waren von Zorn und Elend gezeichnet. „Warum soll ich mich quälen mit den Erinnerungen an guten Wein, Gesang und die Tage meiner Jugend. Wein würde mir den Abschied nur schwerer machen ... auch wenn er abgestanden und sauer ist, wie alles in diesem Haus. Er ist uns gemäß, dieser Wein! Wir alle, die wir hier leben, sind über die Jahre abgestanden und sauer geworden.“ Ihre Stimme bekam einen flehenden Klang. „Aphrodite, die du mir heißes Blut geschenkt hast! Wie grausam der Verfall für eine Frau wie mich ist, kannst nur du wissen.“
Wieder schickte sich Thratta an zu schluchzen, doch Kokkaline stieß sie in die Seite. Es war schwer genug für die Herrin; Thratta sollte es nicht noch schlimmer machen. Endlich wandte die Herrin den Kopf und sah Kokkaline und Thratta in die Augen. Für einen Augenblick gewannen sie ihren alten Glanz und ihre Klarheit zurück. Es waren jene Augen ihrer Herrin, die Kokkaline noch immer einen Schauer über den Rücken laufen ließen. Sie allein waren dem Verfall des Alters entgangen. Noch immer waren die Augen der Herrin groß und braun. Sie wirkten sanftmütig und beinahe schutzbedürftig. Es waren Augen, die Männer um den Verstand gebracht und dazu verführt hatten, die Erfüllung ihrer Sehnsüchte in ihnen zu erhoffen. Viele von ihnen waren der Täuschung dieser Augen erlegen. Einige von ihnen hatten nie erkannt, was hinter den großen braunen Augen verborgen war – ein wacher Verstand voller begehrlicher Wünsche, ein heißblütiger Wille, jedoch ebenso ein kühler und planender Kopf, dem es gegeben war Ziele anzustreben und sie zu erreichen.
Früher hatte Kokkaline diese Augen gefürchtet. Sie konnte sich nicht mehr erinnern, wie oft der Stock der Herrin auf ihrem Rücken getanzt hatte, wie oft sie danach die Striemen in ihrem Fleisch mit kühlenden Salben behandelt hatte; sie konnte sich nicht mehr entsinnen, wie oft Thratta nachts weinend neben ihr auf der Strohmatte gelegen hatte. Vor allem sie hatte unter der Unberechenbarkeit der Herrin gelitten – der Herrin, die sie so sehr geliebt hatte, aber von der eine Sklavin kaum Gegenliebe erwarten durfte. Trotzdem waren sie miteinander verwachsen – die beiden Sklavinnen und die Herrin. Sie waren wie knorriges Wurzelholz, ineinander verschlungen, verknotet und verhärtet. Sie teilten Geheimnisse und fast ein ganzes Menschenleben.
Die Herrin streckte ihre trockene Hand aus. „Thratta ... habe ich dich zu oft geschlagen und zu schlecht behandelt? Ich meine, dass es wohl so gewesen ist.“
Thratta, obwohl selber bereits über sechzig Jahre alt, zog die Nase hoch wie ein Kind und schüttelte den Kopf. „Nein, Herrin! Du warst gerecht, nie hast du mich mehr geschlagen, als es für eine Sklavin gemäß ist.“
„Lügnerin“, antwortete die Herrin sanft, und aus Thrattas Augen begannen die Tränen zu laufen. „Mancher Hund hat in seinem Leben weniger Schläge abbekommen als du. Ich bedauere das sehr. Du hast mir stets treu gedient. Aber mein Blut war heiß und leidenschaftlich, sodass jeder, der mir nahestand, sich an mir verbrannte.“
„Ich habe dich immer verehrt und geliebt Herrin. Ich habe dir gerne gedient.“ Thrattas Stimme wurde brüchig. Sie konnte ihren Kummer nicht mehr verbergen.
„Das weiß ich ja, Thratta. Arme kleine Thratta! Es sind immer die mit den reinsten Herzen, denen wir Leid zufügen.“ Ihre Augen schienen abzuschweifen, weit in die Vergangenheit zu reisen. Dann wandte sie sich an Kokkaline, die ruhig und gefasst neben Thratta saß. Ihre braunen Augen fixierten die Sklavin mit jenem forschenden Blick, der früher oft eine Strafe angekündigt hatte. „Kokkaline, du warst anders als Thratta, doch ebenso treu. Thratta schlug ich, weil ich ihre Gutherzigkeit kaum ertragen konnte. Dich jedoch, Kokkaline, strafte ich für deinen Stolz, für deine ruhige besonnene Art und die Anmut, welche eine Sklavin nicht haben darf. Du, meine stolze und starke Kokkaline, hast mich stets daran erinnert, wie unvollkommen und ungeschliffen mein Herz war. Mein ganzes Leben habe ich danach gestrebt, eine freie Frau zu sein und meine Schande zu tilgen. Doch tief in mir wusste ich, dass jenes Leben, das mein Schicksal war, mir gut zu Gesicht stand. Ich verabscheute seine Lasterhaftigkeit ebenso, wie ich seine Vorzüge genoss.“
Kokkaline nahm die Hand ihrer Herrin und führte sie an ihre Wange. Auch sie war alt geworden, eine alte nutzlose Sklavin. Doch ihr Rücken war noch immer so gerade wie der eines jungen Mädchens. „Obwohl deine Hand mich oft geschlagen hat, hadere ich nicht mit meinem Leben. Es war erfüllt.“
„Ja, Kokkaline“, flüsterte die Herrin mit einem Lächeln. „Auch dies ist ein Grund für die harte Behandlung - deine Zufriedenheit, dein festes Herz, deine Bescheidenheit, mit dem glücklich zu sein, was dir das Leben schenkte. Ich war immer unzufrieden. Was ich auch bekam – ich verlangte stets nach mehr. Ich neidete dir dein Talent zum Glücklichsein.“ Der aufkommende Husten der Herrin erinnerte Kokkaline an das Bellen eines alten Straßenhundes. Thratta beeilte sich, der Herrin eine Schale mit Wasser an die Lippen zu halten. Nachdem die Herrin einen Schluck getrunken hatte, ließ sie sich zurück auf ihr Lager sinken. „Vielen Menschen habe ich Leid zugefügt – einige hatten es verdient, andere nicht. Jene, die es nicht verdient hatten, kann ich nicht um Verzeihung bitten, da sie bereits den Styx überquert haben. Meine arme Tochter Phano, die ein Opfer meiner Selbstsucht wurde, und Stephanos, den Mann, den ich innig geliebt habe, obwohl er mich einmal aus Schwäche verraten hat. Dies sind die beiden Menschen, um derentwillen ich Reue empfinde. Die Anderen“, nun zeigte sich auf dem von Alter und Krankheit gezeichneten Gesicht der Herrin ein Lächeln, wie es früher oft gewesen war, wenn sie meinte, einen Sieg errungen zu haben. „Die Anderen habe ich nie in mein Herz sehen lassen! Wie habe ich sie an der Nase herumgeführt, diese unbescholtenen Bürger Athens, die so gut und gerecht taten und ihre gierigen Gelüste in jene Häuser trugen, in die zuerst Nikarete und später Phrynion mich brachte. Um sie tut es mir nicht leid, um keinen Einzigen von ihnen! Wenn ich es vermocht hätte, so wären sie allesamt in den Tartaros gestürzt worden und ihre Taten vor den Göttern offenbart. Doch was vermag eine Frau auszurichten in dieser Welt der Männer? Ich habe mein Bestes getan!“ Erneut schüttelte sie der Husten. Kokkaline hob den Kopf der Herrin an, während Thratta ihr die Trinkschale an die Lippen hielt. Nur langsam schien die Herrin sich zu beruhigen. „Auch ihr kennt sie, diese feinen Bürger Athens.“ Sie suchte mit fiebrigen Augen die Zustimmung ihrer Sklavinnen. Thratta und Kokkaline nickten stumm. „Ja“, flüsterte die Herrin heiser. „Ihr wart stets an meiner Seite, und doch wisst ihr nicht wie es dazu kam, dass ich die Frau wurde, die ich bin. Ihr wisst nicht, woher meine Herzenskälte rührt. Deshalb will ich euch meine Geschichte erzählen, bevor ich sterbe und euch die Freiheit schenke. Es wird nur einen Tag dauern, nur so lange bis die Sonne untergeht. Obwohl ihr mich verlassen könnt, da ich euch in diesem Augenblick die Freiheit schenke, hoffe ich, dass ihr mir diesen letzten Dienst erweisen werdet.“ Sie machte eine Pause und sah die Sklavinnen bittend an. Es war Kokkaline, die ihr antwortete. „Wir bleiben bei dir, bis du den Styx überquert hast. Wir würden auch bei dir bleiben, wenn der Fährmann dir weitere Jahre gewährt. Was bedeutet die Freiheit schon für uns, die wir alt sind?“ Kokkalines blaue Augen vergossen keine Tränen, doch sie trauerte im Angesicht des Abschieds, der unzweifelhaft bevorstand. Gewiss, die Herrin war streng gewesen und hatte sie oft geschlagen. Doch was machte das schon. Die Hände der Herrin waren nicht so hart gewesen wie die der Herren, welche sie mitunter auch geschlagen hatten.
Die Blicke der Herrin wanderten über die weiß gekälkte Decke des Raumes. Sie suchte nach einer Tür in ihrem Geist, die es aufzustoßen galt, um den Staub der Jahre und des Vergessens von ihren Erinnerungen zu nehmen. Als sie dies gefunden hatte, atmete sie tief durch. Ihre Stimme festigte sich mit den ersten Worten, so als wäre die Herrin zurückgekehrt in eine Zeit, in der Schmerz für sie nur ein bloßes Wort ohne Bedeutung gewesen sein musste.
„Ich muss ungefähr sechs Jahre alt gewesen sein, als ich an der Hand meiner Mutter nach Korinth kam ... sechs Jahre, aber ich weiß es nicht mehr genau. Ich weiß noch nicht einmal, wie die Polis hieß, in der ich mit meiner Mutter lebte, noch weiß ich, wer mein Vater war ... ich wusste damals auch nicht, warum meine Mutter mit mir nach Korinth kam. Heute weiß ich es – damals staunte ich nur über diese große Stadt, in die mich meine Mutter mitgenommen hatte ... ich war ein staunendes Kind, das nichts Böses ahnte und kannte.“
1. Kapitel
50 Obolen für eine Kindheit
„Jetzt lass dich nicht ziehen wie ein Esel, und bleib nicht überall stehen“, beschwerte sich ihre Mutter, als Neaira den Akrobaten anstarrte, der sich eine brennende Fackel in den Rachen schob und diese mit einer Qualmwolke zum Erlöschen brachte. Sein Oberkörper glänzte vom Öl, um seine Hüften hatte er ein Tuch gewickelt. Es war ein heißer Sommertag, und Neaira hätte es ihm gerne gleichgetan und sich den durchgeschwitzten Chiton vom Leib gerissen. Als er die gelöschte Fackel zur Seite warf und Neairas Mutter entdeckte, setzte er ein freches Grinsen auf und vollführte ein paar kreisende Bewegungen mit dem Becken. Unvermittelt zog die Mutter Neaira weiter, ohne dass das Mädchen etwas von den Anzüglichkeiten des Mannes verstanden hätte. Für Neaira war alles in Korinth neu und aufregend, während sie sich von ihrer Mutter durch die Straßen ziehen ließ. Der Lärm der Stimmen, die vielen Menschen auf der Agora in ihren farbenfrohen oder weißen Chitonen, die Mäntel der edlen Herren in tiefem Rot oder Purpur, die Sklaven in ihren kurzen Chitonen, welche ihrem Stand gemäß die rechte Schulter unbedeckt ließen. All die verschiedenen Gerüche, welche aus den Garküchen und von den Verkaufständen und Läden her in ihre Nase zogen oder die großen Gebäude mit den hohen Säulen und eben jene Straßenkünstler und Akrobaten, die auf der Agora ihre Kunststücke darboten, brachten Neaira zum Staunen, obwohl über all diesen Dingen der brodelnde Gestank einer großen Polis lag. Es stank geradezu erbärmlich an diesem heißen Sommertag, doch Neaira war es egal. Ihre Augen konnten von dem Geschehen um sie herum nicht genug bekommen. Sie kannte nicht viel mehr als die enge staubige Gasse, in der sie mit ihrer Mutter ein ärmliches Zimmer bewohnte, bei einer auffällig geschminkten Frau, die jeden Abend an ihre Tür klopfte und von der Mutter einen Obolus verlangte. Es war eine einsame Straße, in der sie lebten, kaum ein Hund lief tags vorüber, nie schien etwas zu geschehen, was die Eintönigkeit ihres Lebens unterbrach. Bisher hatte das Neaira jedoch nicht gestört. Tagsüber blieb sie allein und beobachtete ihre Mutter von der Fensteröffnung aus, wenn sie in einem leichten Chiton oder an kühleren Tagen in einem Peplos mit rotem Mantel davonging, wobei die Sohlen ihrer Sandalen Muster im Sand der Straße hinterließen. Es war für Neaira ein tröstliches Ritual geworden zu beobachten, wie die Muster nach und nach vom Wind verweht wurden, und erst wenn es dunkel wurde und ihre Mutter heimkehrte, ihre Sandalen erneut Muster in den Sand der Straße zeichneten. So wartete sie Tag für Tag und vertrieb sich die Zeit, indem sie aus dem Fenster sah oder vor der kleinen Statue der Göttin Aphrodite betete, wie sie es von ihrer Mutter kannte, die jeden Abend für die Göttin etwas Mhyrre entzündete und sie darum bat ihre Jugend zu erhalten. Neaira sprach dieselben Gebete an die Göttin. Wie es Kinder gerne tun, plapperte sie ihrer Mutter alles nach. Aphrodite, so wusste Neaira, war ihrer beider Schutzgöttin. Sie brachte ihr kleine Opfer dar - Blumen, die sie am Straßenrand fand, ein paar Tropfen des Duftöls, das ihre Mutter benutzte und schöne Steine, die sie auf der Straße fand. Es waren Schätze jener Art, die nur glänzend erscheinen, solange sie mit Kinderaugen betrachtet werden. Neaira war in der Trostlosigkeit der Gasse niemals einsam. Ihre Welt war die der kindlichen Vorstellungskraft. Wie jedes Kind kannte sie die Schlupflöcher, durch welche sie aus der Enge der Wirklichkeit ausbrechen konnte. Wenn die Mutter am Abend zurückkehrte, brachte sie einen Laib Brot und manchmal harten Käse mit, den sie schweigend aßen. An jenen Abenden war die Mutter immer müde und Neaira, erschöpft von den Abenteuern ihrer kindlichen Gedankenflut, ebenfalls. Nur selten verließen sie gemeinsam die Enge des Zimmers. Dann gingen sie eine Nachbarin besuchen, die ein einfaches, jedoch sauberes Badehaus mit einem marmornen Louterion, einem Waschbecken, besaß. Solche Tage waren für Neaira besonders schöne Tage, denn dann lachte ihre Mutter und wusch ihr das lange braune Haar mit duftendem Öl.
Der Besuch in Korinth war für Neaira somit das Aufregendste, was sie sich in ihrem jungen Leben vorzustellen vermochte – ihr kam es vor als wären die Abenteuer ihrer Nachmittage auf einmal Wirklichkeit geworden.
„Wir gehen in Korinth eine alte Freundin besuchen“, hatte Neairas Mutter ihr eines Tages eröffnet und einen neuen Chiton aus einem Korb gezogen, den sie Neaira hatte anziehen lassen. Neaira, die bislang nur zwei Chitone besessen hatte, einen Gelben, den die Mutter aus einem ihrer eigenen abgetragenen Chitone genäht hatte, und einen schlichten weißen, war ehrfürchtig mit den Händen über den hellblauen Stoff gefahren. Heute trug Neaira ihren neuen blauen Chiton und fühlte den Stolz jedes kleinen Mädchens, das ein neues Kleidungsstück trägt.
„Neaira, jetzt trödele nicht herum. Wir müssen vor Einbruch der Dunkelheit das Viertel der Tuchweber erreicht haben.“
Mit enttäuschtem Gesicht wandte das Mädchen sich von den Akrobaten ab und stolperte hinter ihrer Mutter her. „Ich habe Hunger, Mama“, nörgelte sie, als sie am Stand eines Händlers vorbeikamen, der dampfende Brotlaibe von seinem Karren lud. Neaira lief das Wasser im Mund zusammen.
„Wenn du brav bist, kaufe ich dir auf dem Rückweg Datteln, aber jetzt müssen wir uns beeilen.“
Neaira entging nicht der ungeduldige Ton in der Stimme ihrer Mutter. Begehrlich starrte sie auf die dampfenden Brotlaibe, doch die Aussicht auf süße Datteln ließ sie schließlich ihre Enttäuschung vergessen. Obwohl Neairas Füße schmerzten und sie Blasen zwischen den Zehen hatte, ließ sie sich weiter durch die schwitzenden Menschleiber ziehen. Neaira bemühte sich krampfhaft, die Hand ihrer Mutter nicht loszulassen. Sie fühlte sich klein und verloren zwischen dem Tumult. Es wurde ruhiger als sie die Agora verlassen hatten, und endlich verlangsamte die Mutter ihre Schritte. Neaira atmete auf und bemühte sich, nicht zu stark zu humpeln. Bald zog die Mutter sie durch kleinere Straßen und Gassen, hügelabwärts, was das Laufen etwas vereinfachte. Die Menschen, die vor den Häusern und Läden ihrem Tagewerk nachgingen, sahen nur ab und an auf und beachteten sie nicht weiter. Meist waren es Männer, einfache Arbeiter oder Sklaven, die ihnen hinterher sahen. Neaira war Derartiges gewohnt, da es nicht viele Frauen gab, die so ungezwungen durch die Straßen liefen wie ihre Mutter. Diese wehrte einige der Männer ab, die sie anzusprechen versuchten, und zog ihre Tochter fester an sich. Neaira schrie auf, als ihre Mutter sie schmerzhaft am Arm zog, beruhigte sich jedoch schnell wieder. Sie wollte nicht, dass ihre Mutter böse mit ihr wurde. Als sie nach einer Weile in eine Gasse einbogen, in der vor vielen Häusern bunte Tücher auf Gestellen im Wind flatterten, lachte Neaira auf. Die farbenfrohe Gasse empfand sie fast noch schöner als die Agora mit ihren Feuerspeiern und den vielen Menschen. Sie war versucht, sich in die flatternden bunten Tücher zu werfen. Vielleicht würde sich ihre Mutter auf dem Rückweg ein schönes Tuch für einen Chiton kaufen und es bliebe noch ein Streifen für einen Schal oder einen Gürtel übrig. Neaira bemühte sich, besonders brav zu sein.
Ihre Mutter blieb stehen und wandte sich zu ihr um. „Wie siehst du denn aus? Vollkommen verstaubt, und dein Haar ist wirr.“ Mit fahrigen Bewegungen klopfte die Mutter ihren Chiton aus und fuhr Neaira mit den Fingern durch das Haar. Danach betrachtete sie Neaira kritisch und kniff ihr in die Wangen. „Wir wollen doch nicht, dass du blass und krank aussiehst, wenn wir meine Freundin besuchen, nicht wahr?“
Neaira war es herzlich, egal wie sie aussah, sie wollte nur nicht mehr laufen. Als hätte Aphrodite ihre heimlichen Gebete gehört, mussten sie nur noch wenige Schritte gehen, bis die Mutter vor einem Haus mit einer rot getünchten Tür stehen blieb und laut gegen das Holz klopfte. Sie schenkte dem Kind ein nervöses Lächeln, und die Nervosität der Mutter legte sich auf das Gemüt des Mädchens. Die kurze Zeit, in der sie warteten, schwiegen sowohl Mutter als auch Tochter.
Kurz darauf öffnete eine Frau die Tür und musterte die Besucher geringschätzend. Sie war nicht mehr jung, aber auch nicht alt. Eine blumige Duftwolke entstieg ihrem blauen Chiton mit den goldenen Paspeln und Borten. Ihr dunkles Haar war hochgesteckt und wurde von einer auffälligen Tiara gehalten. Sie war schlank, doch die edle Aufmachung stand im Gegensatz zu der grellen Schminke auf dem geweißten Gesicht, das Neaira an die Vermieterin ihres Zimmers daheim erinnerte. Endlich verzogen sich die roten Lippen der Fremden in aufkeimender Erkenntnis zu einem spöttischen Lächeln.
„Dies ist meine Tochter“, hörte Neaira ihre Mutter steif sagen, woraufhin die Frau Neaira unverhohlen musterte.
„Ich habe bereits fünf neue Mädchen. Für deine Tochter habe ich keine Verwendung.“ Ihre Stimme klang schrill. Neaira empfand sie als unangenehm. Etwas im Verstand des Kindes sagte ihm, dass es nicht durch diese Tür gehen wollte. Wieder schien Aphrodite selbst Neairas Gebete zu erhören. Ohne ein weiteres Wort wollte die auffällige Frau die Tür zustoßen. Doch Neairas Mutter trat einen Schritt vor, sodass sie im Türrahmen stand. „Sieh sie dir doch an, Nikarete! Sie verspricht, eine wahre Schönheit zu werden.“
„Ich sehe ihre Mutter“, bekannte Nikarete kühl. „Dies reicht für mein Urteil.“
„Auch ich war einmal schön, das weißt du sehr wohl – und es war nicht zu deinem Schaden!“ Neaira verstand nicht, was ihre Mutter von der Fremden wollte. Für sie war ihre Mutter die schönste Frau, die sie sich hätte vorstellen können. Unbehaglich zog sie die Mutter am Ärmel des Chitons. „Können wir gehen, Mama?“ Ihre Mutter beachtete sie nicht. Stattdessen maßen sich ihre Blicke mit denen Nikaretes. „Sieh sie dir noch einmal an, Nikarete. Man sagt, du hättest ein Auge für so etwas.“
Wiederum wurde Neaira von Nikarete gemustert, dieses Mal ausführlicher. Ein unbestimmtes Gefühl der Angst stieg in Neaira auf.
„Ich gebe dir dreißig Obolen für sie.“
„Bei der großen Aphrodite – hältst du mich für dumm, Nikarete? Sieh dir ihre Augen an. Diese Augen werden Geldbeutel öffnen. Sie ist mindestens zweihundert Obolen wert. Aber ich will großzügig sein und mich mit hundert Obolen zufriedengeben.“ Die Stimme der Mutter klang ungewohnt hysterisch. Neaira drängte es immer mehr zu gehen. Sie zerrte an der Hand der Mutter, um sie von der ihr Angst einflößenden Nikarete fortzulocken.
„Fünfzig Obolen! Das ist mein letztes Angebot. Wenn du es ausschlägst, nimm sie wieder mit und sieh zu, wie du sie durchfütterst. Immerhin muss ich noch Jahre in sie investieren, bis sie mir meine Mühen entlohnen kann.“
Neairas Mutter verschwendete keine Zeit für weitere Überlegungen. „Gut, fünfzig Obolen.“
Nikarete zog einen Geldbeutel unter den Falten ihres Chitons hervor. Ohne Eile zählte sie der Mutter fünfzig Obolen in die Hand. Dann endlich schien die Mutter zufrieden. Sie beugte sich zu Neaira hinunter, auf den Lippen ein festgefrorenes Lächeln. „Neaira, du wartest hier bei Nikarete. Ich hole dich morgen ab, wenn die Sonne aufgeht. Sei brav, und mache mir keine Schande.“ Sie fuhr Neaira über das Haar und nickte Nikarete zu. Neaira bekam furchtbare Angst. Als ihre Mutter sich umwandte, wollte sie ihr hinterherlaufen, wurde jedoch von Nikarete am Handgelenk gepackt und festgehalten. „Mama! Mama, geh nicht, nimm mich mit, ich werde auch brav sein, ich verspreche es!“, jammerte sie kläglich. Doch die Mutter wandte sich nicht mehr um - vielmehr beschleunigte sie ihre Schritte, je lauter Neaira nach ihr rief. Ihr Chiton verschwand in der Farbenvielfalt der flatternden Tücher. Neaira sah sich gehetzt um. Die Tücher, die gerade noch so freundlich und farbenfroh gewesen waren, erschienen ihr jetzt wie ein Labyrinth, das die Mutter in seinen Tiefen verschluckte. Noch einmal zerrte sie mit aller Kraft an der Hand Nikaretes um freizukommen und hinter der Mutter herzulaufen. Nikarete, deren Geduld schnell erlahmte, zog die schreiende Neaira in das Haus, hinter die rote Tür. Das Herz des Kindes setzte einen Moment aus, als die Tür hinter ihm mit einem dumpfen Laut zufiel. Es war düster und roch nach kalter Asche, die von einem Hauch Blütenduft verdeckt wurde. Neaira meinte, dass es so im Hades riechen musste, wo die Toten als Schatten umherwandelten. Alles lag unter einem Mantel aus Asche, jegliche Empfindungen wären unerreichbar. Neaira aber wusste, dass sie nicht im Hades war, denn sie empfand sehr wohl etwas – Angst.
„Ich will nicht hierbleiben. Ich will zu meiner Mutter“, klagte sie aufgebracht. Nikarete packte sie noch fester am Handgelenk als zuvor, sodass Neaira schmerzvoll das Gesicht verzog. Sie zwang das aufgebrachte Kind, ihr in die funkelnden Augen zu schauen. „Ich bin nun deine Mutter, Kind! Hier wirst du besser leben als bei diesem Weib, das dich zu mir brachte. Ich schicke dich nun zu deinen neuen Schwestern. Morgen werden wir schauen, wozu du zu gebrauchen bist.“
Neaira stand stocksteif. Wollte die Frau sie etwa nicht mehr zu ihrer Mutter lassen? Sie musste sofort weglaufen. Was wäre, wenn ihre Mutter zurückkam und Nikarete sie nicht zu ihr ließ. Im Hinblick auf diese Vorstellung schüttelte Neaira ihre Angst ab. Es gelang ihr, sich von der Hand Nikaretes loszureißen und ihr mit verzweifelter Wut gegen das Schienbein zu treten. Nikarete heulte auf und fasste sich an das schmerzende Bein, während sie immer wieder einen Namen rief. „Idras!“
Neaira stob herum und suchte nach dem Riegel der Tür. So hoch schien er zu sein, und sie streckte sich, doch war einfach zu klein, um ihn zu erreichen. Ihre Hände waren nass vom Schweiß – nur ein kleines Stück weiter recken, den Riegel hochschieben und in die Freiheit laufen. Ihre Mutter konnte noch nicht weit sein, und sie hatte sich den Weg zurück zur Agora gemerkt. Neaira wischte sich über die Augen, die voller Tränen waren, und streckte weiter ihre Hand nach dem Riegel aus, als eine Welle heißen Schmerzes zuerst durch ihren Rücken, dann durch ihren gesamten Körper fuhr. Mit einem Schrei sackte sie zusammen und wurde von zwei groben Händen wieder auf die Beine gezogen. Noch immer halb vom Schmerz gelähmt fuhr sie herum und blickte in das Gesicht einer riesigen vierschrötigen Frau mit dunkler Haut, deren grell gelber Chiton die massige Körperfülle nur vage verhüllte.
„Idras, bring sie zu den anderen, die kleine Mänade. Schlag sie, aber nicht so hart, dass sie nicht mehr zu gebrauchen ist!“ Neaira hörte nicht auf die Worte von Nikarete, die sich langsam vom Schreck des Trittes erholt zu haben schien; sie starrte der dunkelhäutigen Frau in das fleischige Gesicht und die kalten Augen. In ihrer großen Hand hielt sie einen biegsamen Stock, gleich einer Weidenrute. „Wie du befiehlst, Herrin“, antwortete die Schwarze in kehligem Akzent. Dann packte sie Neaira mitleidlos am Arm und schleifte sie mit sich, immer weiter fort von der Freiheit verheißenden roten Tür.
Es war nicht der Schmerz, der wie Feuer brannte, und auch nicht die Angst vor den weiteren angedrohten Schlägen, die Neaira zittern ließen, während die Schwarze sie vor sich hertrieb. Es war die Gewissheit, sich immer weiter von der Tür zu entfernen, durch die Nikarete sie gezogen hatte – immer weiter fort von ihrer Mutter. Je weiter die Schwarze sie in das Haus trieb, desto schaler wurde der Geruch. Einmal musste sie husten, weil die Trockenheit der Luft ihr im Hals kitzelte. Idras zog ihr Mündel weiter, trieb Neaira zunächst durch einen langen Korridor, dessen Wände rot getüncht waren, ehe sie um eine Ecke bogen, die in einem schmucklosen mit Steinen gepflasterten Hof mündete, von dem aus zur Rechten und zur Linken Zimmerfluchten zu sehen waren. Neaira blieb wie angewurzelt stehen und starrte zur Sonne hinauf. Wenn es ihr gelingen würde über die Zimmerfluchten zu klettern und auf der anderen Seite heil hinunter zu gelangen, wäre sie frei. Idras schien ihre Gedanken zu erraten und grinste boshaft. „Denk nicht einmal daran“, flüsterte sie mit ihrer kehligen Stimme und fuhr sich mit dem Stock über den Hals als würde sie ihn aufschlitzen. Neaira begann zu weinen.
Hier und da spähte ein junges Mädchen aus einer der Türen, das neugierig war, was es wohl mit dem Geheule im Hof auf sich hatte. Einige der Mädchen hielten Spindeln in den Händen oder einen Korb mit Wolle. Nur kurz hoben sie die Brauen als sie das weinende Kind entdeckten. Als sie Idras sahen, verschwanden ihre Köpfe wieder in ihren Zimmern. Idras schubste Neaira zu einem Durchgang im hinteren Teil des Hofes, von wo aus ein kurzer Korridor zu weiteren Zimmerfluchten führte. Hier veränderte sich der Geruch und bekam etwas Beißendes. Wieder sah Neaira sich vorsichtig um, fand jedoch keinen Fluchtweg. Bei einer von außen verriegelten Tür blieb Idras schließlich stehen, um sie zu öffnen und Neaira hineinzustoßen.
Hinter Neaira fiel die Tür mit einem lauten Knall zu, während sie stolperte und mit den Knien auf dem harten Steinboden aufschlug. „Aua“, jammerte sie und rieb sich die aufgeschürften Knie. Beim Fall war ihr Chiton zerrissen, und sie hätte am liebsten vor Wut geschrieen. Was erlaubte sich die Schwarze überhaupt? Sklaven schlugen keine kleinen Mädchen!
Neaira hielt sich die Nase zu, als sie bemerkte, dass der beißende Geruch, den sie bereits auf dem Flur vor der Tür wahrgenommen hatte, jetzt ein ekelerregender Gestank war. Ungelenk stand sie auf und erschrak, da einige Augenpaare auf sie gerichtet waren. Schnell wischte sie sich die Tränen aus den Augen. Große Kinderaugen musterten Neaira wie ein seltsames Tier, einige ältere Mädchen hatten bereits das Interesse verloren. Sie hatten sich auf die Polster eines steinernen Schlafpodestes gedrängt, das kaum genug Platz für sie alle bot. Neaira zog ihre Rotznase hoch und wich einen Schritt zurück Sie stanken ... ihre Chitone waren fleckig und verschwitzt, das Haar klebte ihnen strähnig im Gesicht. Einige der kleineren Kinder hatten sich und ihre Chitone vollgepinkelt. Neaira ging zurück zur Tür und hämmerte dagegen. Wie lange waren sie hier schon eingesperrt, und warum hatte ihre Mutter sie hier gelassen, bei dieser grausamen Idras und der gemeinen Nikarete? Sie wollte raus und schrie nach Leibeskräften, damit die Schwarze zurückkäme. Dieser Raum war zu voll, als dass man einen weiteren Bewohner willkommen geheißen hätte. Als die Schwarze nicht kam, schob Neaira trotzig die Unterlippe vor und erwiderte den Blick der anderen Mädchen. Drei von ihnen schienen in Neairas Alter zu sein, zwei von ihnen waren junge Frauen, eine weitere stand an der Schwelle zur Frau. Es gab keine Fensteröffnung, sondern nur eine Spalte über der Tür, durch die spärliches Licht und viel zu wenig frische Luft einfielen. Was sollte sie jetzt tun?
Eines der Mädchen, es hatte ein hübsches Gesicht mit weichen Zügen und helles Haar in der Farbe reifer Gerste, sprang vom Lager und kam zu ihr. Unter dem Gestank von Schweiß und dem Urin der Kinder duftete sie leicht nach Mhyrre, was Neaira an zu Hause erinnerte. Mit einem Zipfel ihres dreckigen Chitons wischte sie Neaira die letzten Tränen vom Gesicht. „Ich bin Metaneira“, sagte das Mädchen leise und lächelte wie die Statue von Aphrodite zu Hause in Neairas kleinem Zimmer. „Wie ist dein Name?“
Neaira wollte dieser Metaneira antworten, doch aus ihrer Kehle kam nur ein Quietschen. Ohne dass sie es gewollt hätte, rollten wieder dicke Tränen über ihre Wangen.
„Lass sie! Die wird sich schon beruhigen.“ Eines der älteren Mädchen machte sich bereit, den ohnehin knappen Platz auf dem Polster zu verteidigen.
Metaneira nahm Neaira bei der Hand. „Woher kommst du? Hat Nikarete dich einem Haushalt in der Polis abgekauft oder bist du mit dem Schiff über das Meer gekommen?“
Neaira verstand die Frage nicht. Hilflos starrte sie die Fremde an. Was wollte diese Metaneira von ihr? Dann wurde ihr klar, dass ihre Mutter sie spätestens am nächsten Tag wieder abholen würde. „Ich bleibe nur hier, bis meine Mutter zurückkehrt.“
Die Unfreundliche, die Haut so dunkel wie eine Zimtstange und das Haar nach Sklavenart kurzgeschnitten, machte ein verächtliches Geräusch in Richtung der Neuen und ließ sich dann zu einer Antwort herab. „Deine Mutter hat dich verkauft, du dummes Balg. Nikarete hat dich genauso gekauft wie uns. Du bist jetzt ihre Sklavin. Gewöhn dich daran.“
Trotz Angst und Unsicherheit streckte Neaira ihr die Zunge heraus. Ihr Haar war doch nicht kurz geschnitten, und sie trug auch keinen Sklavenchiton! „Meine Mutter holt mich morgen früh. Sie hat versprochen, mir süße Datteln auf der Agora zu kaufen. Ihr werdet ja sehen!“
Metaneira gab den Mädchen schließlich ein Zeichen, für Neaira Platz auf den Polstern zu machen; doch wieder war es die Unfreundliche, die entschlossen den Kopf schüttelte. Ihre Lippen verzogen sich zu einem dünnen unnachgiebigen Strich. „Es gibt nicht genug Platz für uns alle hier – schon gar nicht für so ein trotziges Balg, das sich für etwas Besseres hält!“
Kurzentschlossen kletterte Metaneira zurück auf ihren Platz und zog Neaira auf ihren Schoß. Obwohl es ihr unangenehm war, zwischen all die fremden Mädchen gedrängt zu werden, war es ein tröstliches Gefühl, die Körperwärme Metaneiras zu spüren. Nur der beißende Gestank war noch schlimmer als vorher. Neaira fand die kleine Tür zu ihren Gedankenwelten und stellte sich vor, wie sie sich in die Arme ihrer Mutter warf und diese so glücklich über das Wiedersehen war, dass sie ihr eines der schönen Tücher und eine große Schale Datteln kaufte. Sie fand Trost in ihren Tagträumen und döste in der Hitze des Raumes ein, während Metaneira ihr sanft über das Haar strich.
Am nächsten Morgen erfuhr Neaira die Namen der Mädchen. Da gab es einmal Metaneira, die von Anfang an freundlich zu ihr war und sie vor den Gemeinheiten der anderen zu schützen versuchte. Der Name der Unfreundlichen war Stratola. Sie mochte Neaira von Anfang an nicht leiden und hatte sich mit einem blassen unauffälligen Geschöpf namens Anteia angefreundet. Stratola war eine Sklavin und hasste Kinder. Sie hatte auf die Kinder ihrer Herren aufpassen müssen und stets dafür Prügel bezogen, wenn die Kinder etwas ausgefressen hatten. Die drei Mädchen in Neairas Alter hießen Phila, Isthmias und Aristokleia. Das Bemerkenswerteste an ihnen waren die großen traurigen Augen, und dass sie allesamt so verängstigt waren, dass sie sich ständig aneinander klammerten.
Obwohl Neaira gehofft hatte, ihre Mutter würde bald kommen, um sie zu holen, erschien erst einmal Idras und verabreichte ihr die von Nikarete angedrohte Trachtprügel. Die Schwarze war dabei nicht zimperlich und zog sie grob vom Schoß Metaneiras herunter. Kurz streckte Metaneira die Arme nach Neaira aus, um sie festzuhalten, erkannte jedoch schnell die Sinnlosigkeit dieser Geste. „Du dicke dumme Kuh“, schrie Neaira die Schwarze an, dann musste sie feststellen, dass jede Gegenwehr zwecklos war. Grinsend legte Idras sie über ihr Knie und zog ihr den Chiton bis über die Hüften. Der biegsame Stock sauste abwechselnd auf Beine und Hinterteil, hart genug, dass es schmerzte, jedoch keinerlei Striemen zurückblieben. Neaira konnte Stratolas und Anteias verhaltenes Kichern hören, als die Weidenrute immer wieder mit einem Zischen auf sie hinabfuhr. Obwohl jeder Schlag wie der Biss einer Giftschlange zwickte, kam kein einziger Laut aus Neairas Mund. Trotzig biss sie sich auf die Lippen und zwang sich daran zu denken, dass ihre Mutter sie bald aus diesem Tartaros befreien würde. Idras schüttelte angesichts solcher Sturheit nur den Kopf und bedachte Neaira mit noch mehr Schlägen. „Dummes Kind“, sagte sie nur, als Neaira sich das Hinterteil rieb, und nahm Stratola und Anteia mit, als sie ging. Neaira war froh darüber, dass die beiden fort waren. Nun gab es endlich genügend Platz auf dem Polster.
Am späten Vormittag kam Idras zurück und brachte ihnen Schalen mit noch dampfendem im Ofen gebackenen Getreidebrei mit Früchten, den sie hungrig hinunterschlangen. Jede von ihnen bekam auch einen Becher mit Ziegenmilch. Obwohl Neaira so ausgehungert war, dass sie glaubte, nie etwas Besseres gegessen zu haben, kamen ihr die süßen Datteln in den Sinn, die ihre Mutter ihr auf der Agora versprochen hatte. Wo blieb sie nur? Ihr Herz schlug schneller, da sie hoffte dass ihre Mutter in diesem Augenblick an die rote Tür klopfte, um sie aus diesem bösen Traum zu befreien. Bald würde sie das alles vergessen können. Sie warf einen verstohlenen Blick auf Metaneira, die ruhig ihren Getreidebrei aß, da es ihr leidtat sie hier zurücklassen zu müssen. Vielleicht konnte sie ihre Mutter ja bitten, auch Metaneira mitzunehmen? Doch ihre Mutter kam nicht. Stattdessen kam am Nachmittag erneut Idras. Sie trieb sie wie eine Herde erschöpfter und zerlumpter Ziegen in einen abgelegenen Hof, wo sie ihre Notdurft verrichten sollten. Neaira zupfte Metaneira am Ärmel ihres Chitons. „Ich kann hier nicht pinkeln.“ Metaneira bat sie mit flehendem Blick es zu versuchen, und Neaira stellte fest, dass sie es doch konnte. Ihre Blase drückte als hätte sie eine ganze Viehtränke verschluckt. Während Neaira sich in den heißen Sand hockte, um ihre drückende Blase zu entleeren, starrte sie hinauf zur Sonne und beobachtete ein paar Vögel, die über sie hinwegflogen. Noch nie hatte sie sich darüber Gedanken gemacht, wie es wäre Flügel zu haben. Jetzt wünschte sie sich nichts mehr als das.
Kurz darauf trieb die Schwarze sie weiter in ein Badehaus. „Zieht das dreckige Zeug aus, ihr stinkt wie Ziegen!“
Obwohl Neairas blauer Chiton mittlerweile nicht besser roch als die der anderen Mädchen, musste Idras ihr noch ein paar Stockschläge verpassen, bis sie ihn hergab. „Den hat meine Mutter mir geschenkt.“
Idras kümmerte es wenig. Der blaue Chiton wanderte mit den anderen in einen Korb, den Idras einer jungen Sklavin in die Hand drückte, die ihn mit gerümpfter Nase forttrug.
Kurze Zeit später kamen noch mehr Sklaven und brachten Kessel mit Wasser, ein paar Lappen und ein billiges Öl. Wieder schämte sich Neaira, da sie nackt vor den Knaben stand, die sie mit Wasser übergossen. Immerhin würde sie sich sauber fühlen und nicht mehr so stinken, wenn ihre Mutter sie holen kam. Metaneira half zuerst Neaira beim Waschen der Haare, dann bemühte sich Neaira nach Leibeskräften, die mittlerweile verfilzten Haarsträhnen ihrer neuen Freundin zu entwirren. Bald roch es im Badehaus nicht mehr nach Urin und Schweiß, sondern nach frisch gewaschenen Leibern und Blüten. Idras brachte ihnen neue grobe Chitone, die sie anziehen mussten. Sie kratzten auf der Haut, waren aber sauber. Mit kritischem Blick betrachtete Idras ihr Werk, als sie in einer Reihe nebeneinanderstanden wie Priesterinnen vor der Weihe. Was sie sah, schien sie wenig zu überzeugen. „Immerhin stinkt ihr nun nicht mehr so erbärmlich.“
Neaira hatte gewartet und gehofft bis zum Abend. Erst als die Sonne sich rot färbte, wurde ihr klar, dass ihre Mutter nicht zurückkommen würde. Vielleicht war sie da gewesen, aber Nikarete hatte sie fortgeschickt, kam es Neaira in den Sinn. Immerhin hatte Idras hatte nicht mehr in den engen Raum zurückgetrieben. Doch der neuer Raum war auch nicht viel besser, außer dass er nicht so erbärmlich stank. Auch hier gab es keine Fenster, nur das funzelnde Licht einer Talglampe. Immerhin war sie allein mit Metaneira eingeschlossen worden. Wo die anderen Mädchen waren, wusste sie nicht. Neaira war zu jung als etwas anderes als Traurigkeit und Trotz über den Verlust ihrer Mutter zu empfinden. Sie saß auf Metaneiras Schoß als Idras kam und ihnen wortlos Körbe mit Wolle und Spindeln brachte. Die Wolle war ebenso kratzig wie ihr neuer Chiton, doch Metaneira begann wie selbstverständlich mit der Arbeit, obwohl sie im Dämmerlicht kaum die Hand vor Augen erkennen konnte. Während der nächsten Tage taten sie nichts anders als Wollfäden zu spinnen, die am Abend von Idras abgeholt wurden. Anfangs bluteten Neairas Hände von den harten Fäden, die ihre Finger wundscheuerten. Doch nach ein paar Tagen und der Unterweisung Metaneiras wurde sie flinker und die Haut auf den Fingerkuppen härter. Ihren Händen wäre ohnehin nichts anderes übrig geblieben, als sich an die Wollfäden zu gewöhnen. Arbeiteten die Mädchen für Idras Empfinden zu langsam, setzte es Schläge von der Schwarzen.
Nach einem Mondumlauf kam überraschend Nikarete und musterte beide Mädchen ausgiebig. Sie trug einen leuchtend roten Peplos und allerlei Schmuck, der an ihren Fingern, den Handgelenken und ihren Ohrläppchen hing. Im Licht der Talglampe funkelte sie wie ein Berg aus glitzernden Steinen und Bosheit, und ihr geweißtes Gesicht flößte Neaira Furcht ein. „Wie ich sehe, hat sich die kleine Mänade in ihr Schicksal gefügt. Das ist gut, denn es wäre doch schade um so ein hübsches Ding. Idras ist sehr geschickt mit dem Stock. Ich sehe nicht den kleinsten Kratzer auf deiner Haut.“ Als ob sie ein Pferd prüfte, zog sie Neaira zu sich hin und betastete ihren Körper. Wäre sie eine Katze gewesen, Neaira hätte einen Buckel gemacht und gefaucht – vor allem als Nikarete ihr den Mund öffnete, um hineinzuschauen. „Alle Zähnchen am richtigen Platz, keines ausgeschlagen oder faul.“
Neaira klappte den Mund so schnell zu, dass Nikarete erschrocken ihre Finger zurückzog und sie verärgert ansah. „Du bist noch sehr jung und wirst genügend Zeit haben dich zu besinnen, doch Metaneira hier ... “, sie wies mit einem spitzen Finger auf das Mädchen, das dem Geschehen still zugesehen hatte, „ ... muss rasch lernen! Entweder ein Leben als Wollspinnerin in einem Sklavenchiton und nachts die schwitzenden Körper einfacher Seeleute und Männer oder guter Wein, die Gesellschaft reicher Herren und Annehmlichkeiten. Wofür entscheidest du dich?“
Das Mädchen legte die Wollspindel zur Seite und antwortete, ohne zu zögern: „Auch wenn mein Körper mir nicht mehr gehört, so würde ich doch das angenehmere Leben vorziehen.“
Nikarete schien zufrieden, denn ein seltenes Lächeln erschien auf ihrem Gesicht. „Dann heiße ich dich in meinem Haus willkommen. Ab heute wirst du meine Tochter sein.“
Es war dem Entschluss Metaneiras zu verdanken, dass sie nicht länger ihre Zeit mit Wollspinnen verbringen mussten. Sie zogen noch am gleichen Tag aus dem hinteren Teil des Hauses auf den großen Hof mit den vielen Zimmerfluchten um. Auch das neue Zimmer war klein, stellte jedoch eine wesentliche Verbesserung dar – es wurde nicht hinter ihnen verschlossen, und sie konnten hinaus auf den Hof gehen und die Sonne in ihr Gesicht scheinen lassen. Sie hatten die Sonne so lange nicht mehr gesehen, dass Metaneira ein Polster von ihrer Schlafkline zerrte und es in den Hof legte, wo sie den ersten Tag einfach faul in der Sonne lagen. Ihre bescheidene Idylle hatte nur einen einzigen Makel – Stratola und Anteia lebten ebenfalls auf dem Hof. Neaira entdeckte die beiden, wie sie tuschelnd mit ihren Wollkörben vor ihren Zimmern saßen und Wolle spannen. Doch die Schadenfreude darüber, dass vor allem Stratola der verhasste Wollkorb nicht erspart geblieben war, erregte nur kurz Neairas Aufmerksamkeit. Stattdessen maß sie den Abstand vom Boden bis zum Dach der Zimmer, der nicht besonders hoch zu sein schien. „Wir könnten doch einfach weglaufen – nachts, wenn alle schlafen.“
Metaneira, die neben ihr in der Sonne gedöst hatte, öffnete die Augen und schüttelte den Kopf. „Denk nicht mal dran, meine Kleine. Glaub mir, da draußen ist nichts für uns, und ich verbiete dir, nachts das Zimmer zu verlassen.“
Eine trotzige Bemerkung lag auf Neairas Lippen, doch sie verschluckte sie. Metaneira war zu nett zu ihr, und sicherlich würde sich noch eine bessere Gelegenheit zur Flucht bieten. Denn fortlaufen wollte sie auf jeden Fall.
Sofort am ersten Abend verstand Neaira auch, weshalb Metaneira nicht wollte, dass sie nachts das Zimmer verließ. Ungewohnte Geräusche, schrille Laute und dumpfes Grunzen raubten ihr den Schlaf und machten ihr Angst. Vielleicht, so glaubte sie, waren es Mänaden und Satyrn, die diesen unscheinbaren Hof heimsuchten, um ein Fest für Dionysos zu feiern. Ihre Mutter hatte ihr oft vom Weingott und seinem Gefolge erzählt, wenn sie unartig gewesen war. „Wenn du nicht damit aufhörst, werden die Satyrn dich holen, und du musst mit ihnen im Wald leben!“ Immer wieder hatte ihre Mutter mit dem Finger gedroht und ihr dann schaurige Geschichten von den Festen der Satyrn und Mänaden erzählt; es waren unheimliche Feste von einer solchen Ausgelassenheit, dass sich Menschen wie Raubtiere benahmen und rohes Fleisch von den Tieren des Waldes in sich hineinschlangen. In ihrem kindlichen Verstand wusste Neaira sich zwar nichts Genaues vorzustellen, doch die Geschichten ihrer Mutter weckten Ahnungen von grauenvollen Dingen, die in den Wäldern vor sich gingen und von Schattenwesen mit Hörnern, Ziegenohren und Pferdeschwänzen, die über junge Mädchen herfielen und sie zwangen mit ihnen zu tanzen. Die Geräusche, die vom Hof und aus den Zimmern an ihre Ohren drangen, ließen sie solch schreckliche Dinge befürchten, von denen ihre Mutter ihr erzählt hatte. Die gesamte Nacht hielt sie sich die Ohren zu und bemühte sich vergeblich um Schlaf, während Metaneira neben ihr weniger ängstlich zu sein schien. Erst gegen Morgen kehrte Ruhe auf dem Hof ein, und Neaira verschlief beinahe den ganzen Tag. Nach den ersten unruhigen Nächten gewöhnte sie sich jedoch an das nächtliche Treiben, zumal sie meist ohnehin neben Metaneira auf das Polster kletterte, anstatt auf ihrer eigenen Schlafmatte zu schlafen. Neugierig fragte sie Metaneira einmal, ob Stratola und die anderen Mädchen nachts auf dem Hof zu Mänaden wurden und sich mit Satyrn zusammentaten. Anscheinend sprach Metaneira jedoch nicht gerne darüber, da sie ihr keine Antwort gab und stattdessen durchkitzelte, sodass Neaira ihre Frage schnell vergaß. Wenn sie aber nachts neben Metaneira lag und die Geräusche vom Hof vernahm, meinte sie zu wissen, dass es so war. Nicht umsonst war Stratola von Anfang an so unfreundlich gewesen, und nicht umsonst schien sogar Metaneira Angst zu haben nachts ihr Zimmer zu verlassen. Neaira war sich ganz sicher, das Geheimnis dieses seltsamen Hauses gelöst zu haben. Alle hier waren Diener des Dionysos und seiner Scharen – Stratola, Nikarete, und vor allem Idras – und sie und Metaneira sollten ebenfalls dazu gezwungen werden ihm zu dienen. Als Neaira das erkannt hatte, beschloss sie einmal mehr fortzulaufen. Sie würde Metaneira einfach überreden mit ihr zu gehen. Dann würden sie zusammen ihre Mutter suchen und ihr all das Schreckliche erzählen, was sie erlebt hatten.
Idras stand wie ein böser schwarzer Schatten in ihrer Tür und verschluckte das spärliche Sonnenlicht, das in das Zimmer schien. Ein paar Tage hatten sie Ruhe vor ihr gehabt, doch nun war sie gekommen. Neaira sah fragend zu Metaneira, die neben ihr auf der Kline gelegen hatte. Erkannte die Freundin die Gefahr, in der sie schwebten?
„Ich soll euch zur Herrin bringen.“ Idras verlor keine Zeit, was für Neaira ein geradezu verräterisches Zeichen war. Metaneira schien nicht argwöhnisch, denn sie erhob sich ohne Zögern oder Murren von der Kline und begann sich anzukleiden. Neaira, die nicht wusste was sie tun sollte, ließ sich unwillig von Metaneira ihren Chiton über den Kopf streifen, nachdem diese sie ermahnte nicht zu bummeln. Danach folgten sie den watschelnden Schritten der Schwarzen hinein in das Haus, während Neaira sich ängstlich an Metaneiras Hand festklammerte. Es bereitete ihr Unbehagen, die rot getünchten Flure des Hauses zu durchqueren, in denen es so schal roch. Doch Neaira tröstete sich mit dem Gedanken, dass sie die Aussicht darauf hatte, in die Nähe der roten Tür zu gelangen, hinter der die Freiheit wartete. Sie warf einen Seitenblick auf Metaneira. Wenn Metaneira mit ihr fortlaufen würde, könnten sie zusammenbleiben ... irgendwo, wo es schöner war als hier. Sie könnten auch nach ihrer Mutter suchen. Neaira war so in Gedanken vertieft, dass sie kaum bemerkte, wie Idras sie ins Andron des Hauses schob. Sie hätte beinahe mit offenem Mund gestarrt, als sie Nikarete mit einer Handarbeit auf einem großen Stuhl sitzen sah, die Füße ordentlich auf einem Fußschemel ruhend. Die dicke weiße Schicht Schminke auf ihrem Gesicht fehlte. Neaira konnte sehen, dass Nikarete älter war, als sie geglaubt hatte. Dieses Bild einer arbeitenden Frau passte gar nicht zu Nikarete. Auch dies schien Neaira ein weiterer Beweis dafür, dass sie sich nur tagsüber als Mensch ausgab, während sie nachts Dionysos anrief. Idras schien Neairas Gedanken erraten zu können und belohnte diese mit einem einzigen schmerzhaften Schlag auf ihren Rücken, der sie zusammenzucken ließ.
Mit spitz gefeiltem Fingernagel wies Nikarete beide Mädchen an, sich zu ihren Füßen auf den Boden zu setzen. „Es ist Zeit, mit dem Unterricht zu beginnen.“
Neaira bekam Angst. Würde sie jetzt ihre wahren Absichten verraten, die Spindel fallen lassen und Idras anweisen, sie und Metaneira in einen Wald zu bringen? Doch nichts dergleichen geschah, stattdessen brachte Idras eine Kithara und drückte sie Metaneira in die Hand.
„Spiel etwas“, wies sie Metaneira an, die vorsichtig begann die Saiten zu zupfen und dabei tatsächlich ein Lied zustande brachte. Neaira war erstaunt, und auch Nikarete schien zu gefallen, was sie hörte. Sie fuhr mit ihrer Handarbeit fort. „Gut“, gab Nikarete schließlich nach einer ganzen Weile zu und nickte. Ohne verschleppt oder verzaubert worden zu sein, kehrte Neaira an der Seite von Metaneira zurück in ihr Zimmer im Hof. Sie dankte Aphrodite dafür, dass sie noch einmal davon gekommen waren, und wies es Metaneiras schönem Kitharaspiel zu. Insgeheim betete sie dafür, dass Metaneira in allem so gut war, wie im Umgang mit der Kithara, sodass ihr Zeit blieb darüber nachzudenken, wie sie es schaffen konnten zu fliehen.
Die Götter schienen Neaira tatsächlich gewogen zu sein, denn die Besuche bei Nikarete häuften sich, und Metaneira stellte sich bei allem, was Nikarete von ihr verlangte, geschickt an. Metaneira wurde gezeigt, wie sie ihr Haar zu richten hatte, wie sie Schminke auflegte, aber auch wie sie sich anmutig bewegte. Obwohl Neaira nicht verstand, weshalb Nikarete und Idras das alles taten, verhielt sie sich ruhig und brütete weiter über der Frage, wie sie endlich die rote Tür erreichen konnten. Dabei tat sie möglichst gelangweilt und ließ ihre Blicke über die üppige Einrichtung Nikaretes schweifen - die dick gepolsterten Klinen, die vielen Tücher und Kissen. Auf keinen Fall wollte sie, dass Nikarete erriet worüber sie nachdachte. Wer wusste schon, ob ihr wilder Gott ihr nicht die Kraft gegeben hatte in ihren Kopf zu schauen. Nikarete thronte bei den Unterweisungen stets auf ihrem Stuhl und spann Wolle. Immer wenn Neairas Gedanken abschweiften, erhielt sie von Idras einen Schlag mit dem Stock in den Rücken, und sie wandte ihre Aufmerksamkeit wieder den Unterweisungen zu, ohne jedoch wirklich aufmerksamer zu sein.
„Das Kind ist nicht lernwillig“, stellte Nikarete irgendwann fest. Neaira war es egal.
Ein paar Tage später erschien Idras am Abend in ihrer Unterkunft, um Metaneira zu holen. Schon den gesamten Tag war Metaneira nervös und kaum ansprechbar gewesen. Auf Neairas Fragen war sie kaum eingegangen, und am frühen Abend hatte Metaneira damit begonnen, sich herauszuputzen. Jetzt trug sie einen blassgrünen mit goldenen Fäden durchwirkten Chiton aus Leinen, dessen Stoff so dünn war, dass man ihre Beine durchscheinen sah. Goldene Paspeln waren auf die Träger ihres Gewandes genäht. Neaira hatte ihr helfen müssen, das gerstenblonde Haar zu waschen und hochzustecken. Besonders seltsam fand Neaira Metaneiras Gesicht, welches sie wie Nikarete mit einer dicken Paste geweißt hatte – Metaneiras leicht gebräunte Haut schien hinter einer starren Maske verschwunden zu sein.
Idras hatte eine kleine Schatulle aus Holz mitgebracht, der sie goldene Ohrgehänge und perlenbestickte Bänder entnahm. Sie zupfte noch einmal eigenhändig am hellblauen Gürtel und richtete die Raffung des Chitons, bevor sie zufrieden nickte. Neaira sah es mit zunehmendem Grauen. Als Idras Metaneira am Arm packte, krallte sich Neaira am Bein ihrer Freundin fest. „Du darfst nicht mit ihr gehen.“
Metaneira lächelte gerührt und umarmte Neaira ein letztes Mal. Dann folgte sie Idras mit anmutigen Schritten, wie sie es von Nikarete gelernt hatte.
Neaira war verzweifelt. „Du darfst nicht mit ihr gehen, Metaneira. Bitte nicht!“
Drei Stockschläge landeten auf ihrem Rücken als Idras ihre Hartnäckigkeit zu viel wurde.
„Keine Sorge, ich bin bald wieder da“, versuchte Metaneira sie zu beruhigen. Dann musste Neaira hilflos zusehen, wie Metaneira hinter der Schwarzen herlief.
Am frühen Morgen war Metaneira wieder zurück. Neaira, die kein Auge zugetan hatte, fiel ihr erleichtert um den Hals. Sie meinte die unterschiedlichsten Gerüche an Metaneira wahrzunehmen - einen verbrauchten Duft von blumigem Salböl, den sauren Geruch von Wein in ihrem Atem und einen anderen Geruch, den Neaira oft an ihrer Mutter wahrgenommen hatte. Es war ein stechender Geruch, den sie nicht zuzuordnen vermochte. Obwohl dieser Geruch sie irritierte, dachte Neaira nicht weiter über ihn nach. Alles war gut, solange Metaneira nur unbeschadet zurückkehrte.
Metaneira schob sie sanft von sich und zog die Bänder aus den Haaren. „Kommst du mit mir zum Louterion und hilfst mir?“
Neaira sprang vom Schlafpolster auf und nickte eifrig. Die vage und immer mehr verblassende Erinnerung an die Waschtage mit ihrer Mutter kam ihr in den Sinn und versprach eine erfreuliche Abwechslung im täglichen Einerlei.
Als Metaneira an das Louterion im Badehaus trat, blieb die erhoffte gute Stimmung jedoch aus. Stattdessen schickte Metaneira sie, die Sklaven von ihren Schlafmatten aufzuscheuchen, damit sie Wasser brachten. Müde und mit verquollenen Augen tappten die Knaben immer wieder zum Brunnen, um Wasser für Metaneira zu holen. Ihre Mienen ließen keinen Zweifel daran, dass Metaneiras Waschhysterie sie ärgerte. Auch Neaira wunderte sich. Metaneira mochte überhaupt nicht mehr aufhören, ihren Körper zu schrubben. Obwohl die weiße Farbe längst von ihrem Gesicht gewaschen war, schien es nicht genug Wasser zu sein, das die Sklaven über ihr ausgossen. Erst als Neaira laut gähnte, schien Metaneira sich zu besinnen. Müde kehrten sie in ihre Unterkunft zurück. Neaira war froh, noch eine Weile schlafen zu können, bevor der Hof erwachte. Als sie jedoch wie gewohnt zu Metaneira auf die Schlafkline klettern wollte, wehrte die Freundin ab. „Nicht heute, Neaira. Ich bin jeglicher Berührung müde.“ Enttäuscht rollte sich Neaira auf ihrer eigenen Matte zusammen und zerbrach sich den Kopf darüber, was Nikarete und Idras ihrer Freundin wohl angetan hatten. Hatte Metaneira mit den Satyrn auf dem Hof getanzt? War sie deshalb so seltsam? Neaira schauderte bei dem Gedanken - sie mussten endlich fliehen, bevor es zu spät war.
2. Kapitel
Spuren im Sand
Langsam aber sicher schien Metaneira ihre alte Gelassenheit zurückzugewinnen, was Neaira beruhigte. Anfangs packte sie noch Angst, sobald Idras kam, um Metaneira zu holen. Nach Metaneiras Rückkehr am frühen Morgen suchte diese stets das Louterion auf, um sich zu waschen. Neaira glaubte ihre Freundin verloren zu haben – das was von Metaneira übrig war, hatte nichts mehr mit dem Mädchen zu tun, das Neaira kennengelernt hatte. Dann, im zweiten Mondumlauf, entwickelte Metaneira eine gewisse Gleichgültigkeit und folgte Idras ohne Furcht, wenn sie kam, um sie zu holen. Nach einem halben Jahreswechsel war es für Metaneira zur Gewohnheit geworden sich zu schmücken, und sie wies Neaira auch nicht mehr ab, wenn sie nachts zu ihr auf das Lager kletterte. Aus Angst vor den schrecklichen Dingen, die Metaneira ihr vielleicht erzählen könnte, fragte Neaira sie nicht, was in den Nächten geschah, in denen Idras sie ins Haus von Nikarete brachte. Sie hatte rasende Angst davor, dass man sie von Metaneira trennte und sie in diesem Haus alleine blieb.
Die verschiedenen Gerüche, die an Metaneira hafteten, nahm Neaira bald nicht mehr wahr. Auch Metaneira schienen sie gleichgültig, sodass sie ihren Besuch im Badehaus bis zum Mittag aufschob, wenn sie ausgeschlafen hatte. Metaneira wurde mittlerweile nicht mehr zu Nikarete gerufen, um Unterweisungen von ihr zu erhalten. Neaira dankte Aphrodite dafür.
Das Leben auf dem Hof verlief in eigentümlicher Langeweile, unterbrochen nur von Stratolas bösen Blicken, mit denen sie Metaneira bedachte. „Sie neidet mir meine bessere Stellung“, erklärte die Freundin Neaira dann. Noch immer konnte sich Neaira nichts unter den wenigen Erklärungen vorstellen, die Metaneira ihr zuteilwerden ließ.
Neaira lebte seit einem Jahr in Nikaretes Haus, ging Metaneira zur Hand, was bedeutete, dass sie tagsüber faul in der Sonne lag und der Freundin abends half sich zu schmücken, als sich im gleichtönigen Tagesablauf eine unverhoffte Abwechslung einzustellen schien, die ihr auch ihre Fluchtpläne wieder ins Gedächtnis rief. Idras stand eines Morgens überraschend auf ihrer Türschwelle. „Heute besuchen wir die Agora. Die Herrin braucht neue Tücher und Bänder. Nimm die kleine Mänade mit, damit sie die Einkäufe tragen kann“, befahl sie Metaneira.
Neaira, die ruhig in einer Ecke gesessen hatte, sprang auf und warf sich Metaneira in die Arme, sobald die schwarze Sklavin fort war. Gemeinsam drehten sie sich im Kreis und freuten sich über den Ausflug. „Endlich kommen wir aus diesem Haus heraus“, rief vor allem Metaneira immer wieder. Neaira dachte bereits darüber nach, wie sie Idras klammerndem Griff würden entkommen können. Diese Gelegenheit war ein Wink der Götter, den sie sich zunutze machen mussten. Neaira überlegte, ob sie Metaneira in ihre Fluchtpläne einweihen sollte. Doch Metaneira hatte schon einmal abgelehnt zu fliehen, und wer wusste schon, wie sehr Nikarete ihr den Kopf verdreht hatte. Wenn sie erst einmal aus dem Haus heraus wären, würde Neaira schon etwas einfallen, wie sie es anstellte, Metaneira zu überzeugen.
Neaira konnte ihre Aufregung kaum verbergen, während sie neben Metaneira und Idras über die Schwelle der roten Tür trat, hinter die sie vor nunmehr einem ganzen Jahresumlauf gestoßen worden war. Es war ein angenehmer Tag im Frühsommer, und die bunten Stoffe der Tuchweber flatterten wie Fahnen im Wind, sodass Neaira sich kaum vorstellen konnte, dass sie ihr einmal wie ein undurchdringliches Labyrinth erschienen waren. Kurz hielt sie den Atem an, als sie über die Schwelle trat, denn sie befürchtete, dass etwas oder jemand sie zurückhalten würde; doch es geschah nichts. Es war so einfach, über diese Schwelle zu treten. Neaira konnte ihr Glück kaum fassen.
Obwohl Idras ihren Stock dabei hatte und wie ein Wachhund darauf achtete, dass keines der Mädchen fortlief, genoss Neaira den Weg zur Agora, der sie hinaus aus der Gasse der Tuchweber und immer hügelaufwärts durch die Straßen Korinths führte. Je weiter sie liefen, desto aufgeregter wurde sie. Auf der Agora wären viele Menschen. Es wäre leicht, Metaneira dort einfach an die Hand zu nehmen und mit ihr fortzulaufen. Idras war dick und würde ihnen in dem Gewimmel nicht so schnell folgen können. Nun bereute Neaira, dass sie der Freundin nicht vorher von ihren Fluchtplänen erzählt hatte. Sie hoffte, dass sie Metaneira nicht lange würde bitten müssen. Doch wer konnte schon widerstehen, an einem solch schönen Tag fortzulaufen?
Wie schon mit ihrer Mutter wurden sie hier und da angestarrt, während sie zu dritt durch die Straßen liefen. Doch ein Wort von Idras genügte bereits, die Blicke der Männer abzuwehren. Erinnerungen gingen Neaira durch den Kopf, die schnellen Schritte ihrer Mutter, das unbarmherzige Ziehen an ihrem Arm und die Hoffnung auf süße Datteln. Neaira zupfte an ihrem einfachen Chiton und erinnerte sich, dass sie bei ihrer Ankunft in Korinth einen vergleichsweise Schöneren getragen hatte. Doch was machte das schon? Sie fühlte den Sand der Straße zwischen ihren Zehen, der sich in ihre Sandalen setzte, spürte die warme Sonne auf ihr Haar scheinen, und sie vernahm den Lärm der Straße. So frei war sie schon lange nicht mehr gewesen. Metaneira, die den Ausflug ebenfalls genoss, hatte einen Schleier über ihren Kopf gelegt und hielt ihn sich vor das Gesicht, wenn ein vorbeifahrender Karren zu viel Staub aufwirbelte. Ihr Betragen war ganz so, wie es Idras gefiel. Die Freude über den Ausflug trübte sich ein wenig bei Neaira, als Idras an einer breiten Straße zwei gelangweilte Sänftenträger heranwinkte. Ohne große Eile handelten sie den Preis einer Beförderung bis zur Agora aus. „Sie ist eine edle Dame“, ereiferte sich Idras, um den Preis zu drücken.
Die beiden Träger grinsten und zeigten dabei ihre schlechten Zähne. „Ein edles Pferdchen“, sagte einer und machte eine kreisende Bewegung mit dem Becken. Neaira kramte in ihrer Erinnerung, wo sie dies schon einmal gesehen hatte und erinnerte sich an den Akrobaten, der ihre Mutter mit einer solchen Geste bedacht hatte.
Der überdachte Tragstuhl war zwar schäbig, trotzdem bestand Idras nach erfolgreicher Verhandlung darauf, dass Metaneira ihn bestieg. „Deine Haut wird sonst zu dunkel“, murrte sie. Für die gezahlten zwei Obolen erlaubten die Männer, dass Neaira sich zu Metaneiras Füßen kauerte. Neaira wäre lieber gelaufen, denn wer konnte schon wissen, wann sie das nächste Mal die Gelegenheit bekam, das Haus Nikaretes zu verlassen. Ach nein, ich werde ja gar nicht dahin zurückkehren, fiel ihr wieder ein. Ein Blick auf Idras Stock ließ sie ihren Unwillen hinunterschlucken. Ihre Weigerung war eine Trachtprügel nicht wert.