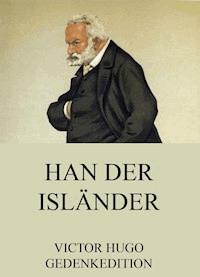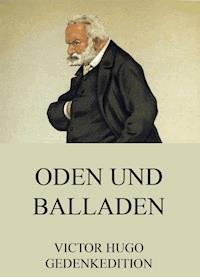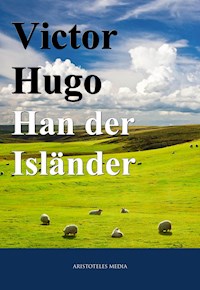0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RUTHebooks
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Für RUTHeBooks Klassiker lassen wir alte oder gar schon vergriffene Werke als eBooks wieder auferstehen. Wir möchten Ihnen diese Bücher nahebringen, Sie in eine andere Welt entführen. Manchmal geht das einher mit einer für unsere Ohren seltsam klingenden Sprache oder einer anderen Sicht auf die Dinge, so wie das eben zum Zeitpunkt des Verfassens vor 100 oder mehr Jahren "normal" war. Mit einer gehörigen Portion Neugier und einem gewissen Entdeckergeist werden Sie beim Stöbern in unseren RUTHeBooks Klassikern wunderbare Kleinode entdecken. Tauchen Sie mit uns ein in die spannende Welt vergangener Zeiten!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 893
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Victor Hugo
Der Glöckner von Notre-Dame
Impressum
Inhalt
Einleitung
Vor einigen Jahren fand der Verfasser dieses Buches beim Besuche, oder besser gesagt, beim Durchsuchen von Notre-Dame, in einem versteckten Winkel des einen der Türme das Wort:
ΑΝΑΓΚΗ
mit der Hand in die Mauer eingegraben.
Diese großen griechischen Buchstaben, die vor Alter schwarz geworden und ziemlich tief in den Stein eingekratzt waren, hatten in ihren Formen und Stellungen so eigentümliche, an die gotische Schreibkunst erinnernde Züge, daß man in ihnen die mittelalterliche Hand erriet, welche sie da angeschrieben hatte. Überdies ergriff der düstere und unheimliche Sinn, den sie enthielten, den Autor in lebhafter Weise.
Er fragte sich, er suchte zu erraten, wer wohl die bedrängte Seele sein konnte, welche diese Welt nicht hatte verlassen wollen, ohne dieses Denkzeichen eines Verbrechens oder Unglücks an der Front der alten Kirche zu hinterlassen.
Seitdem hat man die Mauer mit Mörtel übertüncht, oder irgend jemand sie abgekratzt, und die Inschrift ist verschwunden. Denn so verfährt man seit bald zweihundert Jahren mit den wundervollen Kirchen des Mittelalters. Verstümmelungen erleiden sie von allen Seiten, von innen so wie von außen. Der Priester übertüncht sie, der Baumeister kratzt sie ab; schließlich kommt das Volk darüber und demolirt sie.
Daher ist außer dem schwachen Andenken, welches der Autor dieses Buches ihm hier widmet, heute nichts mehr von dem geheimnisvollen, im düstern Turme von Notre-Dame eingegrabenen Worte übrig; nichts mehr von dem unbekannten Schicksale, welches es in so schwermüthiger Weise zum Ausdruck bringt. Der Mensch, welcher das Wort auf die Mauer geschrieben hat, ist vor mehreren Jahrhunderten aus der Mitte der Geschlechter verschwunden, das Wort gleichfalls von der Mauer verwischt, und die Kirche wird vielleicht selbst bald von der Erde verschwinden.
Gerade über dieses Wort ist vorliegendes Buch geschrieben worden.
März 1831
Erstes Buch
Kapitel 1 - Der große Saal
Heute vor dreihundertachtundvierzig Jahren sechs Monaten und neunzehn Tagen erwachten die Pariser unter dem Geläute aller Glocken, welche innerhalb des dreifachen Bereiches der Altstadt, Südstadt oder des Universitätsviertels und der Nordstadt mit lautem Schalle ertönten.
Und dennoch ist der 6. Januar 1482 kein Tag, von dem die Geschichte eine Erinnerung bewahrt hat. Nichts Merkwürdiges war an dem Ereignisse, welches seit dem Morgen die Glocken und die Bürger von Paris so in Bewegung und Erregung versetzte. Weder war es ein Überfall der Picarden oder der Burgunder, noch ein glänzender Jagdaufzug, noch ein Studententumult im Weingarten von Laas, noch ein Einzug "unseres allergnädigsten Herrn, des sehr gefürchteten Herrn Königs", noch auch eine hübsche Aufknüpfung von Spitzbuben und Diebinnen im Gerichtshofe zu Paris. Nein, nicht einmal die im fünfzehnten Jahrhunderte so häufige Überraschung durch irgend welche verbrämte und mit Federbüschen geschmückte Gesandtschaft war es. Vor kaum zwei Tagen hatte der letzte derartige Aufzug, nämlich derjenige der flamländischen Gesandten, welche mit Abschließung des Ehebündnisses zwischen dem Dauphin und Margarethen von Flandern beauftragt waren, seinen Einzug in Paris gehalten, zum großen Verdrusse des Herrn Cardinals von Bourbon, welcher, dem Könige zu gefallen, dieser ganzen tölpelhaften Gesellschaft flamländischer Bürgermeister höflich begegnen und sie in seinem Palaste Bourbon mit einem "viel köstlichen Moralitätsspiele, Possen- und Schwankspiele" hatte unterhalten müssen, während ein Platzregen die prächtigen Teppiche vor seinem Tore überschwemmte.
Der 6. Januar, welcher "die ganze Bevölkerung von Paris in Bewegung brachte", wie Jehan von Troyes erzählt, vereinigte seit undenklicher Zeit ein Doppelfest in sich: das des Königstages und des Narrenfestes.
An diesem Tage mußte es Freudenfeuer auf dem Grèveplatze, Maienaufpflanzung in der Kapelle Braque und geistliches Schauspiel im Justizpalaste geben. Am Abend vorher war es unter Trompetenschall in den Gassen durch des Herrn Oberrichters Leute in ihren Waffenröcken von violettem Camelot, mit großen weißen Kreuzen auf der Brust, ausgerufen worden.
Das Gedränge der Bürger und Bürgerinnen wogte also vom Morgen an, und nachdem Häuser und Verkaufsläden geschlossen waren, von allen Seiten nach einem der drei bezeichneten Stellen hin. Ein jeder hatte Partei genommen: der eine für das Freudenfeuer, der andere für die Maie, der dritte für das geistliche Schauspiel. Zum Ruhme des einfachen, gesunden Menschenverstandes der Pariser Maulaffen muß man sagen, daß der größte Teil der Menge seine Schritte nach dem Freudenfeuer lenkte, welches ganz zum Wetter paßte, oder nach dem Schauspiele, welches in dem wohl verdeckten und geschlossenen Saale des Palastes aufgeführt werden sollte; und daß die Schaulustigen übereingekommen waren, die arme, grüne Maie ganz allein unter dem Januarhimmel auf dem Kirchhofe der Kapelle Braque frieren zu lassen.
Das Volk wogte vornehmlich auf den Zugängen nach dem Justizpalaste, weil man wußte, daß die flamländischen Gesandten, welche vor zwei Tagen eingetroffen waren, sich entschlossen hatten, der Aufführung des Schauspiels und der Wahl des Narrenpapstes beizuwohnen, die gleichfalls im großen Saale stattfinden sollte.
Es war kein leichtes Vorhaben, an diesem Tage in jenen Saal zu gelangen, welcher damals für den größten bedeckten Raum, der in der Welt war, galt (freilich hatte Sauval den großen Saal des Schlosses Montargis noch nicht ausgemessen). Der menschenbedeckte Platz vor dem Palaste bot den Schaulustigen an den Fenstern den Anblick eines Meeres dar, in welches fünf bis sechs Straßen als ebenso viele Strommündungen jeden Augenblick neue Fluten von Köpfen ergossen. Die Wogen dieser unaufhörlich zunehmenden Menge brachen sich an den Ecken der Häuser, welche hier und da, wie ebenso viele Vorgebirge in das unregelmäßige Becken des Platzes hervortraten. In der Mitte der hohen gotischen Façade des Palastes wogte die große Treppe unaufhörlich ein Doppelstrom auf und ab, welcher, nachdem er sich unter dem Zwischenperron gebrochen hatte, in großen Wellen auf seine beiden Seitentreppen hinströmte; ungefähr, behaupte ich, wie eine Cascade in einen See spie die große Treppe unaufhörlich Menschen auf den Platz. Das Schreien, Lachen, Stampfen dieser Tausende von Füßen verursachte einen großen Lärm und mächtiges Toben. Von Zeit zu Zeit verdoppelten sich dieses Toben und Lärmen, sobald der Strom, welcher die ganze Menschenmasse nach der großen Treppe zu trieb, zurückprallte, durcheinander wogte und wirbelte; oder wenn ein Häscher Rippenstöße verteilte, oder das Pferd eines Sergeanten vom Gerichtsamte hinten ausschlug, um die Ordnung wieder herzustellen: – eine herrliche Überlieferung, welche das Obergerichtsamt an die Landreiter, und die Landreiter an unsere Pariser Gendarmerie vererbt haben.
An den Türen, in den Fenstern, an den Dachluken, auf den Dächern wimmelte es von Tausenden jener guten, ruhigen, rechtlichen Bürgergestalten, welche den Palast betrachteten, das Gedränge beobachteten und nichts weiter verlangten; denn sehr viele Leute in Paris sind schon zufrieden, Zuschauer von Zuschauern sein zu können, und für manche von uns ist schon eine Mauer, hinter der sich etwas ereignet, eine sehr merkwürdige Sache.
Wenn es uns, den Menschen von 1830, erlaubt wäre, im Gedanken uns unter diese Pariser des fünfzehnten Jahrhunderts zu mischen, und mit ihnen, gedrängt, gestoßen und getreten in den ungeheuren Saal des Palastes einzudringen, welcher am 6. Januar 1482 so beengt war, – dies Schauspiel würde für uns nicht ohne Reiz und Vergnügen sein, und wir würden so viel alterthümliche Gegenstände rings um uns erblicken, daß sie uns ganz neu erscheinen müßten.
Wenn es dem Leser recht ist, wollen wir versuchen, den Eindruck zu schildern, den er beim Eintritt in diesen Saal, mitten unter den Schwarm in Wamms, in Jacke und in Weiberrock mit uns empfangen haben würde.
Schon von vornherein sind unsere Ohren betäubt, unsere Augen geblendet. Über unseren Köpfen befindet sich ein doppelbogiges Gewölbe, mit Holzbildschnitzereien vertäfelt, azurblau gemalt und mit goldenen Blumen geschmückt; unter unseren Füßen ein abwechselnd aus weißem und schwarzen Marmor zusammengesetzter Boden. Einige Schritte von uns erhebt sich ein riesiger Pfeiler, dann ein zweiter, dann noch einer: im ganzen sieben Pfeiler in der Länge des Saales, der mitten in seiner Breite die Schwibbogen der Doppelwölbung trägt. Rings um die vier ersten Pfeiler stehen Kramläden, die von Glas und Flittertand glänzen, um die drei Letzten Bänke von Eichenholz, die von den Hosen der Prozessierenden und den Amtskleidern der Sachwalter abgenutzt und glatt gesessen sind. Ringsum im Saale, längs der hohen Wände, zwischen den Türen, den Nischen und den Pfeilern befinden sich in unabsehbarer Reihe die Statuen aller Könige Frankreichs seit Pharamund: die schwachen Regenten unter ihnen mit herabhängenden Armen und gesenkten Blicken; die tapferen, schlachtberühmten mit mutig zum Himmel erhobenem Haupte und Händen. In den hohen Rundbogenfenstern aber glänzen tausendfarbige Scheiben; an den breiten Ausgängen des Saales sehen wir reiche Türen mit schöner Holzschnitzerei; und das Ganze: Gewölbe, Pfeiler, Wände, Simswerk, Täfelung, Türen und Statuen, ist von oben bis unten mit glänzender Malerei in Blau und Gold bedeckt, welche, als schon ein wenig gedunkelt in dem Zeitraume wo wir sie sehen, im Jahre der Gnade 1549, wo Du Breul sie nach der Überlieferung noch bewunderte, fast ganz unter dem Staube und den Spinneweben verschwunden war. Nun denke man sich diesen ungeheuren Saal in rechteckiger Gestalt erleuchtet von dem matten Lichte eines Januartages, überschwemmt von einer lärmenden und bunten Menge, die längs der Wände hinflutend um die sieben Pfeiler brandet, und man wird einen allgemeinen Eindruck von dem ganzen Gemälde haben, das wir in seinen merkwürdigen Einzelheiten zu schildern versuchen wollen.
Sicher ist, daß, wenn Ravaillac Heinrich den Vierten überhaupt nicht ermordet hätte, es gar keine Prozessakten Ravaillacs, die in der Kanzlei des Justizpalastes lagen, gegeben haben würde; daß keine Mitschuldigen Interesse daran gehabt hätten, die genannten Acten verschwinden zu lassen; folglich keine Brandstifter erforderlich waren, um, mangels eines bessern Mittels, die Kanzlei anzuzünden, um die Acten zu verbrennen, und den Justizpalast einzuäschern, um die Kanzlei mit Feuer zu vernichten; in Folge wovon es schließlich 1618 keine Feuersbrunst gegeben hätte. Der alte Palast mit seinem alten großen Saale würde noch stehen, und ich könnte zum Leser sprechen: "Geh hin und sieh ihn an"; und wir würden demnach alle beide überhoben sein: ich, eine Beschreibung zu geben, und er, eine mittelmäßige Beschreibung zu lesen. – Diese neue Wahrheit beweist, daß große Ereignisse unberechenbare Folgen haben.
Freilich würde es sehr wohl möglich sein können, sobald Ravaillac keine Mitschuldigen hatte; hernach, daß seine Mitschuldigen, sofern er solche zufällig hatte, beim Brande von 1618 umsonst waren. Es gibt dafür zwei andere sehr annehmbare Erklärungen. Erstens: den großen flammenden Stern von ein Fuß Breite und einer Elle Höhe, der, wie jedermann weiß, am 7. März nach Mitternacht vom Himmel auf den Palast fiel. Zweitens: den vierzeiligen Vers Theophiles:
Der Spaß war wahrlich teuer,
Als in Paris der Dame Recht
Vom zu viel Schlingen wurde schlecht,
Der Palast ganz aufging in Feuer.
Was man von dieser dreifachen politischen, natürlichen und poetischen Erklärung des Brandes des Justizpalastes im Jahre 1618 auch denken mag, die unglücklicherweise feststehende Tatsache ist der Brand. Heute ist nur noch sehr wenig vorhanden, Dank diesem Unglücke, Dank vornehmlich den verschiedenen Wiederherstellungsversuchen im Laufe der Zeit, welche vollends zu Grunde gerichtet haben, was er verschont hatte; es ist nur noch sehr wenig von diesem ersten Aufenthaltsorte der französischen Könige, von diesem ursprünglichen Palastbaue des Louvre übrig, der schon zu Philipps des Schönen Zeit so alt war, daß man hier nach den Spuren der prächtigen Bauten forschte, die vom König Robert aufgeführt und von Helgaldus beschrieben worden sind. Fast alles ist verschwunden. Was ist aus dem Zimmer der Kanzlei geworden, wo der heilige Ludwig "seine Ehe vollzog"? Was aus dem Garten, wo er Recht sprach, "angetan mit einem Camelotrocke, mit einem grobwollenen Obergewande ohne Ärmel, und mit einem Mantel darüber von schwarzem Sandal, auf Teppichen liegend mit Joinville"? Wo ist das Zimmer des Kaisers Sigismund? Dasjenige Karls des Vierten? Dasjenige Johanns ohne Land? Wo ist die Treppe, von welcher Karl der Sechste sein Gnadenedict verkündete? Die Steinplatte, wo Marcel, in Gegenwart des Dauphins, den Robert von Clermont und den Marchal von Champagne erwürgte? Das Pförtchen, wo die Bullen des Gegenpapstes Benedikt zerrissen wurden, und aus welchem diejenigen mit Spottchorröcken und Bischofsmützen angetan heraustraten, welche sie überbracht hatten, und welche öffentliche Buße durch ganz Paris taten? Und wo der große Saal mit seiner Vergoldung, seinem Azurblau, seinen Spitzbogen, seinen Statuen, seinen Pfeilern; wo sein ungeheures Gewölbe, das von Steinmetzarbeiten ganz überzogen war? Und das vergoldete Zimmer? Und der steinerne Löwe, der an der Tür stand, mit gesenktem Kopfe, den Schwanz zwischen den Beinen, wie die Löwen an Salomo's Throne, in der demütigen Stellung, welche sich für die Stärke vor der Gerechtigkeit schickt? Und wo die schönen Türen, und die farbenprächtigen Fenster? Wo die getriebenen Eisenbeschläge, welche Biscornette abschreckten? Und die zierlichen Schreinerarbeiten Du Hancys? ... Was hat die Zeit, was haben die Menschen aus diesen Wunderwerken gemacht? Was hat man uns für alles das gegeben; für jene ganze Geschichte unserer Vorfahren, für jene ganze gotische Kunst? Die plumpen Halbwölbungen des Herrn de Brosse, dieses ungeschickten Baumeisters des Portals von Saint-Gervais – das hat man uns für die Kunst gegeben; und was die Geschichte betrifft, so haben wir die geschwätzigen Erinnerungen der dicken Schandsäule, die noch völlig wiederhallt von dem Altweibergewäsch der Leute wie Patru. Das hat keine Bedeutung. – Wir wollen zu dem wirklichen großen Saale in dem wirklichen alten Palaste zurückkehren.
Die beiden Endseiten dieses gigantischen Rechtecks waren gleichfalls nicht frei: die eine war von der berühmten Marmorplatte aus einem Stücke eingenommen, welche so lang, breit und dick war, wie man sie niemals gesehen hat, erzählen die alten Grundbuchacten in einem Stile, der die Begierde Gargantua's, "eines ähnlichen Marmorblockes in der Welt" gereizt haben würde; an der andern Seite befand sich die Kapelle, in welcher Ludwig der Elfte, auf den Knien vor der heiligen Jungfrau liegend, sich in Marmor hatte abkonterfeien lassen, und wohin er, unbekümmert, daß zwei Nischen in der Reihe der königlichen Standbilder leer würden, diejenigen Karls des Großen und des heiligen Ludwig hatte bringen lassen, – zwei Heilige, von denen er glaubte, daß sie als Könige von Frankreich im Himmel großes Ansehn hätten. Diese noch neue, kaum seit sechs Jahren fertige Kapelle war ganz im reizenden Geschmacke jener feinen Bauart und wunderbaren Meisel- und Grabstichelarbeit ausgeführt, die in Frankreich das Ende der gotischen Bauperiode kennzeichnet, und bis zur Mitte des sechzehnten Jahrhunderts in den zauberischen Phantasiespielen der Renaissance fortdauert. Die kleine, durchbrochene Rosette über dem Portale besonders war ein Meisterwerk von Zartheit und Anmut: man hätte sie für einen Stern aus Spitzen halten mögen.
Mitten im Saale, der großen Tür gegenüber, war eine mit Goldbrokat bedeckte Erhöhung, die bis an die Mauer reichte, errichtet worden, und auf ihr durch ein Fenster aus dem Gange zu dem sogenannten goldenen Zimmer, ein besonderer Eingang für die flamländischen Gesandten und andere hohe Personen hergestellt, die zur Aufführung des Schauspieles geladen worden waren.
Dieses Schauspiel mußte dem Herkommen gemäß auf der Marmorplatte aufgeführt werden. Am Morgen war sie dazu hergerichtet worden; die große Marmorfläche, die von den Absätzen der Parlamentsschreiber ganz zerritzt war, trug ein ziemlich hohes Balkengerüst, dessen Oberfläche, vom ganzen Saale aus sichtbar, als Theater dienen sollte, während sein mit Teppichen ringsum verhängtes Innere für die Personen des Stückes als Ankleidezimmer herhalten mußte. Eine Leiter, die offenherzig außerhalb angebracht war, sollte die Communication zwischen Szene und Ankleidezimmer unterhalten, und ihre steilen Sprossen den auf- und abtretenden Personen herleihen. Da gab es keine so plötzliche Erscheinung, keine Entwickelung im Schauspiel, keinen Theatereffect, der nicht gezwungen gewesen wäre, auf der Leiter hinaufzuklettern. – O du unschuldige, treuere Einfalt in Kunst und Maschinerien!
Vier Diener des Gerichtsvogtes, die gewöhnlichen Aufseher aller Volksbelustigungen sowohl an den Festtagen, als an den Hinrichtungstagen, standen an den vier Ecken der Marmorplatte. Erst mittags, beim zwölften Glockenschlage auf der großen Palastuhr sollte das Stück beginnen. Das war freilich recht spät für eine Theateraufführung; aber man hatte auf die Zeit der Gesandtschaft Rücksicht zu nehmen.
Nun wartete diese ganze Menge schon seit dem Morgen. Eine gute Anzahl dieser neugierigen Spießbürger fror seit Tagesanbruch vor der großen Treppe des Palastes; ja, einige versicherten, die ganze Nacht dem Tore gegenüber zugebracht zu haben, um sicher zuerst den Saal zu betreten. Die Menge wurde jeden Augenblick dichter, und wie ein Gewässer, das sein Bett verläßt, fing sie an längs der Wände in die Höhe zu steigen, um die Säulen herum anzuschwellen, an den Täfelungen, Karnießen, Fensterbrettern, an allen Vorsprüngen der Architektur und an allen Erhöhungen der Bildhauerarbeit hinaufzusteigen. Dazu der Zwang, die Ungeduld, die Langeweile, die Zügellosigkeit eines frechen Narrenfestes, die Streitigkeiten, welche bei jeder Gelegenheit wegen eines spitzen Ellenbogens, eines eisenbeschlagenen Schuhes ausbrachen, das ermüdend lange Warten, – alles das gaben schon lange vor der Zeit, in welcher die Gesandtschaften anlangen sollten, dem Geschrei dieses eingeschlossenen, eingepferchten, gequetschten, erstickten Volkes einen scharfen und bittern Ausdruck. Man hörte nur Klagen oder Verwünschungen gegen die Flamländer, gegen den Oberbürgermeister, den Cardinal von Bourbon, den Palastvogt, gegen Madame Margarethe von Österreich, gegen die Polizisten, über Kälte, Hitze und schlechtes Wetter, gegen den Bischof von Paris, gegen den Narrenpapst, gegen die Pfeiler und Statuen, gegen diese verschlossene Tür und jenes offene Fenster, – alles das zur großen Belustigung der unter der Volksmenge zerstreuten Studenten- und Bedientenrudel, welche diese Unzufriedenheit durch ihre boshaften Neckereien erhöhten, und die allgemeine Mißstimmung, so zu sagen, mit Nadelstichen reizten.
Unter anderen befand sich ein Haufe dieser lustigen Teufel, welche die Scheiben eines Fensters eingestoßen und sich keck auf das Gesims gesetzt hatten, und von wo aus sie ihre Blicke und Spöttereien abwechselnd bald nach innen, bald nach außen, auf die Menge im Saale und auf die des Platzes hinschickten. An ihren äffenden Geberden, an ihrem lauten Gelächter, an den spöttischen Zurufen, welche sie von einem Ende des Saales bis zum andern mit ihren Kameraden wechselten, konnte man leicht erkennen, daß diese jungen Gelehrten nicht die Langeweile und die Ermüdung der übrigen Anwesenden teilten, sondern daß sie recht gut verstanden, bei dem, was unter ihren Augen vorging, zu ihrem Privatvergnügen ein Schauspiel zu genießen, welches sie das andere geduldig erwarten ließ.
"Bei meiner Seele, Ihr seid's, Johannes Frollo de Molendino!" rief einer von ihnen einer Art kleinem blonden Teufel mit hübschem und schalkhaften Gesichte zu, der sich an das Laubwerk eines Säulenknaufes angeklammert hatte, "Ihr heißt ganz richtig Mühlenhannes, denn Eure zwei Arme und Beine sehen ganz wie vier Flügel aus, die im Winde tanzen. Seit wie lange seid Ihr hier?"
"Bei der Gnade des Teufels," antwortete Johannes Frollo, "seit mehr als vier Stunden, und ich hoffe mit Recht, daß sie mir dereinst auf meine Fegefeuerzeit angerechnet werden. Ich habe um Sieben die acht Sänger des Königs von Sizilien die erste Strophe des Hochamts in der heiligen Kapelle anstimmen hören."
"Schöne Sänger das!" versetzte der andere, "und die eine noch spitzere Stimme haben, als ihre Mütze. Ehe der König dem heiligen Herrn Johannes eine Messe stiftete, hätte er sich erst erkundigen sollen, ob der heilige Herr Johannes lateinischen Psalmengesang mit provençalischem Accent vertragen kann."
"Blos um die verdammten Sänger des Königs von Sizilien anzubringen, hat er das getan," rief ärgerlich ein altes Weib in der Menge unter dem Fenster. "Ich frage Euch nur! tausend Livres Pariser Münze für eine Messe! Und außerdem die Pachtung des Seefisches in den Markthallen von Paris auch noch!"
"Ruhig, Alte!" versetzte ein dicker ernsthafter Mann, welcher sich neben dem Fischweibe die Nase zuhielt, "er mußte wohl eine Messe stiften. Möchtet Ihr etwa, daß der König wieder krank würde?"
"Brav gesprochen, Herr Gilles Lecornu, Meister Hofkürschner!" rief der kleine Student, der am Säulenknaufe sich angeklammert hatte.
Ein lautes Gelächter aller Studenten bewillkommnete den unglücklichen Namen des armen Hofkürschners.
"Lecornu! Gilles Lecornu!" riefen die einen.
"Cornutus et hirsutus," entgegnete ein anderer.
"Ei gewiß," fuhr der Kleine oben auf dem Säulenknaufe fort. "Was ist da zu lachen? Ein Ehrenmann, der Gilles Lecornu, der Bruder des Meisters Johann Lecornu, des Profoß im königlichen Palaste, der Sohn vom Meister Mahiet Lecornu, dem Oberwaldhüter im Gehölz von Vincennes, – alles Bürger von Paris, alle verheiratet vom Vater bis zum Sohne!"
Die Ausgelassenheit verdoppelte sich. Der dicke Kürschner bemühte sich, ohne ein Wort zu sprechen, den Blicken sich zu entziehen, die überallher auf ihn gerichtet waren; – aber vergebens schwitzte und keuchte er: wie ein Keil, der ins Holz getrieben wird, dienten die Anstrengungen, die er machte, nur dazu, sein breites, aufgedunsenes, vor Zorn und Ärger purpurrothes Gesicht noch fester zwischen die Schultern seiner Nachbarn einzuklemmen. Endlich kam ihm einer von diesen, welche kurz, dick und ansehnlich wie er waren, zu Hilfe.
"Abscheulich! Schuljungen, die so mit einem Bürger sprechen! Zu meiner Zeit hätte man sie mit Ruthen ausgepeitscht, und dann hätte man sie verbrannt."
Die ganze Bande brach nun los.
"Holla he! wer liest da einem den Text? Wer ist der Unglücksrabe?"
"Warte, ich kenne ihn," sagte ein anderer, "es ist Meister Andry Musnier."
"Jawohl, es ist einer von den vier geschworenen Universitätsbuchhändlern," sagte ein anderer.
"Alles ist vierfach in dieser Bude," schrie ein dritter, "die vier Nationen, die vier Facultäten, die vier Feste, die vier Procuratoren, die vier Wahlmänner, die vier Buchhändler."
"Nun wohl," entgegnete Johann Frollo, "man muß ihnen auch den Teufel vervierfachen."
"Musnier, wir werden deine Bücher verbrennen."
"Musnier, wir werden deinen Diener prügeln."
"Musnier, wir werden deine Frau zerdrücken."
"Die gute, dicke Frau Oudarde."
"Die so frisch und so lustig ist, als wäre sie Witwe."
"Möge der Teufel euch holen!" brummte Meister Andry Musnier.
"Meister Andry," fing Johann wieder an, welcher immer noch an seinem Säulenknaufe hing, "sei stille, oder ich falle dir auf den Kopf!"
Meister Andry hob die Augen auf, schien einen Augenblick die Höhe des Pfeilers, die Schwere des Burschen zu taxiren, multiplicirte in Gedanken diese Schwere mit dem Quadrate der Geschwindigkeit, und schwieg.
Johann, Herr des Schlachtfeldes, fuhr triumphirend fort:
"Ja, das würde ich tun, obgleich ich der Bruder eines Archidiaconus bin!"
"Schöne Herren, unsere Leute von der Universität! nicht einmal an einem Tage, wie dem heutigen, unsere Privilegien in Ruhe zu lassen! Kurz, in der Nordstadt gibt's Maifest und Freudenfeuer, in der Altstadt Schauspiel, Narrenpapst und flamländische Gesandte, und im Universitätsviertel – nichts!"
"Und doch ist der Maubertsplatz groß genug!" entgegnete einer von den Burschen, die auf dem Fensterbrette campirten.
"Nieder mit dem Rector, mit den Wahlmännern, mit den Procuratoren!" rief Johann.
"Diesen Abend wird man im Champ-Gaillard ein Freudenfeuer machen müssen," fuhr der andere fort, "mit den Büchern Meister Andry's."
"Und mit den Pulten der Schreiber," sagte sein Nachbar.
"Und den Stöcken der Pedelle!"
"Und den Spucknäpfen der Decane!"
"Und den Aktenschränken der Procuratoren!"
"Und den Kasten der Wahlmänner!"
"Und den Fußschemeln des Rectors!"
"Nieder!" rief der kleine Johann mit falscher Baßstimme, "nieder mit Meister Andry, mit den Pedellen und Schreibern, nieder mit den Theologen, Medicinern und Decretisten; mit den Procuratoren, den Wahlmännern und mit dem Rector!"
"Das ist ja das Weltende!" murmelte Meister Andry, indem er sich die Ohren verstopfte.
"Ei seht da, der Rector! Da geht er auf dem Platze," rief einer von denen im Fenster. Die Folge war, daß sich alles nach dem Platze wandte.
"Ist das wirklich unser ehrwürdiger Rector, Meister Thibaut?" fragte Johann Frollo du Moulin, der an einem Pfeiler im Innern hängend, nicht sehen konnte, was draußen vorging.
"Ja, ja," antworteten alle andern, "gewiß, er ist es, Meister Thibaut, der Rector."
Es war in der Tat der Rector mit allen Würdenträgern der Universität, welche in feierlichem Zuge der Gesandtschaft entgegengingen, und in diesem Augenblicke den Platz des Palastes überschritten. Die in das Fenster gedrängten Studenten empfingen sie beim Vorübergehen mit Spottreden und ironischem Beifallsgeschrei. Der Rector, welcher dem Zuge voranschritt, erhielt die erste Salve; sie war stark.
"Guten Tag, Herr Rector! Holla! ei! Guten Tag denn!"
"Wie kommt es, daß er hier ist, der alte Spieler? Er hat also seine Würfel verlassen?"
"Wie er auf seinem Maulesel einhertrottet! der hat weniger lange Ohren, als er."
"Holla, he! Guten Tag, Herr Rector Thibaut! Tybalde aleator! Alter Esel, alter Spieler!"
"Gott schütze Euch! Habt Ihr vergangene Nacht oft Doppel-Sechs geworfen?"
"O! seht einmal das hinfällige, bleifarbige, matte Gesicht, mit den Spuren der Spielwuth darin!"
"Wo geht es jetzt hin, Thibaut, Tybalde ad clades, weil Ihr der Universität den Rücken zugekehrt habt und nach der Stadt trabt?"
"Zweifelsohne will er eine Wohnung in der Straße Thibautodé suchen," schrie Johann du Moulin.
Die ganze Bande wiederholte den faulen Witz mit donnerndem Geschrei und wütenden Händeklatschen.
"Ihr wollt Euch in der Straße Thibautodé Wohnung suchen, nicht wahr, Herr Rector, Ihr Spielcumpan des Teufels?"
Dann kamen die andern Würdenträger an die Reihe.
"Nieder mit den Pedellen! nieder mit den Stabträgern!"
"Sage mir doch, Robin Poussepain, wer ist denn jener dort?"
"Das ist Gilbert von Suilly, Gilbertus de Soliaco, der Kanzler des Collegiums Autun."
"Da hast du meinen Schuh: wirf ihn diesem an den Kopf; du hast einen bequemeren Platz als ich."
"Saturnalitias mittimus ecce nuces."
"Nieder mit den sechs Theologen in ihren weißen Chorhemden!"
"Das dort sind die Theologen? – Ich dachte, es wären die sechs weißen Gänse, welche Sanct Genoveva der Stadt für das Lehngut von Roogny geweiht hat."
"Nieder mit den Medicinern!"
"Fort mit den schwerfälligen und abgeschmackten Redeübungen!"
"Da fliegt dir meine Mütze an den Kopf, Kanzler von Sanct Genoveva! Du hast mir Unrecht getan."
"Jawohl! er hat meine Stelle in der normännischen Landsmannschaft dem kleinen Ascanio Falzaspada gegeben, der zur Provinz Bourges gehört, weil er ein Italiener ist."
"Das ist eine Ungerechtigkeit," sagten alle Studenten. "Nieder mit dem Kanzler von Sanct Genoveva!"
"Ho he! Meister Joachim von Ladehors! Ho he! Ludwig Dahuille! Ho he! Lambert Hoctement!"
"Hole der Teufel den Procurator der deutschen Landsmannschaft!"
"Und die Kapläne der heiligen Kapelle in ihren grauen Pelzmänteln, cum tunicis grisis."
"Seu de pellibus grisis fourratis!"
"Holla, seht, die Meister der freien Künste! Die ganzen schönen Schwarz- und Rothmäntel!"
"Die bilden einen schönen Schweif für den Rector!"
"Man möchte ihn für einen Dogen von Venedig halten, der sich mit dem Meere vermählen will."
"Sind das die Canonici von Sanct Genoveva, Johann?"
"Zum Teufel mit den Canonicis!"
"Abt Claude Choart! Doktor Claude Choart! sucht Ihr Marie la Giffarde?"
"Sie wohnt in der Straße Glatigny."
"Sie macht dem Hurenkönige das Bett."
"Sie zahlt ihre vier Heller; quatuor denarios."
"Aut unum bombum!"
"Soll sie Euch hinter die Ohren bezahlen?"
"Kameraden! Meister Simon Sanguin, der Wahlmann der Picarden, der seine Frau hinter sich auf dem Pferd hat!"
"Post equitem sedet atra cura."
"Muthig, Meister Simon!"
"Guten Tag, Herr Wahlmann!"
"Gute Nacht, Frau Wählerin!"
"Sind die doch glücklich, alles sehen zu können," seufzte Johannes de Molendino, der immer noch am Blätterwerke seines Säulenknaufes hing.
Währenddem neigte sich Meister Andry Musnier, der geschworene Universitätsbuchhändler, zum Ohre des Hofkürschners, Meister Gilles Lecornu.
"Ich sage Euch, Herr, es ist das Ende der Welt da. Man hat wohl niemals solche Zügellosigkeiten der Studentenschaft gesehen! Das kommt aber von den verfluchten Erfindungen dieses Jahrhunderts, die noch alles verderben: von den Geschützen, Feldschlangen und Donnerbüchsen, und vor allem vom Buchdruck, dieser zweiten deutschen Pest. Gibt's keine Manuskripte mehr, gibt's keine Bücher mehr! Der Buchdruck vernichtet den Buchhandel. Das Ende der Welt ist nahe."
"Ich merke es auch recht am Überhandnehmen der Samtstoffe," sagte der Pelzhändler.
In demselben Augenblicke schlug es Zwölf.
"Ah! ..." machte der ganze Haufe mit einem Munde.
Die Studenten schwiegen. Nun entstand eine große Verwirrung, eine geräuschvolle Bewegung der Füße und der Köpfe, ein starkes, allgemeines Gehuste und Geschneuze; jeder stellte sich zurecht, richtete sich in die Höhe. Nun tiefes Schweigen; alle Hälse blieben gereckt, alle Mäuler offen, alle Blicke nach der Marmortafel gerichtet ... nichts war dort zu sehen. Die vier Diener des Vogtes waren immer noch da, starr und unbeweglich, wie vier bemalte Statuen. Alle Augen wandten sich nach der, für die flamländischen Gesandten bestimmten Tribüne. Die Tür blieb geschlossen, und die Tribüne leer. Diese Menschenmasse erwartete nun seit der Frühe dreierlei: die Mittagsstunde, die flandrische Gesandtschaft, das geistliche Schauspiel. Der Mittag allein war da, auf die Minute. Das war für diesmal zu viel!
Man wartete eine, zwei, drei, fünf Minuten, eine Viertelstunde: nichts kam. Die Tribüne blieb leer, das Theater stumm. Da folgte der Ungeduld der Zorn auf dem Fuße nach. Gereizte Worte flogen umher, allerdings noch mit leiser Stimme. "Das Schauspiel! das Schauspiel!" murmelte man dumpf. Die Köpfe erhitzten sich. Eine Wetterwolke, die nur erst noch grollte, zog über die Häupter dieser Menge hin und her.
Johann du Moulin war es, der ihr den ersten Funken entlockte.
"Das Schauspiel, und zum Teufel mit den Flamländern!" schrie er aus Leibeskräften, indem er sich wie eine Schlange um seinen Säulenknauf wand.
Die Menge klatschte in die Hände.
"Das Schauspiel," wiederholte sie, "und mit Flandern zu allen Teufeln!"
"Wir müssen das Stück auf der Stelle haben," fuhr der Student fort, "oder ich bin der Ansicht, wir hängen den Palastvogt, als Ersatz für Lustspiel und Schauspiel."
"Wohl gesprochen," schrie das Volk, "und laßt uns mit den Gerichtsdienern das Hängen beginnen."
Rauschender Beifall folgte. Die vier armen Teufel fingen an blaß zu werden und sich gegenseitig anzusehen. Die Menge drang auf sie ein, und sie sahen schon das schwache Holzgeländer, das sie von ihr trennte, sich biegen und unter dem Drängen der Menge zusammenbrechen. Der Augenblick war kritisch.
"Drauf! drauf!" schrie man von allen Seiten.
In diesem Augenblicke hob sich der Teppich des Ankleidezimmers, welches wir oben beschrieben haben, und ließ eine Person herein, deren bloßer Anblick die Menge plötzlich zum Stehen brachte, und wie mit einem Zauberschlage ihren Zorn in Neugierde verwandelte.
"Still! still!"
Die Person trat, ziemlich bestürzt und an allen Gliedern zitternd, an den Rand der Marmorplatte unter vielen Verbeugungen, die, je näher sie kam, zu förmlichen Kniebeugungen wurden.
Indessen war die Ruhe nach und nach wieder hergestellt. Nur jenes leise Geräusch blieb übrig, das selbst noch beim Schweigen der Menge vernommen wird.
"Meine Herren Bürger," sagte die Person, "und meine werten Bürgerinnen, wir sollen die Ehre haben, ein sehr schönes Schauspiel mit Namen: 'Das gerechte Urteil unserer lieben Jungfrau Maria' vor Seiner Eminenz dem Herrn Cardinal vortragen und aufführen. Ich selbst gebe den Jupiter. Seine Eminenz begleitet in diesem Augenblicke die sehr ehrenwerte Gesandtschaft des Herrn Herzogs von Österreich; diese ist gegenwärtig noch an der Pforte Baudets aufgehalten, um die Begrüßungsrede des Herrn Universitätsrectors anzuhören. Sobald der hochwürdigste Herr Cardinal angekommen sein wird, wollen wir anfangen."
Sicherlich bedurfte es nichts weniger, als der Dazwischenkunft Jupiters, um die vier unglücklichen Diener des Palastvogtes vom Verderben zu retten. Wenn wir das Glück hätten, diese sehr glaubwürdige Geschichte erfunden zu haben, und folglich vor unserer Dame, der Kritik, dafür verantwortlich zu sein, so könnte man sich in diesem Augenblicke uns gegenüber nicht auf die klassische Vorschrift berufen: "Nec deus intersit."
Übrigens war das Costüm des Herrn Jupiter sehr schön, und hatte nicht wenig dazu beigetragen, die Menge zu beruhigen, deren ganze Aufmerksamkeit er auf sich zog. Herr Jupiter war in ein Panzerhemd aus schwarzem Samt, der mit vergoldeten Nägeln beschlagen war, gekleidet; er trug einen Helm mit vergoldeten Silberknöpfen auf dem Kopfe; und wäre der rote und lange Bart, welcher die Hälfte seines Gesichts bedeckte, wäre die Rolle vergoldeter Pappe nicht gewesen, die er, mit eisernen Haken übersäet und starrend von Flittergoldstreifen, in der Hand trug, und in welchem geübte Augen leicht den Blitzstrahl erkennen konnten; wären die fleischfarbenen, nach griechischer Weise bebänderten Beine nicht gewesen, er hätte wegen der Ernsthaftigkeit seiner Haltung mit einem bretonischen Bogenschützen vom Corps des Herrn von Berry den Vergleich aushalten können.
Kapitel 2 - Peter Gringoire
Die Genugtuung und die Bewunderung, welche sein Costüm überall hervorgerufen hatte, verschwanden jedoch während seiner Ansprache; und als er mit den unglücklichen Worten schloß: "Wir werden anfangen, sobald seine Hochwürden, der Herr Cardinal angekommen sein wird," verschwand seine Stimme in einem donnernden Hohngeschrei.
"Fangt auf der Stelle an! Das Schauspiel! Auf der Stelle das Schauspiel!" schrie das Volk. Und über alle Stimmen hinweg hörte man diejenige des Johannes von Molendino, welche den Tumult durchdrang wie die Pfeife bei einer Katzenmusik in Nîmes: "Sofort anfangen!" kreischte der Student.
"Nieder mit Jupiter und dem Cardinal von Bourbon!" schrien Robin Poussepain und die andern im Fensterkreuz hockenden Studiosen.
"Sofort die Aufführung!" wiederholte die Menge, "sofort, auf der Stelle! Galgen und Rad für die Schauspieler und den Cardinal!"
Der arme Jupiter, verwirrt, bestürzt und unter seiner Schminke erbleichend, ließ seinen Donnerstrahl niederfallen und nahm seinen Helm in die Hand; dann grüßte er zitternd und stotterte heraus: "Seine Eminenz ... die Gesandten ... Frau Margarethe von Flandern ..." Er wußte nicht, was sagen. Er fürchtete auch, gehangen zu werden. Gehangen durch den Pöbel, wenn er zögerte, gehangen vom Cardinal, wenn er früher angefangen hätte. So sah er von zwei Seiten einen Abgrund, d.h. den Galgen. Glücklicherweise erschien jemand, um ihn aus der Verlegenheit zu ziehen und die Verantwortlichkeit auf sich zu nehmen.
Ein Mensch, welcher sich diesseits des Geländers in dem rings um die Marmorplatte freigelassenen Raume befand, und den noch niemand bemerkt hatte, so vollständig war seine dürre, lange Figur für jedes Auge von dem Durchmesser der Säule, an welche er sich gelehnt hatte, verborgen worden, – dieser ziemlich große, magere, bleiche, blonde, trotz Falten an Stirn und Wangen noch junge Mann mit glänzenden Augen und lächelndem Munde, in schwarze, vom Alter abgenutzte und glänzende Sarsche gekleidet, näherte sich der Marmorplatte und gab dem armen Dulder ein Zeichen. Dieser aber, in seiner Bestürzung, sah ihn nicht.
Der Ankömmling trat einen Schritt näher.
"Jupiter! mein lieber Jupiter!" rief er.
Dieser hörte aber nichts.
Endlich schrie ihm der große Blonde ungeduldig geworden fast ins Gesicht:
"Michel Giborne!"
"Wer ruft mich?" sagte Jupiter erschrocken, wie aus dem Schlafe erwachend.
"Ich," antwortete der Schwarzgekleidete.
"Ah!" sagte Jupiter.
"Fangt gleich an," fuhr jener fort. "Stellt das Volk zufrieden; ich übernehme es, den Herrn Palastvogt zu beschwichtigen, der wieder den Herrn Cardinal beschwichtigen wird."
Jupiter atmete auf.
"Meine Herren Bürger," rief er mit aller Kraft seiner Lungen der Menge zu, welche fortfuhr, ihn zu verhöhnen, "wir wollen sogleich beginnen."
"Evoe Jupiter! Plaudite cives!" schrien die Studenten.
"Juchhe! Juchhe!" schrie das Volk.
Ein betäubendes Händeklatschen begann, und Jupiter war schon hinter den Vorhang zurückgekehrt, als der Saal noch vom Beifallsgeschrei erzitterte.
Unterdessen war der Unbekannte, der auf so magische Weise "den Sturm in Stille" verwandelt hatte, wie unser alter, lieber Corneille sagt, bescheiden in das Halbdunkel seines Pfeilers zurückgekehrt, und würde dort unsichtbar, unbeweglich und stumm wie zuvor geblieben sein, wenn ihn von hier nicht zwei junge Frauenzimmer, die in der Vorderreihe der Zuschauer standen, und die sein Zwiegespräch mit Michel Giborne-Jupiter beobachtet hatten, weggelockt hätten.
"Meister," sagte die eine von ihnen, die ihm mit der Hand ein Zeichen gab, heranzukommen ...
"Schweiget doch, liebe Liénarde," sagte ihre reizende, junge und in ihrem Sonntagsstaate stattlich geputzte Nachbarin; "das ist kein Gelehrter, sondern ein Laie; und Ihr dürft nicht Meister, sondern müßt vielmehr Herr sprechen."
"Herr," sagte Liénarde.
Der Unbekannte trat an das Geländer.
"Was wünscht ihr von mir, liebe Fräulein?" fragte er eifrig.
"Oh! nichts," sagte Liénarde ganz verwirrt, "meine Nachbarin Gisquette la Gencienne ist es, die Euch sprechen will."
"Ganz und gar nicht," versetzte Gisquette erröthend, "Liénarde hat Euch Meister gerufen, und ich sagte ihr, daß man Herr sagen müßte."
Die beiden jungen Mädchen schlugen die Augen nieder. Jener der nichts angelegentlicher wünschte, als ein Gespräch anzuknüpfen, sah sie lächelnd an.
"Ihr habt mir also nichts zu sagen, werte Fräulein?"
"Oh! ganz und gar nichts," antwortete Gisquette.
"Nein, nichts," sagte Liénarde.
Der große blonde junge Mann trat einen Schritt zurück; aber die beiden Neugierigen hatten nicht Lust, die Beute fahren zu lassen.
"Mein Herr," sagte Gisquette lebhaft und mit dem Ungestüm einer sich öffnenden Schleuse oder eines Weibes, die einen Entschluß faßt, "Ihr kennt also den Soldaten, der die Rolle der heiligen Jungfrau im Schauspiele geben wird?"
"Ihr wollt sagen die Rolle Jupiters?" entgegnete der Unbekannte.
"Ei, ja!" sagte Liénarde, "die Thörichte! Ihr kennt also den Jupiter?"
"Michel Giborne?" antwortete der Unbekannte; "ja, werthes Fräulein."
"Er hat einen prächtigen Bart!" sagte Liénarde.
"Wird das hübsch sein, was man da oben sprechen wird?" fragte schüchtern Gisquette.
"Sehr schön, mein Fräulein," entgegnete der Unbekannte ohne das geringste Zaudern.
"Was wird es denn sein?" sagte Liénarde.
"Das gerechte Urteil der heiligen Jungfrau, ein moralisches Stück, wenn's beliebt, mein Fräulein."
"Ah! das ist etwas andres!" versetzte Liénarde.
Ein kurzes Schweigen folgte. Der Unbekannte unterbrach es:
"Es ist ein ganz neues Stück, und noch gar nicht gegeben."
"Es ist also nicht dasselbe," versetzte Gisquette, "welches man vor zwei Jahren, beim Einzuge des Herrn päpstlichen Gesandten gegeben hat, und in welchem drei hübsche Mädchen Rollen gaben ..."
"Sirenen," sagte Liénarde.
"Und ganz nackt –" fügte der junge Mann hinzu.
Liénarde schlug verschämt die Augen nieder. Gisquette sah sie an und machte es ebenso. Er fuhr lächelnd fort:
"Das war sehr spaßhaft zu sehen. Das heutige Schauspiel ist expreß für das gnädige Fräulein von Flandern gemacht."
"Wird man Liebeslieder singen?" fragte Gisquette.
"Pfui!" sagte der Unbekannte, "in einem moralischen Stücke? Man darf die Gattungen nicht verwechseln. Wenn es eine Posse wäre, allerdings!"
"Schade!" entgegnete Gisquette. "Damals gab es an der Fontaine von Ponceau wilde Männer und Frauen, welche mit einander kämpften, mehrere Gruppen aufführten und kleine Arien und Liebeslieder sangen."
"Was für einen päpstlichen Gesandten paßt," sagte ziemlich trocken der Unbekannte, "paßt nicht für eine Prinzessin."
"Und neben ihnen," fuhr Liénarde fort, "spielten mehrere dumpfe Instrumente prächtige Melodien."
"Und zur Erfrischung der Vorübergehenden," fuhr Gisquette fort, "spie die Fontaine aus drei Mündungen Wein, Milch und Gewürzwein aus, wovon trank wer wollte."
"Und ein wenig unterhalb Ponceau, bei der Trinité," sagte Liénarde, "gab es ein Stück aus der Leidensgeschichte Christi, von stummen Personen aufgeführt."
"Ja, ich erinnere mich!" rief Gisquette, "der Herr am Kreuze und die beiden Schächer links und rechts."
Jetzt begannen die beiden Schwätzerinnen, in der Erinnerung an den Einzug des Herrn Legaten sich ereifernd, beide auf einmal zu sprechen.
"Und weiter vorwärts bei der Malerpforte waren andere sehr reich geschmückte Personen zu sehen."
"Und bei der Fontaine Saint-Innocent der Jäger, welcher eine Hindin unter lautem Hundegebell und Hörnerschall verfolgte."
"Und bei dem Schlachthause von Paris die Gerüste, welche die Burg von Dieppe vorstellten."
"Und weißt du, Gisquette, als der Legat vorüberkam, spielte man die Erstürmung und allen Engländern kostete es die Köpfe."
"Und nach dem Tore des Châtelet hin waren sehr schöne Figuren zu sehen!"
"Und auf der Wechslerbrücke, die oben ganz mit Teppichen behangen war."
"Und als der Legat vorüberzog, ließ man auf der Brücke mehr als zweihundert Dutzend Vögel aller Art fliegen; das war herrlich, Liénarde."
"Heute wird's viel schöner sein," fuhr endlich der Unbekannte fort, welcher ihnen anscheinend mit Ungeduld zuhörte.
"Ihr versprecht uns, daß dies Schauspiel schön sein wird?" sagte Gisquette.
"Ohne Zweifel," antwortete er; dann fügte er mit einem gewissen Nachdrucke hinzu: "Meine Fräulein, der Verfasser desselben bin ich."
"Wahrhaftig?" riefen die jungen Mädchen ganz erstaunt.
"Gewiß!" antwortete der Dichter, indem er sich vornehm in die Brust warf; "das heißt, wir sind zwei: Johann Marchand, der die Bretter zugeschnitten, das Gerüst des Theaters und das Holzwerk aufgebaut hat, und ich, der das Stück gemacht hat. Ich heiße Peter Gringoire."
Der Dichter des "Cid" hätte mit nicht mehr Stolz sagen können: "Peter Corneille."
Unsere Leser haben bemerken können, daß schon eine gewisse Zeit verflossen sein mußte seit dem Augenblicke, wo Jupiter hinter den Vorhang zurückgekehrt war, und der Verfasser des neuen Stückes sich so plötzlich der naiven Bewunderung Gisquettens und Liénardens offenbart hatte. Sonderbare Tatsache! Diese ganze, wenige Minuten zuvor so unbändige Menge wartete jetzt mit Sanftmut auf das Wort des Schauspielers hin; was die ewige und in unsern Theatern noch alle Tage erprobte Wahrheit dartut, daß das beste Mittel, das Publikum geduldig warten zu machen, das ist, ihm zu erklären, daß man sofort beginnen werde.
Jedoch der Student Johannes ließ sich nicht in Sicherheit einwiegen.
"Holla, he!" schrie er auf einmal mitten in der ruhigen Erwartung, die dem Lärme gefolgt war: "Jupiter, heilige Jungfrau, Teufelsgaukler, wollt Ihr uns foppen? Das Stück, das Stück! Fangt an oder wir beginnen von neuem!"
Mehr brauchte es nicht.
Eine Musik von lauten und gedämpften Instrumenten ließ sich aus dem Innern des Gerüstes heraus vernehmen; der Vorhang hob sich; vier geputzte und geschminkte Personen traten hervor, kletterten die steile Theaterleiter hinauf und stellten sich, auf der obern Plattform angekommen, in einer Linie vor dem Publikum auf, welches sie mit tiefer Verbeugung begrüßten. Jetzt schwieg die Symphonie. Das Stück begann nun.
Nachdem die vier Personen das Beifallsklatschen für ihre Verbeugungen reichlich eingeerntet hatten, begannen sie unter andächtigem Schweigen der Hörer einen Prolog, mit dem wir den Leser bereitwillig verschonen wollen. Übrigens beschäftigte sich das Publikum, wie heutzutage noch geschieht, mehr mit den Costümen, welche sie trugen, als mit der Rolle, die sie vortrugen; und in Wahrheit, es war in der Ordnung. Sie waren alle vier in halb gelbe und halb weiße Gewänder gekleidet, die sich von einander nur durch die Beschaffenheit des Stoffes unterschieden; die eine war in Gold- und Silberbrokat, die andere in Seide, die dritte in Wolle, die vierte in Leinwand gekleidet. Die erste Person trug ein Schwert in der Rechten, die zweite zwei goldne Schlüssel, die dritte eine Wage, die vierte einen Spaten; und um den beschränkteren Köpfen, welche die Bedeutung dieser Attribute nicht vollkommen klar hätten begreifen können, zu Hilfe zu kommen, konnte man unten auf der brokatenen Robe in großen, schwarzgestickten Buchstaben lesen: "Ich bin der Adel"; unten auf der seidenen: "Ich bin die Geistlichkeit", auf der wollenen: "Ich bin der Handel" und auf der leinenen: "Ich bin die Arbeit". Das Geschlecht der beiden männlichen Figuren war für jeden urtheilsfähigen Zuschauer an den weniger langen Gewändern und an der Mütze angedeutet, welche sie auf dem Kopfe trugen, während die beiden weiblichen Erscheinungen nicht so kurz gekleidet und mit einer Haube geschmückt waren.
Es hätte viel böser Wille dazu gehört, um aus dem Inhalte des Prologs nicht zu begreifen, daß die Arbeit mit dem Handel, die Geistlichkeit mit dem Adel vermählt war, und daß die zwei glücklichen Paare gemeinsam einen prächtigen Golddelphin hatten, den sie nur mit der Schönsten zu verbinden beabsichtigten. Sie zogen also durch die Welt, auf der Suche nach dieser Schönheit, und nachdem sie nach und nach die Königin von Golkonda, die Prinzessin von Trapezunt, die Tochter des Groß-Kans von der Tartarei u.s.w. u.s.w. verworfen hatten, waren Arbeit und Geistlichkeit, Adel und Handel nach dem Justizpalaste gekommen, um sich auf der Marmorplatte niederzulassen, und vor einem verehrungswürdigen Publikum so viele Sittensprüche und Maximen auszukramen, wie man damals bei der Facultät der freien Künste, in den Prüfungen, wo die Meister ihre Doctorhüte erlangten, Trugschlüsse, Determinationen, Redefiguren und Disputationen an den Mann bringen konnte.
Alles das war wahrhaftig sehr schön.
In dieser ganzen Menschenmenge jedoch, über welche die vier Erscheinungen um die Wette Fluten von Gleichnisreden ausschütteten, gab es kein aufmerksameres Ohr, kein klopfenderes Herz, kein unstäteres Auge, keinen gereckteren Hals, als Auge, Ohr, Hals und Herz des Autors, des Dichters, dieses braven Peter Gringoire, welcher kurz zuvor dem Entzücken nicht hatte widerstehen können, den beiden hübschen Mädchen seinen Namen zu nennen. Er war nicht weit von ihnen entfernt hinter seinen Pfeiler zurückgekehrt, und dort hörte, sah und verschlang er. Der wohlwollende Beifall, mit welchem der Vortrag seines Prologs aufgenommen worden war, tönte noch in seinem Innern nach, und er war ganz von jener Art verzückter Betrachtung hingerissen, mit welcher ein Autor seine Gedanken, einen nach dem andern, von den Lippen des Schauspielers in die Stille eines ungeheueren Auditoriums fallen hört. Würdiger Peter Gringoire!
Es tut uns leid, es zu sagen, aber diese erste Verzückung wurde sehr bald gestört. Kaum hatte Gringoire seine Lippen an den berauschenden Becher der Freude und des Triumphes gelegt, als ein Wermuthstropfen hineinfiel.
Ein zerlumpter Bettler, welcher nicht hatte einsammeln können, weil er mitten im Gedränge sich befand, und der zweifelsohne in den Taschen seiner Nachbarn keine hinreichende Entschädigung gefunden hatte, war auf den Gedanken gekommen, irgend einen sichtbaren Platz zu suchen, um die Blicke und Almosen auf sich zu lenken. Er hatte sich deshalb während der ersten Verse des Prologes mit Hilfe der Pfeiler, welche sich an der Gesandten-Tribüne befanden, auf das Karniß geschwungen, welches den unteren Teil derselben begrenzte; und da hatte er sich niedergelassen, um Aufmerksamkeit und Mitleiden der Menge durch seine Lumpen und eine scheußliche Wunde am rechten Arme auf sich zu ziehen. Übrigens sprach er kein Wort.
Das Stillschweigen, welches er beobachtete, ließ den Prolog ohne Störung vorübergehen, und keine merkliche Unordnung wäre eingetreten, wenn das Unglück nicht gewollt hätte, daß der Student Johannes von der Höhe seines Pfeilers den Bettler und seine Firlefanzereien gesehen hätte. Ein tolles Lachen packte den jungen Taugenichts, welcher, unbesorgt darum, das Schauspiel zu unterbrechen und die allgemeine Aufmerksamkeit zu stören, frech ausrief:
"Seht da den Elenden, der um ein Almosen bittet!"
Wer je einmal einen Stein in eine Froschpfütze geworfen, oder eine Flinte auf einen Vogelschwarm abgefeuert hat, kann sich einen Begriff von der Wirkung machen, welche diese unpassenden Worte bei der allgemeinen Stille hervorbrachten. Gringoire fuhr zusammen, wie von einem elektrischen Schlage getroffen. Der Prolog blieb stecken, und alle Köpfe wendeten sich heftig nach dem Bettler um, der, ohne die Fassung zu verlieren, in diesem Zwischenfalle gute Gelegenheit zu einer Ernte erblickte, und mit schmerzlicher Miene und halbgeschlossenen Augen zu rufen anfing:
"Eine milde Gabe, wenn's beliebt!"
"Ei aber ... bei meiner Seele," versetzte Johannes, "das ist Clopin Trouillefou. Holla, Freund, deine Wunde genirte dich wohl am Beine, daß du sie auf den Arm gelegt hast?"
Bei diesen Worten warf er mit der Geschicklichkeit eines Affen ein kleines Silberstück in den schmierigen Filz, den der Bettler mit seinem kranken Arme hinhielt. Der Bettler nahm das Almosen und die beißenden Worte unbeirrt hin, und fuhr mit kläglicher Stimme fort: "Gebt mir ein Almosen, ich bitte!"
Dieser Zwischenfall hatte die Hörerschaft sehr zerstreut; und eine ziemliche Anzahl Zuschauer, Robin Poussepain und alle Studenten an der Spitze, klatschten diesem sonderbaren Duett lustig Beifall, welches, mitten im Prolog, der Student mit seiner kreischenden Stimme und der Bettler in seinem beharrlichen Klagetone eben improvisirt hatten.
Gringoire war sehr mißgestimmt. Nachdem er sich von seiner ersten Bestürzung erholt hatte, ermannte er sich und rief den vier Personen auf der Bühne zu: "Fahret fort, zum Teufel, fahret fort!" ohne auch nur sich gemüßigt zu fühlen, einen verächtlichen Blick auf die zwei Störenfriede zu werfen.
In diesem Augenblicke fühlte er sich am Saume seines Oberkleides gezogen; er wandte sich nicht ohne eine gewisse Übellaune um, mußte aber, wenn auch widerwillig, lachen. Es war der hübsche Arm der Gisquette la Gencienne, welche über das Geländer hinweg auf diese Weise seine Aufmerksamkeit reizte.
"Mein Herr," sagte das junge Mädchen, "werden die da fortfahren?"
"Gewiß," entgegnete Gringoire von dieser Frage ziemlich beleidigt.
"In diesem Falle, Herr," fuhr sie fort, "habt Ihr wohl die Güte, mir zu erklären ..."
"Was sie sagen werden?" unterbrach sie Gringoire. "Nun gut! hört nur zu!"
"Nein!" sagte Gisquette, "aber was sie bis jetzt gesprochen haben."
Gringoire tat einen Satz, wie ein Mensch, dessen offene Wunde man berührt.
"Daß dich die Pest, du dummes, vernageltes Ding!" murmelte er zwischen den Zähnen.
Von diesem Augenblicke an hatte es Gisquette bei ihm vollständig verdorben.
Indessen hatten die Schauspieler seinem energischen Befehle Folge geleistet, und das Publikum, welches sah, daß sie wieder zu sprechen anfingen, hatte begonnen zuzuhören; viele Schönheiten waren ihm aber bei der Art Zusammenlötung der zwei Teile des so schändlich unterbrochenen Stückes verloren gegangen. Gringoire machte die bittere Bemerkung ganz in der Stille. Dennoch war die Ruhe nach und nach wiederhergestellt; der Student schwieg, der Bettler zählte einiges Geld im Hute, und das Stück hatte seinen Fortgang genommen.
Es war in der Tat ein sehr schönes Werk, aus dem man, wie uns bedünkt, noch heute mit kleinen Änderungen sehr wohl Nutzen ziehen könnte. Die Erfindung des Stückes war, wenn auch nach den Regeln der Kunst ein wenig lang und dürftig, einfach; und Gringoire bewunderte vor dem lauteren Heiligtum seines geistigen Richterstuhles deren Dursichtigkeit. Wie man sich wohl denken mag, waren die vier allegorischen Gestalten ein wenig ermüdet von ihrem Zuge durch die drei Welttheile, ohne Gelegenheit gefunden zu haben, sich ihres Golddelphines angemessen entledigen zu können. Nun kam eine Lobrede auf den wunderbaren Fisch, mit tausend feinen Anspielungen auf den jungen Bräutigam Margarethens von Flandern, der damals höchst jämmerlicherweise in Amboise eingeschlossen war, und sich wohl nicht träumen ließ, daß Arbeit und Geistlichkeit, Adel und Handel soeben seinetwegen eine Fahrt durch die Welt gemacht hätten. Besagter Delphin also war jung, schön, tapfer und vor allem – herrlicher Ursprung aller königlichen Tugenden! – er war der Sohn des Löwen von Frankreich. Ich erkläre, daß dieses kühne Gleichnis bewunderungswürdig ist, und daß die Naturgeschichte des Theaters, an einem Tage, der für verblümte Rede und königliches Hochzeitsgedicht bestimmt ist, nicht irgendwie an einem Delphine Anstoß nimmt, welcher der Sohn eines Löwen ist. Das sind eben die seltenen und pindarischen Vermengungen, welche den Enthusiasmus zeigen. Nichtsdestoweniger, um auch noch etwas Tadel unter das Lob zu mischen, hätte der Dichter diesen schönen Gedanken in etwa zweihundert Versen aussprechen können. Es ist wahr, daß das Schauspiel, nach Anordnung des Herrn Oberrichters von zwölf Uhr mittags bis um vier Uhr dauern sollte, und notwendigerweise wohl etwas gesagt werden mußte. Außerdem hörte man geduldig zu.
Auf einmal, mitten in einem Streite zwischen Frau Handel und Frau Adel, im Augenblicke, wo Meister Arbeit folgenden wunderbaren Vers sprach:
"man in Wäldern ein stolzeres Tier" –
öffnete sich ganz zur Unzeit die Tür zu der reservirten Tribüne, welche bis dahin leider geschlossen geblieben war, und die lautschallende Stimme des Türhüters meldete hastig: "Seine Eminenz, der hochwürdige Herr Cardinal von Bourbon."
Kapitel 3 - Der Herr Cardinal
Armer Gringoire! Das Knallen aller großen Doppelpetarden am Johannisfeste, die Salve von zwanzig Hakenbüchsen, der Donner jener berühmten Feldschlange auf dem Turm Billy, die während der Belagerung von Paris, am Sonntage den 29. September 1465, sieben Burgunder auf einmal tötete, die Explosion des ganzen an der Pforte du Temple aufgespeicherten Pulvers, hätten ihm in diesem feierlichen und dramatischen Augenblicke nicht so heftig die Ohren zerreißen können, als die wenigen, dem Munde eines Türhüters entfallenen Worte: "Seine Eminenz, der hochwürdige Herr Cardinal von Bourbon."
Es fürchtete Peter Gringoire nicht etwa den Herrn Cardinal, noch haßte er ihn. Er besaß weder jene Schwäche, noch diese Verwegenheit. Durchaus Eklektiker, wie man heutzutage sagen würde, gehörte er zu den stolzen und festen, gemäßigten und ruhigen Geistern, die sich immer in allem mitten inne zu halten wissen (stare in dimidio rerum), und die voll Verstand und freier Lebensweisheit sind, auch wenn sie mit Cardinälen zu rechnen haben. Schätzbares und immer gleichmüthiges Philosophengeschlecht, denen die Weisheit, als eine andere Ariadne, einen Garnknäuel gegeben zu haben scheint, an dessen Faden sie seit Anfang der Welt mitten durch das Labyrinth menschlicher Verhältnisse sich hindurchfinden! Man findet sie, immer die nämlichen, zu allen Zeiten, d.h. allen Zeitläufen gemäß. Und ohne unseres Peter Gringoire zu gedenken, der jene im fünfzehnten Jahrhunderte zeigen würde, wenn wir dazu kämen, ihm die Verherrlichung zu Teil werden zu lassen, die er verdient, so ist es sicherlich ihr Geist, der den Pater Du Breul beseelte, als er im sechzehnten Jahrhunderte folgende naiv erhabenen Worte schrieb, die aller Jahrhunderte würdig sind: "Ich bin Pariser von Geburt und freimüthig in der Rede, da im Griechischen 'Parrhisia' Freimuth im Sprechen bedeutet, von welcher ich selbst gegen die hochwürdigen Herren Cardinäle, den Onkel und den Bruder des gnädigen Herrn Prinzen von Conty Gebrauch gemacht habe: gleichwohl mit Ehrfurcht und ohne jemanden ihres Gefolges zu beleidigen, was viel ist."
Es war also weder Haß gegen den Cardinal, noch Geringschätzung seiner Gegenwart bei dem widerwärtigen Eindrucke, den sie auf Peter Gringoire machte. Ganz im Gegentheile; unser Dichter hatte zu viel gesunden Verstand und einen viel zu fadenscheinigen Kittel, als daß er nicht dem einen besondern Wert beigelegt hätte, daß manche Anspielung seines Prologes, und besonders die Verherrlichung des Delphins, des Sohnes des französischen Löwen, von einem hochwürdigsten Ohre aufgenommen würde. Es ist aber nicht das Interesse, was in der edlen Natur der Dichter vorherrscht. Ich setze den Fall, daß die Wesenheit des Dichters durch die Zahl Zehn ausgedrückt wird; gewiß ist, daß ein Chemiker, wenn er sie analysirte und durcheinander mischte, wie Rabelais sagt, diese aus einem Teile Eigennutz mit neun Theilen Eigenliebe zusammengesetzt finden würde. Im Augenblicke nun, wo die Tür sich für den Cardinal geöffnet hatte, waren die neun Teile Eigenliebe bei Gringoire angeschwollen und hervorgetreten, und in einem Zustande erstaunlicher Zunahme, bei welcher jene unmerkliche Eigennutzmoleküle, welche wir soeben in der Gemüthsbeschaffenheit der Dichter erkannten, wie erstickt verschwand; – übrigens ein kostbarer Bestandtheil, ein Ballast von Wirklichkeit und Menschenwesen, ohne die sie nicht mehr die Erde berühren würden. Gringoire weidete sich daran, eine ganze Versammlung zu bemerken, zu sehen, gewissermaßen zu betasten, die – allerdings aus Gesindel bestehend, doch was tut das? – betäubt, versteinert und wie erstickt vor dem endlosen Wortschwalle stand, der beständig aus allen Theilen seines Hochzeitsgedichtes hervorsprudelte. Ich bestätige, daß er selbst die allgemeine Seligkeit teilte, und daß Gringoire, im Gegensatze zu La Fontaine, der bei der Aufführung seines Luftspieles "Der Florentiner" fragte: "Wer ist der Kerl, der das Flickwerk gemacht hat?" gern seinen Nachbar gefragt hätte: "Von wem ist dieses Meisterwerk?" Man kann jetzt beurteilen, welche Wirkung das plötzliche und unzeitige Erscheinen des Cardinals auf ihn hervorbrachte.
Was er befürchten konnte, verwirklichte sich nur zu sehr. Der Eintritt Seiner Eminenz brachte die Zuhörer in Verwirrung. Alle Köpfe wandten sich nach der Tribüne hin. Man konnte sein eigenes Wort nicht verstehen. "Der Cardinal! Der Cardinal!" wiederholten alle Stimmen. Der unglückliche Prolog blieb zum zweiten Male stecken.
Der Cardinal blieb einen Augenblick auf der Schwelle zur Tribüne stehen. Während er einen ziemlich gleichgiltigen Blick über die Zuhörerschaft schweifen ließ, verdoppelte sich der Tumult. Jeder wollte ihn am besten sehen und suchte seinen Kopf über die Schultern seines Nachbars zu heben.
Es war in der Tat eine stattliche Persönlichkeit, deren Anblick wohl jedes andere Schauspiel aufwog. Karl, Cardinal von Bourbon, Erzbischof und Graf von Lyon, Primas beider Gallien, war sowohl mit Ludwig dem Elften durch seinen Bruder Peter, den Herrn von Beaujeu, welcher die älteste Tochter des Königs geheirathet hatte, als auch mit Karl dem Kühnen durch seine Mutter Agnes von Burgund verwandt. Der herrschende Zug nun, das eigenartige und hervorstechende Merkmal im Charakter des Primas beider Gallien war hofmännischer Sinn und Ergebenheit gegen die Mächtigen. Man kann die zahllosen Verlegenheiten, welche ihm diese doppelte Verwandtschaft verursacht hatte, und alle die zeitweiligen Klippen sich denken, zwischen denen sein Geistesschiff hatte laviren müssen, um weder an Ludwig noch an Karl zu scheitern, – dieser Charybdis und dieser Skylla, welche den Herzog von Nemours und den Connetable von Saint-Pol verschlungen hatten. Dank dem Himmel, er hatte diese Fahrt glücklich überstanden und war ohne Unfall in Rom angelangt. Aber obgleich er im Hafen war, und eben weil er in ihm war, erinnerte er sich nie ohne Besorgnis der verschiedenen Wechselfälle seiner so lange Zeit hindurch stürmischen und mühevollen politischen Laufbahn. Daher pflegte er zu sagen, daß das Jahr 1476 "trübe" und "licht" für ihn gewesen sei; womit er meinte, daß er im nämlichen Jahre seine Mutter, die Herzogin von Bourbonnais, und seinen Vetter, den Herzog von Burgund, verloren, und daß ein Trauerfall ihn über den andern getröstet hätte.
Übrigens war er ein schlichter Mann, führte ein vergnügtes Cardinal-Leben, erheiterte sich gern mit königlichem Gewächs von Challuau, hatte weder Richarde la Garmoise noch Thomasse la Saillarde ungern, gab hübschen Mädchen lieber ein Almosen, als alten Weibern, und aus allen diesen Gründen war er beim Pariser "Volke" sehr beliebt. Er zeigte sich auf der Straße nur umgeben von einem kleinen Hofstaate von Bischöfen und vornehmen, galanten Äbten, lustigen Herren, die, wenn's sein mußte, tüchtig schmausten; und mehr als einmal hatten die ehrbaren Betschwestern von Saint-Germain d'Auxerre, wenn sie abends unter den erleuchteten Fenstern des Bourbonischen Hauses vorübergegangen waren, sich geärgert, von denselben Stimmen, die ihnen am Tage Vespern gesungen hatten, beim Gläserklirren den bacchantischen Trinkspruch Benedict des Zwölften: "Bibamus papaliter" vortragen zu hören, jenes Papstes, welcher der Tiara noch eine dritte Krone hinzugefügt hatte.
Ohne Zweifel war es diese so rechtmäßig erworbene Popularität, welche ihn bei seinem Erscheinen vor jedem üblen Empfange seitens der Volksmenge bewahrte, die den Augenblick zuvor so unzufrieden und an dem Tage sogar, an welchem sie einen Papst wählen sollte, sehr wenig zum Respect vor einem Cardinal aufgelegt war. Doch die Pariser besitzen wenig Groll; und dann hatten die guten Leute, weil sie den Beginn der Vorstellung mit Gewalt durchsetzten, über den Cardinal einen Sieg errungen, und dieser Triumph genügte ihnen. Übrigens war der Herr Cardinal von Bourbon ein schöner Mann; er trug ein schönes rothes Kleid, das ihm sehr gut stand; daher hatte er alle Weiber für sich und folglich die bessere Hälfte der Zuhörerschaft. Gewiß, es würde ungerecht sein und schlechten Geschmack verraten, einen Cardinal zu verhöhnen, der beim Schauspiele auf sich hatte warten lassen, zumal er ein schöner Mann war, der sein rothes Kleid gut trug.
Er trat also ein, grüßte die Versammlung mit jenem angeborenen Lächeln der Mächtigen für das Volk, ging mit langsamen Schritten nach seinem scharlachrothen Sammetsessel hin und zeigte ein Gesicht, das an irgend etwas anderes dachte. Sein Gefolge, was wir heutzutage seinen Generalstab von Bischöfen und Äbten nennen würden, drang hinter ihm auf die Tribüne ein, nicht ohne den Tumult und die Neugierde im Parterre zu verdoppeln. Hier galt's jetzt, diese zu zeigen, sie zu nennen, wenigstens einen mußte man kennen! Der eine erkannte Herrn Alaudet, den Bischof von Marseille, wenn mir recht ist, der andere den Obern von Saint-Denis, ein dritter Robert von Lespinasse, den Abt von Saint-Germain des Prés, diesen liederlichen Bruder einer Maitresse Ludwigs des Elften: – alles das wurde mit vielen verächtlichen und häßlichen Worten zum besten gegeben.