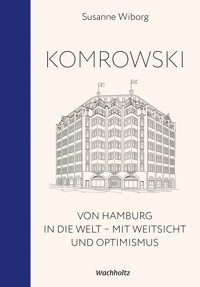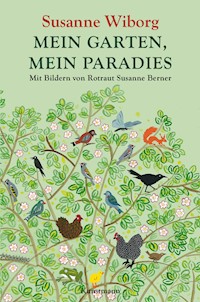20,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kunstmann, A
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Ein Streifzug durch acht Landschaften: Wald und Wiese, Moor und Heide, Felder und Flüsse, Berge und Küsten – literarisch, naturkundlich, historisch –, die uns prägen, so wie wir sie seit Jahrtausenden geprägt haben. Wir leben in ihnen, wir leben von ihnen, und das seit Jahrtausenden. Jeder glaubt sie zu kennen – aber wer sind unsere Landschaften wirklich? Was macht ihren Charakter aus, ihre Wechselbeziehung zu uns Menschen? Wer verkörpert sie perfekt? Sind sie Ödnis oder Idylle, eher Geborgenheit oder abweisende Macht? Was an unserem Landschaftsbild ist Erfahrung, was Projektion? Der unheimliche Wald, das gefährliche Moor, die helle und fröhliche Blumenwiese, die fruchtbaren Felder, die karge Heide, die übermütigen Flüsse, das unbezwingbare Meer mit seinen Küsten oder die herausfordernden Berge? Wo findet man noch unberührte Natur, was ist Menschenwerk, welche Ökosysteme sind sogar von menschlicher Bewirtschaftung abhängig? Wie haben Bewohner, Besucher und Eroberer eine Landschaft geformt und geprägt? Und vor allem: Wie ist dieser vielfältige Lebensraum über Jahrtausende hinweg von Menschen erlebt und beschrieben worden? Ein literarischer, biologischer und historischer Streifzug durch acht Landschaften, von der Küste bis zum Gebirge – eine Einladung zum Nachlesen, Miterleben und Augenaufmachen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 360
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Susanne Wiborg
DER GLÜCKLICHE HORIZONT
Was uns Landschaft bedeutet
Verlag Antje Kunstmann
INHALT
Vorwort: Der Rhythmus der Landschaft
Die mächtige Landschaft: Berge
Die fruchtbare Landschaft: Feldmark
Die symbolische Landschaft: Fluss
Die karge Landschaft: Heide
Die grenzenlose Landschaft: Meer und Küste
Die doppelbödige Landschaft: Moor
Die fröhliche Landschaft: Wiese
Die Seelenlandschaft: Wald
Quellenverzeichnis
VORWORT: DER RHYTHMUS DER LANDSCHAFT
»Es besteht kein Grund, vor jedem Fleck Deutschlands in die Knie zu sinken und zu lügen: wie schön! Aber es ist da etwas allen Gegenden Gemeinsames – und für jeden von uns ist es anders. Wenn da einer seine Heimat hat, dann hört er ihr Herz klopfen. Das ist in schlechten Büchern, in noch dümmeren Versen und in Filmen schon so verfälscht, daß man sich beinahe schämt, zu sagen: man liebe seine Heimat. Wer (aber) den Rhythmus einer Landschaft spürt, nein, wer gar nichts anderes spürt, als dass er zu Hause ist: daß das da sein Land ist, sein Berg, sein See – auch wenn er nicht einen Fuß des Bodens besitzt … es gibt ein Gefühl jenseits aller Politik, und aus diesem Gefühl heraus lieben wir dieses Land.«
Landschaft spiegelt sich in jedem, der sie wahrnimmt. In seiner Satire »Deutschland, Deutschland über alles« wurde Kurt Tucholsky da ganz deutlich: Die deutsche Politik bedeutete ihm nichts. Die deutschen Landschaften alles. Er liebte sie. Da war er nicht allein, im Gegenteil: Die Verbundenheit zu unserer engsten Umgebung stand lange jenseits jeder Diskussion, über jeder Ideologie. Sie war einfach ein selbstverständlicher Teil aller Lebensqualität. Das macht es so reizvoll, auch lange zurückliegende literarische Streifzüge durch verschiedene Landschaftstypen zu verfolgen: Sie spiegeln immer auch menschliche Gefühle, menschliche Geschichte und menschliche Schicksale, im Kleinen wie im Großen.
Über Jahrhunderte blieb diese Verbindung eng und gut dokumentiert, erst mit dem Kulturbruch des Ersten Weltkrieges riss die Kontinuität ab. Plötzlich kamen Landschaft und Natur zugunsten des Urbanen aus der Mode. Sie gerieten ins Abseits, und bald geschah ihnen auch, wovor Tucholsky so eindringlich gewarnt hatte: Sie wurden politisch missbraucht, Stichwort »Blut und Boden«. Was, als perfide Langzeitwirkung, die gesellschaftliche und literarische Abwendung nach 1945 noch einmal beschleunigte. Bis sich die Landschaft mit Umweltproblemen ins öffentliche Bewusstsein zurückmeldete – und dabei sehr schnell klarmachte, wie viel mehr sie nach wie vor zu bieten hat. Mit diesem Comeback der Nähe sind auch die Texte wieder aktuell, die sie so über so lange Zeit für uns konserviert und gespiegelt haben. Jede Landschaft ist ein lebendes Archiv, und diese vielfältigen Beschreibungen ergeben eine Chronik, so alt wie das geschriebene Wort. Mit dem Anbruch der Moderne halten sie dramatischen Wandel fest: aus der verrufen kargen Heide wird ein Tourismus-Hotspot, das unheimliche Moor avanciert zur trendigen Künstleroase. Meer und Berge, einst ängstlich gemiedener Inbegriff bedrohlicher Naturgewalt, machen Karriere als Urlaubsziele. Das gerade noch Abgelegene, Weltentrückte wandelt sich zum Freizeitpark – und das bedeutet dann wieder ein neues Kapitel in der jahrtausendelangen Geschichte der Kulturlandschaft.
Landschaft und Mensch sind in unseren Breiten immer untrennbar gewesen. Eine aus und für sich selbst existierende, ursprüngliche Wildnis gibt es hier schon sehr lange nicht mehr. Stattdessen leben wir in einer uralten, sich ständig entwickelnden Symbiose von Natur und Kultur, die oft lebende Gesamtkunstwerke ergibt. Allen Klagen, sogar allen menschlichen Zerstörungs-Anstrengungen zum Trotz hat die Landschaft um uns herum ihre Seele noch nicht verloren. Manchmal braucht es ein bisschen Zeit, sie zu entdecken, manchmal nur einen kurzen, ruhigen Spaziergang, manchmal reicht sogar ein besonders einfühlsamer Text. Ob in der Literatur oder im wirklichen Leben, das Grundthema bleibt immer gleich: Es geht ums Hinsehen, ums Kennenlernen, um persönliche Beziehungen. Und wie alle Beziehungen kann auch diese durchaus ihre Tücken haben:
Still ruht die Stadt. Es wogt die Flur.
Die Menschheit geht auf Reisen
oder wandert sehr oder wandelt nur.
Und die Bauern vermieten die Natur
zu sehenswerten Preisen.
Sie vermieten den Himmel, den Sand am Meer,
die Platzmusik der Ortsfeuerwehr
und den Blick auf die Kuh auf der Wiese.
Limousinen rasen hin und her
und finden und finden den Weg nicht mehr
zum Verlorenen Paradiese.
Im Feld wächst Brot. Und es wachsen dort
auch die zukünftigen Brötchen und Brezeln.
Eidechsen zucken von Ort zu Ort.
Und die Wolken führen Regen an Bord
und den spitzen Blitz und das Donnerwort.
Der Mensch treibt Berg- und Wassersport
und hält nicht viel von Rätseln.
Er hält die Welt für ein Bilderbuch
mit Ansichtskartenserien.
Die Landschaft belächelt den lauten Besuch.
Sie weiß Bescheid.
Sie weiß, die Zeit
überdauert sogar die Ferien.
Sie weiß auch: Einen Steinwurf schon
von hier beginnt das Märchen.
Verborgen im Korn, auf zerdrücktem Mohn,
ruht ein zerzaustes Pärchen.
Hier steigt kein Preis, hier sinkt kein Lohn.
Hier steigen und sinken die Lerchen …
Seit Erich Kästner dieses Gedicht 1955 schrieb, hat sich wenig verändert: Das verlorene Paradies suchen wir immer noch, und immer noch rasen wir oft daran vorbei. Dabei ist das Geheimnis einer Landschaft selten das Sensationelle, Auffällige, Atemberaubende. Es ist ihre Atmosphäre, ihre Wirkung auf uns. Frei nach Tucholsky, mit einem ganz großen Wort: Es ist ihr Herz, oder vielmehr: ihre Seele – und die hat auch ein Mais-Stoppelfeld im Herbstnebel.
Aber wer lässt sich auf so etwas noch ein, wenn so viel Spektakuläres so leicht verfügbar ist? Anscheinend nicht einmal mehr die Klimaschützer, immerhin an der Umwelt zumindest theoretisch überdurchschnittlich interessierte Mitbürger. Sonst wäre ein Satz wie »Deine Möhren sind nicht wichtiger als unser Klima. Sorry«, nicht denkbar. So reagierte der Berliner Grünenabgeordnete Georg Kössler 2019 auf die Fassungslosigkeit von Landwirten, durch deren Getreide- und Gemüsefelder Aktivisten auf einer Demo breite Schneisen getrampelt hatten.
Im Kleinen zeigt sich hier der Verlust jeden Bewusstseins für die Umgebung, von der wir alle abhängen. Kein Gespür mehr für Tucholskys »Rhythmus der Landschaft«, und erst recht keinen Funken Ahnung von der Ironie, die hier den Flurschaden zum Symptom macht: Das Klima ist genau da, wo es ist, weil wir die Möhren nicht mehr achten. Wer die eigene Umgebung buchstäblich mit Füßen tritt, für den ist auch das große Ganze höchstens virtuell. Wie glaubhaft ist der Einsatz für ein Universum weit weg, während man das nahe Feld achtlos zertritt? Besonders beklemmend, weil da weniger böse Absicht mitspielt als achselzuckende Gleichgültigkeit, weil man das, was man da plattmacht, nicht einmal mehr kennt. Kein Respekt mehr, weil die persönliche Bindung zur Umwelt abgerissen ist? Tatsächlich: Ende Gelände?
Das wäre neu in der gesamten Menschheitsgeschichte. Früher – und dieses »früher« erstreckte sich über Jahrtausende – war zwar mitnichten alles grüne Harmonie. Die gab es nie und nirgends, solche Romantik ist Illusion. Aber es gab ein kollektives Bewusstsein, nämlich das von existenzieller Abhängigkeit. Die erzeugte Achtung, nicht nur vor der mächtigen See, sondern auch vor der zierlichen Gerste und sogar vor den unscheinbaren Möhren. Sie alle standen das Große, das Globale, oft sogar das Göttliche, nämlich für die Landschaft, für den Lebensraum rundum, der ernährte, schützte, wärmte, aber auch jederzeit mit Katastrophen vernichten konnte. Für die Macht, die die unmittelbare Nähe hatte, galt ihr ein Respekt, der in einer global vernetzten, selbstverständlich satten Konsumgesellschaft schnell abhandenkommt. Doch das ist ein Grundirrtum: Es geht immer um die Landschaft vor dem Horizont und ihren Bezug zu der dahinter, kurz: Es geht ums Klima und um die Möhren. Beide gehören zusammen, und wir gehören dazu. Nicht nur aus existenziellen Gründen, sondern auch, weil diese Beziehung so viel Freude macht: Es bleibt immer ein großes Vergnügen, sie wieder aufzunehmen, sei es real oder literarisch, und dabei staunend festzustellen, wie weit und tief die eigenen Wurzeln reichen können. Alles Ansichtssache, alles individuell, alles ein persönlicher Gewinn. Und, klar: Goethe hat das immer schon gewusst:
Und es ist das ewig Eine,
Das sich vielfach offenbart;
Klein das Große, groß das Kleine,
Alles nach der eignen Art,
Immer wechselnd, fest sich haltend;
So gestaltend, umgestaltend –
Zum Erstaunen bin ich da.
DIE MÄCHTIGE LANDSCHAFT: BERGE
»Man steht am Ende der Welt und zugleich an ihrem Ursprung, an ihrem Anbeginn und in ihrer Mitte. Gewaltiger silberner Rahmen, im Halbrund geschlossen, nach Süden von Schneegipfeln in einer Anordnung von unerklärlicher Harmonie, nach Westen von einer Kette gotischer Kathedralentürme. Zuerst kann man da nur hinaufschauen, es verschlägt einem den Atem. Dann sieht man vor sich den Ort Saas-Fee, in weit ausschwingende Matten eingebettet, von ansteigenden Lärchen- und Arbenwäldern gesäumt und von soviel Himmel überwölbt, daß man – ähnlich wie auf der offenen See – nach allen Seiten Freiheit und Weite verspürt. Dieser Himmel blühte jetzt, am Abend, in einem tiefen, fast violett getönten Dunkelblau, während es auf den Schneefirnen noch blitzte und wetterte vom Widerstrahl der schon gesunkenen Sonne. Die Luft war von Heu durchsüßt und von einer prickelnden, eisgeborenen Reinheit. ›Hier‹, sagte dann einer von uns – ›wenn man hier bleiben könnte!‹«
Er blieb, für den Rest seines Lebens. Carl Zuckmayer, vom NS-Regime ausgebürgert, zog sich nach seiner Rückkehr aus dem Exil in die Schweizer Alpen zurück. Ein Haus am Hang, Abgeschiedenheit dicht am Unendlichen, eine Zuflucht über allen Dingen und unter einem Himmel, »den die hohen Berge nicht einengen, sondern wunderbar umrahmen und tragen« – das war ein passendes letztes Zuhause für einen Schriftsteller zwischen allen Stühlen. Es passte auch zu der Rolle, die die Berge immer gespielt haben: erhebend und verkleinernd, beschützend und bedrohlich zugleich. Hier bestimmt das Bewusstsein eben doch das Sein: Keine andere Landschaft wird so unterschiedlich erlebt. Was der eine unwiderstehlich anziehend findet, wirkt auf den anderen abweisend, einengend und bedrückend. Die Amerikanerin Betty MacDonald zog schon als ganz junge Frau ins Gebirge, und auch sie erlebte die Landschaft als überwältigend. Nur eben ganz anders:
»Die Berge machten nicht den Eindruck, als sei ihnen daran gelegen, Schutz zu spenden. Trat ich vor die Türe oder schaute zum Fenster hinaus, ragte vor mir eine hohe, weiße Kuppe auf, blickte hochmütig über mich Erdenwurm hinweg und gab mir deutlich zu verstehen, dass alles Land hier herum einst in erhabener Einsamkeit geruht hatte und den hohen Herrschaften das Blut in Wallung geriet, weil sie jetzt das profane Menschengeschmeiß zu ihren Füßen dulden mußten. Wir hatten uns nun einmal breitgemacht, daß sie uns aber auch noch willkommen heißen oder gar schöntun sollten, war, weiß Gott, zuviel verlangt. Mit Freude wären sie bereit gewesen, die Hälfte ihres Baumbestandes zu opfern, hätten sie uns kurzerhand mit einer hübschen, mittleren Lawine das Lebenslicht ausblasen können.«
Der Mensch und die Berge – eine Geschichte, die zu einer schon in sich widersprüchlichen Landschaft passt. Dass sich hier Idylle so jäh zur Vorhölle wandeln kann, ist vielleicht kein Zufall: Berge sind der versteinerte Zusammenprall divergierender Kräfte, Stein gewordene Gewalt. Die Alpen zum Beispiel, eine vergleichsweise junge geologische Formation, verdanken ihre Existenz der Kollision zweier Kontinente. Sie entstanden vor etwa 50 Millionen Jahren aus dem Zusammenstoß Europas und Afrikas. Die Gegeneinander-Bewegung der beiden Kontinentalplatten türmte das Gestein immer weiter aufeinander, in Falten und Verwerfungen, die an vielen Bergflanken deutlich zu erkennen sind. Ein Prozess übrigens, der immer noch nicht beendet ist: Noch immer wachsen die Alpen mehrere Millimeter im Jahr. Allerdings verlieren sie durch Erosion bedeutend mehr an Masse und wären ohne diese ständige Abtragung mehrere Tausend Meter höher. Weite Teile der Voralpen bestehen aus Kalkstein, die Gebirge der West- und Zentralalpen meist aus kristallinen Gesteinen wie Gneis oder Granit. Sie entstanden durch Druck und Hitze oder durch die Kristallisation von Magma im Erdinnern, sind also Tiefengesteine und gelangen nur durch schwere tektonische Verwerfungen an die Oberfläche.
Ihr heutiges Gesicht verdanken die Alpen den Eiszeiten: Abschmelzende Gletscher rissen Täler ein, verbreiterten sie ständig und schliffen die Berge glatt. Durch die enormen Temperaturwechsel in diesem Lebensraum konnte sich auf dem Steinsockel nur schwer Erdreich bilden, denn es wurde und wird immer wieder weggerissen. Gehalten wird der Boden in höheren Lagen von einer festen Grasnarbe, die durch Tritt und Verbiss von Weidevieh entsteht und erhalten wird, in tieferen vom Wald, der als Schutzwald die Täler vor Lawinen und Erdrutschen abschirmt. Die Vegetation des Gebirges ist in deutliche Stufen eingeteilt: Laubwald in Höhen zwischen 800 und 1000 Meter, anschließend die Nadelwaldstufe. Zwischen 1500 und 2200 Höhenmetern ist der Wald zu Ende, läuft in verkrüppeltes Krummholz und in die Mattenstufe aus, auf der die Almen liegen, die Weiden hoch am Berg. Sie sind ungewöhnlich artenreiche Biotope ebenso wie ein Lawinenschutz für das darunterliegende Land: kurz gefressenes, festgetretenes Gras bremst Schneerutsche oder lässt sie gar nicht erst entstehen. Ausgewucherte, umgekippte Vegetation ist dagegen eine ideale, beschleunigende Gleitbahn für Lawinen. Den Almen folgt die Fels- und Eisstufe bis zum Gipfel, der Bergspitze.
Diese ganze Landschaft ist ein Crescendo, das in ständigem Anstieg auf die hohen Gipfel zuführt. Es beginnt mit der Voralpenidylle, wie Jörg Mauer sie in seinem Alpenkrimi »Föhnlage« schildert:
»Die Tür, aus der sie herausgetreten waren, befand sich an der Rückseite der Polizeidienststelle, und es war die Bühnentür zum Glück. Eine Wiese von einem brauereireklamesatten Grün reichte ein paar hundert Meter bis zu einem Waldrand, der Wald selbst stieg leicht an, die Wipfel bewegten sich lyrisch und eichendorffartig im Wind, dahinter ragten schroffe Felswände hoch. Nichts fehlte zum strotzend gesunden Bild einer oberbayerischen Sommerfrische, auch wenn sie hinter dem Polizeirevier lag. Es fehlte nicht die würzige Luft, die von irgendwo herwehte und sentimentale Erinnerungen an Sommerferien und Freibadromanzen mit sich trug. Es fehlte nicht der unausbleibliche Duft von Heu, es fehlten nicht die bayerischen Kühe, die da und dort grasten und glockig rumorten, es fehlte nicht das Summen der Bienen und das flüchtige Spiel der Quellwolken, es war ein Kalenderblatt, das Bayern hieß.«
Diese Landschaft, lieblich, sanft und grün, ist eine zeitlose Verkörperung von Sommer und Ferienglück. Thomas Mann besaß dort ein Landhaus, und sein Sohn Klaus schwärmte noch Jahrzehnte später:
»Ja, dies ist Sommer. Der Grund, auf dem wir gehen, ist weich und elastisch, es ist sumpfiger Boden: daher die Üppigkeit der Vegetation, das tiefe Grün des saftig wuchernden Grases, das flammende Gold der Butterblumen, der reiche Purpur des Mohns. Dies ist der Sommerhimmel: in seinem Blau schwimmen weiße, flockige Wolken, die sich zwischen den alpinen Gipfeln zu barocken Formationen ballen. Die Luft riecht nach Sommer, schmeckt nach Sommer, klingt nach Sommer. Die Grillen singen ihr monoton-hypnotisierendes Sommerlied. Zu unserer Rechten liegt das Sommer-Städtchen, Tölz mit seinen bemalten Häusern, seinem holprigen Pflaster, seinen Biergärten und Madonnenbildern. Um uns breitet sich die Sommerwiese; vor uns ragt das Gebirge, gewaltig getürmt, dabei zart, verklärt im Dunst der sommerlichen Mittagsstunde. Seht, und da ist unser Sommer-Weiher, ein kleiner, runder Teich mit hohem Schilf am Ufer. Weiße Wasserrosen, beinah tellergroß, schwimmen auf seiner regungslosen, dunklen Fläche. Das Moorwasser, es ist gold-schwarz in meiner Erinnerung, atmet einen kräftig-aromatischen, dabei etwas fauligen Geruch. Es ist von seltsamer Substanz, das Wasser des Klammerweihers, sehr klar trotz seiner dunklen Färbung, von fast öliger Weichheit, und so schwer, daß man das eigene Gewicht kaum spürt, solange man sich seiner goldenen Tiefe anvertraut.«
In so einem blaugoldenen Sommer ist dann auch der Berg selbst zunächst von der verlockenden Opulenz, die die britische Schriftstellerin Elizabeth von Arnim anzog:
»Wenn man sich gen Westen wendet und an der Flanke des Berges immer weiter und weiter geht, ohne nach oben oder unten auszuweichen, durch ausgedehnte sonnendurchflutete Gefilde, in denen es nichts zwischen einem selbst und den erhabenen schneebedeckten Gipfeln zu geben scheint, auf schmalen Pfaden, wo es so finster ist, daß man kaum sieht, wohin man tritt, wo es nach Harz riecht und heißen Fichtennadeln, nach Wanderlust und frisch gemähtem Heu, dann wieder nach Schnittholz, nach Wasser, das über Steine sprudelt, wo es nach Honig riecht, nach Heißem und Kaltem – nachdem man also zwei Stunden so dahingewandert ist, wovon man schnell müde würde, wenn man sich nicht von der Luft auf merkwürdige Weise getragen fühlte, so als schwebe man dahin, gelangt man schließlich an den Rand eines steilen Abhangs, wo ein paar Lärchen stehen.«
Danach geht es bergan, himmelwärts, und über solchen Wegen liegt eine Magie, die Carl Zuckmayer und seine Frau Alice sogar körperlich spüren konnten:
»Wir gingen diesen Weg zum erstenmal, in einer kaum erklärlichen, wachsenden Bewegtheit, wie man sie sonst bei Ausflügen, auch in einer neuen, erregenden Landschaft, selten empfindet – als hätten wir ein Vorgefühl, daß uns dort oben etwas ganz Ungeahntes, Wunderbares erwarte. Noch immer sah man die blauen Berge nicht, nur dann und wann das Wehen eines blauen Eisschimmers, das Aufblenden einer Schneekuppe, das in der nächsten Kehre wieder verschwand. Der Wald rückte dichter zusammen und tat sich auf einmal zu einer lichten, grasigen Anhöhe auf, die von vereinzelten, uralten, mächtigen Lärchenbäumen mit rötlich gekerbter Rinde bestanden war. Durch die von der Luft leicht bewegten Kronen der Lärchenbäume hindurch blickte man in einen ungeheuren Glanz, ein überweltliches Strahlen, vor dem man fast die Augen schließen mußte. Es war das Abendleuchten von den Gipfeln der Viertausender.«
Auf diesen Viertausendern, hoch auf den Gipfeln der leuchtenden Berge, zeigt die Landschaft dann plötzlich ihr kaltes, ihr hartes, ihr tödliches Gesicht. Mag der Himmel hier auch so nah sein wie nirgendwo sonst auf der Erde, Leben ist nicht mehr geduldet. »Falls es einen trostloseren, unwirtlicheren Ort auf diesem Planeten gibt, hoffe ich, ihn nie zu sehen«, urteilte Bestsellerautor und Bergsteiger Jon Krakauer über den Südsattel des Mount Everest, eine »nackte, kahle Fels- und Eislandschaft«. Das ist natürlich das Extrembeispiel, aber auch die höheren Lagen der Alpen sind in ihrer schroffen Feindseligkeit nicht zu unterschätzen. Edward Whymper, der Erstbesteiger des Matterhorns, schilderte in den 1860er-Jahren eine Übernachtung hoch auf dem Gletscher, mitten in einer damals noch völlig unbekannten, unerforschten Welt:
»Ein majestätisches Schweigen herrschte. Die Steine hatten aufgehört zu fallen, das Wasser rieselte nicht mehr. Es war so bitter kalt, daß das Wasser in einer Flasche unter meinem Kopf gefror. Das durfte uns nicht überraschen, denn wir lagen auf dem Schnee auf einer Stelle, wo der leiseste Windzug sofort fühlbar wurde. Gegen Mitternacht kam von hoch oben ein furchtbarer Krach herunter, dem eine sekundenlange Totenstille folgte. Eine große Felsmasse war geborsten und kam gegen uns herunter. Mein Führer sprang auf, rang die Hände und rief: »Herr Gott, wir sind verloren!«
»Es ist nicht so, dass ich die Berge hasse«, konstatiert angesichts solcher immer latenten Drohungen viel später ein Autor der Neuen Zürcher Zeitung.
»Ich hasse es nur, in den Bergen zu sein. Dieses seltsame Gefühl, das damit zu tun hat, den Gesetzen der Natur ausgesetzt zu sein. Dieses Rauschhafte, das viele Menschen als angenehm empfinden und das anderen (mir) körperliches Unwohlsein verursacht. Das Dorf klebt am Berg, und ich sitze also hier, umgeben von Freunden, und schaue aus einem der kleinen Fenster, die diese Häuser haben, und ich sehe die Steilwand auf der anderen Seite des Tals, es ist ein Naturschutzgebiet, der Hang ist von Nadelgehölz besetzt, und während ich versichere, wie extrem supertoll ich diese Aussicht finde, fühle ich mich schwindlig, leichtköpfig. Das große Thema Sein und Vergehen im Lichtspiel ewiger Transformation genau vor mir. Und mir wird schlecht.«
Hierzulande sind es die Alpen, die solches Sein und Vergehen am eindrucksvollsten repräsentieren. Und das seit Urzeiten: »Der Name dieses mächtigen Hochgebirges im mittleren Europa, des höchsten dieses Erdteils und zugleich des vollkommensten und am besten entwickelten aller Hochgebirge der Erde, wurde schon von den Römern bei der Bevölkerung vorgefunden«, hielt Meyers Konversationslexikon 1888 fest. Der Name war lange vor der Römerzeit entstanden, abgeleitet von der Pluralform des alemannischen Wortes Alp oder Alpe für Alm, für Bergweide also. Der überraschende Schluss daraus: Es ist nicht die Landschaft, nach der die Almen heißen, es ist genau umgekehrt: Diese spezielle Wirtschaftsform ist so alt, dass sie dem mächtigen Gebirge den Namen gab. Tatsächlich lassen sich Spuren von Beweidung auf einigen Almwiesen bis zur Bronzezeit, bis 1700 vor Christus, zurückdatieren – ein eindeutiger Beweis dafür, wie sehr die Menschen und ihr Vieh eine Umgebung, die wir heute als so natürlich wahrnehmen, geprägt haben. Ein weiteres perfektes Zusammenspiel von Bewirtschaftung und Natur, und das Ergebnis ist eine klassische Kulturlandschaft, die Wildtiere und Menschen gleichermaßen anzieht.
»Die Alpen«, so heißt es in dem alten Lexikon weiter, »erscheinen schon aus der Ferne wie eine durch Höhe und Reichtum der Formen überwältigende Gebirgsmauer, auf dem größten Teil ihrer Länge von Hochgipfeln überragt, die mit ewigem Schnee bedeckt sind.« Der höchste dieser Hochgipfel, der Mont Blanc, ist 4810 Meter hoch, die Zugspitze, der höchste Berg Deutschlands, bringt es dagegen nur auf 2962 Meter. Doch überall ist dieses Gebirge ein extremer Lebensraum, ein Ökosystem mit Tieren und Pflanzen, wie es sie in dieser Kombination sonst nirgendwo gibt. Zu dieser Lebensgemeinschaft gehören auch Menschen und ihre Haustiere, teilweise hoch spezialisierte, uralte Rassen. Da ist, als ein Beispiel, das Walliser Schwarznasenschaf, an das raue Hochgebirge ebenso gut angepasst wie jedes Wild. Es kann selbst noch steile Hänge kurz grasen und so die winterliche Lawinengefahr verringern, das knappe Erdreich festtreten und düngen und damit beste Voraussetzungen für vielfältiges natürliches Leben schaffen. »Einer der wenigen Orte in Westeuropa, an dem man noch ganz ursprüngliche blumenreiche Wiesen findet, sind die Alpen«, schildert Zoologe und Autor Dave Goulson das Ergebnis.
»Die schiere Unzugänglichkeit vieler höher gelegener Weiden hat sie bis zu einem gewissen Grad vor den Verheerungen der modernen Landwirtschaft geschützt, und so bleiben die Alpen der größte Biodiversitäts-›Hotspot‹ Europas. Wenn man Glück hat und die Alpen an einem sonnigen Tag erwischt, sind sie atemberaubend. Üppige Blumenteppiche ergießen sich über die felsigen Hänge, flirrend vor Insekten, die aus dem kurzen Sommer das Beste herausholen. Natürlich wirkt das alles besonders schön vor der Kulisse schneebedeckter Bergspitzen und glitzernder Seen.«
»In jedem Geschöpf der Natur lebt das Wunderbare«, lautet eine mehr als 2000 Jahre alte Erkenntnis des Aristoteles, und gerade in den Bergen gibt es überall Beweise dafür. Kaum zu übertreffen ist da das Alpenglöckchen, auf den ersten Blick einfach nur eine niedliche, aber unspektakuläre kleine Pflanze, deren violette Blüten aussehen wie eine Glockenblume im Fransenlook. Auf den zweiten Blick jedoch ist dieser zarte Zwerg tatsächlich ein echtes Wunder: Das fragile Blümchen wächst unbeirrt und kerzengerade durch Schnee und knallhartes Eis, um im Frühjahr vor aller Konkurrenz in voller Blüte zur Stelle zu sein. Die jahrhundertealte Frage: Wie macht es das bloß? ist inzwischen zumindest teilweise beantwortet: Das Alpenglöckchen wird unter dem Schnee nicht, wie andere Pflanzen, durch Zellteilung größer, sondern seine Zellen strecken sich einfach immer weiter, bis es das Licht erreicht. Dann folgt der nächste Trick: Mit dunkler Knospe und violetter Blüte zieht es das ultraviolette Sonnenlicht an, und der Pflanzenstängel wird mit dieser Bestrahlung um bis zu zehn Grad wärmer als Schnee und Eis rundum. So kann das Alpenglöckchen sie einfach wegschmelzen, der Weg ans Licht ist frei, und eine winzige Mischung aus Solarkraftwerk und botanischem Schneidbrenner besiegt problemlos massive Eisschichten.
Die hoch liegenden Wiesen und ihre einzigartigen Bewohner scheinen derart weltentrückt, buchstäblich über allem stehend, dass sie auch Menschen andere Dimensionen eröffnen. Hier ist es der Schriftsteller Peter Altenberg, der sich an Kindheitsausflüge erinnert:
»Ich aber gedenke dieser Almwiese in Tau und Sturm, bevor die Sonne brennt und Segen spendet – – –. Alle ihre Gräser waren mir teuer, der kalte Wind strich über sie, ich hätte ein jedes streicheln und behüten mögen! Man war so ferne vom Leben der Menschen, wie ein Entdecker fremder Welten. Man war so außerhalb und oberhalb. Keines der Gräser war ähnlich denen in der Ebene, und sogar der Sturm, die Luft hatten ein anderes Gepräge. Die Gebüsche waren wie niedergeduckt und die Bäume widerstandsfähiger. Die Blumen waren wie matte Abdrücke aus dem Album ›Unsere Bergesflora‹ und das Wasser aus den Rindenröhren hatte einen anderen Geschmack als jedes andere Wasser. Man war leicht und frei und die Sorge war hinter uns.«
Nicht nur das Alpenglöckchen, auch viele andere Pflanzen haben Spezialeffekte, um mit der Höhenlage zurechtzukommen: Die purpurrote Alpenrose, eigentlich ein Rhododendron, bildet zusammen mit Blaubeere und Wacholder die berühmten, weithin leuchtenden Rhododendronfelder, die den Übergang zwischen Almweide und darunterliegendem Nadelwald markieren. Die untersetzte, buschige Pflanze kann an diesem extremen Standort bestehen, weil sie sich nicht nur mit festen Blättern und sehr dicken Zellmembranen vor Verdunstung schützt, sondern zusätzlich mit speziellen Chemikalien vor dem oxidativem Stress durch das ständige starke UV-Licht.
Wie oft schon bin ich stehn geblieben,
Vertieft in Schaun vor dir. Allein
Um dich muß man die Berge lieben,
Du bist die Seele, Gluth im Stein.
… schwärmte der bayerische Dichterarzt Hermann von Lingg von ihrem intensiven, brennenden Rot. Dieser Landschaft sind auch viele Tiere ähnlich perfekt angepasst – es sei denn, sie schweben so hoch über allem, dass sie das nicht nötig haben. So hält es der Steinadler mit einer Flügelspannweite von über zwei Metern. Er könnte auch in anderen Habitaten gut leben, ist aber durch jahrhundertelangen Verfolgungsdruck aus dem Flachland bis in die Alpen zurückgedrängt worden. Der mächtige, bis über sechs Kilo schwere Vogel kann sich das Abgehobensein leisten: Mit seinen sprichwörtlichen Adleraugen erspäht er noch aus mehreren Hundert Metern Höhe eine einzige Maus. Mythologisch und heraldisch ist »der Adler« die Nr. 1, ist unangefochtener König der Bergwelt, ist der majestätische, lebende Wappenvogel schlechthin – auch wenn das Vorbild für den deutschen Adler genau genommen der noch etwas größere Seeadler ist.
Weniger eindrucksvolle Vögel nutzen gerade ihre Unscheinbarkeit als Überlebensvorteil: Das Alpenschneehuhn mausert nicht, wie üblich, einmal im Jahr, sondern gleich dreimal, und dabei passt es sich jedes Mal genau der saisonalen Landschaft an: von Steingrau über Weißgesprenkelt bis hin zu reinem Weiß, das den Vogel im Winter nahezu unsichtbar mit dem Schnee verschmelzen lässt. Auch hinter diesem kleinen Hühnchen steht eine erstaunliche Geschichte: Es stammt ursprünglich aus der arktischen Tundra, wo seine Verwandtschaft heute noch lebt, und wanderte während der Eiszeit in den Alpenraum ein. Dumm gelaufen: Kälte und Gletscher zogen sich bald immer weiter zurück, und so musste ihnen der arktische Vogel bergwärts folgen, immer höher hinauf, in einen immer kleineren Lebensraum. Dabei wurde das Schneehuhn zum perfekt angepassten Alpenbewohner.
Die Alpengams, die fast nur in Europa vorkommt, setzt dagegen weniger auf Tarnung als auf Energieoptimierung: Ihr Winterfell ist dunkler als das Sommerkleid und zieht so in der kalten Jahreszeit jedes bisschen verfügbarer Sonnenwärme an. Ihre gespaltenen Hufe, korrekt Schalen genannt, sind ein weiteres Anpassungswunder, mit Kanten wie scharfen Stollen und Sohlen wie Hartgummi. Mit derart festem Halt schafft die Gams im felsigen Gelände bis zu zwei Meter hohe und sechs Meter weite Sprünge. Auf abschüssigem Terrain erreicht sie mit bis zu 50 km/h fast die Spitzengeschwindigkeit eines Rennpferdes. Für diese athletischen Höchstleistungen ist sie mit ungewöhnlich vielen roten Blutkörperchen zur Sauerstoffversorgung ausgestattet, und dazu kommt ein Sportlerherz, mit dessen Volumen und Muskeldicke die Gams Flachlandbewohnern wie dem Reh weit überlegen ist. Während das nur über kurze Strecken flüchten kann, schaffen Gemsen notfalls über längere Zeit bis zu 200 Herzschläge pro Minute und ein entsprechendes Tempo. Doch selbst das rettet sie nicht immer vor ihrem Fressfeind, dem Steinadler, der es besonders auf die Kitze abgesehen hat.
Vom Fell der Gams stammt auch die Bezeichnung für einen gelbbräunlichen Farbton: »chamois« bedeutet übersetzt »gamsfarben«. Dunkler braun ist dagegen »ein wunderlich verwegenes und geschwindes Thier, wohnet in den höchsten Plätzen und Orten der Teutschen Alpen, Felsen, Schrofen, und wo alles gefroren Eyss und Schnee ist«. So beschrieb der Schweizer Arzt und Naturforscher Conrad Gessner im 16. Jahrhundert als Erster den Alpensteinbock. Capra ibex ist wuchtiger und mit seinem weit geschwungenen Gehörn deutlich eindrucksvoller als die zierlichen Gemsen. Auch sein Huf ist, mit verhornten Schalenrändern, weichen Ballen und der Fähigkeit, beide Zehen sowohl zu spreizen als auch unabhängig voneinander zu bewegen, perfekt für schwierige Berglagen ausgerüstet. Seit der Steinzeit war dieses prachtvolle, bis zu 100 Kilo schwere Tier für die Menschen im Gebirge Jagdbeute Nr.1. Auch im Magen von Ötzi, dem vor etwa 5000 Jahren umgekommenen Gletschermann, fanden sich Reste von Steinbockfleisch.
Doch es war weniger das Fleisch, das den Steinbock in der Neuzeit an den Rand der Ausrottung brachte, es war vor allem sein Ruf als lebende Apotheke: Das auffallende Tier wurde derart mythologisch überfrachtet, dass praktisch jeder Teil von ihm als heilend oder zauberkräftig galt. Neben Blut, Knochenmark und Milz waren die Hörner sowie das Herzkreuz, ein verhärteter Knorpel der Herzklappen, besonders begehrt. Letzteres sollte seinen Träger unverwundbar machen. Harry-Potter-Lesern ist natürlich auch der Bezoar oder Magenstein bestens vertraut, ein Klumpen aus unverdaulichem Material, der sich im Magen vieler Ziegenarten findet, zu denen auch der Steinbock gehört. Ein Bezoar schützt angeblich vor fast allen Giften. Um all dessen wurde der Steinbock so heftig verfolgt, dass er im Mittelalter schon selten geworden und Anfang des 19. Jahrhunderts nahezu ausgerottet war. Vittorio Emanuele II., König von Italien und, wie es sich damals für einen Monarchen gehörte, begeisterter Jäger, rettete die Tiere in letzter Minute. Sein frühes, groß angelegtes Artenschutz- und Auswilderungsprojekt war seiner Zeit weit voraus und startete eine weltweit beispiellose Erfolgsgeschichte: Von wenigen geretteten Exemplaren stammen heute alle 40.000 Steinböcke in den Alpen ab.
Durch intensive Jagd geriet auch das Murmeltier zeitweise an den Rand der Ausrottung. Gut drei Kilo Gewicht, wohlschmeckendes Fleisch, dazu reichlich Fett, dem ebenfalls magische Wirkung nachgesagt wurde – das war ein Geschenk für die Bewohner dieser rauen Gegend. Die kompakten Nager sind im Winter praktisch eine lebende Konserve: Sie entgehen der harten Jahreszeit, indem sie fett gefressen von Oktober bis Frühjahr unter der Erde schlafen. Die herbstliche Jagd auf die in ihrem Bau unbeweglichen Tiere macht vergleichsweise wenig Mühe, sodass sie, wie es 1910 hieß, »zahlreich ausgegraben, geschlachtet und verzehrt werden. Murmeltierfleisch wird gesalzen, geräuchert und getrocknet; es eignet sich zur Zubereitung in Pfefferbeize.« Aber auch lebend war das Mankei, wie es auf Bayerisch heißt, ausgesprochen einträglich, denn es ist leicht zähmbar, gelehrig und drollig. Diese im Flachland völlig unbekannten Tiere als Kuriosität vorzuführen, war eine oft unentbehrliche Einkommensquelle für arme Familien ganzer Regionen. Die »Marmottiers«, Bettelkinder aus den Alpen, die bis ins 19. Jahrhundert alleine durch ganz Europa wanderten, um in den Großstädten in ihren malerischen Trachten mit Murmeltier und Flöte um milde Gaben zu bitten, waren so berühmt, dass Goethe ihnen das »Murmeltierlied« widmete: »Ich komme schon durch manche Land / avec que la marmotte, / und immer was zu essen fand / avec que la marmotte.«
Das ganze vielfältige Ökosystem lebt auf Stein, der Basis der gesamten Landschaft. Von monumentalen Bergflanken bis zum kleinen Bachkiesel ist er trotz seiner statisch wirkenden Härte abwechslungsreich und vielgesichtig. Die Farbe der Felsflanken wechselt je nach Bewuchs und Licht: steingrau, silbern und pink, purpur und violett, grasgrün, rotbraun und schneeweiß, manchmal auch wie von innen leuchtend im Sonnenuntergang. »Gott schläft im Stein«, heißt es in einer indischen Weisheit, und vielleicht auch deshalb ziehen die Berge Menschen so magisch an. Einer der frühen Alpentouristen, Johann Wolfgang von Goethe, notierte 1786 im Tagebuch seiner »Italienischen Reise«:
»Glimmerschiefer und Quarz durchzogen. Stahlgrün und dunkelgrau. An denselben lehnte sich ein weißer, dichter Kalkstein, der an den Ablösungen glimmerig war und in großen Massen, die sich aber unendlich zerklüfteten, brach. Oben auf dem Kalkstein legte sich wieder Glimmerschiefer auf, der mir aber zärter zu sein schien. Weiter hinauf zeigte sich eine Art Gneis oder vielmehr eine Granitart, die sich zum Gneis umbildet.«
Carl Zuckmayer betrachtete die ganze Pracht weniger wissenschaftlich, dafür aber sehr viel sinnlicher:
»Mich entzückten die Steine und Felsbrocken, wie sie überall verstreut waren, blauer Basalt und grün durchbänderter Serpentin, mattgrauer Gneis, tiefroter Porphyr, schimmernder Quarz, der auf das Vorkommen von Kristallen deutet, und breit gelagerte Schichten von Glimmerschiefer.«
Entzücken war in den Bergen eine vergleichsweise neue Reaktion. Lange war da eher Grauen die vorherrschende Empfindung gewesen. Obwohl die Alpen schon gegen Ende der letzten Eiszeit, ungefähr 13.000 Jahre vor Christi Geburt, von Menschen besiedelt wurden, galten die großen Berge bis in die frühe Neuzeit als steingewordene Bedrohung, als gefährliches Verkehrshindernis und vor allem als Wohnort böser Mächte. Kurz: als sorgsam zu meidende oder möglichst schnell zu durchquerende Horror-Landschaft. Die Bergspitzen umgab dann noch einmal eine besonders furchterregende Aura, »als sei um die oberen Bereiche dieser großartigen Gipfel ein Kordon gezogen, der von keinem Menschen durchbrochen werden sollte«. So urteilte der britische Höhenbergsteiger Eric Shipton. Wie sehr auch tapfere, erfahrene Einheimische vor diesem Bann zurückschreckten, erfuhr der Engländer Edward Whymper, als er 1863 versuchte, Führer für einen Besteigungsversuch des Matterhorns anzuheuern:
»Nicht die Schwierigkeit des Unternehmens hatte davon abgehalten, als der Schreck, den seine steinernen Wände einflößten. Es schien eine Schranke um ihn gezogen zu sein, bis zu der man gehen konnte, aber weiter nicht. Jenseits hausten Zwerge und Kobolde, der ewige Jude und die Geister der Verdammten. Die abergläubischen Bewohner der nahe liegenden Täler, von denen viele das Matterhorn für den höchsten Berg in den Alpen, ja der Welt hielten, sprachen von einer in Trümmern liegenden Stadt auf dem Gipfel, die von Geistern bewohnt werde. Lachte man, so schüttelten sie ernst mit dem Kopfe, zeigten auf die Türme und Mauern, die man ja mit Augen sehe, und warnten vor der Besteigung, weil die wütenden Teufel von ihren uneinnehmbaren Höhen Felsen auf den Frevler schleudern würden.«
Diese, gemessen an den damaligen Möglichkeiten sehr vernünftige Abneigung gegen ebenso riskante wie sinnlose Hochgebirgstouren begann sich erst im 19. Jahrhundert zu legen. Allerdings stammt eines der ersten deutschen Berggedichte, »An einen Berg«, verfasst von dem schlesischen Dichter Martin Opitz, doch schon aus dem 17. Jahrhundert, und auch hier klingt bereits das ewige Motiv aller Bergbesteigungen an: menschliche Selbsterfahrung inmitten grandioser Natur:
Du grüner Berg, der du mit zweien Spitzen
Parnasso gleichst, du hoher Fels, bei dir
Wünsch’ ich in Ruh zu bleiben für
und für Und deine Lust ganz einsam zu besitzen,
Weil du mir auch für aller Welt kannst nützen;
Dann wann ich bin auf deinem Klippen hier,
So seh’ ich stets derjenen Ort für mir,
Die für dem Tod alleine mich kann schützen,
Mein’ höchste Freud’ und meines Lebens Leben;
So weiß ich auch, dass man sonst nirgend findt
Mit solcher Zier ein einzig Ort umgeben;
Natura hat die Lust allher gesetzet,
Dass, die auf dich mit Müh gestiegen sind,
Hinwiederum auch würden recht ergetzet.
Die Romantik mit ihrer neu erwachten, sentimentalen Natursehnsucht, mit dem »Zurück zur Natur!«-Verdikt eines Jean-Jacques Rousseau im Hintergrund, mit Freizeit und erleichterten Reisemöglichkeiten für Wohlhabende, verhalf den Gebirgen dann ebenso wie anderen rauen Landschaften zu einem PR-Durchbruch. Für die Alpen kam er deutlich früher als für Heide oder Moor, und es war der totale Imagewandel.
Bedecke deinen Himmel, Zeus,
Mit Wolkendunst
Und übe, dem Knaben gleich,
Der Disteln köpft
An Eichen dich und Bergeshöhen!
… hatte noch der junge, von Sturm und Drang getriebene Goethe in den 1770er-Jahren seinen »Prometheus« wettern lassen. Da waren die Bergeshöhen noch ein Inbegriff des locus terribilis, des schrecklichen Ortes, letzter Machtbereich archaischer Götter, deren Anspruch sich von modernen Menschen nur noch verspotten ließ. Doch das Bild wandelte sich schnell. Hatte es 1730 in einer Beschreibung der Schweiz noch geheißen: »Die ungeheuerliche Höhe der Alpen und der ewige Schnee sind entsetzlich«, bestimmte bald wieder das Bewusstsein das Sein, und dieses Bewusstsein drehte sich komplett: Die Berge waren nicht mehr furchterregende Hindernisse, nicht mehr Spielplatz abgehalfterter Götter, kein schrecklicher Ort. Im Gegenteil: Sie galten zunehmend als bedeutungsgeladene, anziehende Kraftorte, die man einfach erlebt haben musste: »Hohe Berge sind, für mich, eine Empfindung«, fasste etwa Lord Byron, der Romantiker par excellence, die neue Sichtweise zusammen. Für die steht beispielhaft »Mont Blanc« des Briten Percy Bysshe Shelley, 1818 erschienen:
Dort oben glänzt Mont Blanc: die Kraft, sie ruht,
Die stille hehre Kraft, die manches Bild
Und manchen Laut hat in sich aufgesogen.
In Nächten ohne Mond und dunkel-mild,
Im grellen Licht des Tages fällt der Schnee
Auf diesen Berg. Und niemand sieht die Glut
Der Flocken, wenn die Abendsonne sinkt,
Auch nicht den Pfeil des Sternstrahls durch den Schnee.
Die Winde kommen stumm herbeigeflogen,
Mit starkem Atem Schnee zu häufen. Dort
Verweilt der stumme Blitz in Einsamkeit
Und Unschuld, und er überlagert weit
Wie Dunst den Schnee. Geheime Kraft der Dinge
Wohnt ganz in dir, sie wirkt im Denken fort,
Und ihr Gesetz beherrscht den Himmel fern.
Was wärst du, was wär Erde, Meer und Stern,
Wenn nicht des Menschen Phantasie empfinge
Die Einsamkeit, des Schweigens Kern.
Diese empfindsamen Aristokraten waren nicht nur herausragende Dichter, die eine ganze Landschaft neu ins öffentliche Bewusstsein rückten, sondern bald gleich noch ein zweites Mal Trendsetter: Als frühe Touristen bahnten sie den Weg für ihre wohlhabenden, ebenso reise- und abenteuerlustigen Landsleute. Mary Shelley, Percys Frau, war mit den Bergen derart vertraut, dass sie in ihrem Grusel-Klassiker »Frankenstein« effektvoll das Motiv einer Gebirgswanderung einsetzt. Dabei spielt sie mit den alten literarischen Begriffen vom schönen und vom schrecklichen Ort und lässt in dieser Landschaft beides ineinander übergehen:
»Die gewaltigen Berge und Steilwände, die auf allen Seiten über mir aufragten – das Brausen des Flusses, der zwischen den Felsen schäumte, und das Tosen der Wasserfälle ringsum sprachen von einer Kraft, stark wie die Allmacht, und ich hörte auf, mich zu fürchten oder einem weniger allgewaltigen Wesen zu beugen als dem, das die Elemente geschaffen hatte, die sich hier in ihrer schreckerregendsten Gestalt zeigte. Als ich immer höher stieg, nahm das Tal einen immer großartigeren und erstaunlicheren Charakter an. Burgruinen, die an den Abgründen tannenbestandener Berge hingen, die stürmische Arve und hier und da Bauernhäuser, die zwischen den Bäumen hervorlugten, schufen ein Bild von einzigartiger Schönheit. Doch es steigerte sich ins Erhabene durch die mächtigen Alpen, deren weiße und strahlende Pyramiden und Kuppeln hoch über allem anderen aufragten, als gehörten sie einer anderen Erde an, die Wohnstätte eines andern Geschlechts.«
Dr. Viktor Frankenstein, der junge »moderne Prometheus«, hat wie Goethes Vorbild die Götter verflucht, und er ist noch weiter gegangen: Er hat ihnen mit Wissenschaft, mit der Erschaffung eines Monsters aktiv getrotzt. Doch die Allmachtsträume sind gescheitert, und er muss seiner außer Kontrolle geratenen Schöpfung durch halb Europa nachjagen. Mit einer Panik, die erst die übermächtige Landschaft besänftigen kann, war er sicher nicht der typische Bergtourist. Der kam eher voller Freude und reiner, naiver Abenteuerlust und Erwartung angesichts einer überwältigenden, neuen, damals noch ganz exotischen Umgebung. Diesen Unternehmungsgeist der frühen Urlauber fängt Heinrich Hoffmann von Fallersleben genau ein:
Wir haben es beschlossen –
Drum mutig, unverdrossen!
»Zur Bergfahrt« soll die Losung sein!
Nun schließt euch an und stimmt mit ein!
Wie herrlich, Kameraden,
In Alpenluft zu baden!
Wie wird so weit die enge Brust,
Die weite Welt so voll von Lust!
»Durch diese Schönheiten sind die Alpen auch das Reiseziel aller zivilisierten Nationen geworden und werden es durch die Verbesserung und Vermehrung der Verkehrsmittel immer mehr«, konstatiert Meyers Konversationslexikon 1888. »Die Eisenbahnen, welche jetzt an Stelle mühsamer Saumpfade bis zum Fuß der höchsten Berge, ja durch oder über die Berge selbst hinwegführen, die Dampfer, welche die Seen befahren, und prächtige Landstraßen machen das Reisen ebenso bequem wie anziehend.«
Ganz so bequem waren diese Anfänge dann doch nicht. Hermann Allmers, der die Alpen 1845 noch per Postkutsche überquerte, berichtete von einem Bergsturz unterwegs:
»… ein Anblick, der einem wohl das Herz beben machen konnte. Dicht am Weg erhob sich die hohe, wildzerrissene Felswand, aus rotem, härtestem Porphyr bestehend, von der sich die ungeheure Masse abgelöst hatte und mit dumpfem Donnern herabgesunken war. Mit unsäglicher Mühe hatte man eben die Straße gereinigt, und wir fuhren nun durch ein wahres Chaos der schönsten Porphyrblöcke, die in den seltsamsten Formen zu beiden Seiten der Straße hoch und wild übereinander lagen. Noch war nicht alle Gefahr vorüber, weil der Berg fast täglich ansehnliche Felsmassen heruntersandte, und unser Kutscher fuhr in langsamem Schritt, um jede Erschütterung zu vermeiden. Ich war zu sehr von dem ganzen interessanten und großartigen Anblick eingenommen, um der geringsten Angst Raum zu geben, während meine Begleiter schweigend ihre besorgten Blicke auf die drohende Felswand richteten und ein alter, bärtiger Kapuziner mechanisch nach seinem Rosenkranze griff, um schnell ein paar Ave Marias herzumurmeln.«
Auch wenn so eine Reise schnell auf einen ungeplanten Abenteuerurlaub hinauslaufen konnte, brach das gehobene deutsche Bürgertum bald in Scharen bergwärts auf. Repräsentativ war da Thomas Manns Lübecker Senator Thomas Buddenbrook, der um die Mitte des 19. Jahrhunderts gern in die Berge reiste. Am Ende seines Lebens aber zog er – übrigens am Meer – eine elegische Bilanz:
»Vielleicht zog ich ehemals das Gebirge nur vor, weil es in weiterer Ferne lag. Jetzt möchte ich nicht mehr dorthin. Ich glaube, daß ich mich fürchten und schämen würde. Es ist zu willkürlich, zu unregelmäßig, zu vielfach, ich würde mich allzu unterlegen fühlen. Es ist das wenigste, daß man tapfer umhersteigt im Gebirge, während man am Meer still im Sande ruht. Aber ich kenne den Blick, mit dem man dem einen, und jenen, mit dem man dem andern huldigt. Sichere, trotzige, glückliche Augen, die voll sind von Unternehmungslust, Festigkeit und Lebensmut, schweifen von Gipfel zu Gipfel. Man klettert keck in die wundervolle Vielfalt der zackigen, ragenden, zerklüfteten Erscheinungen hinein, um seine Lebenskraft zu erproben, von der noch nichts verausgabt wurde. Aber man ruht an der weiten Einfachheit der äußeren Dinge, müde wie man ist von der Wirrnis der inneren.«
Am Meer, der entgegengesetzten Extremlandschaft, reizt immer auch das, was sich unter der Oberfläche verbergen, was jederzeit überraschend auftauchen könnte. Das Hochgebirge jedoch ist Oberfläche – what you see is what you get. Anstelle vieler verborgener Strömungen eine einzige harte Realität, anstelle schmiegsamer Nachgiebigkeit steinerne Grenzen, die nur wenige überschreiten können. Wasser ist beweglich, Berge sind starr. Gebirge sind verkörperte Macht. Ihre Oberfläche lässt sich nur mit Gewalt durchbrechen. Die Frage ist hier immer nur: Tötet diese Macht, oder gewährt sie Geborgenheit? Und, das gehört zur ambivalenten Faszination dieser Landschaft: Dicht unter den abweisenden Gipfeln, dem letzten Wort in Sachen sichtbarer Naturgewalt, locken dann gleich wieder Vielfalt und eine Schönheit, die den Berg einladend und sogar sanft wirken lässt:
Du, Berg, bist gut. Auf deinen Matten ruht
Das Auge gern und gern auf deinem Wald;
Du bist nicht hoch und stattlich von Gestalt,
Doch macht dein sanfter Reiz dem Träumer Mut.
Die Sonne liegt auf deiner breiten Brust
Den langen Tag; du gibst sie uns zurück;
Und über deinem gütevollen Glück
Entlässt das Herz die letzte böse Lust.
… schilderte Christian Morgenstern seine Begegnung mit »Einem Berge«. Als ähnlich beglückend erlebte Jemima Morell im Sommer 1863 diese Umgebung. Die einunddreißigjährige Britin war Teilnehmerin einer historischen Exkursion: der ersten Pauschalreise in die Alpen, angeboten vom Reisebüro von Thomas Cook. Ihr Reisebericht klingt wie die Expedition in eine neue Welt, was es damals, in dieser Geburtsstunde des organisierten Tourismus, ja auch war. Begeistert schwärmte die junge Frau: »Wer wie wir glaubte, die Berge der Alpen seien kahl und unfruchtbar, wird erkennen, dass dies ein Irrtum war. Denn hier erstrecken sich bis in eine Höhe von 6000 Fuß, unterbrochen von Tannenwäldern, immer wieder grüne Hänge, auf denen überall in kräftigem Rosa Alpenrosen blühen. Wir sammeln sie in Hülle und Fülle, schmücken unsere Hüte mit den verzweigten Gebinden und pflücken Sträuße zu beiden Seiten unseres Weges, der hier und da buchstäblich mit einer Bordüre vielfältiger Blumen gesäumt ist.«
Dieser rundum geglückten Premiere folgte schnell ein touristischer Run auf die Alpen, der bis heute anhält. Als derart faszinierend erwies sich dieses neu zu entdeckende Urlaubsziel, dass Thomas Cook bald eine Zugreise durch die Alpen so anpries:
»Wir dürfen erwähnen, dass es als die ideale Bahnreise für Flitterwöchner erscheint. Sie kommen dabei zur Ruhe. Selbst wenn sich Algie und Angelina aufs Allerzärtlichste zugeneigt sind, wird sie nichts anderes als die grandiose, prachtvolle Landschaft in den Bann schlagen.«