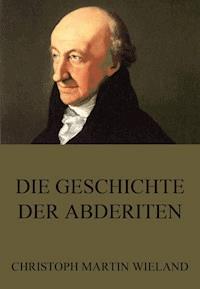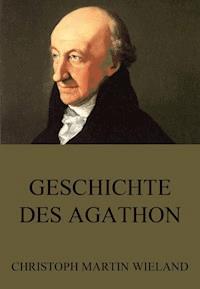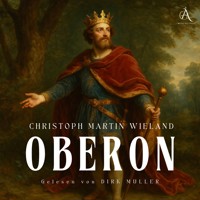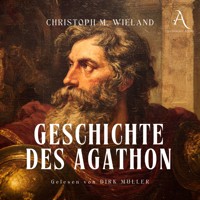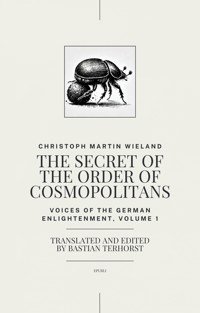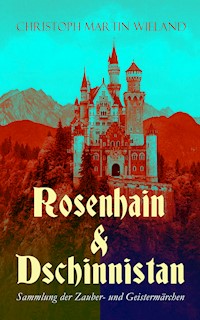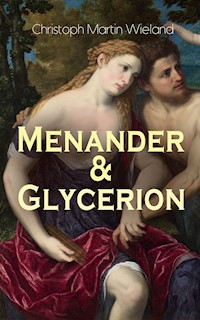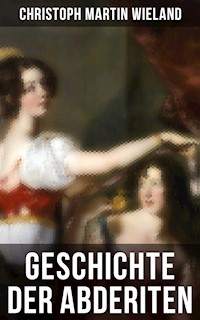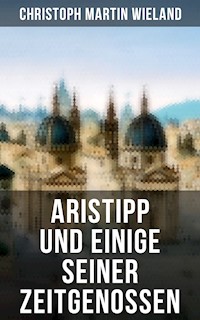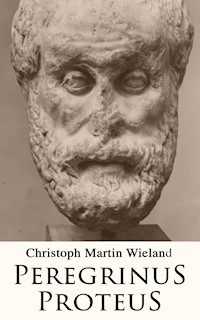Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Der goldene Spiegel" ist ein Roman mit mehreren Handlungsebenen und im Wesentlichen ein Gespräch dreier Personen. Die verbindenden Elemente sind die Betrachtung von Monarchie als Regierungsform und ein Bezug zur Aufklärung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 629
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der goldne Spiegel oder Die Könige von Scheschian
Christoph Martin Wieland
Inhalt:
Christoph Martin Wieland – Biografie und Bibliografie
Der goldne Spiegel oder Die Könige von Scheschian
Zueignungsschrift des sinesischen Übersetzers an den Kaiser Tai-Tsu
Einleitung
Erster Teil
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Zweiter Teil
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Fußnoten
Der goldne Spiegel oder Die Könige von Scheschian, C. M. Wieland
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849639907
www.jazzybee-verlag.de
Christoph Martin Wieland – Biografie und Bibliografie
Hervorragender deutscher Dichter, geb. 5. Sept. 1733 zu Oberholzheim im Gebiete der ehemaligen Reichsstadt Biberach, gest. 20. Jan. 1813 in Weimar, genoss bei seinem Vater, der 1736 als Pfarrer nach Biberach versetzt wurde, sowie in der dortigen Stadtschule trefflichen Unterricht. Noch vor dem 14. Jahr auf die Schule zu Klosterberge bei Magdeburg geschickt, gab der sehr fromm erzogene, leseeifrige Knabe sich anfangs ganz dem dort herrschenden Geiste hin und warf sich in eine ausschließliche Bewunderung Klopstocks. Nachdem er seit Ostern 1749 sich ein Jahr lang bei einem Verwandten in Erfurt aufgehalten, verbrachte er den Sommer 1750 im Vaterhause. Hier traf er mit seiner Verwandten Sophie Gutermann (nachmals Sophie v. Laroche, s. d.) zusammen (vgl. Ridderhoff, Sophie von Laroche und W., Programm, Hamb. 1907). Die schwärmerische Neigung, die er zu ihr faßte, entwickelte rasch sein poetisches Talent. Durch sie empfing W. die Anregung zu seinem ersten der Öffentlichkeit übergebenen Gedicht: »Die Natur der Dinge. Ein Lehrgedicht in sechs Büchern« (anonym erschienen 1752). Im Herbst 1750 hatte W. die Universität Tübingen bezogen, angeblich um die Rechte zu studieren, welches Studium er jedoch über der Beschäftigung mit der neuern schönen Literatur und eigner poetischer Produktion ziemlich vernachlässigte. Ein Heldengedicht: »Hermann«, von dem er fünf Gesänge (hrsg. von Muncker, Heilbr. 1886) ausarbeitete und an Bodmer sandte, brachte ihn mit diesem in einen sehr intimen Briefwechsel. Seine übrigen Erstlingsdichtungen. »Zwölf moralische Briefe in Versen« (Heilbr. 1752), »Anti-Ovid« (Amsterd. 1752) u. a., kennzeichneten ihn als ausschließlichen und leidenschaftlichen Klopstockianer und strebten auf eine spezifisch seraphisch-christliche Dichtung hin. Im Sommer 1752 folgte er einer Einladung Bodmers nach Zürich. Auf das herzlichste empfangen, wohnte er im traulichsten Verkehr eine Weile bei Bodmer, den er sich durch eine Abhandlung über die Schönheiten in dessen Gedicht »Noah« und durch die neue Herausgabe der 1741–1744 erschienenen »Züricherischen Streitschriften« (gegen Gottsched) verpflichtete, und in dessen Sinn er ein episches Gedicht in drei Gesängen: »Der geprüfte Abraham« (Zürich 1753), verfasste. In anregendem Verkehr mit Breitinger, Hirzel, Sal. Geßner, Füßli, Heß u. a. schrieb W. in Zürich um jene Zeit noch die »Briefe von Verstorbenen an hinterlassene Freunde« (Zür. 1753). Die plötzliche Nachricht, dass seine Geliebte sich verehelicht, sowie ein längerer Aufenthalt in dem pietistisch gestimmten Grebelschen Hause in Zürich hielten ihn eine Weile länger, als es sonst geschehen sein würde, bei der seiner innersten Natur ganz entgegengesetzten frommen Richtung. In den »Empfindungen eines Christen« (Zürich 1757) sprach er zum letzten mal die Sprache, die er seit Klosterberge geredet, und erklärte sich mit besonderer Heftigkeit gegen die erotischen Dichter, besonders gegen Uz (s. d.). Aber bald genug vollzog sich in W., besonders unter dem Einfluss der Schriften des Lukian, Horaz, Cervantes, Shaftesbury, d'Alembert, Voltaire u. a., eine vollständige Umkehr von den eben bezeichneten Bahnen. Schon das mit starker Benutzung einer englischen Tragödie von Rowe gedichtete Trauerspiel »Lady Johanna Gray« (Zürich 1758) konnte Lessing mit der Bemerkung begrüßen, W. habe »die ätherischen Sphären verlassen und wandle wieder unter den Menschenkindern«. In demselben Jahr entstand das epische Fragment »Cyrus« (Zürich 1759), zu dem die Taten Friedrichs d. Gr. die Inspiration gegeben hatten, ferner das in Bern, wo W. 1759 eine Hauslehrerstelle angetreten hatte, geschriebene Trauerspiel »Clementina von Porretta« (nach Richardsons Roman »Grandison«, das. 1760) und die dialogisierte Episode aus der Kyropädie des Xenophon: »Araspes und Panthea«, welche Dichtungen sämtlich nach Wielands späteren eignen Worten die »Wiederherstellung seiner Seele in ihre natürliche Lage« ankündigen oder geschehen zeigen. In Bern trat der Dichter in sehr nahe Beziehungen zu der Freundin Rousseaus, Julie Bondeli (s. d.). 1760 nach Biberach zurückgekehrt, erhielt er eine amtliche Stellung in seiner Vaterstadt, deren kleinbürgerliche Verhältnisse ihm minder drückend wurden, nachdem er auf dem Schlosse des Grafen Stadion, der sich nach dem Biberach benachbarten Warthausen zurückgezogen, eine Stätte feinster weltmännischer Bildung, mannigfachste persönliche Anregung und eine vortreffliche Bibliothek gefunden hatte. In Warthausen traf W. auch Sophie v. Laroche, seine ehemalige Geliebte, die mit ihrem Gatten bei Stadion lebte, wieder. Der Verkehr mit den genannten und andern Personen, die sich in jenem Kreise bewegten, vollendete Wielands Bekehrung ins »Weltliche«. Jetzt erst trat seine schriftstellerische Tätigkeit in die Epoche, die seinen Ruhm und seine Bedeutung für die nationale Literatur umfasst. Um 1761 wurde der Roman »Agathon« (Frankf. 1766–67; vgl. Scheidl, Persönliche Verhältnisse und Beziehung zu den antiken Quellen in Wielands ›Agathon‹, Berl. 1904; F. W. Schröder, Wielands. Agathon' und die Anfänge des modernen Bildungsromans, Dissertation, Königsb. 1905) begonnen, nach Lessings Urteil der erste deutsche Roman »für den denkenden Kopf von klassischem Geschmack«, 1764 »Don Silvio von Rosalva, oder der Sieg der Natur über die Schwärmerei« (Ulm 1764; vgl. Martens, Untersuchungen über Wielands, Don Sylvio', Dissertation, Halle 1901) vollendet. Daneben vertiefte sich W. in das Studium Shakespeares und ließ dessen Stücke zu einer Zeit, wo sie sonst in Deutschland noch nirgends ausgeführt wurden, in Biberach von einer Liebhabergesellschaft ausführen. Auch ließ er zuerst eine Sammlung von Shakespeareschen Dramen in deutscher Sprache erscheinen (22 Stücke, Zürich 1762–66, 8 Bde.). Die Übersetzung (in Prosa) wird ebenso wenig wie die Anmerkungen dem Dichter immer gerecht, die Versmaße des Originals sind nur in dem vortrefflich übertragenen und W. besonders kongenialen »Sommernachtstraum« beibehalten (vgl. Wurth, Zu Wielands, Eschenburgs und A. W. Schlegels Übersetzungen des, Sommernachtstraums', Programm, Budweis 1897; Simpson, Eine Vergleichung der Wielandschen Shakespeare-Übersetzung mit dem Originale, Dissertation, Berl. 1898).
Mit den beiden oben genannten Romanen und den Dichtungen: »Musarion, oder die Philosophie der Grazien« (Leipz. 1768) und »Idris und Zenide« (das. 1768), in den nächsten Jahren den Erzählungen: »Nadine« (das. 1769), »Combabus« (das. 1770), »Die Grazien« (das. 1770) und »Der neue Amadis« (das. 1771) verfolgte W. seinen neuen Weg und verkündete eine Philosophie der heitern Sinnlichkeit, der Weltfreude, der leichten Anmut, die im vollen Gegensatz zu den Anschauungen seiner Jugend stand. Inzwischen hatte W., der seit 1765 mit einer Augsburgerin verheiratet war, einem durch Riedel in Erfurt vermittelten Ruf an die dortige Universität im Sommer 1769 Folge gegeben. Seine Lehrtätigkeit, dse er mit Eifer betrieb, tat seiner dichterischen Produktivität wenig Abbruch. In Erfurt verfaßte er, außer einigen der oben genannten Schriften, noch das Singspiel »Aurora«, die »Dialoge des Diogenes« und den lehrhaften Roman »Der goldene Spiegel, oder die Könige von Scheschian« (Leipz. 1772; vgl. O. Vogt, ›Der goldene Spiegel‹ und Wielands politische Ansichten, Berl. 1904), der ihm den Weg nach Weimar bahnte. 1772 berief ihn die Herzogin Anna Amalie von Sachsen-Weimar zur literarischen Erziehung ihrer beiden Söhne nach Weimar. Hier trat W. in den geistig bedeutendsten Lebenskreis des damaligen Deutschland, der schon bei seiner Ankunft Männer wie Musäus, v. Knebel, Einsiedel, Bertuch u. a. in sich schloss, aber bald darauf durch Goethe und Herder erst seine höchste Weihe und Belebung erhielt. W. bezog unter dem Titel eines herzoglichen Hofrates einen Gehalt von 1000 Tlr., der ihm auch nach Karl Augusts Regierungsantritt als Pension verblieb. In behaglichen, ihn beglückenden Lebensverhältnissen entfaltete er eine frische und sich immer liebenswürdiger gestaltende poetische und allgemein literarische Tätigkeit. Mit dem Singspiel »Die Wahl des Herkules« und dem lyrischen Drama »Alceste« (1773) errang er reiche Anerkennung. In der Zeitschrift »Der teutsche Merkur«, deren Redaktion er von 1773 bis 1789 führte, ließ er fortan die eignen dichterischen Arbeiten zunächst erscheinen, neben denen er auch eine ausgebreitete kritische Tätigkeit übte (vgl. Burkhardt, Repertorium zu Wielands deutschem Merkur, Jena 1873). Wielands im »Merkur« abgedruckte »Briefe über Alceste« (September 1773) gaben Goethe und Herder Ärgernis und riefen des ersteren Farce »Götter, Helden und W.« (1774) hervor, auf welchen Angriff W. mit der ihm in der zweiten Hälfte seines Lebens fast unverbrüchlich eignen heitern Milde antwortete. Als Goethe bald darauf nach Weimar übersiedelte, bildete sich zwischen ihm und W. ein dauerndes Freundschaftsverhältnis, dem der überlebende Altmeister nach Wielands Tod in seiner schönen Denkrede auf W. ein unvergängliches Denkmal gesetzt hat. Goethe gewann auch den stärksten Einfluss auf Wielands Bestrebungen in der dritten Periode, in deren Werken sich die besten und rühmlichsten Eigenschaften unsers Dichters gleichsam konzentrieren, während seine Neigung zur ermüdenden Breite und zur sinnlichen Lüsternheit bis auf einen gewissen Punkt überwunden wurde. Die »Geschichte der Abderiten« (Leipz. 1781; vgl. Seuffert, Wielands ›Abderiten‹ Berl. 1878), das romantische, farbenreiche epische Gedicht »Oberon« (Weim. 1781; vgl. M. Koch, Das Quellenverhältnis von Wielands ›Oberon‹, Marb. 1880; Lindner, Zur Geschichte der Oberonsage, Rostock 1902), Wielands Meisterwerk, die prächtigen poetischen Erzählungen: »Das Wintermärchen«, »Geron der Adelige«, »Schach Lolo«, »Pervonte« (vgl. F. Muncker, Wielands ›Pervonte‹, Münch. 1904) u. a., gesammelt in den »Auserlesenen Gedichten« (Jena 1784–87), entstanden in den ersten Jahrzehnten in Weimar. Dazu gesellten sich die trefflichen Bearbeitungen von »Horazens Satiren« (Leipz. 1786), »Lukians sämtlichen Werken« (das. 1788–89; vgl. Kersten, Wielands Verhältnis zu Lucian, Programm, Kuxhav. 1900; Steinberger, Lucians Einfluss auf W., Dissertation, Götting. 1903) und zahlreiche kleinere Schriften. Eine Gesamtausgabe seiner bis 1802 erschienenen Werke (1794–1802 in 36 Bänden und 6 Supplementbänden), die Göschen in Leipzig verlegte, hatte W. in den Stand gesetzt, das Gut Osmannstedt bei Weimar anzukaufen. Dort lebte der Dichter seit 1798 im Kreise seiner großen Familie (seine Gattin hatte ihm in 20 Jahren 14 Kinder geboren) glückliche Tage, bis ihn der 1801 erfolgte Tod seiner Gattin veranlasste, seinen Landsitz zu veräußern und wieder in Weimar zu wohnen (1803), wo er dem Kreise der Herzogin Anna Amalie bis an deren Tod (1807) angehörte. Die Zeitschrift »Attisches Museum«, die W. allein 1796–1801, und das »Neue attische Museum«, das er mit Hottinger und Fr. Jacobs 1802 bis 1810 herausgab, dienten dem Zweck, die deutsche Nation mit den Meisterwerken der griechischen Poesie, Philosophie und Redekunst vertraut zu machen. W. blieb bis in sein höchstes Alter in seltener Weise lebensfrisch (noch aus seinen letzten Lebensjahren stammt seine schöne Übersetzung von »Ciceros Briefen«, Zür. 1808–21). 1808 wurde er von Napoleon mit großer Auszeichnung behandelt. Seine Überreste ruhen seinem Wunsche gemäß zu Osmannstedt in Einem Grabe mit denen seiner Gattin und einer Enkelin seiner Jugendfreundin Laroche, Sophie Brentano. In Wielands Gartenhaus in Biberach wurde 1907 ein Wieland-Museum errichtet (vgl. »Vorträge, gehalten bei der Wielandfeier in Biberach a. Riß am 3. September 1907«, Biberach 1907). Sein Bildnis s. Tafel »Deutsche Klassiker des 18. Jahrhunderts« (im 11. Bd.).
Indem W. bei Beginn seiner zweiten Periode zur Vorbildlichkeit der französischen Literatur zurückkehrte und den Ehrgeiz hegte, die der deutschen Literatur völlig gleichgültig gegenüberstehenden höheren Stände durch eine der französischen ähnliche graziöse Leichtigkeit und lebendige Anmut für die deutsche Literatur zu gewinnen, leistete er ebendieser Literatur einen großen und entscheidenden, aber auch einen etwas bedenklichen Dienst. Er nahm einen guten Teil der Leichtfertigkeit, der Üppigkeit und Oberflächlichkeit jener Musterliteratur in die Produktionen seiner mittleren Zeit herüber. Freilich verband sich diese herausfordernde Frivolität und spöttische Weltklugheit mit dem kräftigen Behagen und dem unverwüstlichen Kern in seiner Natur, der selbst Schiller in einem Brief an Körner Wielands »Deutschheit« trotz alledem und alledem betonen ließ. Und die außerordentliche Entwickelungsfähigkeit seines reichen Talentes, der eigentümliche Aufschwung, den seine Dichtung noch in der zweiten Hälfte seines Lebens nahm, hätten die stutzig machen sollen, die, wie dies im Kreise der Romantiker Mode war, von W. immer und überall nur als von einem guten Kopf, ohne eigenstes poetisches Verdienst und tiefere Bedeutung, sprachen. Die mittelbare Nachwirkung Wielands brachte der deutschen Literatur eine Fülle seither nicht gekannter Anmut und Heiterkeit, die lebendigste Beweglichkeit und gesteigerte Fähigkeit für alle Arten der Darstellung. Die sämtlichen Werke Wielands erschienen im Göschenschen Verlag, herausgegeben von Gruber (Leipz. 1818–28, 53 Bde., mit der unten angeführten Biographie), dann ebenda in 36 Bänden 1839–40 (wiederholt Stuttg. 1853) und bei Hempel (Berl. 1879, 40 Bde.); »Ausgewählte Werke« gaben H. Kurz (Hildburgh. 1870, 3 Bde.), G. Klee (Leipz. 1900, 4 Bde., mit Biographie), W. Bölsche (das., 4 Bde.), H. Pröhle (in Kürschners »Deutscher Nationalliteratur«, Stuttg. 1887, 6 Bde.) und Muncker (in Cottas »Bibliothek der Weltliteratur«, 1889, 6 Bde.) heraus; eine große kritische Ausgabe wird von der Deutschen Kommission der Berliner Akademie vorbereitet; vgl. Seuffert, Prolegomena zu einer Wieland-Ausgabe (Berl. 1904). Von Briefen Wielands erschienen: »Ausgewählte Briefe an verschiedene Freunde« (Zürich 1815–16, 4 Tle.); »Auswahl denkwürdiger Briefe« (hrsg. von Ludwig W., Wien 1815, 2 Bde.); »Briefe an Sophie von La Roche« (hrsg. von Fr. Horn, Berl. 1820); »Briefe an Merck« (hrsg. von Wagner, Darmst. 1835; hauptsächlich auf den »Deutschen Merkur« bezüglich); »Neue Briefe, vornehmlich an Sophie von La Roche« (hrsg. von Hassencamp, Stuttg. 1893). Eine Biographie des Dichters schrieb Gruber (»Christ. Martin W.«, Altenb. 1815–16, 2 Bde.; neue Bearbeitung u. d. T.: »Chr. M. Wielands Leben«, als Bd. 50–53 der Werke, Leipz. 1827–28). Vgl. Ofterdinger, Chr. M. Wielands Leben und Wirken in Schwaben und der Schweiz (Heilbr. 1877); Buchner, W. und die Weidmannsche Buchhandlung (Berl. 1871); R. Keil, W. und Reinhold (Leipz. 1885); L. Hirzel, W. und Martin und Regula Künzli (das. 1891; behandelt eine Episode aus Wielands Züricher Jahren); P. Weizsäcker, Die Bildnisse Wielands (Stuttg. 1893); Wukadinovié, Prior in Deutschland (Graz 1895); Pomezny, Grazie und Grazien in der deutschen Literatur des 18. Jahrhunderts (Hamb. 1900); B. Seuffert, Der Dichter des ›Oberon‹ (Vortrag, Prag 1900); F. Bauer, Über den Einfluß L. Sternes auf W. (Programm, Karlsbad 1898 u. 1900, 2 Hefte); Behmer, L. Sterne und W. (Berl. 1899); Doell, W. und die Antike (Programm, Münch. 1896); L. Hirzel, Wielands Beziehungen zu den deutschen Romantikern (Bern 1904); Ermatinger, Die Weltanschauung des jungen W. (Frauens. 1907); Kuhn, ›Idris und Zenide‹. Ein Beitrag zur Erkenntnis der Sprache Wielands (Würzb. 1903); Calvör, Der metaphorische Ausdruck des jungen W. (Dissertation, Götting. 1906); Schlüter, Studien über die Reimtechnik Wielands (Dissertation, Marb. 1900). Eine Reihe vorzüglicher Arbeiten über W. hat B.Seuffert, der beste Kenner des Dichters, in Zeitschriften veröffentlicht.
Der goldne Spiegel oder Die Könige von Scheschian
Zueignungsschrift des sinesischen Übersetzers an den Kaiser Tai-Tsu
Glorwürdigster Sohn des Himmels!
Ihrer Majestät lebhaftestes Verlangen ist Ihre Völker glücklich zu sehen. Dies ist das einzige Ziel Ihrer unermüdeten Bemühungen; es ist der große Gegenstand Ihrer Beratschlagungen, der Inhalt Ihrer Gesetze und Befehle, die Seele aller löblichen Unternehmungen, die Sie anfangen und – ausführen, und das, was Sie von allem Bösen abhält, welches Sie nach dem Beispiel andrer Großen der Welt tun könnten, und – nicht tun.
Wie glücklich müßten Sie selbst sein, Bester der Könige, wenn es gleich leicht wäre, ein Volk glücklich zu wünschen, und es glücklich zumachen! wenn Sie, wie der König des Himmels, nur wollen dürften, um zu vollbringen, nur sprechen, um Ihre Gedanken in Werke verwandelt zu sehen!
Aber wie unglücklich würden Sie vielleicht auch sein, wenn Sie wissen sollten, in welcher Entfernung, bei allen Ihren Bemühungen, die Ausführung hinter Ihren Wünschen zurück bleibt! Die unzählige Menge der Gehilfen von so mancherlei Klassen, Ordnungen und Arten, unter welche Sie genötiget sind Ihre Macht zu verteilen, weil auch den unumschränktesten Monarchen die Menschheit Schranken setzt; die Notwendigkeit, sich beinahe in allem auf die Werkzeuge Ihrer wohltätigen Wirksamkeit verlassen zu müssen, macht Sie – erschrecken Sie nicht vor einer unangenehmen aber heilsamen Wahrheit! – macht Sie zum abhänglichsten aller Bewohner Ihres unermeßlichen Reiches. Nur zu oft steht es in der Gewalt eines Ehrgeizigen, eines Heuchlers, eines Rachgierigen, eines Unersättlichen, – doch, wozu häufe ich die Namen der Leidenschaften und Laster, da ich sie alle in Einem Worte zusammen fassen kann? eines Menschen – in Ihrem geheiligten Namen gerade das Gegenteil von Ihrem Willen zu tun! An jedem Tage, in jeder Stunde, beinahe dürft ich sagen in jedem Augenblick Ihrer Regierung, wird in dem weiten Umfang Ihrer zahlreichen Provinzen irgend eine Ungerechtigkeit ausgeübt, ein Gesetz verdreht, ein Befehl übertrieben oder ihm ausgewichen, ein Unschuldiger unterdrückt, ein Waise beraubt, ein Verdienstloser befördert, ein Bösewicht geschützt, die Tugend abgeschreckt, das Laster aufgemuntert.
Was für ein Ausdruck von Entsetzen würde mir aus den Blicken Ihrer Höflinge entgegen starren, wenn sie mich so verwegen reden hörten! Wie sollt es möglich sein, daß unter einem so guten Fürsten das Laster sein Haupt so kühn empor heben, und ungestraft so viel Böses tun dürfte? Die bloße Voraussetzung einer solchen Möglichkeit scheint eine Beleidigung Ihres Ruhmes, eine Beschimpfung Ihrer glorreichen Regierung zu sein. – Vergeben Sie, Gnädigster Oberherr! Ungestraft, aber nicht öffentlich und triumphierend, hebt das Laster sein Haupt empor; denn das Angesicht, das es zeigt, ist nicht sein eigenes; es nimmt die Gestalt der Gerechtigkeit, der Gnade, des Eifers für Religion und Sitten, der Wohlmeinung mit dem Fürsten und dem Staate, kurz die Gestalt jeder Tugend an, von welcher es der ewige Feind und Zerstörer ist. Seine Geschicklichkeit in dieser Zauberkunst ist unerschöpflich, und kaum ist es möglich, daß die Weisheit des besten Fürsten sich gegen ihre Täuschungen hinlänglich verwahren könnte. Ihre Majestät glaubten vielleicht das Urteil eines Übeltäters zu unterschreiben, und unterschrieben den Sturz eines Tugendhaften, dessen Verdienste sein einziges Verbrechen waren. Sie glaubten einen ehrlichen Mann zu befördern, und beförderten einen schändlichen Gleisner. Doch, dies sind Wahrheiten, wovon Sie nur zu sehr überzeugt sind. Sie beklagen das unglückliche Los Ihres Standes. Wem soll man glauben? Tugend und Laster, Wahrheit und Betrug haben einerlei Gesicht, reden einerlei Sprache, tragen einerlei Farbe; ja, der feine Betrüger (das schädlichste unter allen schädlichen Geschöpfen) weiß das äußerliche Ansehen gesunder Grundsätze und untadeliger Sitten gemeiniglich besser zu behaupten als der redliche Mann. Jener ist es, der die Kunst ausgelernt hat, seine Leidenschaften in die innersten Höhlen seines schwarzen Herzens zu verschließen, der am besten schmeicheln, am behendesten sich jeder Vorteile bedienen kann, die ihm die schwache Seite seines Gegenstandes zeigt. Seine Gefälligkeit, seine Selbstverleugnung, seine Tugend, seine Religion kostet ihm nichts; denn sie ist nur auf seinen Lippen, und in den äußerlichen Bewegungen, die sein Inwendiges verbergen: er hält sich reichlich für seine Verstellung entschädiget, indem er unter dieser Maske jeder bösartigen Leidenschaft genug tun, jeden niederträchtigen Anschlag ausführen, und mit einer ehernen Stirne noch Belohnung für seine Übeltaten fodern kann. Ist es zu verwundern, o Sohn des Himmels, daß so viele sind, die alle andere Talente verabsäumen, alle rechtmäßige und edle Wege zu Ansehen und Glück vorbei gehen, und mit aller ihrer Fähigkeit allein dahin sich bestreben, es in der Kunst zu betrügen zur Vollkommenheit zu bringen?
Aber wie? Sollte der Fürst, der die Wahrheit liebt, wiewohl auf allen Seiten mit Larven und Blendwerken umgeben, verzweifeln müssen, jemals ihr unverfälschtes Antlitz von dem geschminkten Betrug unterscheiden zu können? Das verhüte der Himmel! Wer die Wahrheit aufrichtig liebt (und was kann ohne sie liebenswürdig sein?), wer auch als dann sie liebt, wenn sie nicht schmeichelt, der hat nur geübte Augen vonnöten, um ihre feineren Züge zu unterscheiden, welche selten so gut nachgemacht werden können, daß die Kunst sich nicht verraten sollte. Und um diese geübten Augen zu bekommen – ohne welche das beste Herz uns nur desto gewisser und öfter der arglistigen Verführung in die Hände liefert –, ist kein bewährteres Mittel, als die Geschichte der Weisheit und der Torheit, der Meinungen und der Leidenschaften, der Wahrheit und des Betrugs, in den Jahrbüchern des menschlichen Geschlechts auszuforschen. In diesen getreuen Spiegeln erblicken wir Menschen, Sitten und Zeiten, entblößt von allem demjenigen, was unser Urteil zu verfälschen pflegt, wenn wir selbst in das verwickelte Gewebe des gegenwärtigen Schauspiels eingeflochten sind. Oder, wofern auch Einfalt oder List, Leidenschaften oder Vorurteile geschäftig gewesen sind uns zu hintergehen: so ist nichts leichter, als den falsch gefärbten Duft wegzuwischen, womit sie die wahre Farbe der Gegenstände überzogen haben.
Die echtesten Quellen der Geschichte der menschlichen Torheiten sind die Schriften derjenigen, welche die eifrigsten Beförderer dieser Torheiten waren. Der Mißbrauch, den sie von der Bedeutung der Wörter machen, betrügt unser Urteil nicht: sie mögen immerhin widersinnige Dinge mit der gelassensten Ernsthaftigkeit erzählen, selbst noch so stark davon überzeugt sein, oder überzeugt zu sein scheinen; dies hindert uns nicht, lächerlich zu finden was den allgemeinen Menschenverstand zum Toren machen will. Immerhin mag ein von sich selbst betrogener Schwärmer die Natur der sittlichen Dinge verkehren wollen, und lasterhafte, ungerechte, unmenschliche Handlungen löblich, heroisch, göttlich nennen, rechtmäßige und unschuldige hingegen mit den verhaßtesten Namen belegen: nach Verfluß einiger Jahrhunderte kostet es keine Mühe, durch den magischen Nebel, der den Schwärmer blendete, hindurch zu sehen. Kon-Fu-Tsee könnte ihm ein Betrüger, und Lao-Kiun ein weiser Mann heißen: sein Urteil würde die Natur der Sache, und die Eindrücke, welche sie auf eine unbefangene Seele machen muß, nicht ändern; der Charakter und die Handlungen dieser Männer würden uns belehren, was wir von ihnen zu halten hätten.
Aus diesem Grund empfehlen uns die ehrwürdigen Lehrer unsrer Nation die Geschichte der ältern Zeiten als die beste Schule der Sittenlehre und der Staatsklugheit, als die lauterste Quelle dieser erhabenen Philosophie, welche ihre Schüler weise und unabhängig macht, und, indem sie das was die menschlichen Dinge scheinen von dem was sie sind, ihren eingebildeten Wert von dem wirklichen, ihr Verhältnis gegen das allgemeine Beste von ihrer Beziehung auf den besondern Eigennutz der Leidenschaften, unterscheiden lehrt, uns ein untrügliches Mittel wider Selbstbetrug und Ansteckung mit fremder Torheit darbietet; einer Philosophie, in welcher niemand ohne Nachteil ganz ein Fremdling sein kann, aber welche, in vorzüglichem Verstande, die Wissenschaft der Könige ist.
Überzeugt von dieser Wahrheit widmen Sie, Bester der Könige, einen Teil der Stunden, welche die unmittelbare Ausübung Ihres verehrungswürdigen Amtes Ihnen übrig läßt, der nützlichen und ergetzenden Beschäftigung, Sich mit den Merkwürdigkeiten der vergangenen Zeiten bekannt zu machen, die Veränderungen der Staaten in den Menschen, die Menschen in ihren Handlungen, die Handlungen in den Meinungen und Leidenschaften, und in dem Zusammenhang aller dieser Ursachen den Grund des Glückes und des Elendes der menschlichen Gattung zu erforschen.
Irre ich nicht, so ist die Geschichte der Könige von Scheschian, welche ich hier zu Ihrer Majestät Füßen lege, nicht ganz unwürdig, unter die ernsthaften Ergetzungen aufgenommen zu werden, bei welchen Ihr niemals untätiger Geist von der Ermüdung höherer Geschäfte auszuruhen pflegt. Große, dem ganzen Menschengeschlecht angelegene Wahrheiten, merkwürdige Zeitpunkte, lehrreiche Beispiele, und eine getreue Abschilderung der Irrungen und Ausschweifungen des menschlichen Verstandes und Herzens, scheinen mir diese Geschichte vor vielen andern ihrer Art auszuzeichnen, und ihr den Titel zu verdienen, womit das hohe Ober-Polizei-Gericht von Sina sie beehrt hat; eines Spiegels, worin sich die natürlichen Folgen der Weisheit und der Torheit in einem so starken Lichte, mit so deutlichen Zügen und mit so warmen Farben darstellen, daß derjenige in einem seltenen Grade weise und gut – oder töricht und verdorben sein müßte, der durch den Gebrauch desselben nicht weiser und besser sollte werden können.
Hingerissen von der Begierde, den Augenblick von Dasein, den uns die Natur auf diesem Schauplatze bewilliget, wenigstens mit einem Merkmale meines guten Willens für meine Nebengeschöpfe zu bezeichnen, hab ich mich der Arbeit unterzogen, dieses merkwürdige Stück alter Geschichte aus der indischen Sprache in die unsrige überzutragen; und in dieses Bewußtsein einer redlichen Gesinnung eingehüllt, überlaß ich dieses Buch und mich selbst dem Schicksale, dessen Unvermeidlichkeit mehr Tröstendes als Schreckendes für den Weisen hat; ruhig unter dem Schutz eines Königs, der die Wahrheit liebt und die Tugend ehrt, glücklich durch die Freundschaft der Besten unter meinen Zeitgenossen, und so gleichgültig, als es ein Sterblicher sein kann, gegen – – –1
Einleitung
Alle Welt kennt den berühmten Sultan von Indien, Schach-Riar, der, aus einer wunderlichen Eifersucht über die Negern seines Hofes, alle Nächte eine Gemahlin nahm, und alle Morgen eine erdrosseln ließ; und der so gern Märchen erzählen hörte, daß ihm in tausend und einer Nacht kein einziges Mal einfiel, die unerschöpfliche Scheherezade durch irgend eine Ausrufung, Frage oder Liebkosung zu unterbrechen, so viele Gelegenheit sie ihm auch dazu zu geben beflissen war.
Ein so unüberwindliches Phlegma war nicht die Tugend oder der Fehler seines Enkels Schach-Baham, der (wie jedermann weiß) durch die weisen und scharfsinnigen Anmerkungen, womit er die Erzählungen seiner Visire zu würzen pflegte, ungleich berühmter in der Geschichte geworden ist, als sein erlauchter Großvater durch sein Stillschweigen und seine Untätigkeit. Schach-Riar gab seinen Höflingen Ursache, eine große Meinung von demjenigen zu fassen, was er hätte sagen können, wenn er nicht geschwiegen hätte; aber sein Enkel hinterließ den Ruhm, daß es unmöglich sei, und ewig unmöglich bleiben werde, solche Anmerkungen oder Reflexionen (wie er sie zu nennen geruhte) zu machen wie Schach-Baham.
Wir haben uns alle Mühe gegeben die Ursache zu entdecken, warum die Schriftsteller, denen wir das Leben und die Taten dieser beiden Sultanen zu danken haben, von Schach-Riars Sohne, dem Vater Schach-Bahams, mit keinem Wort Erwähnung tun: aber wir sind nicht so glücklich gewesen einen andern Grund davon ausfündig zu machen, als – weil sich in der Tat nichts von ihm sagen ließ. Der einzige Chronikschreiber, der seiner gedenkt, läßt sich also vernehmen: »Sultan Lolo«, sagt er, »vegetierte einundsechzig Jahre. Er aß täglich viermal mit bewundernswürdigem Appetit, und außer diesem, und einer sehr zärtlichen Liebe zu seinen Katzen, hat man niemals einige besondere Neigung zu etwas an ihm wahrnehmen können. Die Derwischen und die Katzen sind die einzigen Geschöpfe in der Welt, welche Ursache haben, sein Andenken zu segnen. Denn er ließ, ohne jemals recht zu wissen warum, zwölfhundertundsechsunddreißig neue Derwischereien, jede zu sechzig Mann, in seinen Staaten erbauen; machte in allen größern Städten des indostanischen Reiches Stiftungen, worin eine gewisse Anzahl Katzen verpflegt werden mußte; und sorgte für diese und jene so gut, daß man in ganz Asien keine fettern Derwischen und Katzen sieht, als die von seiner Stiftung.2 Er zeugte übrigens zwischen Wachen und Schlaf einen Sohn, der ihm unter dem Namen Schach-Baham in der Regierung folgte, und starb an einer Unverdaulichkeit.« So weit dieser Chronikschreiber, der einzige, der von Sultan Lolo Meldung tut; und, in der Tat, wir besorgen, was er von ihm sagt, ist noch schlimmer als gar nichts.
Sein Sohn Schach-Baham hatte das Glück bis in sein vierzehntes Jahr von einer Amme erzogen zu werden, deren Mutter eben dieses ehrenvolle Amt bei der unnachahmlichen Scheherezade verwaltet hatte. Alle Umstände mußten sich vereinigen, diesen Prinzen zum unmäßigsten Liebhaber von Märchen, den man je gekannt hat, zu machen. Nicht genug, daß ihm der Geschmack daran mit der ersten Nahrung eingeflößt, und der Grund seiner Erziehung mit den weltberühmten Märchen seiner Großmutter gelegt wurde: das Schicksal sorgte auch dafür, ihm einen Hofmeister zu geben, der sich in den Kopf gesetzt hatte, daß die ganze Weisheit der Ägypter, Chaldäer und Griechen in Märchen eingewickelt liege.
Es herrschte damals die löbliche Gewohnheit in Indien, sich einzubilden, der Sohn eines Sultans, Rajas, Omras, oder irgend eines andern ehrlichen Mannes von Ansehen und Vermögen, könne von niemand als von einem Fakir erzogen werden. Wo man einen jungen Menschen von Geburt erblickte, durfte man sicher darauf rechnen, daß ihm ein Fakir an der Seite hing, der auf alle seine Schritte, Reden, Mienen und Gebärden Acht haben, und sorgfältig verhüten mußte, daß der junge Herr nicht – zu vernünftig werde. Denn es war eine durchgängig angenommene Meinung, daß einer starken Leibesbeschaffenheit, einer guten Verdauung, und der Fähigkeit sein Glück zu machen, nichts so nachteilig sei, als viel denken und viel wissen; und man muß es den Derwischen, Fakirn, Santonen, Braminen, Bonzen und Talapoinen der damaligen Zeiten nachrühmen, daß sie kein Mittel unversucht ließen, die Völker um den Indus und Ganges vor einem so schädlichen Übermaße zu bewahren. Es war einer von ihren Grundsätzen, gegen die es gefährlich war Zweifel zu erregen: Niemand müsse klüger sein wollen als seine Großmutter.
Man wird nun begreifen, wie Schach-Baham bei solchen Umständen ungefähr der Mann werden mußte, der er war. Man hat bisher geglaubt, die einsichtsvollen Betrachtungen, die abgebrochenen und mit viel bedeutenden Mienen begleiteten – »das dacht ich gleich« – »ich sage nichts, aber ich weiß wohl was ich weiß« – oder, »doch was kümmert das mich?« und andre dergleichen weise Sprüche, an denen er einen eben so großen Überfluß hat als Sancho Pansa an Sprichwörtern –, nebst seinem Widerwillen gegen das, was er Moral, und Empfindung spinnen nennt, wären bloße Wirkungen seines Genies gewesen. Aber einem jeden das Seine! Man kann sicher glauben, daß der Fakir, sein Hofmeister, keinen geringen Anteil daran hatte.
Der Sohn und Erbe dieses würdigen Sultans, Schach-Dolka, glich seinem Vater an Fähigkeit und Neigungen beinahe in allen Stücken, ein einziges ausgenommen. Er war nämlich ein erklärter Feind von allem, was einem Märchen gleich sah, und setzte diesem Haß um so weniger Grenzen, da er bei Lebzeiten des Sultans seines Vaters genötiget gewesen war, ihn aufs sorgfältigste zu verbergen. Wir würden uns, nach dem Beispiele vieler berühmter Schriftsteller, über diese Ausartung gar sehr verwundern, wenn uns nicht deuchte, daß es ganz natürlich damit zugegangen sei. Sultan Dolka hatte in dem Zimmer der Sultanin seiner Mama (wo Schach-Baham die Abende mit Papierausschneiden, und Anhören lehrreicher Historien von beseelten Sofas, politischen Bals, und empfindsamen Gänschen in rosenfarbem Domino, zuzubringen pflegte) von seiner Kindheit an so viele Märchen zu sich nehmen müssen, daß er sich endlich einen Ekel daran gehört hatte. Dies war das ganze Geheimnis; und uns deucht, es ist nichts darin, worüber man sich so sehr zu verwundern Ursache hätte.
Vermutlich ist aus dieser tödlichen Abneigung vor den Erzählungen des Visirs Moslem die außerordentliche Ungnade zu erklären, welche er auf die Philosophie, und überhaupt auf alle Bücher, sie mochten auf Pergament oder Palmblätter geschrieben sein, geworfen hatte; eine Ungnade, die so weit ging, daß er nur mit der äußersten Schwierigkeit zurück gehalten werden konnte, nicht etwa bloß die Poeten (wie Plato), sondern alle Leute, welche lesen und schreiben konnten, aus seiner Republik zu verbannen; selbst die Mathematiker und Sterngucker nicht ausgenommen, welche ihm wegen der aerometrischen und astronomischen Erfindungen des Königs Strauß im Herzen zuwider waren. Man sagt von ihm, als der vorbelobte Visir die Geschichte des Krieges zwischen dem Genie Grüner als Gras und dem Könige der grünen Länder in seiner Gegenwart erzählt habe, hätte der junge Prinz, der damals kaum siebzehn Jahre alt war, bei der Stelle, wo der Perückenkopf einen der vollständigsten Siege über den König Strauß erhält, sich nicht enthalten können auszurufen: »Das soll mir niemand weismachen, daß jemals ein Perückenkopf den Verstand gehabt hätte, eine Armee zu kommandieren!« – Eine Anmerkung, welche (wie man denken kann) von allen Anwesenden begierig aufgefaßt wurde, und, als ein frühzeitiger Ausbruch eines seltnen Verstandes an einem noch so zarten Prinzen, mit schuldiger Bewunderung am ganzen Hofe widerschallte.
Schach-Dolkarechtfertigte die Hoffnung, welche man sich nach solchen Anzeigungen von seinen künftigen Eigenschaften machte, auf die außerordentlichste Weise. Der Neid selbst mußte gestehen, daß er seinen Voreltern Ehre machte. Er war der größte Mann seiner Zeit Distelfinken abzurichten; und in der Kunst Mäuse aus Äpfelkernen zu schneiden hat die Welt bis auf den heutigen Tag seinesgleichen nicht gesehen. Durch einen unermüdeten Fleiß3 bracht er es in dieser schönen Kunst so hoch, daß er alle Arten von Mäusen, als Hausmäuse, Feldmäuse, Waldmäuse, Haselmäuse, Spitzmäuse, Wassermäuse und Fledermäuse, auch Ratten, Maulwürfe und Murmeltiere, mit ihren gehörigen Unterscheidungszeichen, in der äußersten Vollkommenheit verfertigte; ja, wenn man dem berühmten Schek Hamet Ben Feridun Abu Hassan glauben darf, so beobachtete er sogar die Proportionen nach dem verjüngten Maßstabe mit aller der Genauigkeit, womit Herr Daubenton in seiner Beschreibung des königlichen Naturalienkabinetts zu Paris sie zu bestimmen sich die löbliche Mühe gegeben hat.
Außerdem wurde Schach-Dolka für einen der besten Kuchenbäcker seiner Zeit gehalten, wenn ihm anders seine Hofleute in diesem Stücke nicht geschmeichelt haben; und man rühmt als einen Beweis seiner ungemeinen Leutseligkeit, daß er sich ein unverbrüchliches Gesetz daraus gemacht habe, an allen hohen Festen seinen ganzen Hof mit kleinen Rahmpastetchen von seiner eigenen Erfindung und Arbeit zu bewirten. Niemals hat man einen Sultan mit Geschäften so überhäuft gesehen, als es der arme Dolka in dem ganzen Laufe seiner Regierung war. Denn da alle Könige und Fürsten gegen Morgen und Abend so glücklich sein wollten, einige Mäuse von seiner Arbeit in ihren Kunstkabinetten, oder einen Finken aus seiner Schule in ihrem Vorzimmer zu haben; und da Schach-Dolka teils aus Gefälligkeit, teils in Rücksicht auf das launische Ding, das man Ratio status nennt, niemand vor den Kopf stoßen wollte: so hatte er wirklich (die Stunden, die er im Divan verlieren mußte, mit eingezählt) vom Morgen bis in die Nacht so viel zu tun, daß er kaum zu Atem kommen konnte.
Der Himmel weiß, ob jemals ein anderes Volk das Glück hatte, mit vier Prinzen, wie Schach-Riar, Schach-Lolo, Schach-Baham und Schach-Dolka waren, in einer unmittelbaren Folge gesegnet zu werden. »O! O! die guten Herren! die goldnen Zeiten!« – riefen ihre Omras und Derwischen.
Allein diese wackern Leute können doch auch nicht verlangen, daß es immer nach ihrem Sinne gehen solle. Schach-Gebal, ein Bruderssohn Bahams des Weisen (wie ihn seine Lobredner nannten), welcher seinem Vetter in Ermanglung eines Leibeserben folgte – denn Dolka hatte vor lauter Arbeit keine Zeit gehabt an diese Sache zu denken –, dieser Schach-Gebal unterbrach eine so schöne Folge von gekrönten guten Männern, und regierte bald so gut, bald so schlecht, daß weder die Bösen noch die Guten mit ihm zufrieden waren.
Wir wissen nicht, ob ein Charakter wie der seinige unter regierenden Herren so selten ist, als die Feinde seines Ruhms behaupten. Aber so viel können wir mit gutem Grunde sagen: daß, wenn weder der Adel noch die Priester noch die Gelehrten noch das Volk mit seiner Regierung zufrieden waren, – Adel, Priester, Gelehrte und Volk nicht immer so ganz Unrecht hatten.
Um eine Art von Gleichgewicht unter diesen Ständen zu erhalten, beleidigte er wechselsweise bald diesen bald jenen, und der weise Pilpai selbst hätte ihm nicht ausreden können, daß man Beleidigungen durch Wohltaten nicht wieder gut machen könne. In beiden pflegte er so wenig Maß zu halten, so wenig Rücksicht auf Umstände und Folgen zu nehmen, so wenig nach Grundsätzen und nach einem festen Plane zu verfahren, daß er meistens immer den Vorteil verlor, den er sich dabei vorsetzte. Man wußte so viele Beispiele anzuführen, wo er seine besten Freunde mißhandelt hatte, um die übelgesinntesten Leute mit Gnaden zu überhäufen, daß es endlich zu einer angenommenen Maxime wurde, es sei nützlicher sein Feind zu sein als sein Freund. Jene konnten ihn ungestraft beleidigen, weil er schwach genug war sie zu fürchten: diesen übersah er auch nicht den kleinsten Fehltritt. Jene konnten eine Reihe strafwürdiger Handlungen durch eine einzige Gefälligkeit gegen seine Leidenschaften oder Einfälle wieder gut machen: diesen half es nichts ihm zwanzig Jahre lang die stärksten Proben von Treue und Anhänglichkeit gegeben zu haben, wenn sie am ersten Tage des einundzwanzigsten das Unglück hatten, sich durch irgend ein nichtsbedeutendes Versehen seinen Unwillen zuzuziehen.
Den Priestern soll er überhaupt nicht sehr hold gewesen sein; wenigstens kann man nicht leugnen, daß die Derwischen, Fakirn und Kalender, welche er nur die Hummeln seines Staats zu nennen pflegte, der gewöhnlichste Gegenstand seiner bittersten Spöttereien waren. Er neckte und plagte sie bei jeder Gelegenheit; aber weil er sie für gefährliche Leute hielt, so fürchtete er sie, und weil er sie fürchtete, so fand er selten so viel Mut in sich, ihnen etwas abzuschlagen. Der ganze Vorteil, den er von diesem Betragen zog, war, daß sie sich ihm für seine Gefälligkeiten wenig verbunden achteten, weil sie gar zu wohl wußten, wie wenig sein guter Wille Anteil daran hatte. Sie rächten sich für die unschädliche Verachtung, die er ihnen zeigte, durch den Verdruß, den sie ihm bei hundert bedeutenden Gelegenheiten durch ihre geheimen Ränke und Aufstiftungen zu machen wußten. Sein Haß gegen sie wurde dadurch immer frisch erhalten; aber die Schlauköpfe hatten ausfündig gemacht, daß er sie fürchte; und diese Wahrnehmung wußten sie so wohl zu benutzen, daß ihnen seine wärmste Zuneigung, kaum einträglicher gewesen wäre. Sie hatten die Klugheit, wenig oder keine Empfindlichkeit über die kleinen Freiheiten zu zeigen, die man sich unter seiner Regierung mit ihnen heraus nehmen durfte. Man mag von uns sagen was man will, dachten sie, wenn wir nur tun dürfen was wir wollen.
Schach-Gebal hatte weniger Leidenschaften als Aufwallungen. Er war ein Feind von allem, was anhaltende Aufmerksamkeit und Anstrengung des Geistes erfoderte. Wenn dasjenige, was seine Hofleute die Lebhaftigkeit seines Geistes nannten, nicht allezeit Witz war, so weiß man, daß es bei einem Sultan so genau nicht genommen wird: aber er wußte doch den Witz bei andern zu schätzen; und so tödlich er die langen Reden seines Kanzlers haßte, so hatte er doch Augenblicke, wo man ihm scherzend auch wenig schmeichelnde Wahrheiten sagen durfte. Er wollte immer von aufgeweckten Geistern umgeben sein. Ein schimmernder Einfall hieß ihm allezeit ein guter Einfall; allein dafür fand er auch den besten Gedanken platt, der sonst nichts als Verstand hatte. Nach Grundsätzen zu denken, oder nach einem Plane zu handeln, war in seinen Augen Pedanterei und Mangel an Genie. Seine gewöhnliche Weise war, ein Geschäft anzufangen, und dann die Maßregeln von seiner Laune oder vom Zufall zu nehmen. So pflegten die witzigen Schriftsteller seiner Zeit ihre Bücher zu machen.
Er hatte ein paar vortreffliche Männer in seinem Divan. Er kannte und ehrte ihre Klugheit, ihre Einsichten, ihre Redlichkeit; aber zum Unglück konnte er ihre Miene nicht leiden. Sie besaßen eine gründliche Kenntnis der Regierungskunst und des Staats; aber sie hatten wenig Geschmack; sie konnten nicht scherzen; sie waren zu nichts als zu ernsthaften Geschäften zu gebrauchen, und Schach-Gebal liebte keine ernsthaften Geschäfte. Warum hatten die ehrlichen Männer die Gabe nicht, der Weisheit ein lachendes Ansehen zu geben? – Oder konnten sie sich nur nicht entschließen, ihr zuweilen die Schellenkappe aufzusetzen? Desto schlimmer für sie und den Staat! Schach-Gebal unternahm zwar selten etwas ohne ihren Rat; aber er folgte ihm während seiner ganzen Regierung nur zweimal, und beide Mal – da es zu spät war.
Es war eine seiner Lieblingsgrillen, daß er durch sich selbst regieren wollte. Die Könige, welche sich durch einen Minister, einen Verschnittenen, einen Derwischen, oder eine Mätresse regieren ließen, waren der tägliche Gegenstand seiner Spöttereien. Gleichwohl versichern uns die geheimen Nachrichten dieser Zeit, daß sein erster Iman, und eine gewisse schwarzaugige Tschirkassierin, die ihm unentbehrlich geworden war, alles was sie gewollt aus ihm gemacht hätten. Wir würden es für Verleumdungen halten, wenn wir seine Regierung nicht mit Handlungen bezeichnet sähen, wovon der Entwurf nur in der Zirbeldrüse eines Imans oder in der Phantasie einer schwarzaugigen Tschirkassierin entstehen konnte.
Schach-Gebal war kein kriegerischer Fürst: aber er sah seine Leibwache gern schön geputzt, hörte seine Emirn gern von Feldzügen und Belagerungen reden, und las die Oden nicht ungern, worin ihn seine Poeten über die Cyrus und Alexander erhoben, wenn er bei Gelegenheit eine Festung ihrem Kommendanten abgekauft, oder seine Truppen einen zweideutigen Sieg über Feinde, die noch feiger, oder noch schlechter angeführt waren als sie selbst, erhalten hatten. Es war eine von seinen großen Maximen: ein guter Fürst müsse Frieden halten, solange die Ehre seiner Krone nicht schlechterdings erfodere, daß er die Waffen ergreife. Aber das half seinen Untertanen wenig: er hatte nichts desto weniger immer Krieg. Denn der Mann im Monde hätte mit dem Mann im Polarstern in einen Zwist geraten können; Schach-Gebal mit Hülfe seines Itimadulet4 würde Mittel gefunden haben, die Ehre seiner Krone dabei betroffen zu glauben.
Niemals hat ein Fürst mehr weggeschenkt als Gebal. Aber da er sich die Mühe nicht nehmen wollte, zu untersuchen, oder nur eine Minute lang zu überlegen, wer an seine Wohltaten das meiste Recht haben möchte: so fielen sie immer auf diejenigen, die zunächst um ihn waren, und zum Unglück konnten sie gemeiniglich nicht schlechter fallen.
Überhaupt liebte er den Aufwand. Sein Hof war unstreitig der prächtigste in Asien. Er hatte die besten Tänzerinnen, die besten Gaukler, die besten Jagdpferde, die besten Köche, die witzigsten Hofnarren, die schönsten Pagen und Sklavinnen, die größten Trabanten und die kleinsten Zwerge, die jemals ein Sultan gehabt hat; und seine Akademie der Wissenschaften war unter allen diejenige, worin man die sinnreichsten Antrittsreden und die höflichsten Danksagungen hielt. Es gehörte ohne Zweifel zu seinen rühmlichen Eigenschaften, daß er alle schöne Künste liebte; aber es ist auch nicht zu leugnen, daß er dieser Neigung mehr nachhing als mit dem Besten seines Reiches bestehen konnte. Man will ausgerechnet haben, daß er eine seiner schönsten Provinzen zur Einöde gemacht, um eine gewisse Wildnis, welche allen Anstrengungen der Kunst Trotz zu bieten schien, in eine bezauberte Gegend zu verwandeln, und daß es ihm wenigstens hunderttausend Menschen gekostet habe, um seine Gärten mit Statuen zu bevölkern. Berge wurden versetzt, Flüsse abgeleitet, und unzählige Hände von nützlichern Arbeiten weggenommen, um einen Plan auszuführen, wobei die Natur nicht zu Rate gezogen worden war. Die Fremden, welche dieses Wunder der Welt anzuschauen kamen, reiseten durch übel angebaute und entvölkerte Provinzen, durch Städte, deren Mauern einzufallen drohten, auf deren Gassen Gerippe von Pferden graseten, und worin die Wohnungen den Ruinen einer ehmaligen Stadt, und die Einwohner Gespenstern glichen, die in diesen verödeten Gemäuern spükten. Aber wie angenehm wurden diese Fremden auf einmal von dem Anblicke der künstlichen Schöpfungen überrascht, welche Schach-Gebal, seinem Stolz und den schönen Augen seiner Tschirkassierin zu Gefallen, wie aus nichts hatte hervor gehen heißen! Ganze Gegenden, durch welche sie gekommen waren, lagen verödet; aber hier glaubten sie, in einem entzückenden Traum, in die Zaubergärten der Peris versetzt zu sein. Man konnte nichts Schlechteres sehen als die Landstraßen, auf denen sie oft ihr Leben hatten wagen müssen; aber wie reichlich wurde ihnen dieses Ungemach ersetzt! Die Wege zu seinem Lustschlosse waren mit kleinen bunten Steinen eingelegt.
Bei allem diesem sprach Schach-Gebal gern von Ökonomie; und die beste unter allen möglichen Einrichtungen des Finanzwesens war eine Sache, worüber er seine ganze Regierung durch raffinierte, und die ihm wirklich mehr kostete, als wenn er den Stein der Weisen gesucht hätte. Eine neue Spekulation war der kürzeste Weg sich bei ihm in Gnade zu setzen; auch bekam er deren binnen wenig Jahren so viele, daß sie schichtenweise in seinem Kabinett aufgetürmt lagen, wo er sich zuweilen die Zeit vertrieb, die Titel und die Vorberichte davon zu überlesen. Alle Jahre wurde ein neues System eingeführt, oder doch irgend eine nützliche Veränderung gemacht (das ist, eine Veränderung, die wenigstens einigen, welche die Hand dabei hatten, nützlich war), und die Früchte davon zeigten sich augenscheinlich. Kein Monarch in der Welt hatte mehr Einkünfte auf dem Papier und weniger Geld in der Kasse. Dies kann, unter gewissen Bedingungen, das Meisterstück einer weisen Administration sein: aber in Schach-Gebals seiner war es wohl ein Fehler; denn der größte Teil seiner Untertanen befand sich nicht desto besser dabei. Indessen war er nicht dazu aufgelegt, durch seine Fehler klüger zu werden; denn er betrog sich immer in den Ursachen. Der erste, der mit einem neuen Projekt aufzog, beredete ihn er wisse es besser als seine Vorgänger; und so nahm das Übel immer zu, ohne daß Gebal jemals dazu gelangen konnte die Quelle davon zu entdecken.
Wenn man diese Züge des Charakters und der Regierung des Sultans Gebal zusammen nimmt, so könnte man auf die Gedanken geraten, das Glück seiner Untertanen müsse, im ganzen betrachtet, nur sehr mittelmäßig gewesen sein. In der Tat ist dies auch das gelindeste, was man davon sagen kann. Allein seine Untertanen wurden mehr als zu sehr dadurch gerochen, daß ihr Sultan bei aller seiner Herrlichkeit nicht glücklicher war als der unzufriedenste unter ihnen.
Diese Erfahrung war für ihn ein Problem, worüber er oft in tiefes Nachsinnen geriet, ohne jemals die Auflösung davon finden zu können. Auf dem Wege, wo er sie suchte, hätte er sie ewig vergebens suchen mögen. Denn der Einfall, sie in sich selbst zu suchen, war gerade der einzige, der ihm unter allen möglichen nie zu Sinne kam. Bald dacht er, die Schuld liege an seinen Omras, bald an seinem Mundkoche, bald an seiner Favoritin; er schaffte sich andere Omras, andere Köche und eine andere Favoritin an; aber das wollte alles nicht helfen. Es fiel ihm ein, daß er einmal dieses oder jenes habe tun wollen, welches bisher unterblieben war. Gut, dacht er, das muß es sein! Er unternahm es, amüsierte sich damit bis es fertig war, und – fand sich betrogen. Ursache genug für einen Sultan, verdrießlich zu werden! Aber er hatte deren noch andre, die einen weisern Mann als er war aus dem Gleichgewichte hätten setzen können. Die Händel, die ihm seine Priester machten, die Intrigen seines Serails, die Zwistigkeiten seiner Minister, die Eifersucht seiner Sultaninnen, das häufige Unglück seiner Waffen, der erschöpfte Zustand seiner Finanzen, und (was noch schlimmer als dies alles zu sein pflegt) das Mißvergnügen seines Volkes, welches zuweilen in gefährliche Unruhen auszubrechen drohte, – alles dies vereinigte sich, ihm ein Leben zu verbittern, welches denen, die es nur von ferne sahen, beneidenswürdig vorkam. Schach-Gebal hatte mehr schlaflose Nächte als alle Tagelöhner seines Reichs zusammen. Alle Zerstreuungen und Ergetzlichkeiten, womit man diesem Übel zu begegnen gesucht hatte, wollten nichts mehr verfangen. Seine schönsten Sklavinnen, seine besten Sänger, seine wundertätigsten Luftspringer, seine Witzlinge, und seine Affen selbst verloren ihre Mühe dabei.
Endlich brachte eine Dame des Serails, eine erklärte Verehrerin der großen Scheherezade, die Märchen der Tausend und Einen Nacht in Vorschlag. Aber Schach-Gebal hatte die Gabe nicht (denn wirklich ist sie ein Geschenk der Natur und keines ihrer schlechtesten), der wunderbaren Lampe des Schneiders Aladdin Geschmack abzugewinnen, oder die weißen, blauen, gelben und roten Fische amüsant zu finden, welche sich, ohne ein Wort zu sagen, in der Pfanne braten lassen, bis sie auf einer Seite gar sind, aber, sobald man sie umkehrt, und eine wunderschöne Dame, in beblümten Atlas von ägyptischer Fabrik gekleidet, mit großen diamantnen Ohrengehängen, mit einem Halsbande von großen Perlen und mit rubinenreichen goldnen Armbändern geschmückt, aus der Mauer hervor springt, die Fische mit einer Myrtenrute berührt, und die Frage an sie tut: Fische, Fische, tut ihr eure Schuldigkeit? alle zugleich die Köpfe aus der Pfanne heben, das einfältigste Zeug von der Welt antworten, und dann plötzlich zu Kohlen werden. Schach-Gebal, anstatt dergleichen Historien, wie sein glorwürdiger Ältervater, mit glaubigem Erstaunen und innigstem Vergnügen anzuhören, wurde so ungehalten darüber, daß man mitten in der Erzählung aufhören mußte. Man versuchte es also mit den Märchen des Visirs Moslem, in welchen unstreitig ein großes Teil mehr Witz, und unendliche Mal mehr Verstand und Weisheit, unter dem Schein der äußersten Frivolität, verborgen ist. Aber Schach-Gebal haßte die dunkeln Stellen darin, nicht weil sie dunkel, sondern weil sie nicht noch dunkler waren; denn er hatte wirklich zu viel gesunden Geschmack, um an Unrat, so fein er auch zubereitet war, Gefallen zu finden; und überhaupt deuchte ihm die mehr wollüstige als zärtliche Fee Alles oder Nichts mit ihrer Prüderie und mit ihren Experimenten, der Pedant Tacitürne mit seiner Geometrie, der König Strauß mit seiner albernen Politik und mit seiner Barbierschüssel, und das ungeheure Mittelding von Galanterie und Ziererei, die Königin der kristallnen Inseln, mit allem was sie sagte, tat und nicht tat, ganz unerträgliche Geschöpfe. Er erklärte sich, daß er keine Erzählungen wolle, wofern sie nicht, ohne darum weniger unterhaltend zu sein, sittlich und anständig wären: auch verlangte er, daß sie wahr und aus beglaubten Urkunden gezogen sein, und (was er für eine wesentliche Eigenschaft der Glaubwürdigkeit hielt) daß sie nichts Wunderbares enthalten sollten; denn davon war er jederzeit ein erklärter Feind gewesen. Dieses brachte die beiden Omras, deren wir vorhin als wohl denkender Männer Erwähnung getan haben, auf den Einfall, aus den merkwürdigsten Begebenheiten eines ehmaligen benachbarten Reichs eine Art von Geschichtbuch verfertigen zu lassen, woraus man ihm, wenn er zu Bette gegangen wäre, vorlesen sollte, bis er einschliefe oder nichts mehr hören wollte. Der Einfall schien um so viel glücklicher zu sein, als er Gelegenheiten herbeiführte, dem Sultan mit guter Art Wahrheiten beizubringen, die man, auch ohne Sultan zu sein, sich nicht gern geradezu sagen läßt.
Man dachte also unverzüglich an die Ausführung: und da man den besten Kopf von ganz Indostan (welches freilich in Vergleichung mit europäischen Köpfen nicht viel sagt) dazu gebrauchte; so kam in kurzer Zeit dieses gegenwärtige Werk zu Stande, welches Hiang-Fu-Tsee, ein wenig bekannter Schriftsteller, in den letzten Jahren des Kaisers Tai-Tsu, unter dem Namen des goldnen Spiegels ins Sinesische, – der ehrwürdige Vater J.G.A.D.G.J. aus dem Sinesischen in sehr mittelmäßiges Latein, und der gegenwärtige Herausgeber aus einer Kopie der lateinischen Handschrift, in so gutes Deutsch, als man im Jahre 1772 zu schreiben pflegte, überzutragen würdig gefunden hat.
Aus dem Vorberichte des sinesischen Übersetzers läßt sich schließen, daß sein Buch eigentlich nur eine Art von Auszug aus der Chronik der Könige von Scheschian ist, welche zur Ergetzung und Einschläferung des Sultans Gebal verfertiget worden war. Er verbirgt nicht, daß seine vornehmste Absicht gewesen, den Prinzen aus dem Hause des Kaisers Tai-Tsu damit zu dienen, denen es (wie er meint), unter dem Schein eines Zeitvertreibs, Begriffe und Maximen einflößen könnte, von deren Gebrauch oder Nichtgebrauch das Glück der sinesischen Provinzen größten Teils abhangen dürfte. So alt diese Wahrheiten sind, sagt er, so scheint es doch, daß man sie nicht oft genug wiederholen könne. Sie gleichen einer herrlichen Arznei, welche aber so beschaffen ist, daß sie nur durch häufigen Gebrauch wirken kann. Alles kommt darauf an, daß man immer ein anderes Vehikel zu ersinnen wisse, damit sowohl Kranke als Gesunde (denn sie kann diesen als Präservativ, wie jenen als Arznei dienen) sie mit Vergnügen hinab schlingen mögen.
Was die hier und da der Erzählung eingemischten Unterbrechungen und Episoden, besonders die Anmerkungen des Sultans Gebal betrifft, so versichert zwar Hiang-Fu-Tsee, er hätte sie von guter Hand, und wäre völlig überzeugt, daß die letztern wirklich von besagtem Sultan herrührten: allein dies hindert nicht, daß der geneigte Leser nicht davon sollte glauben dürfen was ihm beliebt. Wenigstens scheinen sie dem Charakter Schach-Gebals ziemlich gemäß; und eben daher würde es unbillig sein, zu verlangen, daß sie so sinnreich und unterhaltend sein sollten, als die Reflexionen Schach-Bahams, des Weisen.
Erster Teil
1.
»Von Scheschian?« rief Schach-Gebal: »mir deucht, ich kenne diesen Namen. Ist es nicht das Scheschian, wo der Hiof-Teles-Tanzai König war, dessen verwünschten Schaumlöffel ihr Ihr neulich zu verschlingen geben wolltet, wenn ich mich nicht eben so stark dagegen gesträubt hätte, als der Großpriester Sogrenuzio?«
»Vermutlich, Sire«, sagte die schwarzaugige Tschirkassierin, welche schon vor einiger Zeit aufgehört hatte jung zu sein, aber aus dem Verfall ihrer Reizungen unter andern eine sehr angenehme Stimme davon gebracht hatte, und sich eine Angelegenheit daraus machte, den Sultan noch immer so gut zu amüsieren, als es die Umstände auf beiden Seiten zulassen wollten. »Ohne Zweifel, Sire«, sagte sie, »ist es eben dieses Scheschian; denn es nötigt uns nichts, deren zwei anzunehmen, da wir uns mit dem Einen ganz wohl behelfen können; welches, nach dem Berichte gewisser alter Erdbeschreiber, in den Zeiten seines höchsten Wohlstandes beinahe so groß gewesen sein muß als das Reich Ihrer Majestät,5 und ostwärts« –
»Die Geographie tut nichts zur Sache«, fiel Schach-Gebal ein, »in so fern du mir nur dafür gut sein willst, Nurmahal, daß da, wo deine Geschichte anfängt, die Zeit vorbei ist, da die Welt von Feen beherrscht wurde. Denn ich erkläre mich ein für allemal, daß ich nichts von verunglückten Hochzeitnächten, von alten Konkombern, von Maulwürfen, die in der geziertesten Sprache von der Welt – nichts sagen, und kurz, nichts von Liebeshändeln hören will, wie der witzigen Mustasche und ihres faden Kormorans, der so schöne Epigrammen macht und so schöne Räder schlägt. Mit Einem Worte, Nurmahal, und es ist mein völliger Ernst, keine Neadarnen und keinen Schaumlöffel!«
»Ihre Majestät können Sich darauf verlassen«, versetzte Nurmahal, »daß die Feen nichts in dieser Geschichte zu tun haben sollen; und was die Genien betrifft, so wissen Ihre Majestät, daß man gewöhnlich sechs bis sieben Könige hinter einander zählen kann, bis man auf einen stößt, der Anspruch an diesen Namen zu machen hat.«
»Auch keine Satiren, Madam, wenn ich bitten darf! Fangen Sie Ihre Historie ohne Umschweife an; und ihr« (sagte er zu einem jungen Mirza, der am Fuße seines Bettes zu sitzen die Ehre hatte) »gebt Acht wie oft ich gähne; sobald ich dreimal gegähnt habe, so macht das Buch zu, und gute Nacht.«
»Bei irgend einem Volke« (so fing die schöne Nurmahal zu lesen an) »die Geschichte seines ältesten Zustandes suchen, hieße von jemand verlangen, daß er sich dessen erinnere, was ihm im Mutterleibe oder im ersten Jahre seiner Kindheit begegnet ist.
Die Einwohner von Scheschian machen keine Ausnahme von dieser Regel. Sie füllen, wie alle andre Völker in der Welt, den Abgrund, der zwischen ihrem Ursprung und der Epoche ihrer Geschichtskunde liegt, mit Fabeln aus; und diese Fabeln sehen einander bei allen Völkern so ähnlich, als man es von Geschöpfen vermuten kann, die sich auf der ersten Staffel der Menschheit befinden. Derjenige unter ihnen, der zuerst die Entdeckung machte, daß eine Ananas besser schmecke als eine Gurke, war ein Gott in den Augen seiner Nachkommen.
Die alten Scheschianer glaubten, daß ein großer Affe sich die Mühe genommen habe, ihren Voreltern die ersten Kenntnisse von Bequemlichkeit, Künsten und geselliger Lebensart beizubringen.«
»Ein Affe?« rief der Sultan: »eure Scheschianer sind sehr demütig, den Affen diesen Vorzug über sich einzuräumen.«
»Diejenigen, bei denen dieser Glaube aufkam, dachten vermutlich nicht so weit«, erwiderte die schöne Nurmahal.
»Ohne Zweifel«, sagte der Sultan: »aber was ich wissen möchte, ist gerade, was für Leute das waren, bei denen ein solcher Glaube aufkommen konnte.«
»Sire, davon sagt die Chronik nichts. Aber wenn es einer Person meines Geschlechts erlaubt sein könnte, über einen so gelehrten Gegenstand eine Vermutung zu wagen, so würde ich sagen, daß mir nichts begreiflicher vorkommt. Kein Glaube ist jemals so ungereimt gewesen, zu welchem nicht etwas Wahres den Grund gelegt haben sollte. Konnte nicht ein Affe die ältesten Scheschianer etwas gelehrt haben, wenn es auch nur die Kunst auf einen Baum zu klettern und Nüsse aufzuknacken gewesen wäre? Denn so leicht uns diese Künste jetzt scheinen, so ist doch viel eher zu vermuten, daß die Menschen sie den Affen, als daß die Affen sie den Menschen abgelernt haben.«
»Die schöne Sultanin philosophiert sehr richtig«, sagte Doktor Danischmend, derjenige von den Philosophen des Hofes, den der Sultan am liebsten um sich leiden mochte, weil er in der Tat eine der gutherzigsten Seelen in der Welt war, und der daher die Gnade genoß, nebst dem vorerwähnten Mirza diesen Vorlesungen beizuwohnen. »Es ist nicht zu vermuten«, setzte er hinzu, »daß die ersten Menschen in Scheschian scharfsinniger gewesen sein sollten als Isanagi No Mikotto, einer von den japanischen Götterkönigen, von welchem ihre Geschichte versichert, daß er die Kunst, mit seiner Gemahlin Ysanami nach der Weise der Sterblichen zu verfahren, von dem Vogel Isiatadakki abgesehen habe.«6
Schach-Gebal schüttelte, man weiß nicht warum, den Kopf bei dieser Anmerkung; und Nurmahal, ohne den Einfall des Philosophen Danischmend eines Errötens zu würdigen, fuhr also fort.
»In dem ersten Zeitpunkte, wo die Geschichte von Scheschian zuverlässig zu werden anfängt, fand sich die Nation in eine Menge kleiner Staaten zerstückelt, die von eben so vielen kleinen Fürsten regiert wurden, so gut es gehen wollte. Alle Augenblicke fiel es zweien oder dreien von diesen Potentaten ein, den vierten mit einander auszurauben; wenn sie mit ihm fertig waren, zerfielen sie über der Teilung unter sich selbst; und dann pflegte der fünfte zu kommen, und sie auf einmal zu vergleichen, indem er bis zu Austrag der Sache den Gegenstand des Streits in Verwahrung nahm.
Diese Befehdungen dauerten, zu großem Nachteile der armen Scheschianer, so lange, bis etliche von den schwächsten den Vorschlag taten: daß sich die sämtlichen Rajas, um der allgemeinen Sicherheit willen, einem gemeinschaftlichen Oberhaupte unterwerfen sollten. Die mächtigsten ließen sich diesen Vorschlag belieben, weil jeder Hoffnung hatte, daß die Wahl auf ihn selbst fallen würde. Aber kaum war diese entschieden: so fand sich, daß man nicht das beste Mittel die Ruhe herzustellen gewählt hatte.
Der neue König war des Vorzugs würdig, den ihm die Nation beigelegt hatte. Die Achtung für seine persönlichen Verdienste unterstützte eine Zeit lang seine Bemühungen, und Scheschian genoß einen Augenblick von Glückseligkeit, den er dazu anwandte, Gesetze zu entwerfen, welche der große Kon-Fu-Tsee nicht besser hätte machen können; Gesetze, denen, um vollkommen zu sein, nichts abging, als daß sie nicht (wie man von den Bildsäulen eines gewissen alten Künstlers sagt) von selbst gingen, das ist, daß es von der Willkür der Untertanen abhing, sie zu halten oder nicht zu halten. Freilich waren auf die Übertretung derjenigen, von deren Beobachtung die Ruhe und der Wohlstand des Staats schlechterdings abhing, schwere Strafen gesetzt: aber der König hatte keine Gewalt sie zu vollziehen. Wenn einer von seinen Rajas zum Gehorsam gebracht werden sollte, so mußte er einem andern auftragen, den Raja dazu zu nötigen; und auf diese Weise blieben immer die gerechtesten Urteile unvollzogen. Denn keine Krähe hackt der andern die Augen aus, sagt der König Dagobert.«7
»Wer war dieser König Dagobert?« fragte der Sultan den Philosophen Danischmend.
Danischmend hatte bei allen seinen vermeintlichen oder wirklichen Vorzügen einen Fehler, der, so wenig er an sich selbst zu bedeuten hat, in gewissen Umständen genug ist, den besten Kopf zu Schanden zu machen. Niemals konnte er eine Antwort auf eine Frage finden, auf die er sich nicht versehen hatte. Dieser Fehler hätte ihm vielleicht noch übersehen werden können; aber er vergrößerte ihn insgemein durch einen andern, der in der Tat einem Manne von seinem Geiste nicht zu verzeihen war. Fragte ihn, zum Exempel, der Sultan etwas, das ihm unbekannt war; so stutzte er, entfärbte sich, öffnete den Mund und staunte, als ob er sich darauf besänne: man hoffte von Augenblick zu Augenblick, daß er losdrücken würde; und man konnt es ihm daher um so viel weniger vergeben, wenn er endlich die Erwartung, worin man so lange geschwebt hatte, mit einem armseligen das weiß ich nicht betrog; weil er, wie man dachte, dies eben sowohl im ersten Augenblicke hätte sagen können. Dies war nun gerade der Fall, worin er sich itzt befand: kein Mensch in der Welt war ihm unbekannter als der König Dagobert.
»Ich hatte Unrecht, eine solche Frage an einen Philosophen zu tun«, sagte der Sultan etwas mißvergnügt: »laßt meinen Kanzler kommen.«
Der Kanzler war ein großer dicker Mann, welcher unter andern rühmlichen Eigenschaften gerade so viel Witz hatte, als er brauchte, um auf jede Frage eine Antwort bereit zu halten.
»Herr Kanzler, wer war der König Dagobert?« fragte der Sultan. »Sire«, antwortete der Kanzler ganz ernsthaft, indem er mit der rechten Hand seinen Wanst, und mit der linken seinen Knebelbart strich, »es war ein König, der vor Zeiten in einem gewissen Lande regierte, das man auf keiner indostanischen Landkarte findet; vermutlich weil es so klein war, daß man nicht sagen konnte, welches die Nord- und welches die Süd-Seite davon sei.«
»Sehr wohl, Herr Kanzler! Und was sagte der König Dagobert?« »Meistens nichts«, versetzte der Kanzler, »wenn es nicht im Schlafe geschah, welches ihm zuweilen in seinem Divan begegnete. Sein Kanzler, der, wegen seines kurzen Gesichts, nicht immer gewahr wurde, ob der König wachte oder schlummerte, nahm etlichemal das, was er im Schlafe gesagt hatte, für Befehle auf, und fertigte sie auf der Stelle aus; und, was das Sonderbarste ist, die Geschichtschreiber versichern, daß diese nämlichen Verordnungen unter allen, welche während seiner Regierung heraus gekommen, die klügsten gewesen seien.«
»Gute Nacht, Herr Kanzler«, sagte Schach-Gebal.
»Man muß gestehen«, dachte der Kanzler im Weggehen, »daß die Sultanen zuweilen wunderliche Fragen an die Leute tun.«