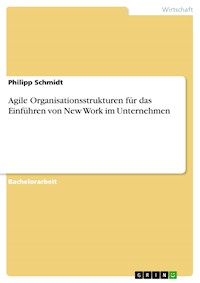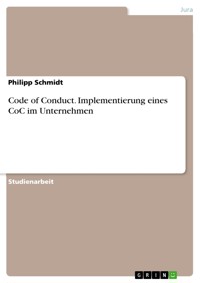Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Die etwas andere Drachengeschichte Elisabeth hat gerade Abitur gemacht, als sie eine Reise nach Südostasien gewinnt. Sie fliegt allein nach Bangkok, wo sie feststellt, dass etwas mit ihr nicht stimmt. Fafnir - ein uralter Drache in menschlicher Gestalt und Grenzwächter der Tore zwischen den Welten - erhält den Auftrag, die frisch Erwachte in Empfang zu nehmen. Kurz nachdem er Elisabeth gefunden hat, wird ein Anschlag auf sie verübt. Die beiden tun sich zusammen und kommen einer finsteren Verschwörung auf die Spur. Ein Roadtrip nimmt seinen Anfang, eine Reise durch eine Welt voller mystischer Geheimnisse und schrecklicher Gefahren.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 225
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Juri
Inhaltsverzeichnis
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Epilog
1. KAPITEL
Der gutgekleidete Mann saß vollkommen reglos, mit kerzengeradem Rücken auf seinem Stuhl und blickte durch die Lücke zweier Wolkenkratzer auf den Ozean. Er kam zuverlässig jeden Sonntag ins Sea View, eines der nobelsten und teuersten Restaurants von Manila, das die oberen zwei Stockwerke eines Hochhauses einnahm. Trotz des sanften Windes auf der Dachterrasse war es heiß, und die Kellnerin, die den Mann beobachtete, wischte sich mit dem Handrücken den Schweiß von der Stirn. Aber es war nicht nur die Hitze, welche Mary Ann schwitzen ließ. Der Mann machte sie nervös, und sie hatte noch nicht entschieden, ob es sich um die angenehme Aufgeregtheit von Verliebtheit und Bewunderung handelte – oder um Furcht. Den Mann mit den dichten schwarzen Koteletten und dem maßgeschneiderten Anzug umgab etwas Geheinmnisvolles, eine Aura der Unantastbarkeit.
Jetzt hatte Cherry, der schwule Bartender, den Longdrink fertig gerührt und stellte ihn aufs Tablett. Er zwinkerte Mary Ann verschwörerisch zu. Diese biss sich auf die Unterlippe, nahm das Tablett und ging auf den allein sitzenden Mann zu.
»Ihr Drink«, sagte Mary Ann kleinlaut und stellte das Gemisch aus Mangosaft und fünfzehn Jahre altem Tanduai-Rum auf die runde Tischplatte.
»Salamat«, dankte der Mann in der Landessprache.
»Sie kommen jeden Sonntag her«, stellte die junge Kellnerin hölzern fest.
Ein leises Lächeln umspielte die sinnlichen Lippen des Mannes. Er schaute nicht auf, dennoch hatte Mary Ann den Eindruck, dass er sie aus dem Augenwinkel musterte. Da ihr nichts einfiel, um die Konversation fortzuführen, wollte sie sich gerade abwenden, als der Mann sagte: »Ich lebe seit vielen Jahren auf den Philippinen, aber ich habe mich noch immer nicht an die kurze Dämmerung gewöhnt.«
Mary Ann wartete, ob er noch mehr sagen würde. Als er es nicht tat, erwiderte sie: »Das Sea View ist ein ausgezeichneter Platz, um sie zu genießen.« Sie leckte sich nervös über die Lippen, ehe sie fragte: »Woher kommen Sie?«
»Europa«, antwortete der Mann knapp.
Wieder wollte Mary Ann sich zurückziehen, als der Mann sagte: »Ich heiße Fernando.«
»Mary Ann«, brachte die Kellnerin mit pochendem Herzen hervor.
»Freut mich, Ihre Bekanntschaft zu machen, Mary Ann.« Endlich sah er auf. Ihre Blicke trafen sich, und Mary Ann zuckte innerlich zusammen. Täuschte sie das rote Licht der Abenddämmerung, oder lag tatsächlich ein gelbes Funkeln in den leicht verengten Augen des Mannes? »Geben Sie mir ein Zeichen, wenn Sie noch etwas wünschen«, sagte Mary Ann, deren Nackenhaare sich aufgestellt hatten.
»Mabuti«, sagte der Mann und sah wieder in Richtung der untergehenden Sonne, die den schmalen Ozeanausschnitt golden färbte.
Fernando, dessen wirklicher Name Fafnir lautete, nahm einen Schluck von seinem Longdrink. Er behielt das Gemisch einen Augenblick lang im Mund, schmeckte den reifen Rum und die Süße des Mangosaftes, bevor er schluckte. Er brauchte den Kopf nicht zu drehen, um die Sterbliche wahrzunehmen, die ihn mit zu Fäusten verkrampften Händen anstarrte. Sie hatte Angst bekommen. Zu recht. Und es war besser so.
Er steckte sich eine Zigarette an und zog den Rauch tief in die Lungen seines menschlichen Körpers. Neue Gäste kamen aus dem Fahrstuhl, und er hörte, wie Mary Ann ihnen Tische zuwies. Die Angehörigen der Oberschicht ließen im Sea View gerne ihren Arbeitstag ausklingen. Für Fafnir war es genau umgekehrt. Der Longdrink und die Zigarette stellten sein Frühstück dar. Eine Oase der Ruhe, ehe er seine Arbeit aufnahm.
Als immer mehr Gäste auf der Dachterrasse eintrafen und laut von Geschäftsabschlüssen prahlten, legte Fafnir einen 200 Peso-Schein neben den halbvollen Drink und erhob sich. Auf dem Weg zum Fahrstuhl nickte er der Kellnerin höflich zu.
Marry Ann schauderte, erwiderte den Gruß aber mit einem gezwungenen Lächeln. Was für ein sonderbarer Kerl, dachte sie. Vielleicht sollte sie die Schicht wechseln, um ihm nächste Woche nicht wieder zu begegnen. Andererseits ging von dem Mann eine schwer zu beschreibende Faszination aus. Sie schüttelte den Kopf und ging rasch zu dem Tisch, an dem ein dickleibiger Gast ungeduldig mit den Fingern schnippte, um ihre Aufmerksamkeit zu erregen.
***
Als Fafnir das Gebäude verließ, steckte er sich die Kopfhörer, die mit seinem Smartphone verbunden waren, auf. Ihm blieben noch etwa zwanzig Minuten, um sich ein wenig die Beine zu vertreten. Er zog seine Bentley-Sonnenbrille auf und machte sich ohne rechtes Ziel auf den Weg. Obwohl er sich für einen anpassungsfähigen Alten hielt, befand sich kaum ein Song in seiner Playlist, der jünger als dreißig Jahre war. Und er fühlte sich noch immer modern bei dem Klang der verzerrten Gitarrenriffs von Jimi Hendrix, die in voller Lautstärke in seinen Gehörgang schmetterten. Es kam ihm vor wie gestern, dass er, auf sein beharrliches Bitten hin, zwei Monde freibekommen hatte, um nach Woodstock zu reisen. Während er an bewaffneten Security-Männern vorbeiging, erinnerte er sich an die Energie der Hippie-Bewegung, die damals auch ihn erfasst hatte. Tatsächlich hatte er daran geglaubt, dass sich etwas ändern würde, dass die Menschen sich kollektiv umorientieren und die Welt mit anderen Augen betrachten würden. Aber dann, ohne einen äußeren Auslöser, war die Kraft verpufft. Die Kommunen lösten sich auf, und die Welt wurde wieder kälter. Es war nicht die erste kulturelle Enttäuschung, die Fafnir erlebt hatte, es war nur die letzte gewesen. Und er hatte noch immer Schwierigkeiten, das neue Nordamerika, wie es ihm täglich in den Nachrichten gegenübertrat, zu akzeptieren. Aber in Manila war sowieso alles anders. Hier, im Stadtteil Makati, waren die Straßen einigermaßen sauber und ähnelten sogar ein wenig Manhattan, aber im Rest der Stadt wehte ein anderer Wind. Fafnir zog den Ärmel seines Jacketts hoch und sah auf das Ziffernblatt seiner Junghans-Meister-Armbanduhr. Es war Zeit, er musste los. Er winkte einem Taxi zu, dessen Fahrer sogleich hart in die Bremsen stieg. Die hintere Tür klemmte, weshalb er vorne auf dem Beifahrersitz Platz nehmen musste.
»Guten Abend, Joe. Wohin?«, fragte der nach schlechter Zahnpflege stinkende Taxifahrer.
»Mein Name ist nicht Joe«, erwiderte Fafnir, schon jetzt von dem Mann genervt. Für engstirnige Filipinos hieß jeder Ausländer Joe, und Fafnir hatte ein Problem mit Rassisten gleich welcher Couleur.
»Häh?«
»Vergiss es«, schnaubte Fafnir. Er gab die Adresse an und sah demonstrativ aus dem Fenster.
Mit quietschenden Reifen setzte sich das Taxi in Bewegung. Der Fahrer fuhr viel zu schnell, aber er beherrschte sein Handwerk. Er flitzte durch Lücken und überholte kühn. War ihm ein Jeepney – ein bemalter Kleinbus – im Weg, hupte er drängelnd, bis Platz gemacht wurde. So sausten sie durch die vollen Straßen Richtung Nordosten. Sie überquerten den Pasig River, ein schmutziges Gewässer, in dem Müll trieb, und tauchten ein in die engen Straßen von Santa Mesa. Die meisten Gebäude in diesem Viertel waren nicht höher als drei Stockwerke. Bis auf die Reklameschilder der Geschäfte dominierte ein hässliches Grau, das im Licht von vereinzelten Straßenlaternen sepia wirkte. In den Ecken lümmelten Banden von Jugendlichen, die auf Gangster machten. Die meisten waren oben ohne, viele trugen ihre Shirts um den Hals gebunden. Kinder spielten mit etwas, das kein Ball war, Fußball. Alte und Kranke hockten oder lagen zwischen Müllbergen am Straßenrand. Der Taxifahrer ignorierte eine rote Ampel und schleuste sie hupend über eine Kreuzung. In diesem Viertel hielt man nicht an, vor allem nicht nach Einbruch der Dunkelheit.
Fafnir war an den Anblick von Armut und Elend gewöhnt, aber es gab durchaus Eindrücke, die ihn noch immer hart schlucken ließen. In einem Müllberg, vor dem eine verbitterte, alte Frau hockte, entdeckte er in Plastikfolie eingewickelte Bündel, aus denen Gliedmaßen ragten. Es waren Arme und Beine von Säuglingen. Er steckte sich eine Zigarette in den Mund und kurbelte das Fenster herunter.
»Ich auch eine, Freund?«, fragte der Fahrer mit aufdringlichem Grinsen.
Fafnir reichte ihm eine Zigarette. Ohne Zweifel besaß er selbst welche. Aber wozu eine eigene verschwenden, wenn er vom reichen Joe eine umsonst bekommen konnte?
Rauchend und bei pfeifender Aircon fuhren sie weiter durch den Slum. Sie hatten das Ziel fast erreicht, als Fafnir Schüsse und Schreie hörte. Sein Blick fiel auf eine Frau, die unter einem Vordach aus Tuch einen Säugling stillte, neben ihr spielte eine Bande Halbstarker Basketball. Der Fahrer hatte die alarmierenden Geräusche noch nicht wahrgenommen. Er schaltete gerade einen Gang herunter, um ein grellgrün bemaltes Tricycle zu überholen, als Fafnir sagte: »Bitte hier anhalten.«
»Ist nur noch kurzes Stück, Freund«, erwiderte der Fahrer.
»Ich weiß. Bitte anhalten. Ich gehe den Rest zu Fuß.«
Beleidigt hielt der Mann am Straßenrand. Er musste Fafnir für irre oder lebensmüde halten, da er freiwillig allein durch diese Gegend laufen wollte. Vermutlich wünschte er ihm, überfallen und ausgeraubt zu werden, vielleicht würde er sogar selbst einem Verwandten mitteilen, dass ein dämlicher Joe ein leichtes Opfer abgäbe. Obwohl Fafnir den Kerl nicht leiden konnte, bezahlte er ihm mehr, als das Taximeter anzeigte; das gebot schlicht die Höflichkeit. Jetzt hörte auch der Fahrer die heulenden Motoren und die Salven von Maschinenpistolen. Rasch stopfte er die Geldscheine in die Hosentasche und trat sogleich aufs Gaspedal, als der verrückte Joe ausgestiegen war.
Fafnir blickte sich um. Die Halbstarken ließen vom Basketball ab und bewaffneten sich mit Prügeln und Messern. Offensichtlich wollten sie ihr Revier verteidigen, aber es war doch äußerst kühn, sich mit Nahkampfwaffen Maschinenpistolen entgegenzustellen. Immerhin waren sie schlau genug, spärliche Deckung hinter parkenden Wagen und niedrigen Mauern zu suchen. Die Frau mit dem Baby war aufgestanden. Das Kleine heulte, und sie wiegte es im Arm. Wieso ging sie nicht ins Haus? Fafnir fluchte und lief auf sie zu. Er durfte sich nicht einmischen, und das würde er auch auf keinen Fall tun, aber er konnte sie warnen.
Jetzt bog die Vorhut der Todesschwadron um die Ecke. Drei Männer in schwarzem Kunstleder und mit schwarzen Helmen, die zur Vermummung dienten, lenkten ihre Motorräder genau auf Fafnir zu. Aus einem Berg aus Müll erhob sich ein alter Mann, um zu sehen, was solchen Lärm verursachte. Der rechte Motorradfahrer streckte seinen Arm aus und drückte den Abzug seiner Uzi. Die Kugeln durchlöcherten den Alten, und er stürzte tot in den Müll. Fafnirs Sinne waren geschärft, und deshalb sah er den Mörder hinter dem verspiegelten Visier breit und triumphierend grinsen. Fünf weitere Motorräder tauchten auf. Also waren sie insgesamt zu acht. Spielt keine Rolle, wie viele es sind, sagte sich Fafnir. Du wirst auf keinen Fall gegen sie vorgehen. Diese Killerkommandos agierten auf staatliches Geheiß. Sie hatten den Auftrag, die Straßen von Drogensüchtigen zu reinigen. Es war jedoch nicht die weltlichpolitische Legitimation, die Fafnir die Hände band, sondern die Gesetze der magischen Gemeinschaft. Gesetze, die er repräsentierte.
»Gehen Sie rein!«, rief er der Frau mit dem Säugling zu.
Der Frau rannen Tränen die Wangen hinab, doch sie schüttelte heftig den Kopf. Offenbar erwartete sie drinnen etwas, das ihr mehr Angst einjagte als das anrückende Killerkommando. Mit knirschenden Zähnen stellte Fafnir sich vor sie. Er bemerkte, dass sein Hände sich in den Hosentaschen zu Fäusten geballt hatten. Du wirst auf keinen Fall eingreifen, ermahnte er sich im Stillen. Denk an den Ärger vom letzten Mal. Andererseits – wenn er angegriffen würde, wäre es etwas ganz anderes. Notwehr.
Jetzt bemerkten ihn die Männer auf den Motorrädern. Einer legte auf ihn an, zögerte dann jedoch. Eine Langnase in schickem Anzug einfach so wegzupusten konnte Ärger bringen. Die Jugendlichen hielten ihre Köpfe unten, und die Frau mit dem plärrenden Säugling ließ sich in die Hocke nieder, als die Killerschwadron vor Fafnir anhielt.
»Was hast du hier zu suchen, Joe?«, knurrte der Vordere unter seinem Visier hervor.
»Mein Name ist nicht Joe«, seufzte Fafnir.
»Verpiss dich lieber!«, schnauzte einer aus der zweiten Reihe.
»Die nächste Girlybar ist da die Straße runter«, sagte der Erste. »Lass dir den Schwanz lutschen, und dann nimm ’n Taxi zurück nach Malate oder Ermita.« Sein behandschuhter Daumen deutete auf die nächste Querstraße.
»Pu’keng ina mo «, sagte einer weiter hinten, der offenbar wollte, dass die Jagd weiterging, und demonstrativ den Schlitten seiner MP nach vorne schnappen ließ. Sein Ausspruch bedeutete so viel wie: Die Muschi deiner Mutter.
Nun hätte es Fafnir gut sein lassen können. Er hätte den Blick senken und sich aus dem Staub machen sollen. Aber manchmal schlug seine alte Natur durch, und dann fiel es ihm schwer, sich zu zügeln. Außerdem würde die Motorradgang zweifelsohne die ganze Gegend mit Kugeln spicken, sobald er außer Schusslinie wäre, und die Frau kauerte noch immer mit ihrem Säugling im Arm auf der Veranda.
»Wenn ich auf Nutten aus wäre«, sagte er mit kalter Stimme auf Tagalog, »könnte ich ja gleich hier bei euch bleiben. Mit eurem ganzen Lack und Leder würdet ihr euch sicher gut an einer Go-go-Stange machen.«
Verunsichert blickte der vordere behelmte Mann über die Schulter zu seinen Kameraden. Zwei von ihnen zischten ihm zu, er solle den Dreckskerl kaltmachen, ganz gleich, ob er nun ein Ausländer war. Sie selbst schritten allerdings nicht zur Tat. Es war ein feiger Haufen.
Als sich der Mann wieder Fafnir zuwandte, zog dieser mit betonter Ruhe die Sonnenbrille ab und klemmte ihren Bügel in die Brusttasche seines Jacketts.
»Der Wichser hat uns beleidigt«, »mach ihn fertig«, feuerten die hinteren Männer den Redeführer an. Dieser zog seine Maschinenpistole aus dem Hüfthalfter und hielt sie Fafnir unter die Nase. »Letzte Chance, du …«, setzte er zischend an. Weiter kam er nicht, da Fafnir ihm blitzschnell die Waffe aus der Hand riss, um sie mit einem knackenden Geräusch zwischen den Fingern zu zerquetschen.
»Ganz genau«, knurrte Fafnir, »letzte Chance.« Er fletschte die Zähne, und nun bekam es der Anführer der Killer mit der Angst zu tun. Er zog die zitternde Hand zurück und legte sie um den Gashebel seiner Maschine. Er wollte davonbrausen, doch im selben Moment stieß einer der hinteren Männer einen Fluch aus, richtete seine Waffe auf den Fremden und zog den Abzug.
Fafnir hatte den Angriff kommen sehen. Er packte den Anführer und hielt ihn im letzten Augenblick als lebendiges Schutzschild vor sich. Ein Knattern, und der Körper des Mannes zuckte, als sich Kugeln in seinen Rücken bohrten.
Das war nicht seine Schuld, sagte sich Fafnir. Sie hatten den Kampf begonnen. Eine Kugel traf den Hals des Mannes, Blut spritzte Fafnir ins Gesicht. Das war nicht gut. Der alte Zorn und die alte Kampfeslust stiegen in ihm auf. Er würde sie nur ein wenig aufreiben, keine Toten mehr, ermahnte er sich, und dann legte er los. Als wöge die Leiche des durchlöcherten Anführers nicht mehr als eine Feder, schleuderte Fafnir sie den anderen entgegen. Durch den unvorhergesehenen Aufprall verloren einige das Gleichgewicht, Motorräder kippten auf den Asphalt. Fafnir machte sich das Durcheinander zunutze. Rasch war er bei einem Typen, der auf ihn anlegen wollte. Er verpasste ihm einen Kopfstoß, der den Helm und den Schädelknochen darunter zum Bersten brachte. Hoppla, dachte Fafnir, das war vielleicht eine Spur zu heftig. Außerdem musste er darauf achten, sich nicht zu schnell zu bewegen. Immerhin gab es Zuschauer. Mit so vielen Einschränkungen machte der Kampf kaum Spaß. Ein weiter Mann in schwarzer Kampfkluft legte auf ihn an. Fafnir packte ihn am Unterarm, verdrehte denselben und brach ihn mit seinem Ellbogen. Ein Stoß vor die Brust, und der Mann knallte gegen einen Kameraden. Oh, wie gerne hätte er richtig gekämpft, die Bestie herausgelassen, aber das kam nicht in Frage. Mit präzisen Schlägen und Tritten setzte er einen Gegner nach dem anderen außer Gefecht. Das brachte ihn nicht einmal ins Schwitzen, und seine Hauptsorge galt der Unversehrtheit seines Anzugs. Als alle am Boden lagen, tastete der letzte, der noch bei Bewusstsein war, nach einer Pistole im Gürtel. Fafnir versetzte ihm einen Klaps auf den Hinterkopf, sodass seine Stirn gegen den Tank eines Motorrads knallte.
Eine plötzliche Stille legte sich bleischwer über den Platz, bis die Halbstarken aus ihrer Deckung hervorkamen.
»Ey Alter, das war echt krass!«, sagte einer beeindruckt.
»Reife Leistung, Joe!«, rief ein anderer.
Fafnir ließ seinen Nacken knacken und setzte an: »Meine Name ist nicht … Ach, was soll’s.« Er steckte sich eine Zigarette in den Mund, warf der Frau mit dem Baby einen letzten Blick zu, wandte sich ab und ging die Straße hinunter.
Die Halbstarken folgten ihm noch ein kleines Stück, dann drehten sie um. Fafnir zwang sich, kurz über die Konsequenzen nachzudenken. Eine polizeiliche Ermittlung würde es nicht geben. Die Killerschwadronen waren halboffiziell. Wenn sie in Schwierigkeiten gerieten, war das ihr Problem. In weniger als einer halben Stunde waren sowieso keine Beweisstücke mehr übrig. Die Motorräder und die Waffen würden auf dem Schwarzmarkt verkauft werden, und morgen würden die Halbstarken Kunstlederwesten tragen und behaupten, dass sie schon immer ihnen gehört hatten. Die Leichen würden sie mit Hilfe des Viertels im Fluss verschwinden lassen.
Es war alles easy, er musste sich um nichts kümmern. Es sei denn, der Rat bekam Wind von der Sache, dann steckte Fafnir in Schwierigkeiten. Vor einer dunklen Seitengasse hielt er kurz inne. Er zog sein Jackett aus, legte es sich sorgsam über den Arm und knöpfte sich das weiße Hemd, das verräterische Blutspritzer abbekommen hatte, auf. Mit einem Ruck riss er es sich vom Leib. Zusammengeknäult hielt er es in der Hand, konzentrierte sich kurz – und der Stoff ging in Flammen auf. Das war eine Vorsichtsmaßnahme, die vielleicht etwas paranoid war, aber er hatte sich angewöhnt, niemals sein eigenes Blut zurückzulassen. Es gab Hexen, und es gab Wesen, die mit dem Blut großen Schaden anrichten konnten. Er ließ den brennenden Klumpen zu Boden fallen, stöpselte die Ohrstecker ein und ging weiter. Der gute alte Jimmi sang: Well, I pick up all the pieces and make an island / Might even raise just a little sand / ’cause I‘m a voodoo child / Lord knows I’m a voodoo child.
Fafnir summte mit und hatte den Vorfall von eben bereits so gut wie vergessen.
***
Elisabeth Pfeiffer hockte angespannt auf dem durchgesessenen Sofa und gab sich Mühe, Ruhe zu bewahren, obwohl ihre Sicht hinter den Brillengläsern verschwamm und das leichte Kribbeln im Bauch sich beinahe zu einem Krampf entwickelt hatte. Angst wäre jetzt ganz schlecht, das wusste sie von Charlotte, die neben ihr im Yogasitz einen guten halben Meter über dem Sofa schwebte und dümmlich grinste. Natürlich schwebte sie nicht wirklich, das war Elisabeth bewusst. Es lag an den mexikanischen Pilzen, die Moritz besorgt hatte. Moritz saß ihnen gegenüber auf dem Boden, flankiert von Georg und Sascha. – Sascha. Er war der eigentliche Grund, weshalb Elisabeth sich hatte breitschlagen lassen mitzumachen. Er sah wie immer tierisch gut aus, während er an einem Joint zog, den rechten Arm locker auf dem angewinkelten Knie abgestützt.
»Abgefahren!«, stieß Georg aus. »Der Teppich … er atmet.«
»Jo, die Wirkung setzt jetzt ein«, sagte Moritz fachmännisch. »Wurde auch Zeit.« Er gackerte. »Fühlt ihr euch auch so … lila?«
»Grün«, sagte die schwebende Charlotte, »alles ist grün.«
Jetzt bemerkte auch Elisabeth, was Georg mit dem atmenden Teppich gemeint hatte. Das rot-braune Muster verschwamm, ordnete sich in einem fort neu, und unmittelbar vor den Jungs blähte sich der ganze Teppich. Er blähte sich und sank wieder hinab, hoch, runter. Elisabeth wurde schlecht, und sie befürchtete, sich übergeben zu müssen. Doch schon war die Übelkeit verflogen, und nun spürte sie die wahre Kraft der Droge. Mit einem Mal fühlte sie sich leicht, unbeschwert und frei. Unwillkürlich lächelte sie.
Zeitsprünge. Die Erfahrungen des weiteren Trips konnte Elisabeth erst nachträglich in eine mehr oder minder sinnvolle Reihenfolge bringen. Im direkten Erleben verschmolz alles zu einem wabernden Kontinuum von Szenen; Vorher und Nachher löste sich auf. Da war eine magische Berührung zwischen ihr und Charlotte. Sie legten die Handflächen aneinander und spürten, wie die Lebensenergie von der einen zur anderen floss. Da war sie, Elisabeth, draußen allein im Garten, den Mond betrachtend. Der volle, runde Mond war riesig und sprach zu ihr in einer fremden Sprache. Und da war sie, wie sie eine Tür öffnete. Auf dem Bett von Moritz’ Eltern lagen Charlotte und Sascha. Sie küssten und streichelten sich. Und plötzlich lag auch sie auf einem Bett. Georg presste seinen schweren Körper auf ihren. Seine Zunge in ihrem Mund fühlte sich nass und eklig an. Sie wollte sich wehren, aber ihre Glieder gehorchten ihr nur widerwillig, und sie war zu schwach. Sie spürte Georgs steifes Glied durch seine und ihre Jeans. Jetzt fingerte er an dem Reißverschluss herum. »Nein … lass das«, japste sie, doch Georg hörte sie entweder nicht, oder er ignorierte ihre Worte.
Ihr wurde schummrig und plötzlich verformte sich Georgs Gesicht. Sein ganzer Kopf wurde zu einem einzigen großen Auge. Dem Auge fehlte die Iris, es bestand lediglich aus trübem Weiß und einer schwarz glänzenden Pupille. Auch der Körper auf ihr fühlte sich anders an, als würde sich eine Schlange oder ein Wurm auf ihr winden. Eine tiefe, unheimliche Stimme sagte etwas, das klang wie: FAILTE HEKATE.
Dann war das Auge verschwunden, und Georgs Gesicht war wieder dicht über ihrem. Speichel troff ihm aus dem Mundwinkel, und er keuchte erregt, als er seinen Unterleib rhythmisch gegen ihren presste.
»Ich sagte … aufhören!«, zischte Elisabeth. Auf einmal fühlte sie sich nicht mehr schwach und ausgeliefert, im Gegenteil, sie fühlte sich unglaublich stark. Sie bekam ihre Hände frei und schob sie unter Georgs Brust, dann spannte sie ihre Brust- und Oberarmmuskeln an und drückte. Die Wirkung war erstaunlich. Georg flog förmlich steil nach oben, bis er mit einem dumpfen Aufschlag gegen die Decke prallte. Elisabeth rollte sich rasch weg, und Georg stürzte neben ihr auf das Bett nieder.
»Was … was?«, stammelte er verdutzt. Er fasste sich an den Hinterkopf, und als er sich die Hand vor die Augen hielt, starrten sie beide darauf. Rotes Blut klebte daran.
Von den Ereignissen verwirrt und noch immer unter dem Einfluss des Psilocybin, brauchte Elisabeth eine Weile, um Moritz zu finden. Sie sagte ihm, Georg habe sich den Kopf gestoßen. Es gab weitere Drogensequenzen, aber irgendwann war die heulende Sirene des Notarztes zu hören, und alle bis auf Moritz ergriffen die Flucht.
Elisabeth konnte sich nicht mehr an den Heimweg erinnern, nur an die Schelte ihres Stiefvaters. Sie saß mit gesenktem Kopf in der Küche und ließ die Strafpredigt über sich ergehen. Ob sie auch mal an andere denke? Was ihre Mutter alles mit ihr auszustehen habe! Eine saftige Ohrfeige rundete das einseitige Gespräch ab, und Elisabeth schleppte sich ins Bett.
Am nächsten Mittag traf sie sich mit Charlotte in einem Café und erzählte ihr von ihren Eindrücken, wobei sie das unheimliche Auge ausließ.
»So ein Schwein!«, rief Charlotte aus, als Elisabeth von der versuchten Vergewaltigung berichtet hatte. »Immerhin hast du ihm eine Abreibung verpasst, die er so schnell nicht vergessen wird.« Sie lächelte schadenfroh. »Ich habe vorhin mit Moritz telefoniert. Der Arsch liegt mit einer Gehirnerschütterung im Krankenhaus.«
»Aber wie habe ich das eigentlich gemacht?«, fragte Elisabeth. »Ich meine, Georg wiegt sicher achtzig Kilo.«
»Na ja, wir waren ja voll auf Pilzen«, erwiderte Charlotte grinsend. »Auch wenn du dich so daran erinnerst, kann es in Wirklichkeit natürlich ganz anders abgelaufen sein. Vielleicht hast du ihm eine Lampe oder so an den Kopf geknallt.«
Elisabeth nickte nachdenklich. Sie nahm einen kleinen Schluck von ihrem Cappuccino und fragte leise: »Wie war’s mit Sascha?«
Charlotte seufzte. »Hey Lizzy, es tut mir echt leid. Das war nicht geplant. Ich weiß auch nicht. Es hat sich irgendwie entwickelt. Die Pilze, das Gras, all das, und plötzlich lagen wir irgendwie in diesem Bett. Mann, das war voll scheiße von mir.«
»Schon gut«, sagte Elisabeth geknickt, »ich habe ja keinen Besitzanspruch auf ihn oder so.«
Charlotte strich sich eine Haarsträhne aus der Stirn und biss sich auf die Unterlippe. »Ich bin deine Freundin, und ich wusste, dass du auf ihn stehst. Ich hab’s echt versaut.«
Genaugenommen war Charlotte Elisabeths einzige Freundin, und sie wollte sie nicht verlieren, aber sie musste dennoch nachhaken: »Wird das jetzt was Ernstes zwischen euch?«
Den Blick in ihren Latte Macchiato versenkt, antwortete Charlotte kleinlaut: »Ich bin mir nicht sicher. Könnte schon sein. Bitte sei mir nicht böse.«
Elisabeth rückte ihre Brille zurecht. Sie war ihr nicht böse, nur maßlos enttäuscht. »Ach, scheiß drauf«, schnaubte sie. »Ist eh alles egal. Morgen sitze ich im Flieger.«
Charlotte blickte vorsichtig auf. »Du willst das echt durchziehen?«
Bis gerade eben war Elisabeth sich unsicher gewesen, ob sie die gewonnene Reise wirklich antreten würde, aber jetzt konnte sie mit dem Brustton der Überzeugung sagen: »Auf jeden Fall.«
»Und deine Eltern?«
»Ich habe Mom noch nichts davon erzählt, und Jonas, der Riesenarsch, ist eh froh, wenn ich ’ne Weile weg bin und keinen Ärger mache. Jedenfalls keinen, den er mitbekommt.« Sie lachte gespielt.
»Finde ich echt mutig von dir«, sagte Charlotte mit ehrlicher Bewunderung.
Die beiden Freundinnen wechselten zu angenehmeren Themen. Sie sprachen über Netflix-Serien und die heißen Kerle, die bestimmt an den tropischen Stränden von Thailand auf Elisabeth warteten. Elisabeth versprach, eine Karte zu schicken, und zur Verabschiedung umarmten sie sich. Charlotte drückte Elisabeth fest an sich, während diese sich unwillkürlich versteifte.
Die Reisevorbereitungen verliefen hastig. Elisabeth hatte Europa noch nie verlassen, und sie musste ihren Rucksack heimlich packen. Als ihre Mutter und ihr Stiefvater ausgingen, schrieb sie einen Abschiedsbrief und steckte ihn unter das Kopfkissen ihrer Mutter. Hauptsächlich stand darin, dass man sich keine Sorgen um sie machen müsse und dass sie sich über Skype melden werde.
Elisabeth war von sich selbst überrascht, als sie ihr Gepäck aufgegeben hatte und in der Boarding Area saß, als eine Stimme über Lautsprecher verkündete, dass die Passagiere von Flug 402 nach Dubai nun einsteigen konnten. Noch konnte sie es sich anders überlegen. Aber nein. Wenn sie eines von ihrem verfluchten Stiefvater gelernt hatte, dann, dass man einem geschenkten Gaul nicht ins Maul schaut. Sechs Wochen Thailand, sechs Wochen keine Sorgen. In dem Brief des Reiseveranstalters lag neben ihrer Gewinnbenachrichtigung ein Prospekt, der malerische Bilder zeigte und eine sorgenfreie Zeit unter tropischen Palmen versprach. Ausnahmsweise hatte sie einfach einmal Glück gehabt, und das würde sie sich von niemandem nehmen lassen, erst recht nicht von kindischen Ängsten. Sie stand auf und reihte sich in die Schlange ein. Als sie an die Reihe kam, zeigte sie ihren Reisepass und ihr Ticket.
Die Flugbegleiterin riss ein Stück des Tickets ab, lächelte Elisabeth freundlich an und sagte: »Einen angenehmen Flug, Frau Pfeiffer.«