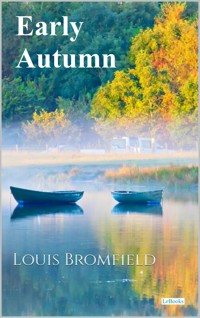9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der alte Maharadscha in der indischen Provinz Ranchipur weiß, dass auf seine Untertanen Hunger und Tod warten, wenn der Regen ausbleibt. So erträgt er die langen Wochen des Wartens in brennender Hitze, solange er sein Volk nicht sicher weiß vor der Katastrophe. Auch Tom Ransome, der verwöhnte Intellektuelle aus der westlichen Welt, wartet auf das Naturereignis, um es zu malen. Den indischen Arzt Dr. Safka lässt seine Berufs- und Menschenpflicht ausharren. Was aber treibt Lady Heston aus England nach Ranchipur? Dann kommt taifunartig der Regen. Die Macht des Monsuns bringt nicht nur ein Gesellschaftssystem ins Wanken, sie bietet auch eine Chance für die Liebe – über sämtliche Klassenschranken hinweg.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1084
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Über dieses Buch
Der alte Maharadscha weiß, dass auf seine Untertanen Hunger und Tod warten, wenn der Regen ausbleibt. Als der Monsun endlich über das Land hereinbricht, bringt er nicht nur ein Gesellschaftssystem ins Wanken, sondern bietet auch eine Chance für die Liebe – über sämtliche Klassenschranken hinweg.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Louis Bromfield (1896–1956) ließ sich nach dem Ersten Weltkrieg in New York nieder, wo er mit dem Schreiben begann. Sein bekanntester Roman Der große Regen wurde zweimal verfilmt.
Zur Webseite von Louis Bromfield.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Louis Bromfield
Der große Regen
Roman
Aus dem Englischen von Rudolf Frank
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 1937 unter dem Titel The Rains Came bei Harpercollins, New York.
Die deutsche Erstausgabe erschien 1946 im Alfred Scherz Verlag, Bern.
Originaltitel: The Rains Came (1937)
© by Bromfield Sisters Trust 1937
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Martina Heuer
ISBN 978-3-293-30495-6
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 28.05.2024, 04:41h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
DER GROSSE REGEN
Erster Teil1 – Dies war Ransome die liebste Stunde des Tages …2 – In der Entbindungsanstalt des Hospitals lief Miss MacDaid …3 – Miss MacDaid hatte darum so spät, vielleicht zu …4 – Obwohl sie sich entsetzlich anstellte, bekam die Bunyafrau …5 – Sie erwartete den Major in dem kleinen …6 – Der erste Gewittersturm, der die Dürre in Ranchipur …7 – In der Frühe, als Johannes der Täufer seinem …8 – Die American Mission bestand aus zwei kasernenartigen Gebäuden …9 – An jenem Samstag, als Ransome zum Mittagessen zu …10 – Während er unter Tante Phoebes hängenden Orchideen und …11 – An Samstagen hatte bei Smiley der Koch Ausgang …12 – Für Raschid hatte Mrs Smiley stets etwas Unerklärliches …13 – Bei Tisch saßen alle so, dass jeder den …14 – Im Haus gegenüber erhob sich Mrs Simon abgespannt …15 – Von einem gewissen Zeitpunkt an zeigten auf allen …16 – Auf seinem Heimweg geriet Jobnekar in den Platzregen …17 – Schweigend, im Gänsemarsch, haben die Lehrerinnen den Platz …18 – Als dann der Krieg zu Ende war …19 – Als Siebzehnjährige hatte Großmutter Grand River verlassen …20 – Großmutter MacPherson blieb in Ransomes Erinnerung immer lebendig …21 – Auf dem Heimweg hielt er beim Konservatorium …22 – Es war das letzte höfische Dinner bis zum …23 – Der Palast, ein Riesenbau, lag in einem weit …24 – Jeder der Ankommenden schritt die breite weiße Marmortreppe …25 – Der »kleine« Weiße Speisesaal, in den man die …26 – Im Blauen Saal war alles für die Unterhaltung …27 – Sie gingen durch die verlassenen Räume zu der …28 – Zur gleichen Zeit feilschte oben in einem der …29 – Bei seinem zweiten Unternehmen ist der Erfolg nicht …30 – Die Gäste waren gegangen. Die Maharani entließ Adjutanten …31 – In der Vorhalle wartete der Hofkrankenpfleger Mr Bauer …32 – Unten in der hohen Halle fand Raschid seine …33 – Der Maharadscha war allein. Aber er schlief nicht …34 – Die Russin, die Raschids Frau durch die Parterre-Räume …35 – Schwindlig, fast ohnmächtig, taumelte die Lischinskaja die Treppen …36 – Zornig, empört, in schlechtester Laune hatte Harry Bauer …37 – Ransome fuhr vom Palast auf gewundenen Parkwegen langsam …38 – Beim Alten Sommerpalast entstiegen Lord und Lady Heston …39 – Während Ransome von der Veranda in sein Schlafzimmer …40 – Das Wasser strömte in den Straßengräben, überflutete an …41 – Als er durchnässt und bedrückt den Wagen unter …42 – Derweil stand Fern bei Smileys blöde herum …43 – Als Bertha Smiley wieder in ihr Schlafzimmer kam …44 – Schnell wie durch Zauberei hatten die Regenfälle Ranchipurs …45 – Der Läufer aus dem Sommerpalast überbrachte Edwinas Brief …46 – Nachdem sie sich angezogen hatte und alle …47 – Miss Dirks verspätete sich, nicht weil sie nicht …48 – Als Elizabeth Hodge über den Platz beim Kino …49 – Lady Heston hatte den Lunch im Bett eingenommen …50 – Trotz dem Regen nahm Miss Hodge nicht den …51 – Von dem Moment an, da die Zofe den …52 – Als Fern kurz nach Tagesanbruch von Smileys Haus …53 – Fern saß auf dem Bettrand und entwarf Pläne …54 – Mrs Simon hatte Hogget-Clapton nie Lily genannt …55 – Während sich Ransome zum Dinner umkleidete, nahm er …56 – Fünf Minuten nachdem er weg war, traf Mrs …Zweiter Teil1 – Das Haus Bannerji war in jeder Beziehung außergewöhnlich …2 – Ransome ging öfter zu Bannerjis, doch nicht nur …3 – Will denn das Dinner kein Ende nehmen?‹ …4 – In dem hart am Rand der Sicherungsschleusen befindlichen …5 – Zur Stunde, da das Unheil hereinbrach, spielte die …6 – Als die erste Flutwelle vorbei war, zog Sarah …7 – In der Abendschule hinter dem Basar versammelten Smileys …8 – Das Gefühl, das Mrs Simon beim Verlassen des …9 – Der alte Wagen schnaufte, immer an der Grenze …10 – Noch lange, nachdem Loder gegangen, saßen die zwei …11 – Die festen antiken Wände des Sommerpalastes krachten beim …12 – Das Viertel der Unberührbaren hatte am meisten zu …13 – Seit dem Tag, an dem vor dreiundzwanzig Jahren …Dritter Teil1 – Auf der brüchigen Galerie, die im ersten Stock …2 – Lange betrachteten sie die Verwüstung, in Bann geschlagen …3 – Den ganzen Tag ließ das Ehepaar Bannerji sich …4 – Als Fern im Zorn die Wohnung Ransomes verließ …5 – Aber das Ehepaar Smiley war nicht zu Hause …6 – Auf der Veranda der verlassenen Villa mit Mrs …7 – Den ganzen Weg vom Banyanbaum bis zum Hause …8 – Den zurückkehrenden Tom empfing Edwina mit der Bemerkung …9 – Der Rest des Tages verging mit Fahrten zwischen …10 – Wieder in Sicht des Hauses Bannerji, sah er …11 – Er glitt an seinem Haus und dem Raschids …12 – Das Haus war still, stiller noch als die …13 – In der Mission ging Tante Phoebe ans Werk …14 – Im Badezimmer beim Chattee lernten Tante Phoebe und …15 – Lady Heston und Mrs Simon hielten, mit Tante …16 – Mrs Simon sprach die Wahrheit. Erdbeben, Fluten und …17 – Als das erste Frühlicht über der zerfallenen Stadt …18 – Als sie den Raum verließen und hinaus auf …19 – Etwa drei Meilen dauerte Ransomes und Raschids Elefantenritt …20 – Blumen, Büsche, Ranken und Bäume des Schlossparks feierten …21 – Während sich alles entfernte, gab die Maharani Ransome …22 – Das Ransome zugewiesene Büro war ehemals Wohnung des …23 – Hinter der Eisenbahnbrücke verließen Bates die Kräfte …24 – Homer Smiley und seine Pariaknaben fanden die Leichen …25 – Homer Smiley geleitete Fern Simon und Edwina Heston …26 – Als sich das Chaos lichtete und sie …27 – Im Großen Tor arbeiteten derweil Ransome und der …28 – Sie wollten auf dem Weg zum Hospital nur …29 – Nachdem Safka und Miss MacDaid Bannerjis Haus verlassen …30 – Es war eine schwere Entbindung, und da war …31 – Aus einem Fenster des ersten Stockwerks sah Major …32 – Tom Ransome und Homer Smiley besuchten inzwischen das …33 – Im Bereich des Basars kam ihnen Elizabeth Hodge …34 – Das Flugzeug, das sich am folgenden Morgen näherte …35 – Die alte Herrin war wieder in ihrem Zelt …36 – Sie war verstimmt und enttäuscht, dass sie Ransomes …37 – In seinem kleinen Extrazimmer neben der Vorhalle im …38 – Edwina war in ihrer Kammer. Dort fand sie …39 – Bates’ Abreise und der Abflug des Flugzeugs waren …40 – Die Bunyas waren nicht die Einzigen, die in …41 – Es schien aussichtslos, das Flugzeug im Schlamm des …42 – Ransome schlief wie ein Toter. Erst nach zwei …43 – Dann musste Edwina Elizabeth Hodge überreden, sich auszuziehen …44 – Als Ransome, vom Schlaf erwacht, Edwinas und Elizabeths …45 – Drüben beim Rama-Tempel entzündete man den Scheiterhaufen …46 – Als Ransome das Hospital verlassen hatte, begaben sich …47 – Miss MacDaid war glücklich; nicht triumphierend wie bei …48 – Derweil saß die Maharani mit untergeschlagenen Beinen auf …49 – Sie brauchte Maria nicht wegzuschicken. Maria ging freiwillig …Vierter Teil1 – Nicht nur das eine erwartete Flugzeug, sondern gleich …2 – Unterwegs musste Ransome den Schweizer unterfassen, ein Sturz …3 – Am Rande des Großen Beckens, während er Harry …4 – Um fünf starb Harry Bauer. Während des ganzen …5 – Gegen Mittag sandte Major Safka Tante Phoebe die …6 – Das Ochsengespann der Maharani hatte eine halbe Stunde …7 – Die Maharani schien über Mrs Phoebe Bascombs Verspätung …8 – Als die neuen Krankenschwestern eintrafen, ergab sich für …9 – Es war schlimmer, als Ransome für möglich gehalten …10 – Die kurzen Augenblicke, die Safka für sich hatte …11 – Um drei Uhr früh weckte Dr. Pindar die …12 – Als sich die Oberschwester leicht an der Schulter …13 – Drei Flugzeuge tauchten am Vormittag hinter dem Abana …14 – Denn als er auf seinem Fahrrad die glatte …15 – Da die Straßen hinter dem Großen Becken infolge …16 – Am Morgen wackelte der erste Zug vorsichtig langsam …17 – Bepackt mit Lebensmitteln und Medikamenten, die ihm Motis …18 – Daheim angelangt, wartete Homer mit seinen Neuigkeiten …19 – Am übernächsten Tag gab es für Fern und …20 – Kissen im Rücken, die Metallkassette, die Bates überbracht …21 – Tante Phoebe ging zum Schrank und brachte Ransome …22 – Als Dr. Safka eintrat, schlug Edwina die Augen …23 – Die Maharani stieg nicht ab. Sie sei …24 – Vor dem Gartentor seines Hauses sagte Tom: »Ich …25 – Die Woche ging zu Ende. Die anormale Menge …26 – Am Ende der Woche gaben Smileys und Tante …27 – Die Sonne sank, und Ransome saß auf der …Mehr über dieses Buch
Über Louis Bromfield
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Zum Thema Indien
Zum Thema Schmöker
Zum Thema Asien
Für alle meine indischen Freunde,
die Fürsten, die Lehrer,
die Politiker, die Jäger, die Bootsleute, die Parias,
und für G. H.,
ohne die ich niemals die Wunder und Schönheiten
Indiens kennengelernt,
noch auch den Traum Indiens
verstanden hätte.
Zwei Männer saßen in einer Bar. Der eine fragte den andern:
»Sind Ihnen die Amerikaner sympathisch?«
»Nein«, antwortete der zweite Mann mit Nachdruck.
»Sind Ihnen die Franzosen sympathisch?«, wollte der erste weiter wissen.
»Nein«, entgegnete der andere mit gleicher Entschiedenheit.
»Die Engländer?«
»Nein.«
»Die Russen?«
»Nein.«
»Die Deutschen?«
»Nein.«
Eine Pause trat ein, der erste Mann hob sein Glas an den Mund und fragte schließlich:
»Wer ist Ihnen denn sympathisch?«
»Meine Freunde«, kam ohne Zögern die Antwort.
Diese Anekdote verdankt der Autor
seinem Freunde Erich Maria Remarque
Erster Teil
1
Dies war Ransome die liebste Stunde des Tages. Brandy trinkend saß er um Sonnenuntergang auf seiner Veranda. Einen Augenblick war das grau-gelbe, von scharlachfarbenen Schlingpflanzen umwucherte Haus, waren die Banyanbäume ringsum von der Zauberfülle goldenen Lichts überflutet. Dann versank die Sonne in jähem Sturz hinter dem Horizont, und das weite Land lag in Finsternis. Es war ein magischer Anblick, doch ewig fremd seiner nordischen Seele, welcher die langen, blauen, gedämpften Dämmerungen Nordenglands vertraut und verwandt waren.
In dieser Stunde war ihm, als stehe die Welt mit einem Mal still, eine Sekunde ganz still, und stürze dann in den Abgrund der ewigen Dunkelheit. Ein Anflug archaischer Ängste überkam Ransome bei diesen indischen Sonnenuntergängen.
Doch hier in Ranchipur gab es um diese Zeit noch anderes als die Schönheit des goldenen Lichts. Die Luft wurde starrer und schwerer von Düften brennenden Holzes, von Jasmin, Ringelblume, Dung und gelblichem Staub, den das Vieh aufwirbelte, das des Abends von der versengten Weide bei der Rennbahn jenseits der Straße in die Ställe getrieben wurde, und man vernahm von den ausgedörrten Ufern des Stromes hinter dem Tierpark des Maharadschas gedämpfter Trommeln Klang und hörte die Schakale schreien, welche am Dschungelrand, die gelben Leiber feige geduckt, den Einbruch der Nacht erwarteten, um unter ihrem Schutz in der Niederung aufzuspüren, was am Tage verendet war.
Ihnen folgen bei Morgengrauen die Geier. Sie steigen aus ihren Höhlen und von den kotigen Dornbäumen auf und gieren nach dem toten Getier der vergangenen Nacht …
Um diese Stunde erklang hauchzart die Melodie einer Flöte. Die blies »Johannes der Täufer«, am Gittertor hockend, der Abendkühle zum Willkomm.
»Johannes der Täufer« saß unter einem riesigen, üppig wuchernden Banyan, der Jahr um Jahr seine Zweige bis auf die Erde senkte, dass sie sich in den Boden fraßen, Wurzeln schlugen und wieder ein paar Quadratfuß des Gartens eroberten. Weiter im Norden bei Peschawar stand ein noch größerer Banyan, der ganze Morgen Landes bedeckte, ein einziger Baum und zugleich ein Wald! – Wenn unser Erdball lang genug lebt, dachte Ransome, kann der Baum völlig von ihm Besitz ergreifen, so wie die menschliche Bosheit und Dummheit, kann langsam, beharrlich Zweig um Zweig vorwärts treiben mit der ganzen Lebensgier und Widerstandskraft Indiens.
Selbst Schakale und Geier mussten, ihr Leben zu fristen, sich zeitig aufmachen und sich ohne Unterschied auf menschliche Leichen und das Aas von Affen, heiligen Kühen und Paria-Hunden stürzen. Wer da in erster Morgenfrühe aus der Stadt ins Freie hinausritt, sah rings in der braunen Weite in kleinen, sich in Kämpfen windenden dunklen Klumpen das Leben, wie es den Tod verschlang. Das waren Geier. Ritt er nur eine halbe Stunde später hinaus, so waren sie weg, und an derselben Stelle lagen nur weiße Häuflein rein abgenagter Gebeine, der einzige Rest von dem, was gestern noch eine Kuh, ein Affe, vielleicht auch ein Mensch war.
In trägem Sinnen, das ihn bald dahin, bald dorthin führte, lauschte Ransome der schlichten Weise, die »Johannes der Täufer« flötete und selber erfunden hatte; die Melodie schien sich für westliche Ohren immerzu bis ins Unendliche zu wiederholen und dabei, wie Ransome herausfühlte, sein Inneres zu befreien – das konnte er nur mit Musik und kunstvollen Arrangements von blauen Lilien und Ringelblumen, dem Einzigen, was zu Ende des Jahres der Garten noch darbot. Der Täufer schien keine Geliebte zu haben oder sich nur heimlich mit ihr zu treffen. Sein Leben war das seines Herrn und Meisters: des Herrn Tee beim Erwachen, des Herrn Frühstück, Mittag- und Abendessen, seine Hemden und Socken, sein Jodhpur und seine Shorts, sein Brandy und seine Zigarren. Er war Christ, ein Katholik aus Pondicherry, und sprach lieber französisch als hindustanisch oder das Gujarati der Einheimischen von Ranchipur, doch war es ein wunderliches Französisch; seine Zunge hatte es abgerundet, es weich ins Indische umgeformt; zum Gebrauch im Salon, im Modeatelier oder in der Diplomatie wäre es nicht geeignet gewesen. Sein wirklicher Name war Jean Baptiste, doch Ransome nannte ihn stets »Johannes der Täufer«; der kleine, sehr magere Diener kam ihm stets vor wie eine Miniaturausgabe jenes hageren Propheten, der sich von Heuschrecken und wildem Honig ernährte.
Im entschwindenden Licht hockte der »Täufer« mit fünf Freunden zusammen; einer davon begleitete sein Flötenspiel mit fiebrigem Trommelschlag. Alle waren von Beruf »Boy« – beim Obersten, bei Bannerjis und Major Safka, die beiden andern im Gästehaus des Maharadschas; aber wer bei wem diente, war schwer zu sagen, denn sie sahen einander unglaublich ähnlich.
Ransome auf seiner Veranda wusste: Nun würden sie noch eine Weile flöten und trommeln, und wenn sie dann aufhörten, verstummten sie aber noch lange nicht, sondern schwatzen; sie wussten ja alles, was sich in Ranchipur zuträgt. Nicht einer konnte richtig lesen; keinem fiel es auch nur im Traum ein, in eine Zeitung zu gucken, und trotzdem erfuhren sie alles, nicht nur Dinge wie Krieg, Erdbeben und andere Katastrophen aus den entferntesten Teilen der Welt, sondern auch Diebstähle, Ehebrüche, Betrugsfälle und so weiter, und zwar mit allen Einzelheiten, die weder der Presse zu Bombay, Delhi oder Kalkutta noch ihren eigenen Herren und Meistern bekannt waren. »Johannes der Täufer« diente Ransome seit dessen Ankunft in Ranchipur, kannte ihn daher in- und auswendig und brachte ihm zuweilen eine erstaunliche kleine Neuigkeit. Er servierte sie zu Tisch, in aller Bescheidenheit selbstverständlich, wie eine Schale Reis oder den Tee: Mrs Talmudes skandalöse Entführung durch Hauptmann Sergeant zum Beispiel hatte »der Täufer« schon drei Tage, bevor sie erfolgte, vorausgesagt. Daraufhin hätte Ransome den Gatten warnen und so den Skandal verhüten können; er wollte sich aber nicht einmischen, wozu? –
Die sechs Männer unter dem Banyan hörten zu spielen auf. Ransome sah die Silhouetten der Köpfe, die sie dicht zusammensteckten, im nächtlichen Licht. Doch ihr Gespräch übertönte ein furchtbares Lärmen. Über ihnen im Baum brach es plötzlich aus, eine Kakophonie aus Gekreisch und Geschnatter; durch die staubigen Wipfel der großen Mangobäume kam es dahergerast: eine förmliche Prozession von Affen, die heiligen Affen von Ranchipur, laute, schwarzgraue, stattliche, patzige Burschen, die von Urzeiten her darum wussten, dass niemand wagte, einem von ihnen ein Leid anzutun: kein Inder, denn sie hatten ja einst in der Schlacht aufseiten des göttlichen Rama gekämpft; kein Europäer, denn ein einziger Affenmord konnte den größten Aufruhr hervorrufen.
Ransome hasste die Biester und musste zugleich über sie lachen. Er hasste sie, weil ihm ihr Höllenlärm die Abendstille zerriss und sie mit Vorliebe die Blumen in seinem Garten pflückten oder in regelmäßigen Zeitabständen vom Dach des Geräteschuppens die Ziegel herunterrissen. Der »Täufer« und seine Freunde schauten nicht einmal in die Höhe. Sie waren zu sehr in ihr Gespräch vertieft. – Das Affengeschrei hatte den Bann der Abendstunde gebrochen. Ransome trank seinen Brandy aus, legte den Fächer beiseite, erhob sich, ging hinters Haus und sah nach dem Wetter …
Das große Geviert des Gartens umgab hohes, aus Flechtwerk und gelbem Lehm errichtetes Mauerwerk, das zwischen dicht rankenden Begonien und Bougainvilleen sanft gesprenkelt hervorlugte. Noch herrschte Dürre. Das Erdreich war bis in die Tiefe von der Glut einer Sonne zerbissen, die, von keiner Wolke verhüllt, Tag für Tag sengte und brannte. Da und dort zeigte sich noch eine müde Ringelblume, eine verzweifelte Stockrose; der Gärtner hat ihre Wurzeln mit Wasser befeuchtet, das er aus der Zisterne am Gartenende herbeitrug; die dünnen, aufgeschossenen Stängel waren vom Sonnenbrand gezeichnet, ausgezehrt und erschöpft. Seit Tagen, ja schon seit Wochen wartete das ganze Land, Bauern, Händler, Soldaten und Staatsminister, auf den Beginn der Regenzeit, die über Nacht mit reich flutenden Güssen Gärten, Felder und Dschungel aus einer dürren, schmorenden Wüste in eine grünende Masse verwandeln soll, üppig wuchernd, als wolle sie Mauern, Bäume und Häuser in sich hineinschlingen.
Selbst der alte Maharadscha hielt die langen Wochen der brennenden Hitze aus, wollte die Freuden von Marienbad und Paris nicht gegen Ranchipur eintauschen, ehe die Regen nicht kamen und er sein Volk vor Hungersnot sicher wusste.
Die Spannung war von Woche zu Woche gewachsen. Nicht nur die grausige Hitze riss mehr und mehr an den Nerven, auch die entsetzliche Angst vor Krankheiten und Hungersnöten, das Grauen vor diesem lodernden Sonnenball; es war unerträglich! Selbst der gute alte Maharadscha mit all seinen Kornkammern und Vorräten konnte nicht zwölf Millionen Menschen vor Elend und Tod bewahren, wenn Rama, Wischnu und Krischna sich weigerten, Regen zu spenden. Panischer Schrecken befiel das Volk; man verspürte ihn selbst in den schattigen Gärten der reichen Kaufleute und auf den Veranden der Europäer, die in der angenehmen Lage waren, sich in die Berge zurückziehen zu können.
Diese Angst war wie eine ansteckende Krankheit; auch Ransome war davon befallen, dabei hatte er es nicht einmal nötig, in Ranchipur zu verweilen. Aber das große Bangen schlug schon seit Wochen alles in Bann; man spürte es ringsumher, zuweilen glaubte man, es mit Händen greifen zu können.
Wieder begannen Flöte und Trommel. Klagend, gedankenvoll schwebte ihr Ton von der Umzäunung her über den Garten.
Das Haus war weiträumig und licht. Ursprünglich für britische Beamte gebaut (damals, als der »Ruchlose Maharadscha« noch herrschte und zwei kriegsstarke Regimenter in Ranchipur lagen), war es für Ransome allein viel zu geräumig. Über seinen hohen Hallen ruhte ein Dach aus Ziegeln und dicken Schichten Binsen und Gras als Schutz gegen die Hitze. Darin raschelten, rauschten, schrien und quiekten nachts Eidechsen, Mäuse und Mangusten so laut, dass manche Abendgesellschaft dadurch gestört wurde. Fantastisch: ein großes, massives Haus im Empirestil mit einem Binsendach, das eine Menagerie von Kleintieren beherbergte! Außen war es wie irgendein Haus im Londoner Westen, etwa in Belgrave, und drinnen tummelten sich Manguste und Echse! Ransome jedoch liebte dieses Getier, die scheuen, feinnervigen Mangusten schon an und für sich und die Eidechsen, weil sie Moskitos vertilgten. Oft sah er sie beim Essen hinter einer Mogul-Miniatur hervorhuschen, hurtig einige Moskitos erschnappen und wieder hinter einem der Bilder verschwinden.
Wie ein plötzlich fallender Vorhang schloss sich die Finsternis über dem Garten, und sogleich erschienen die Sterne in einer glitzernden Pracht, gegen welche die weltberühmten Brillanten der alten, grimmigen Maharani verblassten.
Gelassen ging Ransome über den Gartenpfad, vorbei an dem bambusumwachsenen Brunnen. Das Rohrdickicht flüsterte leise im Winde, der sich bei sinkender Sonne für kurze Minuten erhob. Vor seinen Füßen glitt schattenhaft eine Manguste über den Weg, um nach Mäusen, Schlangen und Schlangeneiern zu fahnden. Ransome verabscheute Schlangen, doch nun kam wieder ihre Jahreszeit. Schon hatte der »Täufer« im Schlosspark gleich hinter dem Eingangstor eine Kobra erschlagen.
Wenn aber dann die ersten dicken Regentropfen herunterprasselten, so schwärmte es aus allen Mauerritzen und unter alten Wurzeln hervor: die Kobra, die Russel-Viper, die kleine, wilde Krait und die riesige Pythonschlange. Trotz der Mauer, die den Garten umgibt, drangen sie ein; jedes Jahr erlegten die Diener wohl ein halbes Dutzend. In der vorigen Regenzeit verendete das gezähmte Wildschwein Togo am Biss einer kaum fußlangen Giftnatter.
Die Fenster des Hauses erhellten sich, für Ransome das Zeichen, dass der Täufer mit Flötenspiel und Geplauder fertig war und ihm das Abendbrot richtete. Hinter den Fenstern sah er ihn, nur mit einem Lendenschurz bekleidet, geisterhaft leise umhergehen. Er war klein, aber nicht wie ein Liliputaner, sondern wohlgeformt wie die Miniaturstatue eines Athleten. Seine Hagerkeit war die eines Mannes, welcher bei schmaler Kost schon als Kind schwer arbeiten musste. In der heißen Jahreszeit ließ ihn Ransome die Hausarbeit nackt verrichten. Das war vernünftig und sauberer, denn sobald er europäische Kleider trug, war das blendende Weiß binnen fünf Minuten voll Staub, Asche, Kaffee- und Suppenflecken. Mit europäischer Kleidung konnte er einfach nicht umgehen.
Nackt war er die Sauberkeit selbst. Seine Hindu-Vorfahren hatten ihm die Gewohnheit des täglichen Bades vererbt. Jeden Morgen eilte er zum Brunnen am Gartenende und wusch sich in praller Sonne von Kopf bis Fuß. Merkwürdig, sagte sich Ransome, dass die Inder der untersten Klasse sonst, sobald sie katholisch getauft sind, nicht mehr ans Waschen denken! Die protestantischen Inder waren reinlicher; darin sah er den Hauptunterschied zwischen jesuitischen und protestantischen Missionen. Diese lehrten bei ihrem Seelenrettungswerk auch Hygiene; jenen kam es, ob mit oder ohne Hygiene, allein darauf an, ihrer Kirche Machtbereich auszubreiten.
Ransome bewohnte nur einen Teil seines großen Hauses, ein Schlafzimmer, ein kleines Wohnzimmer und den Speisesaal im Erdgeschoss. Der nach Norden gelegene mächtige, kühle ehemalige Gesellschaftsraum diente ihm als Atelier; er malte ein wenig aus Liebhaberei. Die übrigen Räume waren verschlossen und – außer von Mäusen und Eidechsen – unbewohnt.
Nachdem er sich im Schlafzimmer umgekleidet, betrat Ransome den Speisesaal, von dessen anderem Ende elektrische Ventilatoren ihm kühlenden Luftzug entgegenwirbelten. Sie waren zwar nicht so malerisch wie die altertümlichen »Punkahs«, aber bedeutend wirksamer, und er dankte Gott, dass Ranchipur ein fortschrittlicher Staat war mit einem Elektrizitätswerk, das zwar seine Launen hatte und manchmal stillstand, aber immerhin besser war als überhaupt nichts. Es war nach den Staudammanlagen die erste Sehenswürdigkeit, die man fremden Gästen zu zeigen pflegte; danach mussten sie meist noch die schmalspurige Eisenbahn besichtigen, hierauf das Spital, den Zoologischen Garten und das Irrenhaus.
Der blanke Esstisch trug in mächtiger Schale einen Berg Früchte: Granatäpfel, Melonen, Mangos, Guaven, Papayas, ein Anblick voll Farbenpracht, Kühle und Wohlgeschmack, der Ransomes Malerherz in Entzücken versetzte.
Das Schakalgeschrei war verstummt. Die hitzige Jagd nach Aas war in Schweigen und Dunkel gehüllt. Die Abendbrise hatte sich plötzlich gelegt. Die Nacht war still von Sternen beglänzt, es schien, so war es stets, wenn Monsun bevorstand, als seien sie unserer Erde näher. Die elektrischen Ventilatoren erzeugten nur noch Geräusch, doch keine Abkühlung mehr.
Als der Täufer die Suppe – kalte Bouillon – servierte, war er nicht mehr nackt, sondern trug einen weißen Leinenanzug, der eben aus der Wäscherei gekommen war, aber am Ellbogen schon einen Aschenflecken und vorn auf dem Jackett eine Spur von Suppe aufwies. Nachdem er die Schüssel abgestellt hatte, wartete er einen Augenblick, bis Ransome fragte: »Was gibt es heut für Klatsch, Johannes?«, worauf er sich erst etwas zierte, doch über die Neugierde seines Herrn sichtlich erfreut war, denn diese gab ihm nicht nur ein Gefühl der eigenen Wichtigkeit, es festigte auch seine Stellung, wenn er dem Herrn und Meister Dinge erzählen konnte, die dieser nicht wusste. »Nicht viel, Sahib«, antwortete er, »nur das von Miss MacDaid.«
Die beiden hatten eine originelle Art, sich zu verständigen. Ransome sprach englisch, und sein Boy antwortete in fremdartig weichem Pondicherry-Französisch. So verstand einer den andern, und jeder sprach, wie ihm der Schnabel gewachsen war. »Also was ist mit Miss MacDaid?«, fragte der Herr, und der Diener versetzte: »Sie liebt Major Safka, meint Antony.«
»Liebt? Inwiefern?«
»Sehr nah!«, grinste der Täufer Johannes.
»Hm! Und sonst?«
»Ein großer Sahib kommt auf Besuch zu Seiner Hoheit, und seine Frau kommt mit.«
»Wie heißt er?«
»Lord Heston«, gab der Boy an. Er sprach zwar den Namen französisch: »Eston« aus, doch wusste Ransome, wer damit gemeint war. »Antony sagt, sie sei sehr schön«, fuhr der Miniatur-Prophet fort, »er hat sie in Delhi gesehen. Sie sei ein Teufel, sagt er, eine … Teufelin … une sorcière!«
Ransome war mit der Suppe fertig. Sofort verstummte der Diener und trug den Teller hinaus, und da er nie unaufgefordert das Wort ergriff, seine Informationen vielmehr nur auf Verlangen preisgab, ließ er sich auch jetzt nicht weiter auf Lord Heston und die »Teufelin« ein, sondern überließ Ransome die Lösung der schwierigen Frage, warum eines englischen Pairs schwerreiche Gemahlin zu einer Zeit nach Ranchipur kam, da jeder, der irgendwie konnte, ins Gebirge entfloh.
Ransome wusste sehr wohl, wer Lord Heston war. Will er den Frieden von Ranchipur stören?, fragte er sich mit gerunzelter Stirn. Lady Heston … Der Name weckte in ihm eine Erinnerung, woran …? Darauf kam er nicht, und es war wirklich zu heiß, sich darüber den Kopf zu zerbrechen. Der Klatsch über Miss MacDaid bewegte ihn tiefer, er kam ihm so unglaubhaft vor und irgendwie tragikomisch.
Er hätte verreisen können. Ihn hielt ja nicht wie den alten Maharadscha ein Gefühl der Verantwortung vor dem indischen Volk oder wie Major Safka und Miss MacDaid die Pflicht zurück, für die Gesundheit von zwölf Millionen zu sorgen. Ihm waren auch nicht wie den Smileys die Kinder der »Unberührbaren« und der unteren Kasten anvertraut, noch hatte er wie Herr Bannerji eine reizende Inderin zur Frau, die als leidenschaftliche Nationalistin jeden Gedanken an Rückzug in einen Gebirgsort abwies. Ransome blieb, fast könnte man sagen, aus Widerborstigkeit. Er war reich, stand völlig allein und blieb doch in der glühenden Hitze, denn er wartete auf den Tag – würde er je kommen? –, da die Himmel sich auftun, die Fluten herabwogen, Felder und Dschungel brodeln, sich bäumen, wachsen und wuchern in einem unbeschreiblichen Dampfbad, furchtbarer als die heiße, staubige Trockenheit der »Wintersaison«. Irgendetwas am Schauspiel der totgebrannten Erde, wie sie hineinspringt in eine unglaubliche Orgie des Lebens, wühlte ihn tiefer, erregender auf als jedes andere Naturereignis. Mit dem Monsun überkam ihn rasende Kraft. Tag für Tag würde er dann malen, solange es hell war, triefend, nackt in der dampfenden Hitze, bald in dem großen, leeren Saal, seinem Atelier, bald von Insekten gepeinigt auf der Veranda; er würde den Garten malen, der vor seinen Augen ins Ungeheure des Lebens wuchs. Er würde das Wunder zu fassen versuchen, zu halten und am Ende sehen, dass er versagt, würde alles Geschaffene vernichten und zum Brandy zurückkehren.
Nichts lockte ihn in die Ferne. Er hatte kein Verlangen nach Simla, Darjeeling oder Utakamund, nach kleinen Leuten mit kleinen Begierden, Offizieren, Beamten mit Kind und Kegel, nach ihren eingebildeten Würden und eitlem Getue, ihren Vereinen und Vorstadtmanieren. Er hatte es zweimal versucht und unerträglich gefunden, viel unerträglicher als den Monsun.
Er hatte das Abendessen, den eisgekühlten Kaffee – gottlob hatte der Maharadscha eine Eisfabrik! – glücklich hinter sich, setzte seine Pfeife in Brand, griff zum Stock und begab sich auf seinen Abendspaziergang. Durch das Tor der Gartenmauer trat er ins Freie. Johannes der Täufer saß wieder mit seinen Freunden unter dem Banyan und flötete. Als Ransome vorbeikam, stand die musikalischen Tratschrunde auf, machte in der Stockfinsternis eine feierliche Salaam-Verneigung und murmelte: »Guten Abend, Sahib!« –
Er ging zur Stadt. Der Weg führte von der Rennbahn zum Alten Palais, das ganz aus Holz gebaut ist. Dort unter den Mangobäumen war es ein wenig kühler; die Wasserwagen hatten bei Sonnenuntergang die Fahrstraße besprengt, und sie war noch feucht. Vorbei an der Wohnung seines Freundes, des Polizeiministers Raschid Ali Khan, gelangte er zum Hause Bannerji. Es lag in Dunkelheit; der unvermeidliche Badminton-Drink, den Bannerji für den letzten Schrei hielt, war also schon überstanden. Nur im Wohnzimmer brannte noch Licht. Einen Augenblick verharrte der einsame Wanderer beim Gittertor in der vergeblichen Hoffnung, Mrs Bannerji auftauchen zu sehen, die er bezaubernd fand, zwar nicht als Frau, aber als eine Art Kunstwerk. Klassisch kühl und entrückt glich sie einer Gestalt aus den Fresken zu Ajunta. Ihr Gatte erregte in ihm nur ein sonderbares Gemisch aus Zuneigung, Heiterkeit, Mitleid, Verachtung: ein schwächliches Rohr im Wind, der bald von Westen und bald von Osten her weht.
Ransome wandte sich ab und stieg den Hang hinunter zur Brücke. Der Strom lag träge, eine schlafende Schlange, in der drückenden Schwüle. Über ihm, zur Zierde des mittleren Brückenpfeilers, ragte eine pompöse Königin Victoria aus Gusseisen. Das Wasser war ohne die leiseste Strömung: kein Fluss, vielmehr ein langes, grünliches, algenbedecktes Rinnsal, ein trüber Spiegel der Sternenpracht – das erst mit den Regengüssen zum reißenden Wildstrom wird und zwischen Basaren und Tempelbauten sich gelb durch die Stadtmitte wälzt und über die breiten Stufen, welche von Krischnas Tempel zum schleimig-stockenden Wasser hinunterführen.
Hinter der Brücke bog er links ein, ging über die staubige Uferstraße und durch die zoologischen Anlagen an den Verbrennungsstätten vorüber. Hier leuchteten nur die Sterne. Nirgends ein Haus.
Er war fern von den Menschen. Doch fühlte er keine Unruhe. In Ranchipur war es nicht gefährlich wie in andern indischen Staaten; auch war Ransome stark, groß und sehnig. Außer im Krieg hatte er niemals physische Furcht verspürt; der Tod barg für ihn keine Schrecken. Seit Langem war ihm das eigene Leben, das eigene Sterben gleichgültig.
Ein matter Lichtschein schimmerte von dem flachen Uferrand. Näher kommend gewahrte er die Aschenglut dreier Totenfeuer. Zwei waren schon fast erloschen; das dritte, etwas entferntere, flammte noch und warf seinen phosphoreszierenden Schein in die Wipfel der Mangobäume, über den reglosen Strom und den dunklen Pfad. Von dem rötlichen Lichtschein hoben sich die Silhouetten dreier Männer ab. Sie waren, bis auf die Lendentücher, nackt. Ransome blieb am Geländer stehen.
Einer der Männer, anscheinend der nächste Verwandte des Eingeäscherten, stach und schlug ungeduldig von Zeit zu Zeit in den Scheiterhaufen. Die Leiche, vom Feuer erst halb verzehrt, war noch nicht zu Asche zerfallen; aber wie es Ransome schien, hatten die drei Leidtragenden schon genug und wollten nach Hause. Als er, die Tragikomik der Situation genießend, sich über das Geländer beugte, erblickte ihn einer der drei, ein hagerer Bursche in mittleren Jahren, trat auf ihn zu und lud ihn grinsend ein, näher zu treten. Der stille Beobachter lehnte ab. Der Anblick sei ihm nichts Neues, bemerkte er auf hindustanisch. Worauf der Mann ihm lachend erzählte, sie seien dabei, ihre Großmutter zu verbrennen, die unvernünftig viel Zeit benötige. Er ließ noch einen zweiten Witz vom Stapel, Ransome jedoch kehrte um und ging zurück in die Stadt.
Es war nicht das erste Mal, dass er nach Einbruch der Nacht den Gang zu den Verbrennungsstätten, den »Ghats«, unternahm. Eine makabre Schönheit umschwebte den Ort, und aus dem Vorgang der Verbrennung sprach ein Glaube, eine Gewissheit, welche ihm Frieden und Frohsinn schenkte. Ihm war, als verneine dies Schauspiel die Bedeutung des Leibes und sage: »Was tot ist, ist tot.« Darum beeilte man sich, den Körper, so rasch es nur anging, vor Sonnenuntergang noch, der Erde zurückzugeben, schlicht, ohne prunkvoll barbarische Aufbahrung und Ansprachen. Es gab weiter nichts als das unabänderliche Zeremoniell einer Trauer, die sich, so aufrichtig sie auch sein mochte, in einfachen überlieferten Formen gleich jenen der archaischen Tänze von Tanjore vollzog. Mit dem Eintritt des Todes war von dem Wesen, das seine Mitmenschen geliebt, vielleicht auch gehasst hatten, nichts mehr vorhanden. Der Leib war ihnen nur ein Apparat, das manches Mal Lust und sicher ebenso oft Leiden erzeugt. Warum ihn dafür ehren? Er war ja ein Nichts.
In dieser Trennung vom Toten liegt ein Wirklichkeitssinn, wie ihn ein Christ nie aufbringen wird. Bei uns im Westen ist es nur eine Behauptung, wenn man sagt, der Leib sei Staub. Hier ist es ein Glaube. Im Westen bleibt der Mensch der erdgebundenen Körperlichkeit immer untertan.
Unter diesen Gedanken war Ransome beim Großen Platz angelangt, an dem sich die Fassade des verödeten Alten Palastes erhob mit ihren unzähligen hölzernen Balkonen und Gitterfenstern, hinter denen düstere Erinnerungen an schauerliche Mordtaten, an Gift, Dolch und Erdrosselung hausten. Bis zu dem großen Aufstand vor fünfzig Jahren hatte der Maharadscha dort residiert, nun lag die Stätte verwunschen da, nur noch ein riesenhaftes, verstaubtes, für immer verschlossenes Museumsstück. Doch es zog Ransome immer von Neuem an; es schien ihm ein spukhaftes Denkmal der Finsternis und des Bösen, das über Ranchipur herrschte, ehe der jetzige Maharadscha, der Alte, von den Göttern (und England) gesandt, endlich Wandel schaffte. Kein Licht brannte im Innern des toten Palastes, doch leuchtete die weiße Fassade hell im Widerschein eines gegenüberliegenden Kinos, in dem ein uralter Chaplin-Film lief.
Die Vorstellung sollte eben beginnen. Ein elektrischer Gong übertönte gellend den Lärm der Besucher, die Rufe der fliegenden Händler mit Eisschnitten, Marke Eskimo, Plätzchen und verdächtig gefärbten Patisserien. Im Vorübergehen wurde Ransome zuweilen von einem aus niederer Kaste erkannt und mit ehrerbietigem Salaam begrüßt, und er war froh, dass man seine Anwesenheit in Ranchipur als etwas Selbstverständliches ansah: dass er dazugehörte!
Die dritte Seite des Großen Platzes stieß an das »Große Becken«, ein ausgedehntes, rechteckiges, von Stufen eingefasstes Bassin, seit zweitausend Jahren lebendiger Mittelpunkt dieser staubigen Welt, der es acht Monate im Jahr inmitten von Glut und Dürre Erquickung bot. Die Armen gingen hier baden, Wäscher und Wäscherinnen klopften ihre Gewänder, die alten Frauen kamen zu einem Schwatz, und die Kinder spielten. Einst wandelten hier auch die heiligen Kühe und Wasserbüffel und beschmutzten die breiten, niedrigen Stufen mit ihrem Kot. Jetzt war das längst untersagt. Die Tiere lechzten von Weitem nach Wasser, aber die Polizei hielt sie von dem Großen Platz und dem Stadtzentrum fern.
Die Wasserfläche des Beckens spiegelte alle Lichter des Platzes: die üppig gleißende Fassade des Kinos, die Feuer der Reiskuchenbäcker und die Petroleumlampen in den Buden der fleißigen Silberschmiede, die auf gekreuzten Beinen dahockten und mit zierlichen Hämmern ihr feines Metall zurechtklopften.
Als Ransome den Platz überquerte, ließ der Lärm des Kino-Gongs und der Händler zufällig nach, sodass ein ganz anderes, doch nicht minder verworrenes, ebenso eindringliches Geräusch an sein Ohr schlug. Es kam aus dem Konservatorium, einem monströsen Steinbau im gotisierenden Stil der König-Albert-Gedächtniskirche zu Bombay. In allen Fenstern war Licht, und in jedem Zimmer wurde gelehrt und geübt. Ransome kannte die rohen Holzbänke wie die Schüler, die darauf saßen: Menschen jeder Altersstufe von Neunzig- bis herab zu Zwölf- und Zehnjährigen, alle gleichermaßen von Eifer erfüllt zu studieren, denn jede dieser Seelen schrie nach Musik. Er ging oft hin. Die Schüler und ihre Klänge, ihr Anblick bezauberte ihn.
Lange stand er im Tosen der Töne und Lichter, umringt von Hall und Widerschein, Schein und Widerhall, und sah die Fliegenden Hunde, groß wie Falken, von den lockenden Lichtern des Kinos zur gleißenden Spiegelfläche des Beckens hinüberfliegen, darüber kreisen, wenden und abermals in ziellos endloser Reise geblendet vom Lichtspiel zum Lichtersee wieder zurückkehren.
Er klopfte die Pfeife aus und ging auf das Konservatorium zu. Da fiel sein Blick auf das Hospital dahinter, den Teil, der die Entbindungsanstalt beherbergte; auch hier war alles beleuchtet. Dort kam wohl jetzt ein neuer Inder zur Welt, oder zwei oder drei, und fügten die Last ihres künftigen Daseins zur Daseinslast von dreihundertsiebzig Millionen in Wüsten, Dschungeln und Städten in unermesslichen Weiten. Miss MacDaid war gewiss zur Stelle; auch Major Safka, wenn ein schwerer Fall vorlag. Safka und Miss MacDaid …, was hatte der Täufer da vorhin getratscht? – Ach, Unsinn! Zu so etwas war Miss MacDaid viel zu nüchtern, zu herb, ein Arbeitstier und kein brünstiges Weibchen! Safka war mindestens zehn Jahre jünger als sie und konnte Frauen haben, so viel er nur wollte. Nein, ärgerte sich Ransome, das war weiter nichts als ein ganz blöder, unmöglicher Klatsch – allerdings, sprach eine Stimme in ihm, hatten der Täufer und seine Freunde in solchen Dingen sich bisher noch nie geirrt.
Im Konservatorium ging er zuerst ins Büro seines Freundes, des Direktors Mr Das. Dieser saß über seinem Hauptbuch, in welches er nach europäischem Vorbild in zahlreiche Rubriken alle möglichen Ziffern eintrug, wodurch seine Einnahmen und Ausgaben in hoffnungslosem Durcheinander blieben. Er war ein zartbesaitetes, schüchternes Männchen, verrunzelt, mit grauem Haar, und wirkte trotzdem nicht unbedeutend, denn aus den großen, dunklen Augen loderte eine feurige Seele. Er hatte nur eine Leidenschaft: indische Musik! Kein Mensch auf Erden verstand so viel wie er von den strengen, uralten liturgischen Kompositionen der Tempel Südindiens, von Klängen und Gesängen der Rajputen, Bengalen und der muslimischen Nachfahren Akbars, wenn er auch Letztere als zu modern ablehnte, denn dort gab es immerzu etwas Neues; der von Westen kommende Jazz hatte die Tradition verdorben.
Außer während der kurzen Stunden des Schlafes lebte Herr Das in einem nimmerendenden Strudel von Tönen; seine Schule begann frühmorgens und schloss erst um Mitternacht. Der Unterricht war unentgeltlich. Der Maharadscha und seine Gemahlin, die Maharani, liebten wie weiland Akbar die Musik und wollten dem Volke nichts vorenthalten, was das Leben heiterer machte und heller, und so strömten aus allen Teilen Indiens zahllose Musikliebende in dies Haus, und wer dessen weite Hallen durchschritt, vernahm Kompositionen jeglicher Kaste, jedes Glaubens und jedes Volksstamms: der Moslems, Bengalen, Rajputen, Marathen, Singalesen, der dunklen Urvölker des Südens und der seltsamen Bhils, die mit ihren Ziegenherden in den von Panthern bewohnten Hängen jenseits der Abana-Berge zu Hause sind.
Als Ransome eintrat, schnellte Direktor Das auf, eilte ihm entgegen, ihm die Hand zu drücken. Er liebte ihn, denn Ransome liebte Musik und war der einzige Europäer in Ranchipur, der dem Konservatorium so viel Interesse entgegenbrachte, dass er es nicht nur einmal besuchte, und das schmeichelte der Eitelkeit des Direktors, dessen Sein von einem ständigen Drang zu gefallen verzehrt war, den er vergeblich zu unterdrücken suchte. Trotz der späten Stunde schien ihn die Ankunft seines Besuchers nicht zu verwundern; er war gekommen, Musik zu hören, das wusste Herr Das, und dies genügte ihm.
»Was möchten Sie heute hören?«, fragte er eifrig und zugleich zagend. Ransome wünschte den Sänger von Rajput zu hören.
»Jemnaz Singh!«, rief der Kleine entzückt, sprudelte etwas über das heiße Wetter und die Verspätung des Monsuns hervor, klatschte in die Hände, gebot dem eintretenden Diener, Jemnaz herbeizuholen, und geleitete den Gast in den kleinen Konzertsaal.
Selbst die Stimme des kleinen, sonst nur von Musik und Schule erfüllten Direktors hatte, da er den bisher ausgebliebenen Monsun erwähnte, angstvoll gebebt. Seit einem Monat schon hätte es regnen sollen. Es war die Furcht von mehr denn vierhundert dürstenden Generationen, die eingeborene Angst vor der Hungersnot, die ihn erzittern ließ.
Der Konzertsaal erinnerte im Aussehen an den Wartesaal erster Klasse in irgendeiner englischen Provinzstadt. Doch auf dem kleinen Mittelpodium zog sogleich eine Gruppe von ungewöhnlicher Schönheit die Augen auf sich und ließ die viktorianische Geschmacklosigkeit des Raumes mit einem Schlage vergessen. Jemnaz Singh saß mit gekreuzten Beinen, im Arm die Laute, ihm zur Seite zwei Knaben, der zur Rechten mit einer Flöte, der links handhabte eine große Trommel, die er zwischen den Knien hielt. Jemnaz war ungemein zart und klein, sein schmales Antlitz von außergewöhnlicher Schönheit. Er trug einen hohen Rajput-Turban, der in Giftgrün, Lila und süßlichem Rosa gemustert war. In seinem Atchcan aus Seidenbrokat vereinigten sich die gleichen Farben mit Silber und Dunkelviolett zu einem extravaganten Blumenmuster.
Er war rachitisch. Unter der mattgoldenen Haut traten an den Backenknochen trübrote Flecken hervor. Beim Anblick Ransomes neigte er lächelnd den Kopf.
Der Zuhörer nahm Platz, der Direktor verfügte sich wieder zu seinem Kontobuch, und der Sänger begann.
Die langen, blassen Finger mit den bemalten, lackierten und nachpolierten Nägeln glitten, noch tastend, über die Saiten; Jemnaz suchte nach einem Thema, einer Eingebung … Mit großen, dunklen Augen verfolgten die neben ihm harrenden Knaben jede Bewegung der schönen Hände.
Ein Motiv nach dem andern klang wie zur Probe auf und versank, bis endlich das Gesuchte gefunden war. Jemnaz sang das Thema mit leiser Stimme, die Knaben lauschten gespannt. Es war eine reine, liebliche Weise, die er ersonnen, ein kunstvolles Flechtwerk von Tönen. Er sang sie einmal, dann noch einmal, leicht variiert. Nun hatten die Knaben verstanden und intonierten ex improviso ihre Begleitung, und wunderbar klar und doch schwierig verschlungen gleich einer Bachschen Fuge oder den weißen, marmornen Arabesken der Tempel am Berge Abu tönte es fort und fort, empor und hinab. Entzückt schloss Ransome die Augen, er wollte nur hören, denn Jemnaz Singh war ein gottbegnadeter Musiker; zuweilen aber öffnete er sie wieder, denn die Schönheit des Bildes, das sich ihm darbot, war nicht geringer als die der Musik. Er nahm des Sängers Gesicht, Gestalt, Bewegung und Lied in sich auf, und die Welt, die Nichtigkeit seines bisherigen Lebens, die dumpfe Planlosigkeit seines künftigen versanken im Hochgefühl des Genusses, und seine müde Seele erfüllte ein tiefes Glück.
Er spürte nicht, wie die Zeit verrann, bis mit einem Schlag ein gigantischer Donner ihn auffahren ließ und den Bann der Musik zerbrach. Allein der Sänger sang weiter, bis er die letzte der Variationen des Themas beendet hatte. Dann erst legte er seine Laute zu Boden und sprach ein Dankgebet an Kali. Endlich waren die Regen gekommen!
Das Gewitter, von einem jähen Sturm aus dem Arabischen Golf begleitet, kam in rasender Schnelle und zog einen dichten Vorhang vor das Sternengeschmeide des Himmels. Donnergrollen und zuckende, wilde Blitze scheuchten riesige Fledermäuse in immer neuen, ungestüm flatternden Scharen über das Große Becken. Während Ransome zum andern Ende des Platzes eilte, klatschten die ersten großen Regentropfen in den dicken Staub, die Kinolichter erloschen plötzlich; unter lautem Geschrei rafften die Händler Reiskuchen, Eisschnitten und sonstiges Zeug zusammen und stoben erschrockenen Küken gleich nach allen Richtungen auseinander. Der Sturm wuchs an. Die Bäume bogen sich, wankten. Unmöglich, trockenen Fußes nach Hause zu kommen. Die flinken kleinen Tongas, die sonst vor dem Alten Palast warteten, waren verschwunden. Ransome ging den kürzesten Weg über die Brücke und an der Rennbahn vorbei, beeilte sich aber nicht allzu sehr. Noch war er von der Musik berückt, und nun riss die Urgewalt des Gewittersturms ihn in Entzücken.
Grellweiß folgte Blitzschlag auf Blitzschlag. Wie von gigantischen Leuchtfeuern war seine Straße erhellt. Die dicken Tropfen fielen immer dichter und schneller, bis alle Wasser des Himmels sich in einem einzigen maßlosen Katarakt ergossen. Beim Hause Bannerji war er bereits so durchnässt, als habe er in Kleidern den Strom durchschwommen.
Beim Aufleuchten eines Blitzes sah er einen Radfahrer aus Leibeskräften gegen den Sturm ankämpfen und erkannte beim nächsten Blitz den nassen, kleinen Pedaltreter als seinen Freund Smiley von der amerikanischen Mission. An der Lenkstange baumelte ein Früchtekorb. Ransome brüllte der kläglich strampelnden Gestalt durch die Dunkelheit einen Gruß zu, doch der Sturm verschlang seinen Ruf. Wem hatte der Emsige noch zu so später Stunde zu helfen?, fragte er sich. Bis zur Mission waren es gut drei Meilen.
Als er durch das Mauertor seinen Garten betrat, klebte der Leinenanzug fest an seinem hageren Leibe, doch nun war er unter Dach. Durch einen Verbindungsgang ging er zur Gartenveranda, zog das nasse Zeug ab und blieb nackt stehen. Sein Herz, seine Augen weilten im Sturm.
Schwarz peitschten die Mangozweige ins wilde Leuchten der Blitze. In Sturzbächen stürzte das Wasser hinein in das ausgetrocknete, lechzende Erdreich. Morgen würde alles wunderbar grünen; das Monsunwunder geschah! Er schritt die Stufen hinab in den Garten. Der warme Regen klatschte auf seine bloße Haut. So stand er und fühlte sich neu geboren. Aller Überdruss, alle Müdigkeit war aus seiner Seele gewichen.
2
In der Entbindungsanstalt des Hospitals lief Miss MacDaid immer wieder von einer Abteilung zur andern. Sie war groß, kräftig, nicht dick, jedoch hatte die drückende Schwüle sie derart in Schweiß versetzt, dass man hätte meinen können, sie sei vom Regen überrascht worden. Umsonst suchte sie einen freien Augenblick zu erwischen, um sich rasch im Office umzuziehen und – wenn auch nicht abzukühlen, so doch wieder so adrett zu sein, wie es sich für eine Oberschwester gehört. Es wäre ja alles viel leichter, lägen die schwangeren Frauen alle auf ein und derselben Abteilung, doch da Nummer eins eine Reinmachefrau, Nummer zwei eine Bunya, die Frau eines kleinen Kaufmanns war, eine dritte wiederum einen Maurer zum Mann hatte, mussten sie getrennt liegen. Der Maharadscha trat zwar sonst für die Menschenrechte der Parias rückhaltlos ein, aber für die Entbindungen hatte er doch eine Konzession gemacht; die Kaste der Unberührbaren sollte abgesondert gebären. Und nun machten die Bunyafrau und die Maurersfrau die größten Schwierigkeiten, dieweil die »Unberührbare« ihre schwere Stunde wie ein gesundes Tier leicht überstand.
Die Bunyafrau glaubte wohl, es ihrer höheren Kaste schuldig zu sein, zu jammern und zu klagen, doch die Maurersfrau war ein schwieriger Fall. Ihr Becken war deformiert. Die Wehen zogen sich endlos hin. Das einzige Ergebnis war eine immer größere Erschöpfung. Die Frau war geduldig, aber so hoffnungslos, wie der Mensch in großer, beständiger Armut wohl werden kann. Sie war eine der vielen Millionen, die in Indien geboren werden und sterben, ohne in all der Zeit auch nur einen einzigen Tag genug zu essen zu haben. Die Beckenverkrümmung rührte von einer früheren Rachitis her. Die Kreißende war erst sechzehn; es war ihre erste Geburt. Wie ein krankes Tier erfasste sie instinktiv, dass etwas nicht stimmte. Sie schrie nicht. Aus der Tiefe des aschgrauen Gesichts starrten angstvoll die dunklen, weit geöffneten Augen.
Miss MacDaid hätte die Pariafrau getrost einer ihrer beiden Helferinnen anvertrauen können; es war ja ein leichter Fall, bei dem nach menschlichem Ermessen alles seinen natürlichen Verlauf nahm, und beide Pflegerinnen waren genügend geschult. Die erste, eine unverheiratete Nichte des Maharadschas, war sechsundzwanzig und arbeitete schon seit fünf Jahren im Hospital; die zweite, die Witwe Gupta, war die Schwester eines Adjutanten der Maharani. Beide waren geduldig und gescheit, aber von jenem bedingungslosen Fatalismus, dem Miss MacDaid schon bei so vielen Indern begegnet war, und der ihr schottisches Herz mit Misstrauen füllte. Denn ihre Kirche lehnt die Prädestinationslehre ab, und daher war sie entschlossen, kein Mittel unversucht zu lassen und bis zum Schluss zu kämpfen, heute wie immer. Erst wenn sich das Schicksal stärker erweisen sollte als ihr schottischer Dickkopf, fügte sie sich, denn dann hatte das Schicksal ehrlich gesiegt.
Die zwei Hilfskräfte taten jede ihnen zugewiesene Arbeit, aber nicht mehr. Denn wie alle Selbstherrlichen beraubte Miss MacDaid ihre Umgebung jeder Initiative, und diese Tyrannei legte sich wie Mehltau über all ihre Mitarbeiter, mit Ausnahme Major Safkas, dessen überlegener Einsicht sie sich unterwarf. Wenn sie an ihre Grenzen stieß, rief sie gewöhnlich nach Safka.
In der Paria-Abteilung war es so weit. Das Kind kam, war da, und Miss MacDaid stand dabei und sah, dass es gut war. Erleichtert lag die Pariamutter in ihrem schmalen Eisenbett und sah stumm zu ihr auf. Überstanden waren die Schmerzen, die Augen glänzten vor Dankbarkeit. So glich sie einer wilden Gazelle, die, eingefangen, sich in ihr Schicksal ergibt.
Wie noch jedes Mal war Miss MacDaid tief erschüttert von der archaischen Schönheit dieser »Unberührbaren«, die sich von anderen Kasten unterschied; angeblich hatten sie in fernster Vergangenheit unterschiedliche Vorfahren. In Ranchipur wurden sie nicht übel behandelt; die Schranken des Vorurteils waren, außer bei den streng orthodoxen Hindus, gefallen. Miss MacDaid waren Parias lieber als alle, die sonst ins Spital eingeliefert wurden; ihr schottisches Herz liebte deren Zähigkeit und trotzige Lebenskraft. Sie hatten auch ausreichend Nahrung. Selten, dass sie ausgehungert daherkamen wie die Armen der niedrigen Kasten. Seit fünftausend Jahren waren sie gewöhnliche Gassenkehrer, lebten unabhängig von Verboten und Riten eines erstarrenden Glaubens und waren daher nie so ausgehungert und entstellt wie jene Maurersfrau oder die Frauen der Bunya, deren Kost immer die gleiche war. Pariafrauen aßen sogar Fleisch; man merkte es an ihren feurigen Augen und an der zähen Kraft in ihren Körpern.
Das Neugeborene war gebadet und lag wie ein dunkelpurpurnes Äffchen zur Seite der Mutter, runzlig, doch drall, und kreischte so kräftig, dass es sogar das fernher eindringende Tönegewirr des Konservatoriums überschrie. Die Nichte des Maharadschas, eine Prinzessin, hatte das Pariakind gebadet.
Noch immer konnte Miss MacDaid es nicht fassen: dass nach einer einzigen Generation diese junge Angehörige der stolzesten Kriegerkaste fünftausendjährige Vorurteile abstreifen und gelassen inmitten von Parias arbeiten konnte.
Freundlich lächelte sie der Prinzessin zu, wandte sich dann an die Wöchnerin, lobte auf Gujarati ihr Kleines und sah im nämlichen Augenblick mit der ihr eingeborenen gälischen Intuition, fast visionär, diese Nichte eines kriegerischen Maharadschas mit dem Neugeborenen der Pariafrau als Sinnbild des künftigen Indiens, als dessen Rettung und Heil, und es flossen daraus gewaltige Ströme des Hoffens und Glaubens und umfluteten sie, die Fremde, in einem Lande, dem ihre Liebe galt und das ihre Heimat geworden war. Aus dem weisen Friedensgeist dieser Pflegerin und der Kraft dieses Pariakindes, so schien ihr, würde einst eine große Nation erstehen und eine ganze Zivilisation wiedergeboren werden. Sie wusste es nicht verstandesmäßig, doch dank dem wachen Instinkt ihres Volkes erkannte sie es wohl klarer als alle Stubengelehrten am andern Ende der Welt.
Das Schreien der Bunyafrau rief sie ab; sie lief in die andre Abteilung. »Das Kind kommt«, rief Frau Gupta, die Schwester des Adjutanten. Miss MacDaid schob sie rasch beiseite und sah nach, ob alles den rechten Verlauf nahm. Komplikationen lagen hier keine vor, allein ein qualvolles, schweres Ächzen von drüben, vom Eisenbett, in dem die Maurersfrau lag, kündigte an, dort sei das Schlimmste zu befürchten. Mit einer normalen Geburt war nicht mehr zu rechnen; die Frau war mit ihrer Kraft am Ende, und davor hatte Miss MacDaid bei Hindu-Patienten immer am meisten Angst. Die Frau hatte sich selbst aufgegeben, lag in dumpfer Ergebenheit da, nicht gewillt, nur noch die leiseste Anstrengung zu unternehmen; es war schrecklich.
Miss MacDaid aber meinte, die Gebärende müsse am Leben bleiben, auch gegen den eigenen Willen. Sie wandte sich an die Pflegerin: »Eine von euch muss Major Safka holen; die andere soll alles zur Operation vorbereiten. Wer zum Major geht, soll auf alle Fälle jemanden zur Begleitung mitnehmen. Allein soll keine weg.«
Die Nichte des Maharadschas erbot sich freiwillig; sie hatte ihr Fahrrad im Hospital und brauchte die Launen der alten Maharani nicht so zu fürchten. Auch kannte sie sich in dem weitläufigen, unübersichtlichen Schlosse gut aus und fand ohne Weiteres den direkten Weg zu den Gemächern der Herrin. Sie warf einen Mantel um, rief den Torwächter, und beide fuhren auf ihren Rädern davon – fast im gleichen Moment, da das gewaltige Donnerkrachen das zarte Tongewebe zerriss, welches der Sänger aus Rajput für Ransome gesponnen hatte.
3
Miss MacDaid hatte darum so spät, vielleicht zu spät, nach Major Safka geschickt, weil sie ihm an diesem Abend gern alles Unangenehme fernhielt. Die ganze Woche arbeitete er für drei, aber am Freitagabend ging er in den Palast, um mit der Maharani Poker zu spielen, nicht etwa aus Pflichtgefühl oder Respekt vor dem Willen der hoffärtigen Dame, sondern zu seiner eignen Entspannung, und weil ihm wie ihr das Spiel über alles ging.
Der Torwächter und die Pflegerin gelangten durch die ersten fallenden Tropfen bis zum Technikum. Dort brach das Unwetter richtig los und durchnässte sie binnen drei Minuten bis auf die Haut. Geblendet von grell aufzuckenden Blitzen und den die Gesichter peitschenden Fluten, bogen sie beim ersten Seitentor in den Park ein und erreichten, unter wogenden Bäumen dahinradelnd, die gewundene Auffahrt und den Palast. Seine Türme, Zacken und Vorbauten stachen schwarz in den blitzeflammenden Himmel.
Durch eine Hintertür traten sie ein. Die Prinzessin wusste, wo sie den Chirurgen zu suchen hatte; es war nicht das erste Mal, dass sie ihn von hier entführte. Der Maharadscha durfte von den Pokerpartien der Maharani nichts wissen. Wenn sie in Monte Carlo, Deauville oder Baden-Baden ihr Geld verlor, hatte er nichts dagegen. Nur hier im Schloss, inmitten des eigenen Volkes, untersagte er es. Doch hatte er ihr im Verlauf ihres langen Zusammenlebens schon vieles verboten, und sie hatte es trotzdem getan.
Sie saß mit Major Safka, Generalmajor Agate, zwei ihrer Neffen und einem Adjutanten in ihrem Privatsalon an einem Mahagonitisch. Die Neffen hatten in Cambridge pokern gelernt und spielten es ebenso konservativ wie stumpfsinnig, während sich General Agate ganz seinem Temperament überließ. Da dieses sehr impulsiv war, verlor er in einem fort. Doch buchte er seine Verluste auf Konto Reisespesen und deklarierte den Pokerabend als »diplomatische Visite«. Es war zwar kein offizieller, vom Vizekönig angeordneter, sondern ein mehr privater Besuch. Aber war er deshalb etwa weniger wichtig und wertvoll? Im Gegenteil. Er hatte sogar seine Reise nach Puna kurzerhand abgebrochen, nur um einige Tage bei den Herrschern von Ranchipur zu verbringen.
Der dickliche Herr war etwa sechzig, sein Gesicht puterrot, sein Schnauzbart breit und weiß. Er hatte sein halbes Leben in Indien verbracht, und es war, als habe sich hier die Natur bemüht, die Literatur zu kopieren, und als sei er just aus einer Erzählung Kiplings herausgestiegen, nicht bloß in seinem Äußern, nein, auch in seinem Charakter, Gehaben und Temperament. Auf seinen breiten Schultern trug er »die Last, die man mit diesen dunkelfarbigen Völkern hat«, und bezeichnete sich Neuankömmlingen gegenüber gern als »Hauptstütze des Empire«. Was er jetzt mit den Herrschern Ranchipurs spielte, war wichtiger und weit schwieriger als das Poker; dieses bereitete ihm höchstens Verdruss, denn er war von Temperament zwar cholerisch, im Denken jedoch phlegmatisch und steif und fest davon überzeugt, er diene dem britischen Empire im Geist ruhmreicher Traditionen, also nicht allein durch seine soldatische Tüchtigkeit (die seine zahllosen Ordensauszeichnungen bezeugten), sondern nicht minder durch sein politisches Verständnis.