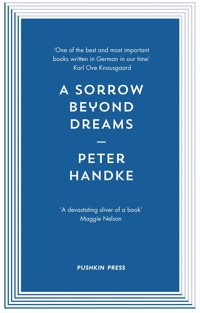18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Geschichte eines müßiggängerischen Schauspielers, an einem einzigen Tag, vom Morgen bis tief in die Nacht: Das Gehen durch eine sommerliche Metropole, von den Rändern bis in die Zentren. Die Begegnungen: mit den Läufern, den Obdachlosen, den Paaren, dem Priester, den Polizisten. Ein Weg mitten durch Nachbarnkriege, vorbei an überlebensgroßen Leinwandpolitikern, dann inmitten von Untergrundfahrern aus einer anderen Welt. Wetterleuchten in der Stadtmitte. Und das Gesicht einer Frau. - Gebundene Ausgabe mit Lesebändchen
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 207
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Peter Handke
Der Große Fall
Erzählung
Suhrkamp Verlag
1
Jener Tag, der mit dem Großen Fall endete, begann mit einem Morgengewitter. Der Mann, von dem hier erzählt werden soll, wurde geweckt von einem mächtigen Donnerschlag. Das Haus, mitsamt dem Bett, wird erzittert und für einen langen Augenblick nachgebebt haben. Augenblick: das traf auf den Liegenden dort nicht zu. Aus dem Schlaf geschreckt, hielt er die Augen geschlossen und wartete, wie das Geschehen nun weiterginge.
Es regnete noch nicht, und durch das weit offene Fenster war auch kein Wind zu hören. Dafür blitzte es wieder und wieder. Die Blitze, sie schossen durch die geschlossenen Lider des Mannes mit einem geballten Blaken, und der trockene Donner darauf, in immer kürzerer Folge, brach sich verstärkt in den Ohren.
Geschreckt aus dem Schlaf: auch das traf auf den da Liegenden nicht recht zu. Nicht einmal überrascht schien ihn das Losschlagen des Gewitters zu haben. Er lag still und ließ es durch die Lider blitzen und durch das Schädelinnere donnern, als etwas Allmorgendliches, als etwas Alltägliches; als sei er es gewohnt, auf solche Weise geweckt zu werden; und nicht bloß gewohnt, sondern zu diesem besonderen Gewecktwerden auch berechtigt. Blitze und Donner wirkten als eine Weckmusik, welche ihn aus dem Tiefschlaf so jäh wie selbstverständlich überführte in eine vollkommene Geistesgegenwärtigkeit, und in noch etwas anderes: eine Bereitschaft; Bereitschaft, sich zu konfrontieren, zu stellen, einzugreifen. Erst einmal lag er hingestreckt in dem Tumult und hatte seine Freude daran.
Nach dem ersten Donnern wäre er fast aufgesprungen, um Fernseh- und Musik-Undsoweiter-Stecker herauszuziehen. Doch im selben Moment das Bewußtwerden: Er war nicht im eigenen Haus, lag in einem fremden Bett. Der Ort selber, an dem er geschlafen hatte, war ein fremder, fremd das ganze Land.
Seit sehr langem war das die erste Nacht fern dem eigenen Bett, fern den vertrauten Räumen gewesen. Noch bei geschlossenen Augen hatte er den Arm nach der gewohnten Zimmerwand ausgestreckt, die dann nicht da war. Er hatte ins Leere gegriffen. Und auch das schreckte ihn nicht, er wunderte sich bloß, bis ihm zu Bewußtsein kam: Ich bin ja unterwegs. Ich bin doch gestern von zuhause aufgebrochen. Zwar bin ich nicht erwacht im eigenen Bett, aber auch nicht in einem fremden.
Früher einmal, am ersten Morgen woanders, hatte ihm das Zuhause gefehlt. Schon an den Ankunftsabenden in dem anderen Land, schon am Flughafen dort zum Beispiel, blickte er mit einer Art Trennungsschmerz auf die Tafel, die den unmittelbaren Rückflug anzeigte. Am Morgen des Tages seines Großen Falls aber setzte ihm die Fremde nicht nur keinen einzigen Moment lang zu, sondern er fand sich in ihr auf der Stelle heimisch. Er wollte die Augen nie wieder aufmachen.
Donner und Blitz, Blitz und Donner waren es, die ihn fern von daheim jetzt gastlich aufnahmen. Und als sie dann allmählich schwächer wurden und sich verzogen, tat das der Regen. Ganz plötzlich schon in der Nachgewitterstille, schüttete es los, ein einziges, gleichmäßiges, andauerndes Schmettern. Von dem Schwall behütet, lag der Mann da, weiter mit geschlossenen Augen. Nichts konnte ihm geschehen. Selbst wenn das nun draußen die Sintflut wäre: Er fand sich in einer Arche, fand sich in Geborgenheit.
Von der gewiegt wurde er noch durch ein Drittes. Er hatte geschlafen und war erwacht im Bett einer Frau, die ihm gut war. Die ihn liebte? Zwar hatte sie ihm das während der Nacht einmal bedeutet. Aber er wäre nicht einverstanden gewesen damit, das hier so wortwörtlich niedergeschrieben zu sehen. Sie war mir gut: das war's, was er sagen konnte.
Auch er war der Frau gut an jenem Morgen, stärker noch als in der Nacht, oder umfassender, aber anders. Sie hatte Bett und Haus sehr früh, schon vor dem Tagwerden, verlassen, für ihre Arbeit. Kaum ein Geräusch war dabei von ihr gekommen, und er, im Halbschlaf, war da erfüllt worden von einer wie kindlichen Dankbarkeit; hatte, das spürte er am ganzen Leib, die Dankbarkeit selber verkörpert. Er hätte es ihr nie und nimmer sagen können, aber wie er so ihrem durch die Räume des Hauses sich entfernenden Luftzug nachhorchte, da lag er und verehrte sie, diese Frau dort.
Eher wäre er mit sich als ihrem Verehrer einverstanden gewesen denn als ihrem Geliebten. Wie sie ihn einmal voll Stolz, kam ihm vor, so ansprach, hatte er, und nicht nur, weil er über das Alter, einen Geliebten darzustellen, hinaus war, die Brauen gehoben und woandershin geschaut.
Gehüllt in den gleichmäßig starken Regenschwall ohne Wind, schlief er noch einmal ein. Obwohl ihm einiges bevorstand, am heutigen Tag und besonders für den morgigen, war ihm, als habe er alle Zeit auf Erden, und zugleich als sei das schon Teil und Anfang der ihn erwartenden Konfrontation. Es war ein so leichter Schlaf, daß der Mensch da in ihm entschwebte. Wenn er noch etwas verkörperte, dann einzig den Schlaf. Fast immer erscheinen in den Filmen die Schauspieler, wenn sie Schlafende darstellten, und sei es noch so lebensecht, fragwürdig. Der da hingegen, mochte er auch, nach dem ersten Erwachen, ganz bei Bewußtsein bleiben, schlief wirklich, während er den Schlaf spielte, und schlief und schlief, und spielte und spielte. Und wenn er dabei träumte und dem Zuschauer etwas vorträumte, so wiederum allein das Schweben und Entschwebtsein. Es war ein Traum ohne Handlung, er konnte darin nicht etwa fliegen. Aber angeblich hatte auch das Traumschweben, gleich dem Fliegenkönnen, eine Bedeutung. Nur hatte er die vergessen, so wie er vieles im Lauf der Jahre entschlossen vergessen hatte.
Das ist der Moment, zu erwähnen, daß der Mann, von dem hier erzählt wird, in der Tat ein Schauspieler ist. Als ganz Junger hatte er, im kleinen Betrieb seines Vaters, ein Handwerk gelernt und, oft auch zusammen mit dem Vater, querhin durch die kleinhäuslerischen Vororte im Nordwesten von B. Fliesen verlegt. Das war ihm immer noch anzusehen, und nicht nur an den Händen, und vielleicht stärker noch anzumerken, an den Bewegungen ‒ einem häufigen Zurücktreten, Rückwärtsgehen, wieder Vortreten ‒, an den tiefen Blicken ‒ seinem Aufblicken vor allem, jäh, nach einem langen Starren bodenwärts, seinem Augenschmalwerden in manchen Filmszenen, für nichts und wieder nichts, ohne jede Pose, ohne angelernte Bedeutung wie nicht selten bei sonstigen Filmhelden. Bei ihm war das, wie sagt man, die zweite Natur geworden, oder überhaupt die Natur?
Wie, die Geschichte eines Schauspielers, an einem einzigen Tag, vom Morgen bis tief in die Nacht? Und eines Schauspielers nicht bei seinem Tun, sondern beim Müßiggehen? Solch einer als der Held, so oder so, einer Geschichte, einer dazu ernsten? ‒ Niemand Gefährdeter, niemand Trittfesterer als ein Schauspieler, einer wie er. Niemand, der im Leben weniger Rollenspieler ist. Er, der Schauspieler, als »ich!«, das Mehr an weniger Ich. Ohne seine Darstellerarbeit ‒ wenn er nicht spielt ‒ tagelang ausgesetzt. So einer ist episch, auch erdenschwer. Es ist von ihm vielleicht eine Geschichte zu erzählen wie von kaum jemand sonst.
Seine ersten Jahre als Schauspieler waren auf dem Theater vergangen. Die Bühnen waren klein, seine Rollen aber immer die großen, von Anfang an. Und trotz seiner Jugend stellte er fast nur die Alterslosen dar, den Odysseus, den Engel, der den Tobias auf dessen Heilsuchreise für den Vater begleitet und führt, den Othello, ohne schwarze Schminke, den Bäcker in der »Frau des Bäckers«, der seine ehebrecherische Frau zuletzt verzeihend wieder aufnimmt, den Emil Jannings, wenn ihm entfährt, wie es so »schrecklich schmerzhaft« sei, »zugleich lebendig und allein zu sein«. Alterslose Helden, oder Idioten, wie etwa den Bennie in der Dramatisierung von William Faulkners »Schall und Wahn«, wo die winzige Vorstadtbühne unter dem Jammerblick des »Hausstocks« ‒ wie die Zurückgebliebenen einmal hießen ‒ sich zum Universum auswuchtete, oder Fastkinder und überhaupt Lebenslangkinder, wie den Parzival oder den Kaspar Hauser, in welcher Rolle er eine Mutter, zum ersten und so ziemlich letzten Mal im Theater zu Gast, an ihren verstoßenen Sohn, den Bauhilfsarbeiter hinter den sieben Bergen in seiner Baracke, gemahnt hat: So erbarmt hatte er, ihr Sohn, da auf der Bühne, daß sie sofort zu ihm fuhr und ihn zu sich heimholte, für eine Zeitlang. Nur den Faust, wenngleich oft dazu angestachelt, hatte er sich seit je zu spielen geweigert, und würde auch jetzt für dessen ewiges Tätigsein zum Gerettetwerden nicht einmal sein angedeutetes Ausspucken übrighaben.
Mit seinen Filmen war er zum Star geworden, ohne daß ihn auf den Straßen, die sein Element blieben, bis auf seltene Ausnahmen jemand erkannte. Alles an ihm, seine Gestalt, seine Haltung, seine Bewegungen, war unscheinbar, und er konnte sich darüber hinaus unsichtbar machen. Jedenfalls war das seine Gewißheit, und bis zum heutigen Tag hatte die gewirkt. Im Film dagegen, in gleich welchem, war er, werweißwarum, augenblicks zu erkennen, auch in einer Menge, und selbst im hintersten Hintergrund. Das war jeweils etwas anderes als ein bloßes Erkennen oder Wiedererkennen, und keine Frage des Lichts. Oder doch ‒ nur eben nicht einer Beleuchtung ‒ oder doch. Schon in der ersten Einstellung war er herauszuriechen, im Guten wie im Bösen, da noch durchdringender, man wollte so einem nicht auf der Straße begegnen, auch nicht am hellichten Tage. Zu Beginn seiner Filmzeit war er noch verglichen worden: ein mehr ins Düstere schlagender Richard Widmark; ein Marcello Mastroianni ohne dessen betonte Nationalität; ein Francisco Rabal, der nie so recht jung gewesen war. Später genügte er als er.
Seit ein paar Jahren war er nicht mehr aufgetreten, weder auf einem Theater noch im Film. Weiter voll Achtung für seinen Beruf und, wenn nicht stolz, so doch erfüllt und dankbar für die Zeit mit ihm, erachtete er sich selber nicht mehr als Schauspieler. Jemand, der, auch in seinen Mußeperioden, nicht beständig, nicht tagaus, nachtein mit dem Problem, dem schönen, dem einengenden, dem befreienden, dem beglückenden und peinigenden Problem des Darstellens lebte, hatte, nach ihm, kein Recht, sich Schauspieler zu nennen, ein Wort, das für ihn eine andere Bedeutung hatte als für nicht wenige. Wort, Name »Schauspieler«: ein Klang.
Nicht mehr zu spielen, das war kein freier Entschluß. Andererseits war es mit den Rollenangeboten weitergegangen, als sei nichts gewesen. Und vielleicht war ja auch nichts gewesen. Nur hatte er, wie er sagte, die Gewißheit (wieder seine »Gewißheit« …), von einem Moment zum nächsten, »mit einem Schlag«, es sei für einen Schauspieler, und nicht bloß für einen wie ihn, nichts mehr darzustellen, zumindest in einem Film. Zwar gebe es Rollen, noch und noch, und nicht nur die bekannten, typisierten. Aber es seien keine Geschichten mehr zu erzählen, und mit Geschichte meine er nicht das üblich gewordene »nach einer wahren Geschichte«, sondern Offenbarung, ob das nun die Offenbarung des Gesichts eines Menschen sei, wie einst in den Filmgeschichten von Carl Theodor Dreyer, Robert Bresson, Maurice Pialat, John Ford, Satyajit Ray, oder das Offenbarwerden eines, des Anderen, eines Größeren, des Großen, in dir und mir, oder schlicht das Sich-Offenbaren des kaum erst Geborenen in einem Sterbenden, eines leeren Schuhs als ein Gleichnis für einen stummen Todesschrei, eines aus der Hand fallenden Teelöffels als Gleichnis für einen größeren Fall.
Auf den Weg gemacht hatte er sich am Vorabend, fort von seinem Haus und seinem Land, nicht eigens wegen der Frau hier. Vielmehr sollte er in deren Stadt und um die herum am folgenden Tag doch noch einmal mit einem Film anfangen, in einer Filmgeschichte auftreten. Diese handelte von einem, der auszieht zum Amoklaufen, zuerst im Kopf, und dann aber … Beim Lesen des Buchs war der Schauspieler sich seiner Sache fast sicher gewesen. Wenn nicht das Buch, so würde er, mit seinem Spiel, seinem Dasein, Stehen, Umsichschauen, der Geschichte zum Augenaufgehen verhelfen. Inzwischen freilich wußte er nicht mehr.
Während dieses Hin und Her war er aufgestanden. Das leere Bett. Im offenen Fenster der Regen. Kein Wind. Vor dem Fenster, im Abstand, die Bäume eines Waldrands, eine unregelmäßige Zeile. Davor ein Garten, eher eine Wiese, so leer, nur das Sommergras, hüfthoch, stellenweise vom Gewitterguß geknickt oder zu Boden geklatscht. Das Fenster war eher eine Glastür, mit zwei weiten Flügeln, die oben fast zum Plafond reichten. Das Zimmer gehörte zu einem Haus, einem einzelstehenden, jahrhundertalten. Es war einmal ein Jagdhaus gewesen und wurde nun bewohnt von der Frau. Sie konnte sich das leisten, sie führte in der nahen Kapitale ein Unternehmen, welches oder was für eines, wollte er nicht wissen, bereits die eine Information war ihm fast zu viel.
Geruch der aus dem Wald dahergewehten und in schaumigen Wellen das Grasland durchziehenden Blütenschnüre der Edelkastanien. Im Regenhimmel oben die Sphärenflüge, die einander durchkreuzenden, der Schwalben, so hoch oben, als nähmen sie das Blau und die Sonne vorweg. Aber schon vorher waren die Schwalben hoch, womöglich noch höher als jetzt, durch die Lüfte und die von Blitzen zuckenden Finsterwolkenbänke geflitzt und hatten den Spruch von ihrem Tiefflug vor Gewittern spielend Lügen gestraft.
Er ging nackt, wie er war, ins Freie. Niemand konnte ihn sehen, so hatte er es beschlossen, und überhaupt. Wo das Gras noch aufgerichtet war, wischten ihm die triefnassen Sommerähren über Hüften und Bauch. Er wusch sich dann so, indem er sich bückte, die Achseln, das Gesicht, die Augen und Ohren, die Haare. Der Regen fiel weiterhin, gleichmäßig und kräftig. Und in der Tat kam von ihm eine Kraft. Man wurde unbändig in ihm. Der Regen war warm, und nach einigen Schritten kalt, dann wieder warm, undsofort. Er würde im Haus keine Dusche zu nehmen brauchen.
Ein großer dunkler Vogel brach aus der Grastiefe und pfeilte mit einem Gellen oder Zetern in den Wald, immer im Tiefflug, mit dem das Dunkle an ihm jäh in ein Gelb umschlug. Der Schauspieler hatte den Namen des Vogels einmal gewußt. Aber inzwischen hatte er ihn vergessen, auch das war so beschlossen, wie bei fast sämtlichen Namen. Dafür redete er hinter ihm her, wie er das früher kaum je gehalten hatte: »He du. Nicht so schnell. Ich tu dir ja nichts. Komm zurück und laß dir was erzählen.« Und da er gewohnt war, auf die eigene Stimme zu achten, fiel ihm auf, wie tonlos die sich anhörte. Die Worte an den Vogel waren das erste, was er an diesem Tag gesprochen hatte. Doch ihm kam vor, es sei nicht die rechte Stimmlage gewesen. Und so sagte er die Worte noch einmal, versuchte es wieder und wieder, bis, während der gelbbäuchige Vogel längst verschwunden war, das an ihn Gerichtete und seine Stimme in einer Art Einklang waren.
In der Küche war das Radio an, der Ton so leise gestellt, daß wieder ein Eindruck von Sphären entstand, von anderen freilich als von den Kurven der Schwalben. Es wurden gerade, wie vorhin schon, und wieder und wieder, die Weltnachrichten verlesen, und die kaum hörbaren, oder so vielleicht desto hörbareren Sprecherstimmen kamen wie aus dem fernsten Weltraum, gerichtet an ein anderes Universum. »Hier Radio Venus.« ‒ »Hier Radio Kassiopeia.«
Während er zuhörte, brach das Regenrauschen ab, von einem Moment zum andern. Aber nein, das Rauschen war gleichmäßig stark weitergegangen. Als er seiner inne wurde, schaltete er das Radio ab und zog, nein, riß zusätzlich den Stecker heraus. Er, der sonst für alles einen umstandslosen Zugriff hatte, griff dann, indem er die Hand nach dem Brot ausstreckte, daneben, und gar mehrere Male. Nicht bloß daneben tappte er, er kam an den Laib nicht heran, nicht und nicht. Jede Kraft war aus seinen Armen gewichen, dem rechten, mit dem er nachzugreifen versuchte, ebenso wie dem linken.
Das setzte sich an anderen Dingen fort. Die Tasse, die er an sich heranziehen wollte; der Löffel im Honigglas; die Zitronenscheibe; die Blume in der Vase auf dem Küchentisch; das daneben aufgeschlagene Buch: es gelang ihm nicht einmal, sie mit den Fingerspitzen zu berühren, geschweige denn, sie anzufassen. Er, ein Meister der Bewegungsfolge ‒ vom, sagen wir, Landkartenzuklappen zum Hutaufsetzen, Türklinkendrücken, über die Schulter den Abschiedsblick Werfen, in der offenen Tür ganz woandershin Schauen, zuletzt noch den Rucksack oder das Sattelzeug Schultern ‒, geriet jetzt, wie er da in der fremden Küche stand, mit seinen Bewegungen, eher schwachen Versuchen dazu, durcheinander, wollte sich mit einer Hand durch das Haar fahren und verfing sich dabei schon unten an der Gürtelschnalle, während die andere Hand, in der Hosentasche weniger zur Faust geballt als verkrampft, sich da eingeschlossen nicht und nicht herausziehen ließ, worauf auch noch die beiden Hände miteinander über Kreuz kamen und zuletzt vielleicht zusammen, heillos eingesackt, in derselben Tasche steckten.
Der Schauspieler hatte dann doch, mit der Zeit, ein eher freudloses Lachen, wie es in den Detektivromanen von Raymond Chandler heißt. Zugleich stand ihm der Schweiß auf der Stirn, perlte ihm sogar aus dem Handrücken. Als er jetzt auf den wie für ihn bereitgestellten Hocker sank, fiel ihm zugleich der Kopf hintüber in den Nacken, mit einer Gewalt, als werde er von ihm abgetrennt; als träfe ihn da jener Genickschlag, welcher in der Sekunde tötete. Und er war doch so stolz gewesen auf seinen starken, unbeugsamen Hals.
Er konnte schon wieder lachen ‒ wie man von einem Kind sagt ‒, aber die Schwäche, in das innerste Herz gestoßen, wich nicht recht von ihm. Er zitterte. Er, der sonst die Seelenruhe und die Erdenschwere verkörperte, war zittrig. In seinen Jahren als Fliesenleger an der Seite seines immer ungeduldigen, reizbaren und unduldsamen Vaters war ihm die Wasserwaage das bevorzugte Ding gewesen, als Werkzeug wie darüber hinaus als eine Art Vorbild: Die Luftblase im Auge der Waage, wenn sie, genau und still, mittendrin die vollkommene Gerade anzeigte, hieß bei ihm »Ruheblase«, und so eine Ruheblase entdeckte er dann auch in sich, oder er selber war die Waage der Ruhe ‒ konnte das sein oder spielen, sowie es darauf ankam. Und so hatte er seine Ruheblase dann auch über die Jahrzehnte hinweg mit ins Spiel, mit in die Arbeit gebracht, und sie hatte sich ein jedes Mal, wie eben nur ein Werkzeug aus den ersten Anfängen des Lebens, bewährt.
Wie das wieder in Funktion bringen? Er wartete. Er hatte ja Zeit (oder etwa nicht?). Er hörte. Der Regen, der Regen. Nicht nachlassen, Regen! Nicht abbrechen, Rauschen! Ja, Hören, das war es. Und er schaute; schaute um sich, wobei er freilich, wie eine Eule, den Kopf als ganzen drehen mußte, die Augen blieben vorderhand starr. Und als er dann endlich die Tasse fest in der Hand glaubte, fiel sie ihm aus den Fingern und zerbrach. Es war seine Reisetasse gewesen, die er überallhin mitnahm, in der Einbildung, der Kaffee, Tee oder was auch immer schmecke nur durch sie, durch ihre Form und ihr Material, so wie es sich gehöre. Da lag sie in Scherben, seltsam großen, ihm entfallen in einem letzten Nachzittern. Immerhin war das Zittern nicht von Dauer gewesen.
Er fügte die Scherben zusammen, mit einem Klebstoff, den er in dem fremden Haus auf Anhieb gefunden hatte. Ja, fremd war das Haus der Frau weiterhin, obwohl er nun schon seit Jahren da übernachtete, fremd in dem Sinn, daß er die meisten der Räume bislang nicht betreten und weder einen Schrank noch eine Lade geöffnet hatte. Dann schnitt er das Brot an, eine vollkommene Scheibe, was für ein herzhaftes Geräusch, und sagte laut zu sich selber: »Kein Tag ohne Brotschneiden.« Wie er doch mit solchem Schneiden alle die vor ihm wurde und frisch verkörperte. (Auch die nach ihm? Das war nun keine Gewißheit.) Die Tasse war gleich dicht verfugt, und er warf die Klebstofftube in Richtung der offengebliebenen Lade: genau an ihren Platz. Und wiederum zu sich selber: »Bist immer noch der Meisterwerfer, Freund. Solltest mit einem deiner Spielernamen Werfer heißen!«
Musik: keine. Die Regenmusik genügte, zumal inzwischen der Wind dazugestoßen war, aus allen Richtungen auf das Haus zu. Der frischte auf und umbrauste jetzt, zusammen mit dem Regenstrom, das ganze Haus, in Wellen, die an Lautstärke zunahmen. Dieser Wind, rund um die Hausmauern, brandete heran, und brandete, und brandete. Und von neuem sagte der Mann an dem Küchentisch in einem lauten Selbstgespräch: »Ah, der Wind, wie er rauscht. Im Umkreis. Im Erdkreis. Es ist also doch noch etwas zu machen dahier. Zu bewerkstelligen. Solch ein Wind ist ein Wert!« Ein wann und wie auch immer draußen im Grasland umgefallener Stuhl wurde von dem Wind wieder aufgerichtet, und stand dann, und stand. War das denn ein Ding der Möglichkeit? Ja.
Der Schauspieler gab sich den Anschein, als gehöre das Kauen des Brots, als gehöre auch jeder Schluck zur Vorbereitung auf das, was bevorstand; als sammle er sich so, essend und trinkend. Mitten in der Zeremonie sprang jedoch die Küchentür auf, die wie alle Haustüren unversperrt war und unmittelbar ins Freie, ins Grasland, ging, und ein Mann, in Gestalt eines Regenmenschen ‒ ein Schneemensch, gäbe es den, wäre gegen den Anblick nichts gewesen ‒, schrie sofort los, wobei er auf der Türschwelle, unter der Traufe, innehielt: »Sie lieben sie ja überhaupt nicht. Ich dagegen liebe diese Frau, ja, ich. Lassen Sie meine Frau in Ruhe. Ja, meine Frau. Denn eines nicht mehr so fernen Tages wird sie die Meine sein. Tausend Nächte haben Sie mit ihr verbracht, und haben kein einziges Mal dabei etwas wie Liebe empfunden. Verschwinde, Falschspieler. Mach Platz. Die Frau gehört mir, mir!« Und dies gesagt, in einem Akzent, welcher vielleicht eher aus der Erregung kam, zog der Regenmensch die Tür, erstaunlich sacht, wieder zu und war weg. Kurz vor seinem Erscheinen hatte der andere ein wie morgendliches Bedürfnis nach einer ersten menschlichen Silhouette gespürt, an die er sich taglang halten würde, als an eine »Formgabel« (wie »Stimmgabel«). War der Eindringling solch eine Silhouette gewesen?
Mein Schauspieler frühstückte daraufhin erst einmal ruhig weiter, aß Bissen für Bissen, trank Schluck um Schluck. Wahr: Er liebte die Frau nicht, hatte es ihr auch gesagt, am Anfang, später noch einmal, und dann hatte es sich wohl erübrigt. »Ich liebe dich nicht.« Und wenn sie beim ersten Mal vielleicht noch zugehört hatte, so beim zweiten Mal entschieden nicht mehr. Es genügte, daß sie liebte und von Liebe sprach, und daß er sich das so gefallen ließ. »Du bist mein Geliebter. Seit meiner Kindheit bist du der erste Mensch, mit dem ich so bin, wie ich bin. Und niemand in der Gegend, niemand im Land hat mehr gemeinsame Liebesstunden verbracht als wir. Und jedesmal haben wir es der Welt gezeigt. Wir haben's ihr gegeben. Haben uns an der Zeit jetzt, der übermächtigen, der scheint's geltenden, gerächt. Haben über sie gesiegt, und sie hat nicht mehr gegolten, ist verduftet, und wir, wir zwei, wir beide, sind die geltende Welt geworden. Sind geworden und gewesen, was der Fall ist.«
Und er ließ sich das, ließ sich sie und sich gefallen. Und trotzdem fehlte sie ihm, »die Liebe«. Ohne Anführungszeichen: Die Liebe fehlte ihm. Sie fehlte ihm jeden Tag, einmal weniger schmerzhaft, einmal als Schmerz der Schmerzen, so oder so ein tagtäglicher Schmerz. Das Fehlen der Liebe, es empörte ihn, zwar unter anderm auch gegen sich selber, aber zuletzt doch weit über sich selber hinaus. Es war im übrigen, recht bedacht, nicht ein Fehlen, welches so empörend war, vielmehr ein Ausbleiben. Ein Fehlen wäre ja schon eine Weise der Liebe gewesen, eine möglicherweise umfassendere und zukunftsweisendere als eine vorhandene, greifbare, sozusagen habhafte, so wie man doch zu einem, einer Abwesenden sagte: »Du fehlst mir!«, und das war eine Art Liebe. Die Liebe, sie fehlte ihm nicht. Sie blieb scheußlich aus, und so auch an diesem, an jenem Morgen. »Und es ist doch ein Fehlen«, sagte er laut zu sich selber. »Ohne sie, ohne auch nur einen Augenblick gesegnet von ihr und mit ihr und durch sie, verdient mein Tag nicht, Tag zu heißen, bin ich nichts als ein üblicher Tagedieb. Den Freundestrug dagegen bin ich froh, für alle Tage los zu sein.«
Regen und Lesen. Der Schauspieler war ein Leser. Obwohl das Buch auf dem Küchentisch von einer Art Amoklauf erzählte, las er es nicht etwa, um sich auf seine Rolle vorzubereiten. Er gehörte zu denen, die sich nie eigens für etwas vorbereiteten, und das galt über seinen Beruf hinaus. Konfrontiert mit einem Part, verstärkte er eher das Müßiggehen, suchte er Ablenkungen, ließ kommen, wie es kam, ließ geschehen. Insofern bereitete er sich so vielleicht doch vor.
Zu Beginn der Geschichte war der, von dem sie handelte, beim Frühstück gesessen, so wie der Leser jetzt ‒ was den nicht kümmerte: Er las, und da galt allein das Erzählte, und er war darin verschwunden. Man konnte sich den Helden des Buchs, wie er Tee trank und einen fernen Horizont im Auge hatte, als jemand Beschwingten vorstellen. Er würde an diesem Tag etwas Großes unternehmen, das entscheidende Bild malen, den langgesuchten Kindermörder fassen, der Frau seines Lebens begegnen, einen aus einem brennenden Haus ins Leere Springenden auffangen.