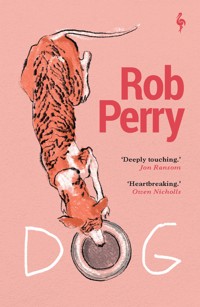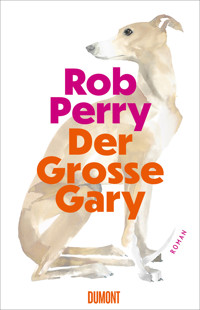
16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Benjamin ist achtzehn, arbeitet im Supermarkt und lebt in einem Caravan Park an der Ostküste Englands. Seit seine Oma im Krankenhaus liegt – ein Ort, den er aufgrund all der Keime und Erreger tunlichst meidet –, ist Benjamin auf sich allein gestellt. Bis ein toter Wal am Strand angespült wird und er einem herrenlosen Windhund begegnet, der sich prompt an seine Fersen heftet. Als wäre der Anblick des toten Wals nicht schon Herausforderung genug gewesen, muss sich Benjamin nun auch noch um einen fremden Hund kümmern, über dessen Herkunft (und vor allem über dessen potenzielle Krankheiten) er nichts weiß. Erst als der Essenslieferant Leonard in dem Vierbeiner den Großen Gary, den schnellsten Hund des Landes, erkennt und Benjamin vor seinen grausamen Besitzern warnt, fasst dieser einen Entschluss: Er muss Gary beschützen. Auch wenn er sich dafür auf einen abenteuerlichen Roadtrip mit dem wenig vertrauenserweckenden Leonard einlassen und sich seinen schlimmsten Ängsten stellen muss.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 375
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
»Manchmal war es schwer zu sagen, ob man sich verirrt hatte oder nicht. Er wusste, dass man sich fehl am Platz fühlen konnte, auch wenn der eigene Körper genau dort war, wo er sein sollte. Dass es oft gar nichts mit dem Ort zu tun hatte.«
Als Benjamin einem zutraulichen Hund am Strand begegnet, ahnt der Achtzehnjährige nicht, dass er dem Großen Gary, einem wertvollen Rennhund, gegenübersteht. Und noch viel weniger, dass er sich schon bald auf der Flucht vor dessen skrupellosen Besitzern befinden wird. Um Gary zu beschützen, stürzt sich Benjamin trotz all seiner Ängste und Vorbehalte kopfüber in ein Abenteuer. Doch kann er dem Essenslieferanten Leonard, der ihm seine Hilfe anbietet, wirklich vertrauen? Und was werden Garys Besitzer tun, wenn sie ihn zwischen die Finger bekommen? Aber Benjamin kann jetzt nicht mehr zurück in sein altes, ängstliches Leben. Er muss die Zügel selbst in die Hand nehmen – für Gary, aber auch für sich selbst.
›Der große Gary‹ ist eine so herzzerreißende wie hoffnungsvolle Coming-of-Age-Geschichte über einen vom Leben überforderten jungen Mann und seiner Freundschaft zu einem Windhund.
© privat
Rob Perry wurde 1987 geboren und studierte Kreatives Schreiben an der University of East Anglia. Er arbeitete als Werbetexter sowie bei der Feuerwehr und als Fitnesscoach, ehe er sich ganz dem Schreiben widmete. Heute lebt Perry in Nordengland. ›Der Große Gary‹ ist sein Debütroman.
Hanna Große, geboren 1994, lebt in Halle (Saale) und arbeitet als Übersetzerin aus dem Englischen.
Rob Perry
Der Grosse Gary
Roman
Aus dem Englischen von Hanna Große
Die englische Originalausgabe erschien 2024 unter dem Titel ›DOG‹ bei Europa Editions, London.
© 2024 by Rob Perry
First Publication 2024 by Europa Editions
E-Book 2025
© 2025 für die deutsche Ausgabe: DuMont Buchverlag GmbH & Co. KG, Amsterdamer Straße 192, 50735 Köln, [email protected]
Alle Rechte vorbehalten.
Die Nutzung dieses Werks für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Übersetzung: Hanna Große
Lektorat: Leonora Tomaschoff
Herstellung: Corinna Gathmann
Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Umschlagabbildung: © Sarah Maycock
Satz: Fagott, Ffm
E-Book-Konvertierung: CPI books GmbH, Leck
ISBN E-Book 978-3-7558-1128-2
www.dumont-buchverlag.de
Für Mama, die den Samen gesetzt hat.
Und Lucy, die ihn gewässert hat.
1
Benjamin Glass wollte sich gerade einen toten Wal ansehen, als der Hund am Strand neben ihm herzulaufen begann. »Ich gehe zu einem toten Wal«, sagte er laut.
Normalerweise ermutigte er keine ihm unbekannten Hunde, aber dieser sah traurig aus. Er schleifte eine rote Leine hinter sich her und blickte sich immer wieder um.
»Du kommst vielleicht besser nicht mit«, sagte er zu dem Hund, denn er wusste nicht, welchen Begriff sich ein Hund vom Tod machte und ob er die nötige innere Stärke besaß.
Benjamin hatte auf der Arbeit in der Zeitung von dem Wal gelesen. Als er von seiner Vorgesetzten Camilla an die Kasse gesetzt worden war, hatte er den Scanner mit Zeitungspapier abgedeckt, damit er nicht blind wurde oder seine Zellen mutierten. Sie hatte den Finger in ein körniges Bild auf einer der Titelseiten gebohrt.
»Das solltest du dir ansehen«, sagte sie, und eine geballte Faust schwebte über ihrem Herzen. »Schau mal, was es mit dir macht.«
Camilla habe sich den Wal schon angesehen, sagte sie, im Geiste ihrer vollständigen und grundlegenden Verbundenheit zu sämtlichen Tieren auf der Welt.
»Das wäre nichts für mich«, sagte Benjamin und sprühte antibakterielles Reinigungsmittel auf das Förderband.
»Vielleicht solltest du gerade deswegen hingehen«, sagte sie.
Benjamin drehte sich mit dem Rücken zum Wind und atmete flach für den Fall, dass das, was den Wal getötet hatte, von einer Spezies auf die andere überspringen konnte. Er fürchtete sich vor durch die Luft übertragenen Erregern, seit er von dem Mann gehört hatte, der mit einer hoch ansteckenden Atemwegserkrankung auf dem Flughafen Gatwick gelandet war. Einige Zeitungen hatten berichtet, dass die Krankheit in Ostasien ausgebrochen war, weil die Leute dort Fledermäuse aßen. Camille hatte mit einer zuckerfreien Limo am Getränkeautomaten gestanden, als sie das hörte. Sie hatte die Augen fest zusammengekniffen.
»Die armen Fledermäuse«, hatte sie gesagt. »Die armen, armen Fledermäuse.«
Am Nachmittag hatte sie ihre Chakren gereinigt und die Dosis homöopathischer Mittel erhöht.
»Er ist tot«, sagte Benjamin und zeigte auf den Wal.
Er beäugte das große Maul und das Blasloch des Tiers. Der Hund nahm ein Stück links von ihm Platz. Der Wal wirkte nicht besonders ramponiert, aber der Sand unter ihm hatte sich rot verfärbt. Benjamin dachte darüber nach, wie Blut in Venen mit dem Durchmesser von Wasserleitungen zum Stillstand kam. Er betrachtete die alten, traurigen, von der Sonne ausgetrockneten Augen des Wals und stellte sich vor, wie die Schwerkraft außerhalb des Wassers seine inneren Organe zusammenpresste.
»Wo ist dein Herrchen?«, sagte er zu dem Hund.
Der Hund beachtete ihn nicht; er saß einfach nur da, die Augen auf den Wal gerichtet, blinzelte und atmete. Nach einer Weile ging er zu dem toten Tier hinüber und begann, den Blubber aufzulecken.
»Verdammte Kacke«, sagte Benjamin, dann schaute er sich um, ob ihn jemand gehört hatte. Als der Hund zurückkam, drückte er seine feuchte Nase an Benjamins Hand. »Verdammte Kacke«, sagte Benjamin noch einmal.
Er inspizierte den frischen, feuchten Fleck direkt über seinen Knöcheln, das feine Büschel roter Handhärchen, das an der Haut festklebte. Der Hund sah ihn mit seinen bernsteinfarbenen Augen leicht entrückt an. Blinzelte langsam, als wäre er gerade aus einem Traum erwacht.
»Ich muss jetzt nach Hause«, sagte Benjamin.
Die Spuckehand vor sich ausgestreckt, ging Benjamin zwischen den Dünen hindurch, und der Hund trottete mit ein wenig Abstand hinter ihm her. Während sie einem sandigen Pfad folgten, der sich am Rand des California Sands Caravan Park emporschlängelte, blieb der Hund gelegentlich stehen, um an vom Meer angespülten Plastikteilen und verwaisten Krabbenschalen zu schnuppern. Sie erreichten ein Loch im Maschendrahtzaun.
»Ich glaube, da quetschst du dich besser nicht durch«, sagte Benjamin und zog sich einen schützenden Ärmel über die saubere, nicht vom Hund angeleckte Hand. »Wenn du dich mit Tetanus infizierst, kriegst du Kiefersperre«, sagte er. »Dann kannst du nichts mehr fressen.« Er machte ein paar Kaubewegungen. »Dein Kiefer verkrampft sich.«
Dann zwängte er sich durch die Lücke. Er drehte sich nicht um, damit der Hund nicht auf dumme Gedanken kam, und ging einfach mit geradeaus gerichteten Augen zwischen den Mobilheimen hindurch – seine Turnschuhe glitten im Schlamm leicht aus – vorbei an einem im Regen stehenden Flachbildfernseher und einem Fahrradgestell ohne Räder.
Beim Mobilheim drehte Benjamin sich um und schaute den Weg entlang. Von dem Hund war nichts zu sehen, also stieg er auf die hölzerne Terrasse. Als er sich noch einmal umwandte, stand der Hund hechelnd da. Mit glasigem Blick und offenem Maul starrte er Benjamin an, der durch die Tür schlüpfte und ihn auf der Veranda stehen ließ.
Benjamin lehnte sich an die Wand und sog Sauerstoff in die Lunge. Er zog die Jeans herunter und steckte sie in die Waschmaschine, dann wusch er sich im Spülbecken gründlich die Hände. Er schlich sich zum Fenster und spähte zwischen den Vorhängen hindurch. Der Hund saß auf der Terrasse und betrachtete die im Wind flatternde Flagge des Mobilheimparks. Gelegentlich schloss er die Augen kaum länger als für ein Blinzeln und schwankte leicht. Als er ihn wieder ansah, trat Benjamin vom Fenster zurück und griff nach dem Telefon. Er rief die Auskunft an, um sich nach einer Tierschutzorganisation zu erkundigen, und ließ sich gleich durchstellen.
Während er auf einen freien Callcenter-Mitarbeiter wartete, nahm Benjamin zwei Hübe aus seinem Inhalator. Er hielt die Luft an, bis ihm leicht schwindlig wurde, und lauschte den fern klingenden Popsongs, die knisternd durch den Hörer drangen wie bei einer schlechten Verbindung. Irgendwann meldete sich eine Frau. Sie sprach walisischen Dialekt und klang nett. Sie stellte sich als Linda vor.
»Hallo, hier ist Benjamin Glass«, sagte er.
»Hallo, Benjamin Glass. Was kann ich für Sie tun?«
»Ich rufe an, weil hier ein Hund ist, der mir immer weiter folgt«, sagte er. »Ich habe ihn am Strand bei einem toten Wal getroffen, und er hat daran geleckt. Dann ist er mir nach Hause gefolgt.«
»Ein toter Wal?«, sagte Laura.
Benjamin fand, dass die Frage etwas an der Sache vorbeiging. Der Wal saß schließlich nicht auf der Terrasse.
»Ja. Am Strand. Meinen Sie, er könnte infiziert sein?«
Laura antwortete nicht, also sprach Benjamin weiter.
»Ich fange an zu keuchen, wenn ich gestresst bin«, sagte Benjamin und hoffte, die Stille rührte nur daher, dass sie über eine Lösung nachdachte. »Ich musste meinen Inhalator benutzen.«
»Fangen wir mal mit der Hunderasse an«, sagte Laura.
Benjamin überlegte. Der Hund war wie andere Hunde, nur mit einem tieferen Brustkorb und längeren Beinen.
»Er sieht aus wie ein Rennrad«, sagte er.
»Aha.«
»Und er hat so ein interessantes Fell. Wie ein Tiger.«
»Okay. Sonst noch was?«
»Ein paar von seinen Rippen gucken raus«, sagte er. »Nicht, weil er ausgehungert ist. Ich glaube, die sehen immer so aus, oder?«
»Was sieht so aus?«
»Diese Hunde.«
»Schon möglich«, sagte Laura. »Könnte es ein Windhund sein?«
Im Hintergrund hörte Benjamin weitere Telefone klingeln. Stühle stießen gegen Schreibtische.
»Ja«, sagte er. »Ich glaube schon.«
Laura antwortete nicht gleich. Das schien so ihre Art zu sein.
»Steht vielleicht ein Name auf seinem Halsband?«, sagte sie.
»Ich weiß nicht. Ich versuche, ihn nicht anzufassen.«
»Wo ist er denn jetzt?«
»Ich habe ihn auf der Terrasse gelassen.«
»Verstehe. Und ist er noch da?«
»Ich weiß nicht. Soll ich nachsehen?«
»Das wäre nett.«
Benjamin ging langsam zur Tür, zog dabei das Telefonkabel so lang wie möglich und sprach lauter, weil der Hörer nicht mehr ganz an seinen Kopf heranreichte. Als er durch den Briefschlitz spähte, sah ihm der Hund durch den Schlitz direkt in die Augen. Er leckte sich über die Lippen und zitterte.
»Ich sehe ihn. Er ist noch da«, sagte Benjamin. »Er zittert jetzt.«
»Besteht vielleicht die Möglichkeit, ihn hereinzulassen?«
»Auf gar keinen Fall«, sagte er. »Er ist ein einziger Bazillenherd. Sie müssten bitte kommen und ihn abholen.«
Benjamin öffnete den Vorhang. Es tat ihm leid, das zu sagen, weil der Hund gefühlvolle Augen hatte und weil es draußen kalt war, aber er wollte nicht, dass er seine Genitalien an den Sitzmöbeln rieb und im ganzen Mobilheim Mikroben verteilte.
»Ist er verletzt?«, fragte Laura.
»Sieht nicht so aus. Sein linkes Auge ist ein bisschen blutunterlaufen, glaube ich. Schwer zu sagen von hier aus.«
»Sieht er aus, als hätte er kürzlich gefressen?«
Benjamin musterte den Hund durchs Fenster.
»Abgesehen von dieser Rippensache?«, sagte er.
»Ja. Wirkt er hungrig?«
Benjamin mochte es nicht, unter Druck gesetzt zu werden und das einfach so entscheiden zu müssen. Schließlich war er kein Hundeexperte.
»Warten Sie«, sagte er, stellte das Telefon auf dem Fensterbrett ab und rannte zum Schrank.
Er nahm das letzte Stück Weißbrot aus der Tüte und schob es durch den Briefschlitz. Das Schnüffeln des Hundes wurde durch den Schlitz noch verstärkt, als er das Brot untersuchte, aber er fraß es nicht.
»Er hat keinen Hunger«, sagte Benjamin.
Benjamin hörte, wie Laura jemandem im Hintergrund die Situation erklärte. Während er wartete, kratzte er sich an einer juckenden Stelle am Unterarm, bis die Haut rot wurde.
»Benjamin«, sagte Laura schließlich, »sind Sie noch da?«
»Ja. Bin noch da«, sagte er.
Sie zögerte.
»Unser Problem mit ihrer, äh, Situation ist, dass wir keine gesunden Hunde abholen.«
Benjamin begriff nicht. Es war ja nicht sein Hund. Er dachte, er hätte sich vielleicht verhört, und bat Laura, es zu wiederholen.
»Wir holen keine gesunden Hunde ab, Benjamin«, sagte sie.
In der einsetzenden Stille dachte Benjamin über einiges nach. Über die Zunge des Hundes, die den Blubber berührt hatte. Über seine nackten Pfoten, die auf allen Oberflächen Fremdkörper hinterließen, und über Camille, die glaubte, Tiere wären zu komplexen menschlichen Empfindungen wie Scham und romantischem Verlangen fähig.
»Haben Sie schon mal von Toxocara canis gehört, Laura?«, fragte er schließlich.
Sie verneinte.
»Das ist eine Art Parasit, der in den Ausscheidungen von Hunden lebt. So eine Art widerlicher Wurm, der hinter den Augen wächst, bis man blind wird.« Benjamin ließ das ein paar Sekunden lang wirken. Die Haut unter seinem Kinn begann zu jucken. »Das kann zu Leber- und Lungenversagen führen.«
Benjamin hörte im Hintergrund ein Telefon klingeln. Er wartete darauf, dass Laura antwortete.
»In der Gemeinde gibt es einen Hundefänger«, sagte sie. »Ich gebe Ihnen mal seine Nummer.«
»Großartig«, sagte Benjamin erleichtert. »Ich will keine große Sache daraus machen oder so, aber er hat mich schon ein paarmal berührt.«
»Berührt?«
»Ja. An der Hand.«
»Ich gebe Ihnen jetzt die Nummer durch, Benjamin …«
Er unterbrach sie.
»Entschuldigung, Laura«, sagte er. »Ein Mal. Eigentlich nur ein Mal.«
»Ein Mal was?«
»Er hat mich nur ein Mal berührt.«
Noch eine Pause. Lauras kaum hörbarer Atem.
»Die Telefonnummer, Benjamin. Sie lautet –«
»Ich habe gelogen, damit es sich schlimmer anhört. Er hat mich nur das eine Mal berührt.«
Laura las die Nummer vor. Er schrieb sie mit zittriger Hand auf einen Briefumschlag; seine Haut war vor Anspannung kalkweiß.
»Es tut mir leid, dass ich gelogen habe, Laura«, sagte er.
»Gibt es vielleicht Angehörige, die helfen könnten?«
»Meine Oma weiß normalerweise, was zu tun ist«, sagte Benjamin.
»Prima. Wo ist sie denn?«
Er stockte. Er sagte das Wort »Krankenhaus« nicht gerne. Das fühlte sich an, als würde er etwas Böses heraufbeschwören.
»Sie ist beim Bingo«, sagte er.
»Gut … dann kann sie dir helfen, wenn sie nach Hause kommt?«
»Es ist ein Bingo-Urlaub«, sagte er.
»Ich wusste gar nicht, dass es so etwas gibt. Wo ist sie denn genau?«
»Teneriffa.«
Benjamin fragte sich, was seine Oma wohl zu der ganzen Sache gesagt hätte. Er wusste, dass sie den Hund gemocht hätte, weil sie Tiere mochte, aber dadurch fühlte er sich zugleich besser und schlechter. Besser, weil er wahrscheinlich das Richtige tat; schlechter, weil sie es ihm nicht sagen konnte.
»Irgendwelche Nachbarn vielleicht?«
Benjamin schaute reflexhaft nach draußen. Es gab einen Nachbarn, aber er war nicht von der hilfreichen Sorte. Er hatte unfreundliche Ansichten über Menschen aus dem Ausland und sagte Dinge über Frauen, die sich nicht gehörten. Camille kannte ihn nur flüchtig aus dem Supermarkt, war sich aber sicher, dass er für den EU-Austritt gestimmt hatte.
»Hier ist gerade Nebensaison«, sagte Benjamin. »Es ist keiner da.«
»Na schön. Aber der Hundefänger ist erst ab Montag wieder erreichbar.«
»Ich kann ihn doch schlecht bis Montag auf dem Balkon lassen«, sagte Benjamin.
»Ja, das ist schlecht«, sagte Laura.
Benjamin kratzte sich am Ellbogen. Wieder schaute er durchs Fenster auf den Hund, der auf der Terrasse aus kleinen Pfützen schlürfte. Er stellte das Telefon ab.
»Verdammte Kacke«, sagte er zum dritten Mal an diesem Tag.
Draußen frischte der Wind auf, die Grashalme neigten sich. Benjamin zog ein Paar Spülhandschuhe über und ging zur Tür. Er öffnete sie so weit, dass er den schlanken Körper des Hundes erspähen konnte, der fröstelnd im Regen stand; sein Brustkorb drückte von innen gegen das Fell mit dem Tigermuster.
Er steckte den Kopf in die Öffnung.
»Du wirst wohl reinkommen müssen«, sagte Benjamin.
2
Drinnen taperte der Hund herum, zog die Leine hinter sich her und schnüffelte. Er zitterte immer noch.
»Mit einem höheren Körperfettanteil würdest du die Kälte wahrscheinlich nicht so spüren«, sagte Benjamin und folgte ihm in die Küche. Seine Krallen klickten auf dem Linoleumboden, als er zu einem der Schränke ging und an einem Fleck an der Tür leckte. »Das muss ich dann wohl sauber machen«, sagte Benjamin.
Der Hund kam herüber und stellte sich vor ihn, die Vorderpfoten dicht beieinander.
»Ich weiß gar nicht, warum dir noch kalt ist«, sagte Benjamin. »Du bist doch drinnen.«
Geschützt durch seine Gummihandschuhe, löste er die Leine des Hundes und legte sie auf die Arbeitsplatte. Dann beugte er sich hinunter und rieb über die dickeren Stellen seiner Hinterbeine, fuhr mit der Hand über die Höcker der Wirbelsäule. Mit der flachen Hand an der Flanke des Hundes spürte er das Beben seines Herzens, das die Rippen nach außen drückte und das Blut in seinen Körper pumpte.
»Hast du dich verirrt?«, sagte er.
Aber die Frage kam ihm dumm vor. Denn manchmal war es schwer zu sagen, ob man sich verirrt hatte oder nicht. Er wusste, dass man sich fehl am Platz fühlen konnte, auch wenn der eigene Körper genau dort war, wo er sein sollte. Dass es oft gar nichts mit dem Ort zu tun hatte.
Der Hund ging zum Kaffeetisch hinüber, wobei er das Sofa streifte, und versenkte die Schnauze in einer kalten Tasse Tee. Benjamin nahm die Tasse und sah eine tote Motte, die sich in der Flüssigkeit auflöste und die Oberfläche mit Schlieren überzog. Er merkte sich, wo der Hund die Tasse berührt hatte. Als er den Tee in die Spüle schüttete, blieb die Motte kurz im Abfluss hängen, bevor sie verschwand. Benjamin fragte sich, ob der Hund Salzwasser und aus Pfützen hatte trinken müssen, als er auf sich allein gestellt gewesen war.
»Ich gebe dir etwas zu trinken«, sagte er und füllte eine Salatschüssel mit Wasser.
Er stellte die Schüssel vor dem Hund ab, der lange trank. Als er den Kopf hob, hingen winzige Wassertropfen in den feinen Haaren an seiner Schnauze. Benjamin sah zu, wie einer davon in den Fasern des Teppichs landete.
»Du kommst jetzt ins Bad«, sagte er. »Ich kann nicht klar denken, wenn du hier alles berührst und überall herumläufst.«
Benjamin führte den Hund ins Bad, wobei er darauf achtete, ihn nicht zu berühren. Als er die Tür schloss, betrachtete ihn der Hund mit ruhigem Blick.
»Es ist nicht für lange, wirklich«, sagte er und hoffte, der Hund würde nicht urinieren.
Benjamin sprühte Desinfektionsmittel auf die Stellen, die der Hund berührt hatte. Auf dem pfirsichfarbenen Läufer hielt er kurz inne, um die Zehen in dem dichten Flor zu spreizen. Er griff nach einem Kissen, drückte das Gesicht hinein und schrie laut auf. Dann sah er sich im Spiegel an. Sein Gesicht und sein Hals waren rot. Er stand stumm da.
»Mir geht’s gut«, sagte er laut, für den Fall, dass der Lärm den Hund beunruhigt hatte, dass sein Gefühlshaushalt durcheinandergeraten war.
Als an der Kasse einmal eine Hähnchenverpackung aufgeplatzt und die Flüssigkeit in die Elektronik von Benjamins Waage gelaufen war, hatte Camille ihm ausführlich erklärt, wie wichtig es sei, die negativen Gefühle herauszulassen. Während Benjamin den Großteil der nächsten vierzig Minuten damit verbrachte, den rosafarbenen Hühnersaft von seinen Händen und seinem Arbeitsplatz abzuwaschen, erläuterte Camille ihm, dass die Energie stetig und ununterbrochen fließe und man ihr ein Ziel geben müsse, so wie bei einem Fluss, der ins Meer ströme. Sie sagte, ihr genüge es manchmal, nach einer schwierigen Schicht in eine Jacke zu schreien. Sie hatte ihm eine in die Hand gedrückt.
»Mir ist nicht kalt«, sagte Benjamin.
»Die ist nicht zum Anziehen. Wir vertreiben jetzt ein paar negative Empfindungen«, sagte sie und setzte sich auf einen in der Nähe stehenden Schemel. »Ich finde, eine erhöhte Position hilft immer. Sie verleiht dir Schutz.«
Benjamin schaute zu Camille hoch und wartete auf ein Zeichen, wie es weitergehen sollte. Als sie das Gesicht in die Jacke drückte, tat er es ihr gleich. Sie schrien, bis ihre Gesichter puterrot waren.
»Fühlst du dich jetzt besser?«, fragte Camille. »Freier?«
»Ein bisschen«, sagte Benjamin.
Aber eigentlich ging es ihm viel besser. Einerseits wegen des Schreiens und andererseits, weil Camille ihn dazu brachte, sich weniger Sorgen zu machen. Sie zerbrach sich selten den Kopf über etwas, und er fand das tröstlich. Sie war vertrauensvoll und freundlich, und das reichte ihm.
Im Mobilheim rollte Benjamin die Gummihandschuhe über seine Unterarme und Hände und hängte sie über den Rand der Spüle. Er riss ein Blatt aus einem Notizblock auf dem Tisch und listete die Stellen auf, die der Hund berührt hatte. Wand im Flur, Sofa (schon abgewischt). Ganzer Teppich.
Die Liste war hilfreich. Sein Gedächtnis arbeitete weniger zuverlässig, wenn er aufgeregt war, und sie würde verhindern, dass er vergaß, welche Gegenstände und Bereiche der Hund schon besudelt hatte.
Im Badezimmer stand der Hund auf dem Badvorleger, wo er ihn zurückgelassen hatte.
»Tut mir leid, dass ich geschrien habe«, sagte er. »Ich musste mich bloß abreagieren.« Benjamin stellte das »Abreagieren« pantomimisch dar, indem er die Hände um die Schläfen kreisen ließ. Während er sprach, drehte der Hund die Ohren und den Kopf, als könnte ihm ein anderer Winkel bei der Entschlüsselung von Benjamins Worten helfen.
»Aber ich habe jetzt eine Liste«, sagte er und wedelte mit dem Blatt Papier. »Dann muss ich mir nicht so viele Gedanken darüber machen, dass du meine Sachen verschmutzt. Ich kann sie später reinigen.«
Der Hund gähnte und reckte den Hals.
»Ich gehe baden«, sagte Benjamin.
Benjamin drehte beide Wasserhähne voll auf, dann faltete er seine Kleider zusammen und legte sie auf den Klodeckel. Während sich die Wanne mit Wasser füllte, betrachtete er seinen nackten Körper im Spiegel. Als Kind hatte er seine blasse Hautfarbe immer genau im Auge behalten, weil er im Geschichtsunterricht von der Pest gehört und Angst gehabt hatte, grau zu werden und dann zu sterben wie die armen Leute im Geschichtsbuch. Seine Beine waren mit Gänsehaut überzogen. Reflexartig umfasste er die Hoden, um sie nach Knoten abzutasten.
»Du kannst dich hinlegen. Wenn du willst«, sagte er zu dem Hund und deutete auf den Boden.
Während das Badewasser einlief, beschrieb der Hund ungelenke kleine Kreise auf dem Boden. Nach drei oder vier Drehungen nahm er eine sphinxartige Haltung ein, die Vorderbeine ausgestreckt, die Hinterbeine angezogen. Benjamin stellte sich in die Badewanne. Als er sich hinsetzte, fühlte er, wie die heiße Flut der Sauberkeit an seinem Körper emporstieg und seine Haut wärmte. Er ließ sich hinabgleiten, bis das Wasser seinen Nasenrücken erreichte, und blinzelte ein paarmal, dann tauchte er ganz unter.
Mit unter Wasser geöffneten Augen sah er, wie sich seine Haare vom Kopf hoben und wie Seetang hin und her wogten. Er spürte, wie sein Körper nach Sauerstoff verlangte, wie das Adenosintriphosphat in seinen Zellen aufgezehrt wurde, während er die Tage zu zählen versuchte, die seine Oma schon im Krankenhaus lag. Das Licht auf den Kacheln schwankte in geraden, leuchtenden Diagonalen.
Die lange dunkle Form des Hundekopfs erschien vor ihm, schwebte über der Wasseroberfläche. Als Benjamin sich aufsetzte, wich der Hund zurück, aber er konnte trotzdem das Namensschild an seinem Hals lesen.
DER GROSSE GARY stand da.
3
Benjamin trocknete sich ab, während das Wasser gurgelnd zwischen seinen Füßen im Orkus verschwand. Er schlang sich das Handtuch um die Hüfte und stieg auf den Badvorleger.
Im Wohnzimmer schaltete er den Nachtspeicherofen ein und nahm eine Handvoll sauberer Kleider vom Wäscheständer. Während er sich einen Pullover über den Kopf zog, sprang Gary aufs Sofa und rollte sich wie eine Garnele zusammen.
»Gott noch mal«, sagte Benjamin, obwohl er wusste, dass das Blasphemie war. Er warf einen Blick auf das Aquarell des Messias über dem Kaminsims. Seine Oma war nie sonderlich gläubig gewesen, aber sie hatte das eine oder andere religiöse Symbol herumstehen, weil ihr Vater Pfarrer gewesen war. Benjamin verstand den Reiz daran – an etwas zu glauben, was größer war, was hinterher kam –, aber es war ihm nie gelungen. Das Ende erschien ihm endgültig. Die Stille, nachdem ein Glas zerschmettert wurde. Die leeren Seiten am Ende eines Buchs.
Benjamin hoffte, dass seine Oma anders dachte, dass sie glaubte, wenn die Lichter ausgingen, würde sie anderswo aufwachen, in einem anderen Körper. Einem anderen Leben. Er nahm ein Kissen und schob Garry damit halbherzig an den Rand des Sofas.
»An deinen Füßen kleben vielleicht Kackepartikel«, sagte er und drückte ein wenig fester, während er sich die Teile einer Hundepfote vorstellte, die solche Partikel beherbergen könnten. Er wedelte mit gespreizten Fingern durch die Luft wie jemand, der Nagellack trocknete, dann beugte er sich weit vor und sah sich die Pfoten des Hundes genau an.
»Ich kann dir eine bequeme Unterlage machen«, sagte er, nahm eine Decke vom Lehnsessel und legte sie über die Kissen am anderen Ende des Sofas. »Die ist richtig gemütlich und leicht zu waschen«, sagte er. »Du musst nicht mal vom Sofa runter. Du darfst es bloß nicht direkt berühren.«
Gary öffnete ein Auge, dann erhob er sich und ging zu der Decke.
»Danke«, sagte Benjamin und setzte Sofa – Sofakissen auf die Liste.
Benjamin ließ sich auf den Boden nieder und schaltete den Fernseher ein. Ein blauer Schimmer ergoss sich über den Teppich, während er durch die Kanäle zappte und genau in dem Moment bei einer Naturdokumentation landete, als ein Pinguin von einem Seeleoparden gefressen wurde. Gary starrte auf den Bildschirm, auf das Maul des Seeleoparden, das sich fest um den Pinguin schloss, dessen winzige schwarze Augen Panik ausstrahlten.
»Entschuldige«, sagte Benjamin und schaltete um.
Hinterher dachte er an den Pinguin, der im starken Wellengang trieb, an seinen Körper, der sich im weiten, kalten Bauch des Ozeans hob und senkte. Er dachte an das wogende Wasser, das ihn umgab, und an die tragische Endgültigkeit dessen, was danach kam. Er griff nach einem Faltblatt auf dem Couchtisch mit der Aufschrift Sunrise Take-It-Away und versuchte, sich mit den Empfehlungen des Küchenchefs abzulenken, aber der einsame Kampf des Pinguins ging ihm nicht aus dem Kopf.
»Wir sollten etwas essen«, sagte Benjamin und hielt den Flyer hoch. Er stellte den Fernseher leiser, griff zum Telefon und wählte die Nummer.
»Du frisst wahrscheinlich andauernd Fleisch«, sagte Benjamin. »Aber ich esse nicht gern Tiere.«
Er bestellte ein vegetarisches Menü für zwei.
Draußen fuhr ein Auto vorbei und schreckte Gary auf. Die Scheinwerfer erhellten die Fenster und warfen lange Schatten, die über die Rückwand glitten. Der Hund sah aus, als wartete er darauf, dass etwas geschah. Als nichts passierte, sprang er vom Sofa und ging zur Tür, wo er weiter wartete, die Schnauze zehn Zentimeter vor dem Glas in die Luft gereckt.
»Was willst du?«, sagte Benjamin und starrte auf den gewölbten Kopf des Hundes.
Gary ließ einen langen Atemzug entweichen und schloss die Augenlider.
»Es ist dunkel draußen«, sagte Benjamin.
Der Hund trat unruhig auf der Stelle. Benjamin wusste nicht, wie er eine Urinlache beseitigen sollte.
»Dann lasse ich dich wohl mal raus«, sagte er.
Auf dem Fußabstreifer kniff Benjamin die Augen zusammen und lauschte. Er versuchte, Garys draußen umherirrende Gestalt von den massiven Umrissen anderer Dinge zu unterscheiden; es bereitete ihm Sorgen, dass so ein verirrter Hund auf sich allein gestellt war. Was, wenn er versehentlich Rattengift fraß oder auf die Straße lief?
Als er glaubte, Gary hätte lange genug Zeit gehabt, um sich gründlich zu erleichtern, rief Benjamin nach ihm, aber der Wind schien seine Stimme zu verschlucken. Als er es lauter wiederholte, übertönte ihn das Rauschen der Wellen, die sich an Land brachen. Er spürte die ihn umgebende Dunkelheit wie etwas Körperliches. Als er zu den Lichtern der Stadt hinübersah, erschienen ihm die Häuser und Menschen auf eine Weise fern, die nichts mit räumlichen Verhältnissen zu tun hatte. Er dachte an seine Oma. An den Krankenwagen, dessen blaues Licht stumm über die Außenwände des Mobilheims geglitten war, und daran, wie das Essen, das sie an dem Abend gekocht hatte – Erbsen und ein kleines Schweinekotelett – kalt neben einem umgestürzten Teller auf dem Linoleum gelegen hatte. Er erinnerte sich, wie es sich angefühlt hatte, sie auf dem Boden zu finden, ein Gefühl, als wäre er kaum noch mit seinem Körper verbunden. Als könnte sein Körper davonlaufen und er könnte vergessen, ihm zu folgen. Als er sie hochzog und während sie blinzelnd dalag, lächelte sie ihn mit einer Seite ihres Mundes an. Er versuchte zu sprechen, aber die Gefühle ließen sich nicht in Worte fassen. Er wollte ihr sagen, dass alles gut werden würde. Dass sie ihm etwas bedeutete, auf eine Art, die dicht und endgültig war, wie Stein, Erdgestein, die gebrechliche Körper überstieg. Aber er schien es nicht herauszubekommen.
Die Sekunden krümmten sich. Je länger Benjamin wartete, desto weniger wusste er, wie lange er schon wartete, bis er sich schließlich fragte, ob das alles war. Ob das, was da gerade mit dem Hund passiert war, nicht der Anfang, sondern das Endergebnis von etwas gewesen war. Er überlegte noch, was von beidem er sich eher gewünscht hätte, als Gary wieder hereinsprang, kleine Atemwölkchen in die Luft hauchend, und ihn überkam eine Erleichterung, die seine Brust erfüllte und seine Haut kribbeln ließ.
Er folgte Gary zurück zum Sofa. Der Hund rollte sich auf der Decke zusammen und schloss die Augen, und Benjamin betrachtete ihn. Nach einer Weile begann er weiter durch die Kanäle zu schalten, wobei er den Ton leise gedreht ließ, um den Hund nicht zu stören. Bei den Nachrichten hielt er inne. Auf dem stumm geschalteten Fernseher verkündete eine Textzeile am unteren Bildrand:
AUSLÄNDISCHER STUDENT POSITIV AUF FLEDERMAUSVIRUS GETESTET.
Mehr wollte er nicht wissen, also schaltete er wieder auf die Dokumentation. Das war nicht viel besser. Jetzt umkreisten Haie einen Schwarm Fische und stießen dann seitlich hinein. Der Hund war wieder wach. Er schien immer dann zuzuschauen, wenn etwas Schlimmes geschah. Seine Augen ruhten weiter auf dem Bildschirm, als Benjamin eine Schublade öffnete.
»Vielleicht sollten wir uns einfach einen Film ansehen«, sagte er und fuhr mit der Hand über die Reihen von VHS-Kassetten mit aufgezeichneten Filmen. Die Etiketten waren in Großbuchstaben beschriftet. Während Benjamins Blick über die Kassetten streifte, stellte er sich vor, wie seine Oma darauf schrieb, wie sie die Spitze des Filzstifts auf das Papier drückte und das leichte Zittern ihrer Hand die horizontalen Linien leicht wellte. Er versuchte vergebens, das Bild von ihr im Krankenhausbett zu verdrängen, als seine Hand den Kopf des Hundes streifte. Aus offensichtlichen Gründen zuckte er zurück, aber wieder war er froh, dass der Hund zurückgekommen war.
»Der hier ist gut«, sagte er und hielt eine Kassette mit der Aufschrift »E-Mail für dich« hoch. Er schob sie in das Gerät und drückte auf Wiedergabe. Die Räder im Inneren begannen sich zu drehen und machten ein surrendes Geräusch, während krisselige Linien über den Bildschirm liefen und wieder verschwanden. Gary wich zurück.
»Der ist mit Tom Hanks und Meg Ryan«, sagte Benjamin. »Sie fangen an, sich gegenseitig romantische Mails zu schicken, aber als sie herausfinden, dass sie Geschäftsrivalen sind, geht es drunter und drüber, weil er für Veränderung steht. Die Qualität ist nicht so gut, weil es VHS ist.«
Genau an der Stelle, an der Tom Hanks erkannt hatte, wo seine E-Mails landeten, hielt ein Auto draußen auf dem Rasen. Gary erhob sich mit gespitzten Ohren und lauschte auf das Geräusch des Motors.
»Das ist bloß das Essen«, sagte Benjamin und hielt den Film an. Er hörte, wie sich der Fahrer räusperte, bevor er klopfte.
»Zwei Sekunden«, rief Benjamin und hielt Gary mit seinem Bein von der Tür fern. Er öffnete sie gerade so weit, dass er den Kopf und einen Arm hindurchstecken konnte und die Lampe im Flur ein dreieckiges Stück der Terrasse erhellte. Der Fahrer warf eine Zigarette über die Schulter und hielt eine weiße Plastiktüte mit Essen hoch.
»Chinesisch, Kumpel?«, sagte er und legte den Kopf in den Nacken, um eine Rauchwolke auszustoßen. Benjamin versuchte, nichts davon einzuatmen.
»Können Sie es bitte auf dem Fußabstreifer abstellen?«, sagte Benjamin.
Der Mann nickte und starrte auf Gary.
»Das ist ein echter Klassehund«, sagte er und bückte sich, um die Tüte abzustellen. »Sieht aus wie ein kleines Rennpferd.«
Zigarettengeruch wehte durch die offene Tür herein, als er Garys Kopf tätschelte.
»Der freut sich bestimmt auf ein Hühnerbällchen, was?«, sagte er lachend. Er streckte die Hand aus und ließ sich von Gary die Finger abschlecken.
»Was bekommen Sie bitte?«, sagte Benjamin und versuchte, Gary mit dem Bein zurückzuschieben. Aber der Mann hörte die Frage nicht. Seine Augen bewegten sich weiter über den Hund. Verengten sich. Kalkulierten irgendetwas. Benjamin fragte sich, ob der Mann sich immer die Hände von Tieren ablecken ließ, wenn er das Essen ausfuhr, und wünschte, er würde nicht so schwer atmen und Rauch durch die offene Tür pusten. Der Mann griff in seine Jeanstasche und zog einen Zettel heraus.
»Macht zusammen achtzehn-vierzig«, sagte er. »Ohne Trinkgeld.«
Benjamin holte einen Zwanziger heraus. Er gab ihn dem Mann, der ihn einsteckte, ohne Rückgeld anzubieten.
»Das ist ein auffälliges Muster. Nennt man gestromert, oder?«
»Ich weiß es nicht genau«, sagte Benjamin. »Er ist nur vorübergehend hier.«
Der Mann sah zwischen Benjamin und dem Hund hin und her.
»Ja. Man nennt es gestromert«, sagte er.
In dem Auto hinter ihm lief noch der Motor.
»Der Motor läuft noch«, sagte Benjamin.
Der Mann richtete sich auf.
»Manchmal springt er nicht an, darum lasse ich ihn laufen, wenn ich Essen ausfahre«, sagte er. »Ich warte den Wagen selbst, aber in letzter Zeit habe ich beim Ausliefern ordentlich Überstunden gemacht.« Er rieb den Daumen an Zeige- und Mittelfinger, um anzudeuten, dass er gut verdiente. »Das Auto ist dabei ein bisschen kurz gekommen«, sagte er.
Benjamin nickte.
»Dann vielen Dank«, sagte er und schloss die Tür.
Benjamin linste durch den Vorhang. Er sah, wie der Mann die Treppe hinunterging, kurz das Gras nach der weggeworfenen Zigarette absuchte und sich dann daran machte, eine neue anzuzünden. Er sah, wie er ins Auto stieg und eine Streichholzschachtel aus dem Handschuhfach nahm. Während er sich die Zigarette ansteckte, starrte er auf die Vordertür des Mobilheims, und Benjamin beobachtete ihn. Dann schnippte der Mann das Streichholz aus dem offenen Fenster und fuhr davon. Die Rücklichter des Wagens verblassten, während er sich aus dem Park schlängelte.
Benjamin schloss die Tür ab und legte ein paar vegetarische Frühlingsrollen in eine Aluschale. Er gab etwas Reis dazu und stellte die Schale vor Gary auf den Küchenboden. Der Hund beugte sich hinunter und nahm eine Frühlingsrolle ins Maul. Er kaute ein paarmal darauf herum, dann ließ er sie auf das PVC fallen.
»Ist bestimmt heiß«, sagte Benjamin und hob die Schale auf. Er pustete auf das Essen, um es abzukühlen. »Jetzt wird es besser gehen«, sagte er. Gary versuchte es noch einmal; diesmal schluckte er die Frühlingsrolle unzerkaut hinunter. Er ging zu der anderen auf dem Boden und verschlang sie ebenfalls. Benjamin sah ein dünnes Stück frittierten Teig, das sich in den Tasthaaren an seiner Schnauze verfangen hatte.
»Du kannst die Kalorien bestimmt gebrauchen«, sagte Benjamin.
Als sie aufgegessen hatten, holte Benjamin seinen Schlafsack aus dem Schrank und zog an der Vorderseite des Sofas, um ein Bett daraus zu machen. Gary beobachtete die Verwandlung genau; als es in der neuen Position einrastete, wich er zurück und wartete ab, ob noch etwas passierte. Als nichts weiter geschah, sprang er wieder hinauf und rollte sich zu einer Art Croissant zusammen. Benjamin setzte sich und sah zu, wie Gary die Augen schloss und schließlich tief und fest einschlief. Seine Flanke hob und senkte sich im Rhythmus seines gleichmäßigen Atems. In der Stille beugte Benjamin sich vor und inspizierte eine Narbe, die sich als blassrosa Gewebe über Garys Brust und Hals zog, und er fragte sich, woher sie kam. Es erschien ihm seltsam, dass solche Dinge – was der Hund gesehen, gehört und gefühlt hatte – für immer in seinem Inneren gefangen oder verloren waren.
Benjamin nickte aufrecht sitzend ein, vollständig angezogen und in den Schlafsack gehüllt, und erwachte nur ein Mal von dem nassen Geräusch, als Gary Wasser aus der Salatschüssel trank.
4
Draußen im Dunkel bewegte sich ein Mann durch den nassen Sand und suchte den Strand mit einer Taschenlampe ab. Er ging zügig, die Schultern vorgebeugt, eine Plastiktüte in der Hand.
»Hund«, sagte er mit einem Akzent, und seine Stimme verband sich mit dem leisen Rauschen der Wellen. Er schüttelte die Tüte, griff hinein und zog eine getrocknete Sprotte heraus.
»Ich habe Fisch«, sagte er und hielt den verschrumpelten Fischkörper hoch. Die freie Hand ballte er so fest, dass die Knöchel knackten.
»Fisch für Hund«, sagte er.
5
Benjamin wachte mit Garys Kopf auf dem Oberschenkel auf. Es war fast Mittag.
»Hallo«, sagte er und hob den Schlafsack an, sodass das Kinn des Hundes auf die Kissen rutschte. Gary öffnete ein Auge und gähnte. Seine Zunge war von spinnennetzartig getrocknetem Speichel bedeckt.
»Entschuldige«, sagte Benjamin. »Du hattest mich berührt.«
Benjamin verwandelte das Bett wieder in ein Sofa und öffnete die Vorhänge, was das Mobilheim mit makellosem Licht erfüllte, das die Oberflächen und die bloße Haut seiner Arme erwärmte. Gary streckte sich und legte das Gesicht in einen gelblichen Lichtkeil, während Benjamin die Tür öffnete, um zu lüften. Er wusste nicht, wie lange Erreger in der Luft blieben, und der Lieferant hatte den Kopf ziemlich weit hereingestreckt.
Der Hund trottete auf den Rasen und pinkelte. Auf dem Weg zurück nach oben blieb Gary bei einer Ameise stehen, die über die Terrasse lief. Er sah eine oder zwei Sekunden lang zu, wie sie zwischen seinen Vorderpfoten umherirrte, dann presste er die Zunge darauf. Als weitere Ameisen aus den Ritzen kamen, ging er von einer zur anderen und saugte sie auf. Benjamin wurde unwohl.
»Ich glaube, das ist Mord«, sagte er von der Tür aus. »Die Ameisen sterben, wenn du das machst.«
Es war das Endgültige daran, das Benjamin beunruhigte. Er wusste nicht, wie er es erklären sollte, aber die Ohnmacht, die Endgültigkeit des Geschehens war übermächtig. Es vollzog sich etwas, das sich nicht rückgängig machen ließ.
»Wenn du aufhörst, Insekten zu fressen«, sagte er, »mache ich dir etwas.«
Gary hob den Kopf. Das helle Sonnenlicht betonte die Härchen um seine Augen und ließ sie durchscheinend wirken. Er leckte noch eine Ameise auf und folgte Benjamin nach drinnen.
Gary richtete sich auf, stellte die Vorderpfoten auf die Arbeitsplatte und versuchte, an die Schale mit den Essensresten heranzukommen, also griff Benjamin danach und hielt sie hoch. »Das können wir nicht mehr essen«, sagte er. »In gekochtem Reis wächst bei Raumtemperatur Bacillus cereus. Davon könnten wir eine Lebensmittelvergiftung kriegen.«
Benjamin wusste nicht, ob Hunde Lebensmittelvergiftung bekommen konnten, aber er wusste noch, wie im Supermarkt einmal ein Staffordshirebullterrier ein ganzes Rotkehlchen auf die Fußmatte gewürgt hatte. Camille hatte damals eine Beziehung mit dem Besitzer gehabt, einem Mann, der eine Hypothek auf sein Haus aufgenommen hatte, um Fotos von Füßen zu kaufen. Sie sagte, sie fühle sich immer zu kaputten Männern hingezogen. Nachdem sie sich getrennt hatten, tranken Camille und Benjamin am Lieferanteneingang zuckerfreie Fanta Tropical aus der Dose und teilten sich eine Tüte Edamame-Bohnen. Sie saßen auf der Mauer, ließen die Beine baumeln und sahen zu, wie sich ein paar schmuddelige Tauben um Kartoffelchips zankten.
Benjamin öffnete den Kühlschrank. Die flackernde Innenbeleuchtung erhellte in kurzen Abständen die leeren Glasfächer. Er nahm einen Milchkarton und hielt ihn hoch, um das Haltbarkeitsdatum zu lesen.
»Die ist gestern abgelaufen«, sagte er, schraubte den Deckel ab und schüttete die Milch in den Abfluss. »Ich mache Porridge, aber wir müssen Wasser nehmen, das könnte ein bisschen eklig werden.«
Während Benjamin die Haferflocken umrührte, stand Gary neben ihm, den samtenen Körper an Benjamins Beine geschmiegt. Benjamin ließ den Löffel fallen, und er schlitterte scheppernd über den Boden und spritzte Porridge auf die Schranktüren. Gary fuhr zusammen, als würde das Mobilheim umkippen.
»Ist schon gut«, sagte Benjamin und bückte sich, um die Tür mit einem Lappen abzuwischen.
Gary tappte heran. Er fuhr mit der Zunge über das Linoleum, wo das Porridge gewesen war. Als Benjamin ihm sagte, er solle aufhören, leckte er stattdessen den Schrank ab.
Benjamin setzte Küchenschrank und Boden auf die Liste. Dann hob er den Löffel auf, damit Gary nicht weiter wahllos irgendwelche Oberflächen abschleckte. Er ging zur Hintertür, wobei das kalte PVC abwechselnd an seinen nackten Füßen haftete und sich abzog wie Heftpflaster. Gary folgte ihm nach draußen.
»Wenn man draußen isst, heißt das al fresco«, sagte Benjamin und stellte eine der Schüsseln auf die Terrasse.
Während Gary fraß, blieben kleine Porridge-Klümpchen in seinen Tasthaaren hängen. Als die Schüssel leer war, leckte er sich über die Lefzen, um sie aufzuspüren. Eine kühle Brise fuhr durch das Mobilheim, und der Hund kauerte sich zusammen. Der Wind ließ nach, und die helle Sonne wärmte Benjamins Schultern. Er kniff die Augen fest zusammen und sah Orange durch die Haut der Augenlider schimmern.
»Meins kannst du auch noch haben«, sagte er und stellte seine Schüssel auf die Terrasse.
Es fühlte sich gut an, Gary zu füttern. Er hatte etwas Verletzliches, etwas Schutzbedürftiges. Benjamin wollte die Schüssel immer weiter auffüllen, solange der Hund fraß. Er hatte das Gefühl, Camilles Bedürfnis, sich um beschädigte Partner zu kümmern, etwas besser zu verstehen.
Als der Hund fertig war, trabte er auf eine Lücke in der Hecke zu, hinter der der Weg zum Strand mit dem kaputten Zaun lag.
»Wo willst du hin?«, fragte Benjamin.
Der Hund ging noch ein paar Schritte weiter und blieb dann stehen. Er drehte sich nicht um, sondern blickte den Weg hinunter zum Meer.
»Warte, ich schließe ab«, sagte Benjamin.
Benjamin vergewisserte sich, dass alle Kochfelder ausgeschaltet waren, damit sich das Mobilheim nicht mit Gas füllte, dann folgte er Gary durch die Dünen zum Strand. Der Hund trabte in leichten Schlangenlinien dahin, vom Wind seitwärts getrieben.
»Pass auf die Muscheln auf«, sagte Benjamin und kickte eine beiseite. »Das sind Messermuscheln, daran könntest du dich schneiden.«
In der Ferne konnte er wieder die dunkle Silhouette des Wals erkennen, der zusammengesackt im Sand lag. Er sah aus, als würde er versinken; die Grenzen zwischen Körper und Boden verschwammen. Er blieb stehen, um ihn zu betrachten, versuchte, die schieren Größenverhältnisse zu begreifen. Wie ein Gehirn zwölf oder fünfzehn Meter von den Rändern seines Körpers entfernt sein konnte, wie Nerven und Sehnen sich so weit durch Fleisch und Knochen ziehen konnten. Es erschien ihm seltsam, dass etwas so Großes einfach aufhören konnte zu existieren, dass etwas so Komplexes für immer verschwinden konnte.
»Ich will ihn heute nicht sehen«, sagte er und wandte den Kopf von der Kreatur ab, als könnte er die Realität verändern, indem er nicht hinsah. »Nicht aus der Nähe.«
Während sie am Strand entlanggingen, drang Feuchtigkeit vom Sand in die Spitzen von Benjamin Turnschuhen ein. Seine Füße wurden kalt, aber es war schön, mit Gary zu gehen. Irgendwie fühlte es sich lebendig an, so als brauchte der Hund die Brise auf der Haut, die Sonne und die salzige Gischt. Als würde er aufgeladen durch die Geräusche, die in seinen zusammengefalteten Ohren landeten. Benjamin bückte sich und hob einen Stein auf. Er war glatt und grau, mit einem weißen Fleck darauf, der wie eine Wolke aussah. Er fuhr mit den Fingern über eine Seite des Steins und spürte die daran klebenden salzigen Rückstände. Er ließ ihn in die Hosentasche gleiten und betrachtete dann die sich am Horizont träge drehenden Windräder. Gary kackte in den Sand.
»Ich hebe das nicht auf«, sagte Benjamin. »Es macht mir nichts aus, vorübergehend dafür zu sorgen, dass du nicht stirbst, aber deine Kacke sammle ich nicht auf.«
Er stand da und starrte auf Garys Hinterlassenschaft, umringt von wenige Meter über dem Boden schwebenden Möwen. Sie navigierten die unsichtbaren Strömungen unter ihren Flügeln, hoben und senkten sich in den vom Meer herüberwehenden Windböen.
»Ich bin nicht dein Herrchen«, sagte Benjamin und versuchte wegzugehen, gepeinigt vom Bild eines Kindes, das sich die Fäkalien beim Sandburgenbauen oder Fußballspielen auf die Hände oder in die Augen schmierte. Damit konnte er sein Gewissen nicht belasten. Das Rauschen der Brandung klang nun sehr weit entfernt.
Benjamin schaute über den Sand hinweg zu dem langen betonierten Weg, der sich lückenlos am Ufer entlangzog. Er sah nicht einen Menschen. Er atmete tief durch, dann nahm er eine Sandwichverpackung aus seiner Tasche und hob damit eine flache Mulde aus.
Garys Kacke sah aus wie ein Wiener Würstchen. Benjamin hob sie mit der Sandwichverpackung auf und ließ sie in das Loch fallen. Dann warf er wieder Sand darüber.
»Ich kann nicht fassen, dass du mich dazu gebracht hast«, sagte er und ging zum Wasser, um den Karton in die Strömung zu werfen. Er wurde von einer Welle hinausgezogen und schlitterte dann zurück in den Sand.
»Gehen wir«, sagte er.
Der Strand ging in Felsen über und die Felsen in eine Felswand. Benjamin und der Hund folgten einem Weg, der landeinwärts und zu einem Rugby-Feld führte, wo sich Benjamin auf ein buntes Klettergerüst in der Form eines Hubschraubers setzte. Gary lief an einer Hecke entlang und schob die Schnauze in die Blätter.
»In den Busch haben bestimmt schon andere Hunde gepinkelt«, sagte Benjamin. »Den, in den du gerade das Gesicht steckst, meine ich.« Er zeigte aufs Feld. »Lauf dich doch ein bisschen aus.«
Der Hund kam zum Hubschrauber herüber und stellte sich vor Benjamin. Selbst wenn er still dastand, spannten und zuckten die Sehnen in seinen massigen Hinterbeinen. Der Wind frischte auf, und er kauerte sich zusammen. Er trank ein wenig aus einer Pfütze auf dem Asphalt, dann ging er zurück zur Hecke und steckte noch ein wenig das Gesicht hinein.
»Na los«, sagte Benjamin und stand auf. »Guck mal, so.«
Benjamin begann zu laufen. Er machte kurze Sprints im Gras, um den Hund anzutreiben, aber Gary musste sich kaum beeilen, um Schritt zu halten. Er trabte in lockeren Kreisen dahin und wedelte mit dem Schwanz, bis Benjamin stehen blieb. Auf dem Feld war es still bis auf das Geräusch von Garys Atem, der nun etwas schwerer ging, während sich seine Lunge füllte und die Haut über seinem Brustkorb straffte.