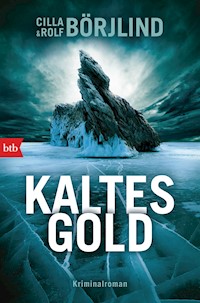10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Rönning/Stilton-Serie
- Sprache: Deutsch
Nummer-2-SPIEGEL-Bestseller – »Olivia Rönning und Tom Stilton sind als Ermittlerduo einsame Klasse.« Svenska Dagbladet
Olivia Rönning ist verschwunden. Ihre Kollegin Lisa Hedqvist ist sich sicher, dass sie entführt wurde. Als Tom Stilton von der Sache erfährt, kehrt er aus seiner selbstgewählten Corona-Isolation in den Stockholmer Schären in die Stadt zurück. Er und Lisa folgen der Spur zu einer einsamen Hütte. Doch als sie sie erreichen, steht das Haus bereits in Flammen. Eine tote Frau wird gefunden. Ist es Olivia?
Zur gleichen Zeit koordiniert ihre frühere Chefin Mette Olsäter die Sicherheit der landesweiten Corona-Impfstofflieferungen, doch es gibt Hinweise, dass der Transport sabotiert wurde ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 502
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Zum Buch
Olivia Rönning ist verschwunden. Ihre Kollegin Lisa Hedqvist ist sich sicher, dass sie entführt wurde. Als Tom Stilton von der Sache erfährt, kehrt er aus seiner selbstgewählten Corona-Isolation in den Stockholmer Schären in die Stadt zurück. Er und Lisa folgen der Spur bis zu einer einsamen Hütte in den Wäldern von Südschweden. Doch als sie sie erreichen, steht das Haus bereits in Flammen. Die verkohlte Leiche einer Frau wird gefunden. Ist es Olivia?
Zur gleichen Zeit koordiniert ihre frühere Chefin Mette Olsäter in Zusammenarbeit mit Experten aus ganz Europa die Sicherheit der landesweiten Corona Impfstofflieferungen, doch es gibt Hinweise, dass der Transport von einer Gruppe international operierender Impfgegner sabotiert wurde …
Zu den Autoren
CILLA und ROLF BÖRJLIND gelten als Schwedens wichtigste und bekannteste Drehbuchschreiber für Kino und Fernsehen. Ihre Serie um Polizistin Olivia Rönning und Kommissar Tom Stilton wurde sehr erfolgreich für das ZDF verfilmt. »Wundbrand« und »Kaltes Gold« standen wochenlang auf der SPIEGEL-Bestsellerliste. Die Kriminalromane sind internationale Bestseller und erscheinen in 30 Ländern.
Cilla & Rolf Börjlind
Der gute Samariter
Kriminalroman
Aus dem Schwedischenvon Susanne Dahmann und Julia Gschwilm
Die schwedische Originalausgabe erschien 2020 unter dem Titel »Den barmhärtige samariten« bei Norstedts, Stockholm.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2021 by Cilla & Rolf Börjlind
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe 2022
btb Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Published by Agreement with Grand Agency
Umschlaggestaltung: semper smile, München
Umschlagmotiv: © mauritius images/Gary corbet/Alamy; DEEPOL by plainpicture/Stefan Isaksson; Shutterstock/Nejron Phot
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-25096-6V002www.btb-verlag.de
Böse Taten resultieren oft aus guten Absichten
Sie rannte!
Der Regen peitschte ihr ins Gesicht, als sie durch den dichten Wald hetzte, die Füße wurden von scharfen kleinen Steinen zerschnitten, grobe Äste rissen ihr die Arme kaputt, und das lange nasse Haar klebte über dem Mund.
Doch am schlimmsten war die Dunkelheit.
Der Mond schaffte es nicht durch die Wolken, sie konnte nur wenige Meter weit sehen. Trotzdem war sie gezwungen, schnell vorwärtszukommen, sich mit den Händen den Weg zu bahnen und weiter durch den Wald zu kämpfen.
Nur weg!
Ein Käuzchen rief, und sein Junges erwiderte den Schrei. Das machte ihr keine Angst, das war ihr vertraut. Was sie rennen ließ, hatte zwei Beine und eine Waffe. Sie warf einen Blick über die Schulter. Kein hin und her flackerndes Licht von einer Taschenlampe, also hatte sie einen Vorsprung. Vielleicht würde ihre Flucht erst bemerkt werden, wenn es hell war, und bis dahin sollte sie es in eine bewohnte Gegend geschafft haben.
Im besten Fall.
Sie atmete jetzt schwer.
Drei Tage und Nächte mit auf dem Rücken zusammengebundenen Händen still in einer dunklen Abstellkammer zu sitzen, hatte Spuren hinterlassen, die Anspannung hatte ihr jede Energie geraubt.
Sie lief etwas langsamer.
Der Boden hatte sich in den letzten Minuten verändert. Um ihre Füße herum gurgelte es, und sie nahm den unverkennbaren Geruch von Sumpf wahr. Ihre Hände berührten etwas, das sich wie große Farnbüsche anfühlte.
Da hörte sie hinter sich ein Geräusch, das immer näher kam.
Das hier war keine Eule, das hier bewegte sich ebenerdig. War sie entdeckt worden? Sie blieb abrupt stehen, bewegte sich nicht, tastete mit den Händen und spürte einen Baumstamm neben sich, drückte sich dahinter und hielt die Luft an. Schloss die Augen, um besser hören zu können. Da hallte ein brüllender Ruf durch den Wald.
Ein Hirsch.
Es war nur ein Hirsch.
Als kleines Kind hatte sie sich immer gewundert, dass so schöne Tiere so furchterregend klingen konnten. Sie atmete aus, wartete ein paar Augenblicke, kroch dann hinter dem Baum heraus und lief weiter. Der Himmel hatte sich ein klein wenig aufgehellt, der Regen hatte nachgelassen, doch im feuchten Boden sank sie bis zu den Waden ein. Sie patschte durch den Schlamm, Wurzeln knotiger Erlen machten jeden ihrer Schritte schwerer.
Wie weit war sie wohl gekommen? War sie im Kreis gelaufen?
Wenn nicht, dann musste sie jetzt ein gutes Stück von der Hütte entfernt sein. Rein geografisch hatte sie keine Ahnung, wo sie war. Während der Autofahrt war sie halb ohnmächtig gewesen, wenn sie auch das Gefühl hatte, dass sie eher Stunden als Tage gefahren waren. Wahrscheinlich befand sie sich also nicht in völliger Wildnis.
Da erhob sich direkt vor ihr eine Felswand, nicht steil, aber hoch. Wenn sie die erklimmen konnte, dann würde sie vielleicht von oben irgendwelche Lichter in der Nähe sehen. Ihre Hände suchten Halt am Felsen. Sie bekam einen Ast zu fassen, der sich stabil anfühlte, und zog sich hoch, fand einen Felsvorsprung, auf den sie die Füße stellen konnte, grub die Finger ins weiche Rentiermoos, um besser greifen zu können, schaffte es, sich hochzuhieven, Stück für Stück, und am Ende konnte sie sich über die Kante heben.
Vor Anstrengung sank sie zu Boden und setzte sich hin, um Atem zu schöpfen. Da spürte sie die Kälte. Sie fror. Schließlich hatte sie nur einen dünnen Pullover und ein Paar Jeans an. Ihre Hände zitterten. Sie rieb sie an den Oberschenkeln und versuchte zu erkennen, wo sie sich befand. Hier oben war es nicht ganz so dunkel, sie konnte immerhin die Baumkronen gegen den Himmel erkennen. Sie stand auf und schaute über die Landschaft. So weit sie sehen konnte, kein Licht von irgendwelchen Häusern. Nur Finsternis. Sie sank zu Boden.
Da tauchte es auf.
Das Licht von zwei Scheinwerfern wischte durch den Wald und verschwand wieder. Eine Straße! Da unten war eine Straße! So schnell sie nur konnte, begann sie, die Felswand hinunterzustolpern. Dieses Auto würde sie nicht erreichen können, aber vielleicht kamen ja noch mehr.
Und Straßen führten ja irgendwohin.
In ihrem Eifer, nach unten zu kommen, rutschte sie auf dem glatten Moos aus, konnte sich gerade noch mit dem einen Arm abstützen und spürte, wie es knirschte. Der Schmerz strahlte bis in den Ellenbogen aus, aber sie kümmerte sich nicht darum. Sie musste zur Straße. Da sah sie noch einmal Scheinwerfer weit entfernt zwischen den Baumstämmen auftauchen, sie rappelte sich hoch und begann zu rennen.
Ein paar Minuten später war sie dort, wankte auf die Straße und sank auf die Knie. Das Auto war noch nicht vorbeigefahren, sie hörte, wie sich das Motorgeräusch näherte.
Ich habe es geschafft!
Sie strich sich das nasse Haar aus dem Gesicht und stand auf. Das Auto glitt durch die Kurve, das starke Fernlicht blendete sie. Sie kniff die Augen zusammen, machte ein paar Schritte auf die Straße hinaus und winkte mit ihrem unverletzten Arm. Der Wagen bremste und blieb mit eingeschalteten Scheinwerfern ein Stück vor ihr stehen. Die Fahrertür wurde geöffnet, und im Gegenlicht war eine Gestalt zu sehen, die ausstieg.
»Ich brauche Hilfe!«, rief sie. »Bitte helfen Sie mir!«
Da erkannte sie, wer es war.
Lisa Hedqvist überquerte auf dem Weg zum Polizeipräsidium die Bergsgatan. Sie zog den Mundschutz ab, den sie im Bus aufgehabt hatte, und schob ihn in die Tasche ihrer Regenjacke. Es war Montagmorgen, und die Stadt war genauso grau wie am Tag zuvor. Und wie an allen vorherigen Wochentagen, soweit sie sich zurückerinnerte. Trüber Herbst. Die Sonne hatte sie nur auf einem Instagram-Bild von ihrer Cousine in Neuseeland gesehen. Hier war die Stimmung düster und wehmütig, und zu allem Überfluss gab es auch noch die Pandemie. Den ganzen Sommer über hatte man die Nation in falscher Sicherheit gewiegt, und jetzt wiesen alle Zahlen wieder in die falsche Richtung.
Kein Wunder, dass sie mit hochgezogenen Schultern herumlief.
Gestern hatte sie sich vorgenommen, den Blick doch mal in die Weite zu richten. Auf das, was kommen würde, wenn das hier alles vorbei wäre. Die Infektionsgefahr. Die Dunkelheit. Das Belastende. Dann wäre der Frühling da und die Impfungen und helle Sommertage und Geselligkeit und körperlicher Kontakt.
Sie sehnte sich danach, Freunde umarmen zu können oder erotischen Austausch zu haben. Es war lange her, seit sie das gehabt hatte, und sie vermisste es mit jedem Tag mehr.
Es gab aber noch einen anderen Grund für ihre angespannte Haltung. Sie sollte in einer Viertelstunde an einem Zoom-Meeting teilnehmen, und einer der Teilnehmer – Jens Ovik, Kriminalkommissar aus Göteborg mit kurzen Zähnen und schütterem Haar – war ihr immer unangenehm. Sie war es durchaus gewohnt, dass Männer den Blick ein paar Augenblicke länger auf ihr ruhen ließen, doch mit dem hier war es anders. Sie hatte das Gefühl, dass er sie auf eine Weise ansah, wie sie nicht von einem fremden Mann auf einem Computerbildschirm betrachtet werden wollte.
Als würde er sich mit seinem Blick in sie hineindrängen.
Im Grunde konnte sie gar nicht genau wissen, ob er wirklich sie anschaute, denn auf dem Monitor waren noch zwei andere Teilnehmer. Es war mehr so ein Gefühl, das sie hatte.
Sie hoffte, dass er heute nicht dabei sein würde.
Doch das war er leider, und sein Blick war durchdringend. Sie beschloss, sich auf die beiden anderen Teilnehmer zu konzentrieren, die Polizeichefs der Regionen West und Süd.
»Dann fehlt jetzt nur noch Rönning«, sagte einer von ihnen.
Bei dem Meeting sollte es um Bandenkriminalität und die immer häufiger vorkommenden Schießereien in den Vororten der großen Städte gehen. Olivia sollte von zu Hause aus an der Videokonferenz teilnehmen.
»Ich rufe sie eben an«, sagte Lisa. »Sie hat in ihrer Wohnung ein etwas unzuverlässiges Internet.«
Lisa nahm ihr Handy heraus und wählte Olivias Nummer. Keine Antwort. Ob sie bei Lukas übernachtet hatte? Wollte sie von dort aus teilnehmen? Sie rief Olivias Freund Lukas an, der sofort am Telefon war.
»Hallo Lisa, wie läuft es bei euch?«
Die Frage überrumpelte Lisa.
»Was denn?«, fragte sie.
»Na, der Einsatz?«
»Welcher Einsatz?«
»Ich habe am Freitag eine SMS gekriegt, in der Olivia geschrieben hat, dass sie übers Wochenende einen kurzfristigen Einsatz hat … Gestern habe ich sie angerufen, aber sie ist nicht rangegangen.«
»Sie ist also nicht bei dir?«
»Nein …«
»Okay, danke.«
Lisa beendete das Gespräch und war verwirrt. Es hatte am Wochenende keinen Einsatz gegeben, an dem Olivia beteiligt gewesen wäre.
Sie wandte sich dem Bildschirm zu und sah, dass Jens Ovik grinste.
»Wir werden ohne Rönning anfangen müssen«, sagte sie.
*
Mette Olsäter, Kriminalkommissarin im Ruhestand, war süchtig geworden.
Seit die Pandemie im März mit voller Kraft zugeschlagen hatte, saß sie rund um die Uhr vorm Fernseher und konsumierte Serien, um die Zeit rumzukriegen. Als sie schließlich bei einem animierten Film über Seelöwen, die Opern sangen, angekommen war, griff ihr Mann Mårten ein und stellte ein paar Regeln auf. Mette musste versprechen, nicht mehr als drei Stunden täglich zu kucken.
Wie ein Kind.
Auch auf ihr Gewicht hatte die Pandemie Einfluss: Es war dramatisch angestiegen. An manchen Tagen fühlte sie sich wie ein lebender Sitzsack und schaffte es kaum mehr aus dem Bett.
Doch dann kam der Telefonanruf vom MSB, der Behörde für Gesellschaftsschutz und Bereitschaft, der alles veränderte.
In der EU rechnete man damit, irgendwann im Dezember einen Impfstoff genehmigen zu können, der daraufhin flächendeckend in Europa verteilt werden sollte. Aus Sicherheitsgründen sollten die Lieferungen im Geheimen vonstattengehen, und Mette war jetzt angefragt worden, ob sie als Schlüsselstelle für den polizeilichen Einsatz um die Transporte herum fungieren wolle. Sie hatte viele Jahre Erfahrung in der internationalen Arbeit, dazu ein Kontaktnetz, das den größten Teil Europas abdeckte, und wäre somit die richtige Person für den Einsatz.
Ohne zu zögern hatte Mette zugesagt.
Die Rolle als Koordinatorin war genau, was sie brauchte, um mit der Sucht nach Serien und ihrem Dasein als Sitzsack Schluss zu machen. Seither hatte sie jeden Tag mit einem ziemlich raschen Spaziergang begonnen, um das Gehirn in Gang zu bekommen, ehe die Arbeit losging, und gespürt, wie die Schritte jedes Mal leichter wurden. Außerdem war sie aus den bequemen Klamotten gestiegen, in denen sie das letzte halbe Jahr gewohnt hatte.
Im Moment hielt sie gerade eine Konferenz über Liefersicherheit mit Repräsentanten von Europol ab.
Sie saß in der Küche mit dem Computer auf dem Esstisch – freilich kein idealer Arbeitsplatz, wenn man bedachte, was da im Hintergrund alles zu sehen war. Es gefiel ihr nicht so gut, den internationalen Topmanagern ihre unordentliche Küche zu zeigen. Außerdem hegte Mårten eine Vorliebe dafür, mit offenem Morgenmantel herumzustreunen, und konnte jederzeit ins Bild geraten.
Auch das wollte sie Europa lieber vorenthalten.
Normalerweise arbeitete sie im – wie die Familie es nannte – »Afrikazimmer«, wo sie die meisten ihrer Souvenirs und Schnäppchen von verschiedenen Auslandsreisen aufbewahrten. Dort gab es einen langen, breiten und sehr schönen Holztisch. Doch da konnte man gerade nicht sitzen, denn Mårten hatte sich in den Kopf gesetzt, ein großes Modell der Cutty Sark, eines Segelschiffs aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, zu bauen, und hatte die Teile dafür überall ausgebreitet.
Sie hatten bereits einen kleineren Konflikt über den Modellbau gehabt, doch ihr war schon klar, dass Mårten in der Isolation, in der sie lebten, ein Ventil für die aufgezwungene Einsamkeit brauchte. Er litt am meisten darunter, all ihre Kinder und Enkelkinder nicht treffen zu dürfen, und war auch schon auf dem Weg in eine echte Depression gewesen, als er die Anzeige im Netz sah: »Bauen Sie sich Ihren eigenen Clipper!«
Genau das tat er jetzt, und seine Laune hatte sich beträchtlich gebessert.
Und Mette saß in der Küche und drehte den Monitor so, dass der Blick der Kollegen auf die am wenigsten chaotische Ecke des Raumes fiel.
»Sind wir uns einig, dass Frigicargo für den größten Teil der Lieferungen verantwortlich sein soll?«, fragte sie und sah, dass die Männer auf dem Bildschirm – die Gruppe bestand hauptsächlich aus Männern – nickten.
»Da sie Spezialisten für temperaturkontrollierte Transporte in Europa sind, ist das nur logisch«, antwortete ein belgischer Vertreter.
»Wie steht es bei ihnen um die Sicherheit?«
»Auf jeden Fall besser als bei den Alternativen aus Polen und Österreich.«
»Gut«, sagte Mette, »nehmen Sie Kontakt zu ihnen auf?«
»Ja.«
Da klingelte ihr Handy. Sie sah, dass es Lisa Hedqvist war, zögerte kurz, ging dann aber ran.
»Hallo, Lisa! Kann ich dich später zurückrufen, ich sitze mitten in einem Meeting.«
»Natürlich. Ich wollte nur fragen, ob du weißt, wo Olivia ist.«
»Keine Ahnung«, erwiderte Mette. »Ich melde mich.«
Mette legte auf, entschuldigte sich bei den Teilnehmern der Onlinekonferenz und diskutierte weiter über die Lieferungen.
*
»Hast du was gefangen?«
Luna Johansson stand auf der kleinen, rot gestrichenen Veranda und rief zu Tom Stilton hinüber. Der saß in einem Kunststoffboot in der Bucht vor seinem Haus auf Rödlöga und war dabei, ein Netz aus dem Wasser zu ziehen, das er gestern ausgelegt hatte. Nun hoffte er auf einen guten Fang. Der Wind vom offenen Meer zerrte an seiner braunen Jacke, doch das störte ihn nicht. Er war da, wo er am liebsten sein wollte, wo es ihm am besten ging: weit draußen auf dem Wasser. Der einzige Kontakt zur Außenwelt war eine unzuverlässige Mobilfunkverbindung auf dem Hügel hinter dem Haus.
Seine Freundin Luna teilte diese Vorliebe nicht, hatte aber eingesehen, dass Rödlöga ein guter Ort war, um sich fern von allem zu halten. Besser isoliert konnte man kaum sein. Also fügte sie sich.
Bis auf Weiteres.
Irgendwann würde sie nach Thailand zu Toms Halbschwester Aditi zurückkehren und versuchen, auch Tom dann wieder mit dorthin zu locken.
Sie hatte ihren Blaumann angezogen, ein Kleidungsstück, in dem sie sich zunehmend wohler fühlte, und das sie an vergangene Zeiten erinnerte, als sie geschuftet hatte, um ihr altes Schiff zu renovieren. Die Sara la Kali lag nun am Långholmskai in Stockholm verankert, wohin Luna und ihr Vater sie vor vielen Jahren aus Frankreich überführt hatten. Seither hatte sie Luna und in den letzten Jahren auch Tom als Wohnung gedient.
Doch im Moment war Rödlöga an der Reihe.
Stilton zog den letzten Meter Netz hoch und stellte fest, dass der Fang eher mittelmäßig war. Massenhaft mickrige Groppen und drei Barsche, von denen nur einer wirklich zum Braten geeignet war.
»Nicht so viel!«, rief er zurück.
Luna wurde klar, dass es heute wahrscheinlich wieder Dosenfutter geben würde. Bei ihrem letzten Besuch auf Köpmanholmen hatten sie so viel gebunkert, dass sie ein paar Wochen auskommen würden.
Eintönig, aber erträglich.
Stilton vertäute das kleine Boot am Steg und hob das Netz heraus. Heute Abend sollte er es besser auf der Nordseite auslegen, vielleicht würde das einen üppigeren Fang geben. Oder auch nicht. Das war für ihn nicht wichtig. Er setzte sich mit dem Netz über den Knien auf die schmale Holzbank und begann die glitschigen Groppen daraus zu lösen. Luna kam auf den Steg.
»Ich glaube, Lisa hat versucht, dich zu erreichen.«
Sie hielt Stilton sein Handy hin. Ab und zu, wenn das Wetter günstig war, schaffte es das ein oder andere Gespräch oder eine SMS, zu ihnen durchzukommen. Stilton wischte sich die klebrigen Hände an der Holzbank ab, nahm das Telefon und stand auf.
»Ich gehe auf den Hügel rauf, du kannst ja die Barsche rausmachen. Einer davon landet in der Pfanne.«
Luna betrachtete die drei kleinen Barsche und versuchte herauszufinden, welchen er meinte. Sie konnte da keinen großen Unterschied erkennen.
Oben auf dem Hügel dauerte es ein paar Minuten, bis das Handy Empfang hatte, aber dann klappte es doch, und er rief Lisa an.
»Hallo, hier ist Tom. Du hast angerufen?«
»Ja, hallo! Wie geht es euch da in der Einöde?«
»Super, man kann kaum mehr Abstand halten als hier. Und bei dir?«
»Doch, alles gut, aber ich versuche gerade, Olivia zu erreichen. Hast du vielleicht übers Wochenende von ihr gehört?«
»Nein. Hier draußen hat man mit keinem groß Kontakt … Hast du mal mit Lukas gesprochen?«
»Ja, und mit Mette und Maria auch. Seit Freitag hat niemand von ihr gehört.«
»Okay … Aber wenn sie anruft, werde ich ihr auf jeden Fall sagen, dass sie sich bei dir melden soll.«
»Super. Sag Grüße an Luna!«
Stilton beendete das Gespräch. Es gefiel ihm überhaupt nicht, was er gerade gehört hatte. Wenn es um Olivia ging, bekam er leicht Bauchschmerzen. Dem Mädchen war in den letzten Jahren einfach zu viel zugestoßen, sie schaffte es immer wieder, in Situationen zu geraten, die man besser ausließ.
Aber, ach was, bestimmt gibt es eine ganz natürliche Erklärung, dachte er.
Lisa dachte anders.
Ganz im Gegenteil.
Sie ging zu ihrem Kollegen Bosse Thyrén, der schläfrig an seinem Schreibtisch hockte. Er war in der Nacht mit einigen Drogenfahndern im Vorort Handen unterwegs gewesen, wo sie einen Dealer mit ein paar Tüten Crystal Meth in der Tasche aufgegriffen hatten. Dadurch war er erst gegen fünf Uhr morgens ins Bett gekommen.
Er hatte also jedes Recht auf einen Büroschlaf.
»Irgendwas stimmt da nicht«, sagte Lisa und setzte sich auf einen etwas vom Schreibtisch entfernten Stuhl.
Sie erklärte ihm die Lage, und Bosse war ihrer Ansicht. Es passte überhaupt nicht zu Olivia, über einen so langen Zeitraum nicht erreichbar zu sein.
»Ist sie vielleicht krank?«, fragte er.
»Ja, aber in dem Fall meldet man sich doch und gibt Bescheid. Außerdem müsste Lukas es dann wissen.«
»Vielleicht hat sie einen neuen Typen kennengelernt.«
»Jetzt hör aber auf«, meinte Lisa.
Sie sahen sich an. Bosse war jetzt deutlich wacher.
»Du solltest zu ihr nach Hause fahren«, sagte er.
Lisa nickte und rief wieder Lukas an.
»Hallo, Lukas, hast du einen Schlüssel zu Olivias Wohnung?«
»Nein, aber bei der Nachbarin eine Etage tiefer liegt ein Ersatzschlüssel. Ich kenne sie.«
Lukas starrte auf den Apparat vor sich. Er stand mit Lisa vor der Tür zu Olivias Haus in der Högalidsgatan und versuchte, den Code einzugeben. Seine Hände waren voller Farbflecken, und er war verwirrt.
»Also, ich weiß ihn, aber manchmal bringe ich die Zahlen durcheinander, und hin und wieder ändern sie auch den Code …«
Er versuchte es noch einmal, aber es klickte nicht.
»Da drinnen kommt jemand«, sagte Lisa.
Ein älterer Mann blieb innen vor der Tür stehen, als er das Paar draußen stehen sah. Lukas machte eine Geste und bat ihn, die Tür zu öffnen. Der Mann zögerte und beugte sich vor.
»Wohnen Sie hier?«, fragte er mit sehr lauter Stimme durch die Scheibe.
»Meine Freundin wohnt hier, Olivia Rönning«, rief Lukas. »Können Sie uns reinlassen?«
»Woher weiß ich, dass sie Ihre Freundin ist?«
Lisa merkte, dass Lukas im Begriff war, den Kontakt zu dem Mann zu ruinieren, also holte sie einfach ihre Polizeimarke heraus und hielt sie an die Scheibe.
»Ich bin Polizistin. Können Sie bitte die Tür öffnen?«
Der Mann zog eine Lesebrille aus seiner Tasche und setzte sie auf. Dann betrachtete er eingehend Lisas Marke durch die Scheibe. Langsam ging auch Lisa die Geduld aus.
»Dann können Sie wohl hereinkommen«, sagte der Mann schließlich und öffnete die Tür. »Aber Sie sollten wissen, dass hier Krethi und Plethi herumlaufen, ich lasse also nicht einfach jeden rein, der dahergelaufen kommt und …«
Lukas und Lisa waren die Treppe rauf, noch ehe der Mann seine Ansprache beendet hatte.
Zum Glück machte ihnen die Nachbarin unter Olivia die Tür auf. Sie war eine ältere und liebenswerte Dame, die strahlte, als sie Lukas’ ansichtig wurde.
»Hallo«, sagte er. »Wir müssten mal in Olivias Wohnung. Sie haben doch einen Schlüssel, oder?«
»Ja, den habe ich. Einen Moment.«
Kurz darauf war die Dame zurück und streckte ihnen den Ersatzschlüssel hin.
»Ist ihr etwas zugestoßen?«, fragte sie.
»Nein«, erwiderte Lukas. »Wann haben Sie Olivia denn zuletzt gesehen?«
»Nun, das ist schon eine Weile her. In diesen Zeiten bleibe ich meist hier im Haus.«
»Das ist gut so. Sie bekommen den Schlüssel gleich wieder zurück.«
Olivias Wohnung war leer, das hatten sie schnell festgestellt. Wohnzimmer, Küche und ein nicht gemachtes Bett im Schlafzimmer. Keine Post hinter der Tür.
Lukas setzte sich aufs Sofa und zog sein Handy raus.
»Das hier hat sie mir geschrieben.«
Er hielt Lisa die SMS von Olivia hin, die am Freitag kurz nach siebzehn Uhr gekommen war. Nach dem, was sie bisher herausbekommen hatte, war das der letzte Kontakt, den jemand mit Olivia gehabt hatte. Lisa lehnte sich an ein Bücherregal und betrachtete Lukas. Er sah sehr ruhig aus. Sie selbst kratzte sich mit den Fingernägeln über ihren Handrücken.
»Und was machen wir jetzt?«, sagte Lisa eigentlich mehr zu sich selbst als zu Lukas.
»Wir werden wohl abwarten müssen, bis sie sich meldet.«
»Du wirkst nicht sonderlich besorgt.«
»Ich bin das gewohnt.«
Lukas stand auf und ging zur Tür. Lisa sah ihm nach. Dann rief sie Bosse an und bat ihn, Olivias Handy orten zu lassen.
Ich dachte, wir wären Freundinnen.«
Die Stimme hinter mir ist hart und kalt. Das ist sie nicht immer, manchmal schwingt auch Empathie mit.
»Das sind wir doch«, antworte ich.
»Freundinnen nehmen nicht voreinander Reißaus.«
Freundinnen bedrohen sich auch nicht gegenseitig mit Waffen, möchte ich gern sagen, doch es ist nicht der richtige Moment für eine Provokation. Ich stehe am Rand einer Luke im Fußboden, von wo aus es in den Keller geht. Sie steht dicht hinter mir. Meine Hände sind auf dem Rücken gefesselt, ich spüre eine Pistole zwischen den Schulterblättern, ich kann nicht viel tun. Ich muss ihr wieder schmeicheln, das kleine Vertrauen zurückgewinnen, das ich mir vor meinem Fluchtversuch erarbeitet hatte.
»Es tut mir leid«, sage ich. »Es war dumm von mir. Ich hatte plötzlich Panik. Ich weiß nicht, was ich dachte.«
»An dich selbst. Du denkst nur an dich selbst. Du tust anderen weh und zerstörst sie. Runter mit dir!«
Ich schaue in den Keller hinunter. Hier soll ich jetzt also hin. Vorher war ich in einer Abstellkammer oben im Haus eingesperrt gewesen. Jetzt werde ich bestraft. Natürlich. Diesmal wird es entschieden schwerer werden, einen Fluchtweg zu finden.
Vorsichtig gehe ich hinunter. Die alte Holztreppe ist abgenutzt und morsch, ich nehme behutsam eine Stufe nach der anderen, um nicht durchzubrechen, es ist schwer, das Gleichgewicht zu halten. Als ich noch zwei Stufen vor mir habe, bekomme ich einen festen Schlag in den Rücken und falle kopfüber direkt hinunter in die Dunkelheit. Ich versuche, mich so gut wie möglich abzurollen, lande aber auf meinem verletzten Arm. Der Schmerz strahlt bis in den Kopf aus, ich schreie auf. Die Luke über mir schlägt zu, und ich höre, wie sie fest verriegelt wird.
Ich bin eingesperrt.
Allein in einem stockdunklen Keller.
Der Boden, auf dem ich gelandet bin, ist feucht und kalt. Ein festgetretener Erdboden. Die Luft ist muffig und riecht stark nach Schimmel. Ich schaffe es aufzustehen, die Decke ist niedrig, wenn ich mich auf die Zehenspitzen stelle, kann ich spüren, wie meine Haare die Holzbalken über mir berühren. Durch einen Spalt in der Luke dringt ein dünner Streifen Licht. Ich beginne mich in der Dunkelheit zu bewegen, langsam, versuche, mir einen Eindruck von dem Raum zu verschaffen. Er ist klein, und aus den Wänden ragen kalte, große Steine.
Meine Beine stoßen an einen Gegenstand, ich drehe mich um und befühle ihn mit den Händen. Das scheint ein Hackklotz zu sein, vermutlich bin ich in einem alten Holzkeller eingeschlossen. Ich setze mich auf den Klotz, um nicht auf dem Boden sitzen und frieren zu müssen. Da überkommt mich die Müdigkeit, die Erschöpfung zieht in langsamen, krampfartigen Wellen durch meinen Körper, die Beine zittern, und der Arm schmerzt. Ich bin völlig fertig. Außerdem zieht sich mein Magen vor Hunger zusammen. Mein Kopf sinkt auf die Brust, und ich spüre, wie sich Kälte und Feuchtigkeit durch meine Haut arbeiten. Alles, was bisher geschehen ist, fordert jetzt seinen Tribut.
Die Gefangenschaft, die Flucht, und jetzt die erneute Gefangenschaft.
Zurück auf los.
Fast hätte ich es geschafft, aber ich war übereifrig. Mal wieder. Jetzt befinde ich mich in einer bedeutend schlimmeren Lage. Ich bin im Keller einer kleinen Hütte irgendwo in Schweden eingesperrt, und niemand weiß, wo ich bin.
Außer ihr, mit der Pistole.
Werde ich hier sterben? Tränen schießen mir in die Augen, obwohl ich sie zu unterdrücken versuche. Ich muss klar denken. Weinen hilft nicht. Panik hilft auch nicht. Ich muss wieder ruhig und methodisch vorgehen. Geduld haben. Die Beziehung zu meiner Kidnapperin ist das Einzige, was mich retten kann.
Bevor ich meinen missglückten Fluchtversuch unternahm, hatten wir ja schon eine Art Beziehung aufgebaut. Sie dachte, wir wären Freunde.
Da müssen wir wieder hin.
Ein Geräusch in der Dunkelheit lässt mich aufhorchen. Ich hebe den Kopf und schaue zum Licht. Es scheint von der Treppe zu kommen. Der Riegel zur Luke ist aufgeschoben worden. Als die Klappe aufgeht, strömt das Licht über die Treppe. Ich stehe vom Klotz auf und schaue hin. Hat sie mich vielleicht begnadigt? Darf ich wieder in die Wärme der Abstellkammer kommen? Ich gehe ein paar Schritte vor. Im Gegenlicht erkenne ich, wie etwas Großes durch die Luke gedrückt wird, auf den Treppenstufen aufschlägt und dann auf dem Boden landet. Ehe die Luke zugeschlagen wird, begreife ich, was es ist. Eine alte Schaumgummimatratze.
Dann wird es wieder dunkel.
»Schlaf gut!«, höre ich durch die Luke.
Die Signale von Olivias Handy wurden in einem engen Radius am Rand des Högalindsparken geortet, genauer gesagt bei den Containern für Müllrecycling auf der Borgargatan. Das Telefon fand man dann in einem grünen Glascontainer. Eine Überwachungskamera in einiger Entfernung konnte keinen Hinweis darauf geben, wer es hineingeworfen haben könnte.
Lisa saß an ihrem Schreibtisch und betrachtete ein Foto von dem Handy. Das Smartphone wurde gerade von den Technikern untersucht, weil vielleicht noch andere Fingerabdrücke als die von Olivia darauf waren.
Wenn nicht Olivia selbst es in den Container geworfen hatte.
Das glaubte Lisa aber nicht. Sie war mittlerweile überzeugt davon, dass Olivia etwas zugestoßen war. Dass sie gegen ihren Willen nicht wieder aufgetaucht war.
»Könnte doch sein, dass sie freiwillig weg ist«, meinte Bosse, der an der einen Wand lehnte.
»Warum sollte sie das tun? Und warum sollte sie das Telefon wegwerfen?«
»Und die SMS? An Lukas?«
»Entweder ist sie gezwungen worden, die zu schreiben, oder jemand anders hat sie in ihr Telefon getippt. Sie war nicht beruflich unterwegs.«
»Wann hat er die Nachricht gekriegt?«
»Freitagnachmittag.«
»Vor drei Tagen.«
»Ja.«
Sie wussten, was das hieß. Wenn Olivia gegen ihren Willen verschwunden war, dann hatten sie viel Zeit verloren.
»Wo fangen wir an?«, fragte Bosse.
»Überall.«
Mette saß in eine warme Decke gewickelt im Garten und genoss die Stille.
Sie hatte eine rote Strickmütze auf dem Kopf, ein Impulskauf aus dem Netz. Leider hatte sie nicht darauf geachtet, woher die Mütze kam, nämlich aus China, was dazu führte, dass sie erst sechs Wochen nach der Bestellung eintraf. Nun war sie endlich da und hatte ihren Dienst angetreten, etwas zu groß und nicht wirklich die Farbe wie in der Anzeige, aber sie wärmte. Mette schloss die Augen.
Da rief Lisa an. Das war’s mit der Ruhe, dachte Mette und ging ran.
»Hallo Lisa, entschuldige bitte, dass ich dich nicht zurückgerufen habe, das ist mir einfach durchgerutscht. Hast du Olivia erreicht?«
»Nein.«
Mette setzte sich ein wenig auf.
Als Lisa die Lage skizziert hatte, die SMS, das gefundene Handy, die leere Wohnung, warf Mette die Decke ab und begann sie mit Fragen zu bombardieren.
»Ist sie bedroht worden?«, fragte sie.
»Nein.«
»Irgendein Fall, in den sie verwickelt war, jemand, der aus dem Gefängnis entlassen worden ist?«
»Soweit ich herausgefunden habe, nicht.«
»Habt ihr Nachforschungen angestellt, wo sie sein könnte?«
»Natürlich«, erwiderte Lisa.
»Und ihren Rechner durchforstet?«
»Sind gerade noch dabei.«
»Ihre Anruflisten?«
»Läuft.«
»Alle Nachbarn befragt?«
»Läuft.«
Die Checkliste war abgehakt, stellte Mette fest. Offenbar ging es in dem Gespräch eher darum, dass Lisa sich rückversichern wollte. Deshalb ließ sie sich ihre eigene wachsende Sorge nicht anmerken.
»Ruf mich an, sowie etwas passiert«, sagte sie.
»Mache ich.«
»Hast du mit Tom gesprochen? Vielleicht ist sie ja zu ihm gefahren?«
»Nein, ich habe am Montag mit ihm telefoniert. Er wusste nicht, wo sie ist. Und dann habe ich ihn heute noch mal erwischt und ihm erzählt, was passiert ist.«
»Wie hat er reagiert?«
»Ich weiß nicht, das Gespräch war plötzlich unterbrochen, er hat ja so gut wie kein Netz da draußen, aber ich nehme mal an, dass er beunruhigt ist.«
»Sicher.«
Sie beendeten ihr Gespräch, und Mette zog die Decke wieder um sich. Beunruhigt? Sie schüttelte den Kopf, wohl wissend, dass Lisas Anruf bei Tom für ein abruptes Ende seiner Rödlöga-Isolation sorgen würde.
»Ist was passiert?«
Mårten kam gerade in seiner dicken Steppjacke und mit einem Tablett in den Händen aus dem Haus. Er hatte Kaffee gemacht und ein paar selbst gebackene Zimtschnecken im Ofen aufgewärmt. Das hätte er natürlich auch in der Mikrowelle tun können, aber da Zeit in diesen Tagen fast unendlich zur Verfügung stand, hatte er sich für den Ofen entschieden, denn dieser verbreitete zudem noch einen angenehmen Duft in der Küche.
»Olivia ist verschwunden«, erklärte Mette und griff, noch ehe er das Tablett auf dem Tisch abstellen konnte, nach einer Schnecke.
»Was soll das heißen? Wie verschwunden? Wann denn?«
Mårten ließ sich neben seiner Frau nieder und schenkte ihnen beiden Kaffee ein. Mette überlegte, inwieweit sie ihn einweihen sollte. Geteilte Sorge ist doppelte Sorge, so viel wusste sie. Außerdem neigte er dazu, sich in Spekulationen zu verlieren, die in der Regel die Unruhe nicht verringerten, eher im Gegenteil.
Also sagte sie: »Ich weiß nicht so viel, Lisa und Bosse versuchen sie gerade zu finden. Was für eine gute Zimtschnecke!«
Mit ihrer gespielten Gelassenheit kam sie bei Mårten nicht durch. Er kannte seine Frau besser, als ihr lieb war.
»Könnte es Kidnapping sein?«, fragte er. »Oder irgendein Psychopath, der unterwegs ist? Terroristen?«
Und schon war es in Gang.
*
Lisa wollte einen Spaziergang machen, mal aus dem Polizeipräsidium rauskommen, und Bosse begleitete sie. Sie gingen zunächst schweigend die Polhemsgatan hinunter Richtung Norr Mälarstrand. Der Wind vom Riddarfjärden frischte auf, und Bosse knöpfte die Jacke bis zum Hals zu. Er musste sich sputen, um wieder aufzuholen, Lisa ging schnell und schlug keine Coronabögen um die Entgegenkommenden. Unten an der Hantverkargatan betrat sie direkt die Kreuzung.
»Lisa! Es ist rot!«
Der große Bus fuhr nur einen halben Meter vor ihr vorbei. Auf der anderen Seite der Straße hatte Bosse zu ihr aufgeschlossen und fasste sie leicht am Arm.
»Wir gehen zum Wasser runter«, sagte sie, den Blick auf den Bürgersteig gerichtet.
Es fiel Bosse nicht sonderlich schwer, sich vorzustellen, was gerade in Lisa vor sich ging. Als Mette Olivia in die Gruppe geholt hatte, war zwischen den jungen Frauen eine Konkurrenzsituation entstanden, in der es ganz schön zwischen den beiden geknirscht hatte. Doch schon bald waren sie enge Freundinnen geworden, auch privat. Jetzt war Olivia verschwunden, vielleicht sogar entführt worden – oder noch Schlimmeres, was keiner von ihnen bisher in Erwägung gezogen hatte, außer in dunklen Gedanken.
Als sie unten am Wasser stehen blieben, sah er, wie Lisa in sich selbst versank. Er wartete ab und blickte über das blauschwarze Wasser. Ein Stück weit draußen kreisten ein paar weiße Schwäne, an der Västerbron war ein Martinshorn zu hören, und ein einsamer Hundebesitzer versuchte im Strandparken, die verstreuten Fäkalien seines kläffenden Zwergpudels einzusammeln.
Bosse schaute Lisa wieder an.
»Denkst du an Olivia?«
»Nein, an Lukas.«
»Was ist mit ihm?«
»Als wir bei Olivia zu Hause waren, wirkte er so seltsam ruhig, fast als wäre es ihm egal. Das war es sicher nicht, aber er … ach, ich weiß nicht.«
»Meinst du, es könnte zwischen ihm und Olivia etwas passiert sein?«
»Keine Ahnung, aber er hat schließlich seine Krankengeschichte. In bestimmten Situationen kann er in eine andere Persönlichkeit rutschen. Vielleicht haben sie ja gestritten, und …«
Lisa verstummte.
»Hast du ihm denn erzählt, dass sie möglicherweise entführt worden ist?«, fragte Bosse.
»Nein, noch nicht.«
»Tu das, dann reagiert er vielleicht.«
Also rief sie auf dem Weg zurück ins Präsidium Lukas an. Ein nicht sonderlich angenehmes Gespräch.
Als Lisa von dem gefundenen Handy und dem Verdacht, dass Olivia gegen ihren Willen entführt worden sein könnte, berichtete, schwieg Lukas zunächst. Dass ihr noch etwas viel Schlimmeres zugestoßen sein könnte, behielt sie erst einmal für sich.
Dann, als Lisa sich so diplomatisch wie möglich nach Lukas’ und Olivias gemeinsamer Situation zu erkundigen begann, wie es ihnen denn derzeit so miteinander gehe, wurde es richtig anstrengend.
»Warum willst du das wissen?«
Lukas fuhr sofort die Stacheln aus.
»Ich meine ja nur, als wir bei ihr waren, hast du nicht sonderlich besorgt gewirkt.«
»Was weißt du schon davon? Kannst du Gedanken lesen?«
»Nein, das war nur ein Gefühl. Machst du dir denn Sorgen?«
»Nein.«
»Warum nicht?«
»Ich lasse es nicht zu.«
Ein paar Augenblicke war es still, dann sagte Lukas:
»Es ist so, Lisa: Ich habe mir so schreckliche Sorgen gemacht, als Olivia voriges Jahr bei diesem Helikopterabsturz verschwand und ich dachte, sie sei tot … ich will nicht wieder in diese Angst hinein … das schaffe ich gerade einfach nicht.«
Lisa erinnerte sich, wie es ihm damals gegangen war, und hatte durchaus Verständnis dafür.
»Entschuldige bitte, Lukas, ich wollte nicht …«
Doch Lukas unterbrach sie mitten im Satz.
»Sara Eriksson.«
»Sara Eriksson?«, fragte Lisa.
»Du weißt, wer sie ist. Die Frau, die mich gestalkt hat.«
»Ja, und?«
»Sie hasst Olivia. Ich denke, du solltest dich lieber auf sie konzentrieren, nicht auf mich.«
Lisa war sofort klar, dass Lukas recht haben konnte. Olivia hatte von dieser komischen Sara erzählt, die nach einer kurzen Beziehung von Lukas besessen war und angefangen hatte, ihn mit Telefonanrufen und SMS zu terrorisieren. Es war so weit gegangen, dass sie ihn in seiner Küche mit einem Messer bedroht hatte. Was zu einer Anzeige bei der Polizei und einem Kontaktverbot geführt hatte.
Warum war sie nicht selbst auf die Frau gekommen?
»Hast du Saras Nummer?«, fragte Lisa.
»Ja.«
Als sie das Gespräch mit Lukas beendete, waren sie schon am Polizeipräsidium. Bosse hielt ihr die Tür auf.
»Lief es gut?«
»Sara Eriksson.«
»Wer ist das?«
Schon auf der Treppe zu ihrem Büro rief Lisa bei Sara an. Sie landete auf einer Mailbox. Oben in ihrer Abteilung warteten auf Bosse und sie bereits ein paar Kollegen, die neue Informationen über die verschiedenen Maßnahmen hatten, die gerade liefen.
Noch keine Hinweise darauf, warum Olivia verschwunden war.
»Mit den Einzelverbindungsnachweisen für ihre Nummer dauert es noch ein bisschen, du weißt ja, wie die Mobilfunkanbieter sind.«
»Ja«, sagte Lisa. »Und die Befragung der Nachbarn?«
»Wir haben mit einem ziemlich ungehaltenen älteren Mann gesprochen, der am Freitag eine jüngere Frau vor dem Hauseingang gesehen hat. Die Frau hatte keinen Türcode, wollte aber rein.«
Lisa ahnte, um wen es sich bei dem älteren Mann handelte.
»Hat er sie reingelassen?«
»Nein … aber sie kann natürlich von jemand anderem reingelassen worden sein.«
»Hat er sie beschreiben können?«
»Er fand, sie sah aus wie alle anderen, die so auf den Straßen herumhängen, keinerlei Details … oder doch, er meinte, sie hätte eine rote Baskenmütze aufgehabt.«
»Okay, danke. Ich möchte, dass ein Handy überprüft wird, das einer Sara Eriksson gehört. Hier ist die Nummer. Es ist eilig.«
Dann rief sie bei der Staatsanwaltschaft an und bat um die Genehmigung für eine Hausdurchsuchung bei Sara Eriksson. Die Adresse hatte sie von Lukas bekommen, ein Mietshaus in Årsta. Den Durchsuchungsbeschluss bekam sie nicht, denn der Staatsanwalt befand die Begründung in diesem Stadium für nicht ausreichend. Während sie auflegte, sah sie, wie Bosse sie skeptisch anschaute.
»Was ist?«, fragte sie.
»Ist das nicht ein bisschen überreagiert? Eine Hausdurchsuchung? Wir wissen ja nicht mal, ob sie …«
»Kommst du mit?«
Ich atme tief ein und spüre, wie sich meine Lungen mit der muffigen, feuchten Luft füllen. Es ist mir gelungen, ein wenig zu dösen, jetzt bin ich kalt und steif. Ich versuche, die Finger auf dem Rücken zu bewegen, die Kabelbinder an den Handgelenken scheuern. Langsam richte ich mich auf der Matratze zum Sitzen auf, der Arm schmerzt immer noch, ich lehne mich vorsichtig gegen die kalte Wand. Ich weiß nicht, wie spät es ist, aber oben über mir höre ich sie gehen. Das ist irgendwie beruhigend. Immerhin ist sie nicht abgehauen und hat mich meinem Schicksal überlassen.
Plötzlich wird die Luke aufgeschlagen, das Licht dringt in den Keller. Ich muss blinzeln und die Augen zusammenkneifen. Im Gegenlicht sehe ich, wie sie mit etwas in der Hand die Treppe herunterkommt.
»Jetzt gibt es Essen!«
Die Stimme klingt keck und fröhlich. Wie eine Mutter, die Saft und Zimtschnecken bringt. Doch ich habe inzwischen genug Zeit mit ihr verbracht, um zu wissen, dass die Stimmung schnell umschlagen kann. Wenn sie gute Laune hat, dann ist es am besten, mitzumachen und dafür zu sorgen, dass es möglichst lange so bleibt.
»Oh, wie schön, ich bin superhungrig!«
Ich versuche ebenso aufgeräumt zu klingen wie sie. Wenn mir die Hände nicht auf dem Rücken gebunden wären, hätte ich sicher vor Begeisterung geklatscht. Da leuchtet mir eine Taschenlampe direkt ins Gesicht. Das starke Licht blendet mich, und ich muss die Augen schließen.
»Und schmutzig bist du auch!«, lacht sie. »Warte, ich helfe dir.«
Sie geht neben der Matratze in die Hocke und sieht mich an. Ihr Blick ist freundlich. Sie legt die Taschenlampe auf den Boden, holt etwas Küchenpapier aus der Brusttasche ihres Hemds, spuckt darauf und fängt an, mir damit hart und grob übers Gesicht zu wischen. Dann nimmt sie die Lampe wieder hoch, betrachtet zufrieden ihr Werk und schenkt mir ein strahlendes Lächeln.
»Na also. Viel besser!«
Ich bemühe mich, ihr Lächeln zu erwidern, mich willig zu zeigen, ich möchte nicht offenbaren, wie gedemütigt ich mich fühle. Die Genugtuung gönne ich ihr nicht. Leider gelingt es mir nicht so gut. Plötzlich verändert sich ihr Blick, die Augen werden schmal und dunkel, das erkenne ich wieder. Dieses Unzufriedene, Hasserfüllte ist immer unmöglich vorherzusagen. Ich weiß nie, was ich Falsches gesagt oder gemacht habe.
Sie streckt die Hand zum Boden und kratzt etwas Erde zusammen, ich versuche, den Kopf zu drehen. Es hilft nicht. Sie packt meine Haare und schmiert das Gesicht wieder ein, die Wangen, die Stirn, um den Mund herum. Ich muss die Augen fest zudrücken.
»Ich vergesse mich selbst«, sagt sie, »du sollst ja schmutzig und eklig sein, damit man sieht, wer du in Wirklichkeit bist.«
Und dann lacht sie wieder und schiebt mir einen Teller mit Essen hin.
»Hier, bitte schön.«
Was auf dem Teller liegt, sieht aus wie Dosenravioli, in deren Mitte ein Löffel gesteckt wurde. Als ich in der Abstellkammer gefangen war, hat sie immer meine Hände losgemacht, sodass ich essen konnte. Jetzt macht sie keine Anstalten dazu.
»Aber wie soll ich denn essen?«, frage ich.
»Wie soll ich denn essen?«, äfft sie mich nach. »Du klingst wie ein kleines Kind. Soll ich dir helfen? Willst du das?«
Dumm wie ich bin, antworte ich nicht. Da beugt sie sich vor zu meinem Ohr und schreit:
»Willst du das?«
Es fühlt sich an, als würde das Trommelfell platzen.
»Ja«, antworte ich.
»Ja?«
»Ja, bitte!«
»Braves Mädchen. Hier.«
Sie nimmt einen Löffel von den Ravioli, und ich öffne den Mund. Ich brauche Essen. Ich brauche Energie, um weiter funktionieren zu können. Das Essen zu verweigern ist keine Alternative. Sie drückt mir den Löffel fest in den Mund, ich habe das Gefühl zu ersticken. Ich huste die Hälfte des Essens wieder raus. Da fängt sie an, hysterisch zu lachen. Ich spüre, wie mir die Soße übers Kinn läuft, die Erniedrigung ist total.
»Das macht Spaß!«, ruft sie. »Jetzt haben wir wieder Spaß. Nicht wahr?«
Sie nimmt den Löffel und schmiert noch etwas Soße auf meine linke Wange, sie genießt ihre Überlegenheit. Als sie ihren Blick in meinen bohrt, sehe ich zu Boden.
»Och komm, bist du traurig? Ich scherze doch nur ein bisschen mit dir. Hier, komm, ich verspreche, dass ich das nicht noch mal mache.«
Sie streckt mir einen neuen Löffel mit Essen hin. Jetzt ist die Stimme wieder fürsorglich, und zwar nicht gespielt fürsorglich – das habe ich zu unterscheiden gelernt. Also öffne ich den Mund und hoffe das Beste. Ich bekomme einen Bissen, ohne dass etwas passiert. Als ich geschluckt habe, wischt sie mit dem Löffel um meinen Mund herum.
»Das hat meine Mutter immer gemacht, als ich klein war«, sagt sie. »Deine auch?«
»Ja«, antworte ich.
Obwohl ich keine Erinnerung daran habe, dass es je geschehen wäre. Das macht man doch nur mit kleinen Babys, oder? Kann sie sich so weit zurückerinnern?
»Das machen Mütter eben so«, fährt sie fort. »Schmeckt es gut?«
»Ja, sehr.«
»Ich liebe Ravioli. Wenn wir hier waren, hat meine Mutter immer solche Dosenravioli für mich und meinen Bruder aufgewärmt.«
Dann lacht sie wieder.
»Na ja, nicht immer natürlich. Manchmal haben wir auch was anderes zu essen bekommen.«
Okay, denke ich. Das hier ist also ein Ort, der ihr seit Kindertagen vertraut ist. Und sie hat einen Bruder. Das sind neue Informationen. Vielleicht kann ich noch mehr rauskriegen.
»Wart ihr oft hier, als du noch klein warst?«, frage ich vorsichtig.
»Ja, jeden Sommer, bis …«
Sie verstummt mitten im Satz.
»Bis wann?«
»Bis das Feuer das Glück verschlungen hat.«
Sie sieht zu Boden, aber ich nehme die Trauer in ihrem Blick wahr. Sie ist eine Person, die ihre Befindlichkeit ständig im Blick trägt. Auf diese Weise kann man sie ablesen, das Problem ist nur, dass sich die Stimmung so schnell ändert.
»Was ist passiert?«
Sie hebt den Blick wieder, jetzt ist er abweisend, und sie antwortet nicht auf meine Frage.
»Hörst du das Rauschen?«, fragt sie stattdessen.
»Ja.«
»Das sind die Wasserleitungen. Mein Bruder und ich haben immer hier unten gesessen, wenn meine Mutter und mein Vater zu viel getrunken hatten. Wir haben gespielt, wir säßen in einer Hütte im Wald, wir zündeten Kerzen an, und dann hörten wir auf das Rauschen, mein Bruder sagte, das wären die traurigen Kinder, die da singen. Wir haben uns in den Arm genommen und mitgesungen.«
»Ihr habt mit den traurigen Kindern gesungen?«
»Ja.«
Das Bild ist herzzerreißend, die beiden kleinen Kinder, die eng umschlungen zum Rauschen in den Wasserleitungen singen.
»Und ich war am traurigsten«, sagt sie. »Er hat mir immer die Tränen abgewischt und mich getröstet.«
»Dein Bruder?«
»Ja.«
»Ist er älter als du?«
»Ja«, sagt sie.
»Ist er auch manchmal hier?«
»Nein, jetzt nicht mehr. Warum fragst du?«
Ihr Blick wird wieder misstrauisch. Falsch von mir, so beharrlich zu sein. Sie ist nicht dumm.
»Er war mein Bruder, und dann hat er aufgehört, mein Bruder zu sein. Er konnte mich nicht retten, und er wird auch dich nicht retten. Dass du es nur weißt.«
Sie steht schnell auf. Ich war wieder zu eifrig.
»Entschuldige, ich war nur neugierig«, sage ich. »Ich habe selbst keine Geschwister und habe mir immer einen großen Bruder oder eine Schwester gewünscht. Als ich klein war, musste ich immer allein in der Waldhütte sitzen, oder klar, ich hatte Freunde, aber das ist ja nicht dasselbe.«
Ich rede drauflos. Meine Güte, was rede ich. Sie sieht mich die ganze Zeit an, abschätzig, als würde sie einen Wurm betrachten, der sich am Haken ringelt. Der Wurm, der ich bin. Am Ende höre ich, wie ich sage:
»Er ist doch wohl nicht tot, dein Bruder?«
»Für mich ist er das.«
Sie verstummt, sieht mich an, und ihr Blick ist jetzt schwer zu lesen.
»Willst du noch mehr?«
Sie deutet mit dem Fuß auf den Teller.
»Ja, gern.«
Sie beugt sich herunter und gibt mir noch einen Löffel.
»Er ist froh, dass ich dich hierhergebracht habe, weißt du das? Er wollte es nämlich.«
Jetzt kann ich nicht folgen. Ihr Bruder? Warum wollte der, dass sie mich hierherbringt?«
»Er will dich nicht mehr zurückhaben«, fährt sie fort, »ist das klar?«
Sie klingt nicht drohend, sondern eher, als würde sie etwas erklären.
Und ich begreife, dass sie jetzt nicht mehr von ihrem Bruder redet, sondern von meinem Freund.
»Ist klar«, sage ich.
Noch ein Löffel wird mir gereicht, und ich nehme ihn mit offenem Mund entgegen.
»Er und ich sind Elben«, sagt sie. »Wir sind auserwählt. Kapierst du?«
»Ja.«
Lüge ich.
»Gut.«
Ein rasches Lächeln fliegt über ihr Gesicht, ehe der Blick wieder ernst wird.
»Er und ich wissen, was mit einem Kind passiert, wenn man sein Inneres anzündet. Es wird schwarz und leer. Rußig. Und Ruß kriegt man niemals richtig weg, ganz egal, wie oft man sich wäscht. Hast du dir das schon mal überlegt?«
Ich nicke und bekomme einen weiteren Löffel Ravioli.
»Und er weiß das auch. Er hat auch ein schwarzes Inneres, und deswegen verschwindet er manchmal. Und deshalb gehören wir zusammen, er und ich. Mit dir ist er verloren. Das ist nicht seine Schuld, sondern deine. Verstehst du?«
»Ja.«
Die Ravioli sind jetzt fast alle, und sie legt den Löffel auf den Teller.
»Er malt nämlich mich. Seine Bilder sind ein Spiegel meines Inneren. Er ist der Einzige, der verstanden hat, und deshalb gehört er mir. Nicht dir. Du bist keine Elbin und wirst es auch nie sein.«
Sie verstummt. Ich weiß nicht, was ich antworten soll, und sehe, wie sie in ihren eigenen Gedanken verschwindet. Ich schaue die Treppe hoch und überlege, wie eine neue Flucht aussehen könnte. Ich könnte es wagen, sie umzustoßen, die Beine hat sie mir nicht gebunden, aber würde ich es hinaufschaffen und die Luke schließen können? Mit auf dem Rücken gebundenen Händen?
Nein.
»Als ich klein war, hat mein Vater mich immer seine kleine Lachkatze genannt«, sagt sie nach einer Weile. »Weil ich immer so fröhlich war.«
»Warst du das?«
»Solange ich meinen Papa hatte, war ich es.«
»Und dann?«
»Dann habe ich die Seiten gewechselt.«
Ich sehe ihr zu, wie sie den Teller vom Boden aufnimmt. Ich habe ihr gegenüber ein ebenso zwiespältiges Gefühl wie sie mir gegenüber. Es gibt etwas in ihr, das so zerbrechlich ist, dass ich sie behandeln will, wie ich es als Kind mit den Vogeljungen getan habe, die aus dem Nest gefallen waren. Sie in Baumwolle betten und sagen, dass alles gut werden wird.
»Du … ich glaube, alles wird …«
Da trifft mich ein fester Tritt direkt auf die Brust, ich falle nach hinten und schlage mir den Kopf auf dem harten Boden an. Und verfluche mich selbst. Ich hätte gewappnet sein müssen. Ich weiß doch, dass sie zu allem fähig ist.
»Und wer mir wehtut, dem tue ich weh«, verkündet sie.
Steigt die Treppe hoch, schlägt die Luke zu und verriegelt sie.
Saras Wohnung lag im dritten Stock eines heruntergekommenen Mietshauses aus den Fünfzigerjahren im Långhalsvägen des Vororts Årsta. An der Tür klebte ein Pferde-Abziehbild.
Lisa klingelte. Zweimal. Keine Reaktion. Sie drückte die Klinke herunter.
»Abgeschlossen«, sagte sie.
»Was hast du erwartet?«
Sie schob die Hand in die Tasche und sah Bosse an.
»Du kannst dich jetzt mal umdrehen.«
Bosse rührte sich nicht. Lisa holte einen Satz Dietriche aus der Tasche, schob ein schmales Eisen in das Schlüsselloch, drehte ein paarmal herum, hörte das kleine Klicken, drückte die Klinke nach unten und merkte, dass die Tür ein paar Zentimeter aufging. Sie machte die Tür ganz auf und rief in die Diele: »Hallo! … Wir sind von der Polizei. Sara!«
Keine Antwort.
»Willst du da reingehen?«, fragte Bosse.
»Ja. Womöglich ist Olivia da drin. Du kannst hier draußen bleiben, falls jemand kommt.«
Bosse schüttelte nur den Kopf. Ihnen war eben noch eine Hausdurchsuchung verweigert worden, trotzdem reinzugehen, würde schwer zu begründen sein. Wenn sie keine Anfrage an die Staatsanwaltschaft gestellt hätten, dann hätten sie sich auf irgendwas rausreden können, dass sie Geräusche gehört hätten, einen Schrei, dass die Tür sperrangelweit offen stand, was auch immer. Jetzt aber wäre es ein möglicher Hausfriedensbruch.
»Beeil dich«, sagte er.
Lisa betrat die Wohnung. Oberflächlich betrachtet erinnerte sie an die von Olivia, dieselbe Aufteilung, zwei Zimmer und Küche. Was nicht an Olivias Wohnung erinnerte, war die Ordnung. Olivias zwei Zimmer befanden sich immer in verschiedenen Stadien eines gemütlichen Chaos, hier jedoch war alles perfekt. Kein Geschirr in der Spüle, ein ordentlich gemachtes Bett, der Couchtisch leer und sauber.
Lisa schaute sich um. Sie wusste nicht so recht, wonach sie suchen sollte oder was sie zu finden hoffte. Spuren von Olivia? Wohl kaum. Sie hatte herausbekommen, dass Sara in Teilzeit als Krankenpflegerin tätig war, viel mehr nicht. Auf einer Holzstaffelei im Schlafzimmer stand eine große aufgespannte Leinwand mit einem Ölgemälde darauf. Lisa trat näher. Es zeigte eine graue Wand, und mitten auf der Wand hing ein totes Tier. Es war sehr dilettantisch gemalt, und Lisa konnte nicht erkennen, was genau es sein sollte, aber es sah aus wie der Kadaver eines Fuchses oder vielleicht eines Nerzes. Neben dem Tier war ein kleines gelbes Kreuz zu erkennen. Lisa nahm ihr Handy und machte ein Foto von dem Bild. Dann ging sie ins Wohnzimmer zurück und rief Saras Nummer an, möglicherweise befand sich ihr Handy ja hier.
Das war nicht der Fall.
Da sah sie den Laptop.
Er stand auf einem Fensterbrett. Sie ging hin, klappte den Bildschirm auf und drückte eine Taste. Nichts geschah. Wahrscheinlich war der Akku leer.
Sie konnte den Computer nicht mitnehmen, aber jetzt wusste sie, dass er hier war. Falls das interessant werden würde. Sie klappte ihn wieder zu.
An der angrenzenden Wand hing ein Stringregal mit Büchern, kleinen Keramikgegenständen und Fotografien. Sie schaute die Fotos an, in dem Bewusstsein, dass es immer das Erste war, was Olivia tat, wenn sie an einen neuen Ort kam: nach Fotos suchen. Die hatten sich in manchen Ermittlungen schon als wichtige Puzzleteile erwiesen. Einige Fotos zeigten Menschen, die Lisa nicht kannte, eines war das Bild von einem Hund. Das größte Foto war schwarz gerahmt und stand ganz hinten. Davor lag eine gehäkelte Puppe auf einem roten Samtherz. Vorsichtig hob sie das Bild heraus. Auf dem Foto waren mehrere Personen zu sehen, die vor einem kleinen, rot gestrichenen Haus standen. Eine ältere Frau, ein Paar mittleren Alters und ein Junge, der ein kleines Mädchen an der Hand hielt. Das Mädchen sah bewundernd zu dem Jungen auf. Ganz unten auf das Foto hatte jemand krakelig mit Bleistift geschrieben: »Das Waldglück, Småland, 1998«. Lisa machte ein Foto von dem Bild.
»Hast du was gefunden?«
Bosse stand draußen im Hausflur und sah Lisa an. Sie nickte und ging zur Eingangstür.
»Einen Laptop ohne Saft. Und ein Foto.«
Sie ging hinaus und sorgte dafür, dass die Tür hinter ihr wieder verschlossen war.
*
Mette hatte vollkommen recht gehabt, was den zweiten Anruf von Lisa bei Stilton anging. Er hatte Luna erzählt, was Lisa gesagt hatte, und dann war Schluss mit der Isolation.
Fürs Erste.
Jetzt war das Schlauchboot mit Motor gefragt, um sie über das weite, kabbelige Meer und weiter in den Furusundsleden hineinzubringen. Es hüpfte über die Wellenkämme, und Luna hielt sich fest, so gut es ging. Tom beherrschte dieses Element, da vertraute sie ihm voll und ganz. Doch das Boot schlug auf die Wellen, und sie wurde nass, wenn das kalte Brackwasser über sie hinwegspritzte.
Als sie in die Fahrrinne kamen, wurde es ruhiger, Stilton nahm Geschwindigkeit raus, und sie konnten sich wieder verständigen.
»Wie besorgt müssen wir sein?«, fragte Luna.
»Keine Ahnung.«
Sie merkte, dass Tom kurz angebunden war, und wusste, was das bedeutete. Inzwischen hatte sie die meisten seiner Reaktionsmuster kennengelernt, es waren aber auch nicht so viele. Die Situation, in der er sich jetzt befand, verlangte zu gleichen Teilen Sorge und Entschlossenheit. Olivia war verschwunden, und nun musste sie gefunden werden. Alles andere lag außerhalb seines Fokus.
Ungefähr auf der Höhe von Kjusterö versuchte sie es trotzdem.
»Gestern, als du Netze ausgelegt hast, habe ich Erik, meinen Cousin, angerufen. Seine Frau liegt auf der Intensivstation, es geht ihr offenbar richtig schlecht.«
Stilton nickte und hielt den Blick auf die Fahrrinne gerichtet.
»Sie ist in deinem Alter. Lehrerin. Er darf sie nicht besuchen, und sie liegt jetzt schon zwei Wochen dort. Ab und zu darf er sich jede Menge Schutzkleidung anziehen und sie durch eine Glastür anschauen. Ist das nicht schrecklich?«
»Ja.«
»Stell dir vor, so was würde einem von uns passieren! Oder Mette und Mårten, die gehören ja wirklich zur Risikogruppe. Oder deine Kumpels aus dem Antiquariat, Ronny und Benseman, was, wenn die auf Intensiv landen würden?«
»Warum sollte ich mir das vorstellen?«
»Es könnte doch passieren«, meinte Luna.
»Und? Jetzt werd mal nicht wie der Nerz.«
»Wieso, wie ist der?«
»Der durchlebt jede erdenkliche Katastrophe im Voraus, dreht total durch, und dann passiert nichts. Was bringt das denn?«
Stilton war alles, was mit Corona zu tun hatte, unglaublich leid. Der tägliche Schwall an Covid-Neuigkeiten hing ihm zum Hals raus, und das war, neben anderen Dingen, ein Grund, warum er sich auf Rödlöga hatte isolieren wollen. Alle hatten Antworten, aber keiner kam zu irgendeinem Ergebnis.
Also?
Er selbst vertraute auf den Staatsepidemiologen Anders Tegnell. Warum sollte der lügen? Ein unglamouröser Beamter war ihm dann doch lieber als ein verschwitzter Alarmist.
Er gab wieder Gas.
Ich vollführe eine halbe Drehung auf der Matratze, nachdem ich mich vorhin erst in die andere Richtung gedreht habe. Wie lange es dauern wird, bis ich in dieser Dunkelheit verrückt werde, weiß ich nicht, aber im Moment scheint mir der Zeitpunkt sehr nahe. Mein Kopf dröhnt vom Schlag auf den harten Boden, der Arm tut immer noch weh. Ich weiß nicht, ob Nacht oder Tag ist, mein Zeitgefühl ist mir völlig verloren gegangen. Ebenso wenig weiß ich, was ihr Plan für mich ist und ob sie überhaupt einen Plan hat, ob sie imstande ist, mich zu erschießen, oder ob sie einfach beschließt, mich hierzulassen. Mich in diesem verdammten Höllenloch verhungern und verrotten zu lassen.
Die negativen Gedanken zehren an mir, zermahlen die Hoffnung, dass sie mich vielleicht einfach laufen lassen wird.
Denn warum sollte sie das tun?
Ein paarmal habe ich in der Annahme, sie würde schlafen, versucht, die Luke aufzukriegen, aber das hat nicht geklappt. Die ist ordentlich verriegelt.
Das Einzige, woran ich arbeiten kann, ist, mich zu bemühen, sie mir gegenüber positiver zu stimmen, zum Beispiel wenn sie mit Essen zu mir runterkommt oder wenn sie den Eimer leert, den ich als Toilette gekriegt habe. Manchmal funktioniert das auch, doch dann folgt der Rückschlag. Ein Tritt. Eine Ohrfeige.
In lichteren Momenten versuche ich, konstruktiv zu denken. Ich bin jetzt fünf, sechs Tage verschwunden, inzwischen müsste eine große Suchaktion nach mir laufen. Lisa und Bosse arbeiten sicher mit Hochdruck. Das Problem ist nur, dass sie nicht wissen, wo sie suchen sollen. Oder wer hinter allem steckt. Denn sie werden ja wohl nicht glauben, dass ich freiwillig verschwunden bin, oder?
Doch am meisten denke ich an den armen Lukas, der ja vollkommen aufgelöst sein muss. Und Mama. Und all die anderen.
Ich ziehe die Decke fester um mich. Die Kälte dringt mir ins Mark, ich muss die Zähne zusammenbeißen, damit sie nicht klappern. Doch zumindest habe ich eine Decke. Und einen Eimer. Und obendrein habe ich gelernt, wie man sich mit auf dem Rücken zusammengebundenen Händen die Hose aus- und wieder anzieht – kein einfaches Manöver.
Und ich bekomme Essen.
Es könnte also schlimmer sein. Oder vielleicht auch nicht. Wenn ich vor mich hin dämmere, rauschen Traumszenen durch meinen Kopf, und fast alle handeln von Flucht. Flucht, die am Ende misslingt.
»Olivia?«
Sie hat die Luke wieder einen Spalt aufgemacht.
»Ja?«
»Magst du Fleischsuppe?«
»Sehr gern.«
»Dann komme ich gleich.«
Die Luke wird wieder geschlossen. Ich höre, wie sie da oben Musik anmacht und anfängt mitzusingen. Was geht wohl in ihrem Kopf vor? Wie sieht ihr Bild von der Wirklichkeit aus? Ob sie überhaupt an die Konsequenzen ihres Handelns denkt?
Wahrscheinlich nicht.
Sicher ist das ein Teil ihrer Krankheit. Sie hat nie begriffen, warum sie das Kontaktverbot bei Lukas erhalten hat. Sie glaubt immer noch, er sei in Wirklichkeit in sie verliebt. Sie glaubt allen Ernstes, dass sie ihn zurückbekommt, indem sie mich verschwinden lässt.
Ist sie schon immer krank gewesen? Oder ist, so wie bei Lukas, ein Trauma die Ursache? In gewisser Weise ist seine Krankheit leichter zu erkennen, weil er, wenn er krank wird, ein ganz anderer Mensch ist. Sara bewegt sich die ganze Zeit an der Grenze entlang, ist vollkommen unvorhersehbar.
Die Luke geht wieder auf, und sie kommt mit der Suppe herunter. Schweigend füttert sie mich. Keine Ausfälle, alles ganz ruhig. Am Ende ist der Teller leer.
»Hier unten ist es kalt. Ich hoffe, du erkältest dich nicht«, sagt sie.
»Nein.«
»Gut.«
»Aber oben war es schöner«, versuche ich.
»Hm«, ist die Antwort.
»Du?«
»Ja«, antwortet sie.
»Wie lange soll ich hierbleiben?«
Einen Versuch ist es wert. Ich weiß, dass so was einen Rückschlag auslösen kann, aber ich muss die Gelegenheit nutzen, wenn sie ruhig ist.
»Bis er dich vergisst und versteht.«
Lukas wird mich nie vergessen, möchte ich sagen, aber das tue ich natürlich nicht. Trotzdem gibt mir ihre Antwort ein wenig Hoffnung. Der grundsätzliche Plan ist also nicht, mich zu töten. Zumindest bisher nicht.
»Du weißt schon, dass sie nach mir suchen werden«, sage ich.
»Aber es wird dich niemand finden. Niemand weiß, wo du bist. Warum fängst du jetzt damit an? Hat dir die Suppe nicht geschmeckt?«
»Doch.«
»Ich strenge mich schließlich für dich an. Leere deine Scheiße aus und koche dein Essen. Das macht keinen Spaß, das kann ich dir sagen.«
Dann kommt die Ohrfeige. Schnell und hart. Diesmal bin ich bereit, aber deshalb tut es nicht weniger weh. Die Wange brennt von dem Schlag und in meinem Ohr singt es. Ich schließe die Augen und warte auf mehr. Doch es kommen keine weiteren Schläge. Als ich vorsichtig die Augen wieder öffne, sehe ich ihre erschrockene Miene. Sie hat die Hände auf den Mund gelegt. Sind das Tränen in ihren Augen?
»Entschuldige, Olivia. Ich weiß nicht, warum ich das tue. Ich will dich doch nicht schlagen. Es kommt einfach.«
Und dann kauert sie sich vor mir auf den Boden, schlägt die Hände vors Gesicht und beginnt zu weinen. Ihr ganzer Körper vibriert.
Jetzt habe ich einen kleinen Vorteil. Was kann ich tun? Schaffe ich es, die Treppe hinaufzusteigen und die Luke hinter mir zuzuklappen? Vielleicht, wenn es mir gelingt, sie schnell genug zu überrumpeln. Ich unternehme einen Versuch, auf die Füße zu kommen und in die Hocke, um rasch agieren zu können. Da sehe ich die Pistole, die sie in den Hosenbund gesteckt hat, und erkenne, dass meine Chancen minimal sind, solange mir die Hände gebunden sind. Ich darf nicht riskieren, noch einmal zu scheitern. Ich brauche Geduld. Also lächele ich stattdessen, als sie schließlich zu mir aufsieht.
»Es ist schon okay, Sara.«