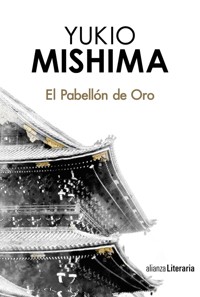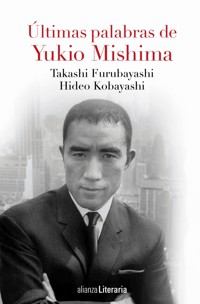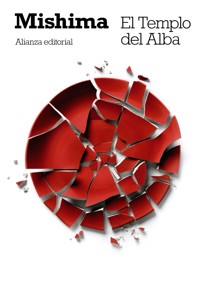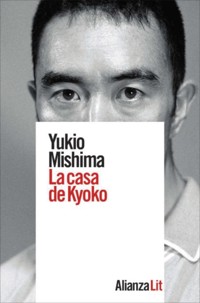18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kein & Aber
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Für den dreizehnjährigen Noboru und seine Freunde ist die Erwachsenenwelt illusionär, heuchlerisch und sentimental. Nur der Seemann Ryuji bildet eine Ausnahme. Fasziniert vergöttert der vaterlose Noboru den Mann vom Meer und prahlt vor seinen Freunden mit dem Liebhaber seiner Mutter. Als er jedoch erfährt, dass sich Ryuji gegen das Leben auf See und für die Ehe mit Noborus Mutter entscheidet, fühlt der Junge sich verraten und beginnt, sein einstiges Idol immer mehr zu verachten. Wie konnte er sich so in dem Seemann täuschen? Noboru und seine Freunde fassen einen grausamen Plan.
Yukio Mishimas Roman zeigt meisterhaft, wie die harte Realität des Alltags Idealbilder zum Zerbrechen bringen kann. Eine Geschichte über die unterschiedlichen Formen, die die Liebe annehmen kann, und den Konflikt zwischen traditionellen Werten und modernen Sehnsüchten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 201
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
INHALT
» Über den Autor
» Über das Buch
» Buch lesen
» Impressum
» Weitere eBooks von Kein & Aber
» www.keinundaber.ch
ÜBER DEN AUTOR
Yukio Mishima wurde 1925 in Tokio geboren und ist Autor zahlreicher Romane, Dramen, Kurzgeschichten, Essays und Gedichte. Nobelpreisträger Yasunari Kawabata war sein Mentor. Sein Werk überschreitet bis heute inhaltliche und stilistische Grenzen und macht ihn zu einem der wichtigsten japanischen Autoren des 20. Jahrhunderts. Als politisch umstrittene Persönlichkeit wählte Mishima 1970, nach einem gescheiterten Aufruf zur Wiedereinsetzung des japanischen Kaisers, den rituellen Freitod.
ÜBER DAS BUCH
Für Noboru und seine Freunde ist die Erwachsenenwelt illusionär, heuchlerisch und sentimental. Nur der Seemann Ryuji bildet eine Ausnahme. Fasziniert vergöttert der vaterlose Noboru den Mann vom Meer und prahlt vor seinen Freunden mit dem Liebhaber seiner Mutter. Als sich Ryuji jedoch gegen das Leben auf See und für die Ehe an Land entscheidet, fühlt der Junge sich verraten. Seine Freunde und er sehen nur eine Möglichkeit, Ryujis Ehre wieder - herzustellen …
ERSTER TEIL
SOMMER
1
»Gute Nacht«, sagte Noborus Mutter und schloss sein Zimmer von außen ab. Was, wenn ein Feuer ausbräche? Natürlich würde sie ihn als Erstes befreien, das hatte sie ihm und sich geschworen. Aber was, wenn die gestrichene Holztür sich durch die Hitze des Feuers verzog oder geschmolzene Farbe das Schlüsselloch verstopfte? Sollte er durch das Fenster flüchten? Die Straße davor war gepflastert und ein Sprung aus dem ungewöhnlich hohen ersten Stock des schmalen Hauses hoffnungslos.
Doch all das hatte er sich selbst zuzuschreiben, denn Noboru hatte der Versuchung nachgegeben, sich nachts aus dem Haus zu schleichen. Aber sosehr seine Mutter ihn auch bedrängt hatte, den Namen des Anführers hatte er nicht preisgegeben.
Während der Besatzungszeit hatten die Amerikaner das von Noborus verstorbenem Vater erbaute Haus am Yatozaka oberhalb des Hafens von Yokohama beschlagnahmt und alle Zimmer im ersten Stock mit Toiletten ausgestattet, sodass es für einen Dreizehnjährigen zwar nicht besonders unangenehm, aber nicht weniger demütigend war, nachts in seinem Zimmer eingeschlossen zu sein.
Eines Morgens, als seine Mutter ihn allein zu Hause gelassen hatte, durchwühlte Noboru in seinem Ärger das ganze Zimmer. In die Wand, die an das Schlafzimmer seiner Mutter grenzte, war eine Kommode eingepasst. Wütend riss Noboru die Schubladen heraus und verstreute die Kleidungsstücke auf dem Boden. Auf einmal bemerkte er einen durch die Rückwand einfallenden Lichtstrahl.
Als er den Kopf in die Nische steckte, um dessen Ursprung zu erkunden, erkannte er, dass es die Spiegelung der Frühsommersonne auf dem Meer war, die das verlassene Zimmer seiner Mutter mit gleißendem Licht durchflutete. Zusammengekauert fand Noboru mühelos Platz in der Nische, in die sogar ein Erwachsener bis zur Hüfte hätte hineinkriechen können.
Durch das Guckloch erschien ihm das Zimmer seiner Mutter wie neu und völlig verändert.
Links an der Wand stand auch nach dem Tod seines Vaters noch das Ehebett aus glänzendem Messing, das dieser eigens in New Orleans bestellt hatte, weil es ihm so gut gefiel. Eine weiße Tagesdecke aus Frottee mit einem eingewebten K – Noborus Familie hieß Kuroda – war ordentlich darübergebreitet. Auf ihr lag ein marineblauer Strohhut mit einem langen hellblauen Band. Auf dem Nachttisch stand ein blauer Ventilator.
Der dreiteilige ovale Spiegel des Frisiertischs rechts am Fenster war nicht ganz geschlossen, sodass seine geschliffenen Kanten durch den Spalt wie aus Eis erschienen. Vor dem Spiegel erhob sich ein kleiner Wald aus Flakons mit Eau de Cologne, Parfümzerstäubern und einem lavendelfarbenen Fläschchen mit Gesichtswasser, neben dem auch eine Puderdose aus böhmischem Kristall funkelte. Am Rand lag wie ein Häufchen verdorrter Zedernblätter ein Paar zusammengeknüllte dunkelbraune Spitzenhandschuhe.
Gegenüber der Frisierkommode am Fenster standen eine Chaiselongue, eine Stehlampe, zwei Stühle und ein zierliches Tischchen. Auf der Chaiselongue lag ein Rahmen mit einer angefangenen Stickerei. Sticken war zwar aus der Mode gekommen, doch Noborus Mutter hatte eine Vorliebe für alle Handarbeiten. Durch das Guckloch konnte er das Motiv nicht genau erkennen, aber es sah aus wie der halb fertige Flügel eines bunten Vogels, vielleicht eines Papageis, auf silbergrauem Grund. Daneben lag, achtlos hingeworfen, ein Paar Nylonstrümpfe. Allein die Art, wie das hauchzarte, hautfarbene Gewebe sich an den Damast der Chaiselongue schmiegte, verlieh dem ganzen Raum etwas seltsam Erregendes. Bestimmt hatte seine Mutter auf dem Weg nach draußen eine Laufmasche entdeckt und in aller Eile noch einmal die Strümpfe gewechselt.
Durch das Fenster sah man nur den strahlend blauen Himmel und ein paar Wolken, die im grellen Widerschein des Meeres hart und glänzend wie Emaille wirkten.
Noboru konnte kaum glauben, dass er das altvertraute Zimmer seiner Mutter vor sich hatte. Ihm war, als blickte er in den Raum einer fremden Frau, die nur kurz das Haus verlassen hatte. Denn dass es sich um das Zimmer einer Frau handelte, war unverkennbar. Es atmete bis in den letzten Winkel vollkommene Weiblichkeit. Und in der Luft hing ein zarter, anhaltender Duft.
Plötzlich fragte sich Noboru, ob das Guckloch natürlichen Ursprungs war. Oder hatten damals mehrere Familien der Besatzungsarmee in diesem Haus gewohnt und …?
So zusammengerollt in dem staubigen Fach, überkam ihn das Gefühl, dass sich hier schon einmal jemand hineingezwängt hatte, der blond, haariger und größer war als er. Als er in der Enge auch noch einen süßsäuerlichen Geruch wahrzunehmen glaubte, hielt er es nicht mehr aus.
Hastig kroch er aus der Nische und stürzte ins Nebenzimmer.
Noboru sollte dieses seltsame Erlebnis nie vergessen.
Das Zimmer nebenan war ihm so vertraut wie eh und je, es hatte nicht mehr die geringste Ähnlichkeit mit dem geheimnisvollen Raum von eben. Hier legte seine Mutter abends ihre Stickerei beiseite, um gähnend mit ihm Hausaufgaben zu machen, ihn zu rügen, weil seine Krawatte nicht richtig saß, oder sich zu beschweren, weil er »ständig mit der Ausrede, Schiffe beobachten zu wollen«, in ihr Zimmer kam. Er sei ja schließlich kein Kind mehr. Der Raum hatte sich außerdem in das Büro zurückverwandelt, in dem die Mutter die Geschäftsbücher durchsah, die sie aus dem Laden mitbrachte, und ewig vor ihren Steuerunterlagen saß.
Noboru suchte nach dem Guckloch.
Es war nicht ganz leicht zu finden.
Bei näherem Hinsehen entdeckte er eine altmodische Zierleiste aus geschnitzten Wellen über der Wandvertäfelung, und das Loch lag gut versteckt unter dem Überhang einer dieser Wellen. Er rannte in sein Zimmer zurück, faltete fieberhaft die verstreuten Kleidungsstücke zusammen und verstaute sie wieder in der Kommode. Während er sie schloss, schwor er sich, nie wieder etwas zu tun, was die Aufmerksamkeit eines Erwachsenen auf diese Schubladen lenken konnte.
Seit Noboru das Guckloch entdeckt hatte, zog er, wenn er in seinem Zimmer eingeschlossen war, immer wieder die Schubladen heraus, um seine Mutter beim Zubettgehen zu beobachten. Er tat dies vor allem an Abenden, an denen seine Mutter mit ihm geschimpft, nicht jedoch, wenn sie ihn liebevoll behandelt hatte.
So fand Noboru heraus, dass seine Mutter die Angewohnheit hatte, sich vor dem Schlafengehen nackt auszuziehen, auch wenn es noch nicht so heiß war, dass man kaum schlafen konnte. Der Ankleidespiegel befand sich in einer versteckten Ecke des Zimmers, und, seine nackte Mutter darin zu sehen, wenn sie dicht davorsaß, war schwierig.
Sie war erst dreiunddreißig Jahre alt, schlank, spielte Tennis und hatte eine gute Figur. Vor dem Zubettgehen pflegte sie sich mit Eau de Cologne einzureiben, doch mitunter saß sie seitlich vor dem Spiegel und starrte mit fiebrig glänzenden Augen hinein, während ihre parfümierten Finger reglos auf ihren Schenkeln ruhten und ihr starker Duft Noboru in die Nase stieg. Eines Abends hielt er ihren roten Nagellack irrtümlich für Blut und erschrak.
Noch nie hatte Noboru den Körper einer Frau so genau betrachtet.
Ihre Schultern fielen zu beiden Seiten ab wie eine sanft geschwungene Küstenlinie. Ihr Hals und ihre Arme waren leicht gebräunt, aber ab dem Dekolleté, über den Brüsten, begann eine zarte, cremige Zone, so warm und weiß, wie von innen erleuchtet. Stolz ragten ihre Brüste aus dem sanften Hang, und wenn sie sie massierte, richteten sich die traubenfarbenen Brustspitzen auf. Ihr sanft atmender Bauch. Die Schwangerschaftsstreifen, ein Wort, das Noboru aus einem verstaubten roten Buch gelernt hatte, das ganz oben auf dem Regal im Arbeitszimmer seines Vaters stand, vorsichtshalber verkehrt herum zwischen einem Gartenbuch über Blumen und Pflanzen der Saison und einem Firmenhandbuch.
Dann betrachtete Noboru es, dieses schwarze Dreieck. Er konnte es partout nicht deutlich sehen, obwohl er seine Augen anstrengte, bis sie schmerzten. Er überlegte sich alle möglichen Obszönitäten, aber keins dieser Worte vermochte das Dickicht zu durchdringen.
Es musste, wie seine Freunde sagten, ein jämmerliches leeres Gehäuse sein. Was hatte dieses leere Ding mit der Leere seiner eigenen Welt zu tun?
Mit dreizehn Jahren war Noboru (wie alle seine Freunde) überzeugt, ein Genie zu sein, überzeugt, dass die Welt aus einigen einfachen Symbolen und Determinanten bestehe, dass der Tod vom Augenblick der Geburt an im Menschen Wurzeln schlage, die er nur zu bewässern und zu nähren brauche, dass die Fortpflanzung eine reine Fiktion sei und mit ihr die ganze Gesellschaft, und dass Väter und Lehrer, allein weil sie Väter und Lehrer waren, eine tödliche Schuld auf sich geladen hätten. So war der Tod seines Vaters, als Noboru acht Jahre alt war, ein freudiges Ereignis, auf das er stolz sein konnte.
An mondhellen Abenden löschte seine Mutter das Licht und stellte sich nackt vor den Spiegel. Das damit verbundene Gefühl von Sinnlosigkeit raubte Noboru in diesen Nächten den Schlaf. Das weiche Licht und die sanften Schatten offenbarten ihm die ganze Hässlichkeit der Welt.
Wäre ich eine Amöbe, dachte er, könnte ich mit meinem mikroskopisch kleinen Körper ihre Gemeinheit besiegen. Aber der Mensch ist mit seinem mittelmäßigen Körper nur zu halben Sachen fähig – er kann gar nichts besiegen.
Nachts drangen die Signale der Schiffshörner wie Nachtmahre durch das offene Fenster. An den Abenden, an denen seine Mutter freundlich zu ihm war, konnte er schlafen, ohne sich daran zu stören. Stattdessen träumte er von ihr.
Noboru war stolz auf sein hartes Herz und weinte nie, nicht einmal im Traum. Sein Herz war hart wie ein mächtiger eiserner Anker, der der zersetzenden Kraft des Meeres trotzte, unbefleckt von den Muscheln und Austern, die die Schiffsrümpfe bedeckten, blank poliert und kühl versunken im Hafenschlamm, zwischen leeren Flaschen, Plastik, alten Schuhen, roten Kämmen mit herausgebrochenen Zähnen und Kronkorken. Eines Tages würde er sich einen Anker auf die linke Seite seiner Brust tätowieren lassen.
An einem Abend, gegen Ende der Sommerferien, behandelte ihn seine Mutter so schroff, wie er es noch nie erlebt hatte. Plötzlich und ohne Vorwarnung war dieser Abend über ihn hereingebrochen.
Sie war ausgegangen, weil sie, wie sie Noboru erzählt hatte, Tsukazaki, den Zweiten Offizier eines im Hafen liegenden Frachtschiffes, zum Essen einladen wollte, um ihm dafür zu danken, dass er am Vortag so freundlich gewesen war, sie und ihren Sohn auf seinem Schiff herumzuführen. Sie trug einen schwarzen Seidenkimono aus Spitze über einem karmesinroten Unterkimono und einen weißen Sommer-Obi aus Gaze. Sie war unvergleichlich schön.
Gegen zehn Uhr abends kam sie mit Tsukazaki zurück. Noboru begrüßte ihn und hörte noch eine Weile im Wohnzimmer zu, wie der leicht angetrunkene Seemann von seinem Schiff erzählte. Um halb elf schickte die Mutter Noboru ins Bett. Nachdem sie ihn auf sein Zimmer gebracht hatte, schloss sie die Tür von außen ab.
Die Nacht war so schwül, dass Noboru in der Nische kaum Luft bekommen würde, also wartete er, war aber bereit, jederzeit hineinzukriechen. Es war nach Mitternacht, als er leise Schritte auf der Treppe vernahm. Im Dunkeln sah er, wie der Knauf seiner Zimmertür verstohlen gedreht wurde, offenbar um zu prüfen, ob sie wirklich verschlossen war. Das war noch nie geschehen. Kurz darauf hörte er, wie die Tür zum Zimmer seiner Mutter geöffnet wurde, und zwängte seinen verschwitzten Körper in die Nische.
Der Mond spiegelte sich auf seinem Weg nach Süden in der Scheibe des offenen Fensters im Schlafzimmer der Mutter. Der Seemann lehnte am Fenster, sein Hemd mit den goldenen Schulterklappen war geöffnet. Mit dem Rücken zu Noboru trat seine Mutter zu ihm, und sie küssten sich lange. Dann berührte sie die Knöpfe seines Hemdes, sagte leise etwas, knipste die Stehlampe mit dem gedämpften Licht an und verschwand aus Noborus Blickfeld. Vor dem Schrank in einer Ecke des Zimmers, die er durch das Guckloch nicht sehen konnte, begann sich seine Mutter auszuziehen. Als sie den Obi löste, hörte er ganz nah ein bedrohliches Zischen wie das einer Schlange, ehe ihr Kimono leise raschelnd zu Boden glitt. Plötzlich drang der allgegenwärtige Duft ihres Parfums – Arpège – durch das Guckloch. Noch nie hatte seine Mutter beim Entkleiden so stark und betörend geduftet wie jetzt, nachdem sie leicht angetrunken und verschwitzt durch die feuchtwarme Nacht gelaufen war.
Der Zweite Offizier starrte vom Fenster aus in Noborus Richtung. Im Licht der Stehlampe blitzten nur seine Augen aus dem sonnenverbrannten Gesicht hervor.
Noboru konnte seine Größe an der Höhe der Stehlampe ablesen, da er seine eigene auch dort abmaß. Der Mann war höchstens 1,70 Meter, vielleicht sogar nur 1,65. Er war jedenfalls nicht groß.
Tsukazaki öffnete langsam die restlichen Knöpfe seines Hemdes und zog es ohne Hast aus. Er war ungefähr so alt wie Noborus Mutter, besaß aber eine jugendlichere und kräftigere Gestalt als die Männer, die an Land lebten, er hatte die Statur eines Seemanns. Seine breiten Schultern waren ausladend wie die Balken eines Tempeldachs, seine behaarte Brust wölbte sich kraftvoll nach vorn, und durch die hart wie gedrehtes Sisalseil hervortretenden Muskelstränge schien es, als trüge er einen Fleischpanzer, den er jederzeit abstreifen konnte. Voller Bewunderung betrachtete Noboru den glänzenden Stupa, der sich stolz aus seinem dicht behaarten Unterleib erhob.
Durch die seitliche Beleuchtung warf seine Brustbehaarung feine flimmernde Schatten, während seine scharf blitzenden Augen unablässig auf Noborus sich entkleidende Mutter gerichtet waren. Das Mondlicht hinter ihm verlieh seinen breiten Schultern einen goldenen Grat und ließ die Adern an seinem kräftigen Hals golden hervortreten. Gold aus echtem Fleisch, gegossen aus Mondlicht und glänzendem Schweiß.
Noborus Mutter ließ sich viel Zeit beim Ausziehen. Vielleicht absichtlich mehr als nötig.
Plötzlich drang das tiefe Dröhnen eines Schiffshorns durch das offene Fenster und erfüllte den dämmrigen Raum. Laut, wild, dunkel, fordernd, klagend, endlos, schwarz und glatt wie der Rücken eines Wals, beladen mit allen Leidenschaften des Wogens der Gezeiten, der unzähligen Fahrten, des Glücks und der Schmach, klang es wie der Schrei des Meeres selbst. Von fernen Küsten ertönte dieser Ruf, erfüllt von der Glut und dem Wahnsinn der Nacht, über die Weiten des Meeres hinweg und trug das Verlangen nach dem dunklen Nektar in dem kleinen Raum in sich.
Mit einem Ruck drehte sich der Offizier zum Fenster und blickte hinaus aufs Meer.
In diesem Moment hatte Noboru das Gefühl, Zeuge eines Wunders zu sein, bei dem sich etwas, das seit seiner Geburt in ihm eingeschlossen war, entfaltete und voll erblühte.
Bis das Horn ertönte, war es nur als vage Skizze zu erkennen gewesen. Alles war bereit und steuerte auf den einen überirdischen Augenblick zu, doch obwohl die feinsten Materialien zur Verfügung standen, hatte es noch an der Kraft gefehlt, das ungeordnete Baustofflager der Wirklichkeit in einen Palast zu verwandeln.
Und damit wurde das Horn zum entscheidenden Signal, das allem seine vollkommene Form gab!
Der Mond, die Meeresbrise, der Schweiß, das Parfüm, das nackte Fleisch des reifen Mannes und der reifen Frau, die Spuren der Fahrten auf See, die Reste der Erinnerung an die Häfen der Welt, das winzige Guckloch in diese Welt, das harte Herz des Jungen, all das war bereits vorhanden gewesen. Doch für sich genommen hatten diese einzelnen Teile noch nichts bedeutet. Erst durch das Horn waren sie eine kosmische Verbindung eingegangen und hatten Einblick in den unentrinnbaren Kreislauf des Daseins gewährt, der den Jungen mit seiner Mutter, die Mutter mit dem Mann, den Mann mit dem Meer und das Meer mit Noboru verband.
Noboru war so atemlos, verschwitzt und ekstatisch, dass er beinahe das Bewusstsein verlor. Er glaubte zu sehen, wie sich vor ihm Fäden zu einem heiligen Gewebe verbanden, das er nicht zerstören durfte, weil er, der dreizehnjährige Junge, es selbst geschaffen hatte.
Niemand darf es zerstören, dachte Noboru zwischen Träumen und Wachen. Seine Zerstörung würde das Ende der Welt bedeuten. Um das zu verhindern, werde ich alles tun, so schrecklich es auch sein mag.
2
Überrascht erwachte Ryuji Tsukazaki in dem ungewohnten Messingbett. Der Platz neben ihm war leer. Allmählich fiel ihm wieder ein, was die Frau gesagt hatte. Sie müsse früh aufstehen, um ihren Sohn zu wecken, der mit Freunden zum Schwimmen nach Kamakura fahren wolle, aber sobald der Junge weg sei, käme sie zurück, bis dahin solle er ruhig liegen bleiben.
Er tastete auf dem Nachttisch nach seiner Armbanduhr und las im Licht, das durch die nicht ganz zugezogenen Vorhänge fiel, die Zeit ab. Es war zehn vor acht. Der Junge war bestimmt noch nicht weg.
Ryuji hatte nur ungefähr vier Stunden geschlafen. Zufällig war er genau um die Zeit eingeschlafen, zu der er für gewöhnlich nach der Nachtwache zu Bett ging.
Dennoch war er hellwach, und nach den Freuden der letzten Nacht fühlte sich sein Körper gespannt an wie eine Feder. Er streckte sich und betrachtete danach zufrieden die Haare auf seinen muskulösen vor der Brust verschränkten Armen, die im Licht, das durch die Vorhänge fiel, golden schimmerten.
Es war brütend heiß, sogar schon am Morgen. Die Vorhänge hingen reglos vor dem Fenster, das sie über Nacht offen gelassen hatten. Ryuji streckte einen Arm aus und drückte mit einem Finger auf den Schalter des Ventilators auf dem Nachttisch.
»Zweiter Offizier, fünfzehn Minuten bis zur Wache«, hatte der Steuermann ihm gerade noch im Traum deutlich zugerufen.
Tag für Tag, von zwölf bis vier Uhr nachmittags und von Mitternacht bis vier Uhr morgens, hielt der Zweite Offizier Ryuji Tsukazaki Wache. Um ihn herum waren nur das Meer und die Sterne.
Auf dem Frachtschiff Rakuyo-maru galt er als Sonderling, mit dem nicht leicht auszukommen war. Er redete nicht gern, hielt nichts vom »Klönen«, dem einzigen Vergnügen der Seeleute, wie man so sagt. Das Gerede über Frauen, die Abenteuer an Land und all die Prahlereien waren ihm zuwider … das ganze banale Geschwätz, das die Einsamkeit vertreiben sollte, ebenso wie die Rituale, die angeblich der Festigung menschlicher Bindungen dienten.
Während viele Seeleute aus Liebe zum Meer zur See fuhren, war Ryuji Seemann geworden, weil er das Land hasste. Ungefähr zu der Zeit, als er die Marineakademie verließ und anheuerte, hob die Besatzungsmacht das Überseeverbot für japanische Schiffe auf, und er fuhr auf einem der ersten Hochseefrachter, die nach dem Krieg Formosa und Hongkong, später auch Indien und Pakistan anliefen.
Die tropische Atmosphäre erfüllte sein Herz mit Freude. An Land brachten die einheimischen Kinder Bananen, Papayas, Ananas, Affen und bunte Vögel, um sie gegen Nylonstrümpfe und Uhren einzutauschen. Er liebte die Palmenhaine, die ihre Schatten auf schlammige Flüsse warfen. Vielleicht zogen sie ihn so sehr in ihren Bann, weil er sie aus der Heimat eines seiner Vorleben kannte?
Mit den Jahren verloren die exotischen Landschaften allerdings ihren Reiz. Er hatte den Charakter eines Seemanns entwickelt, der weder dem Land noch dem Meer angehörte. Vielleicht sollte jemand, der das Land hasste, für immer an Land bleiben. Denn durch die Entfernung und die langen Seereisen begann Ryuji, unweigerlich davon zu träumen, und beging damit den Fehler, von etwas zu träumen, das er eigentlich verabscheute.
Mit zwanzig war Ryuji nur von einem inbrünstigen Gedanken durchglüht gewesen: »Ruhm! Ruhm! Ruhm zu erlangen, dazu bin ich geboren!«
Er hatte keine Ahnung, welche Art von Ruhm er anstrebte oder welche Art von Ruhm für ihn erreichbar gewesen wäre.
Er war lediglich davon überzeugt, dass es in den dunklen Tiefen der Welt einen Lichtpunkt gab, der nur für ihn bestimmt war und sich nähern würde, um allein ihn zu erleuchten.
Je mehr er darüber nachdachte, desto klarer wurde ihm, dass er die Welt auf den Kopf stellen musste, um Ruhm zu erlangen. Umsturz und Ruhm bedingten einander. Er sehnte sich nach einem Sturm. Aber das Leben an Bord lehrte ihn nur die wohlgeordneten Gesetze der Natur und das Gleichgewicht der dem ständigen Wandel unterworfenen Welt.
Ryuji begann nach und nach, seine Wünsche und Träume zu überprüfen und abzustreichen, wie Seeleute die Tage auf dem Kalender in ihrer Kabine.
Aber während der Nachtwache fühlte er manchmal noch jenseits der dunklen Wellen, inmitten der glänzenden Dünung, die in der Finsternis anschwoll, wie sein Verlangen nach Ruhm ausschwärmte wie leuchtende Meerestiere, die sich im Verborgenen bewegten, um seine glorreiche Gestalt am Klippenrand der Menschenwelt zu beleuchten.
Wenn er in solchen Nächten auf der weißen Brücke stand, umgeben von Ruder, Radar, Funkgerät, Magnetkompass und der Schiffsglocke aus Messing an der Decke, glaubte er fest an seine besondere Bestimmung. Glaubte, ihn erwarte ein eigens für ihn geschaffenes glanzvolles Schicksal, wie es keinem gewöhnlichen Menschen vergönnt war.
Ryuji mochte volkstümliche Musik, sammelte Platten mit neuen Schlagern, lernte sie auswendig, wenn er auf See war, und summte sie in den Dienstpausen, verstummte aber sofort, wenn jemand in seine Nähe kam. Seemannslieder wie Das ist das Leben der Matrosen liebte er besonders, obwohl die anderen Seeleute nichts dafür übrighatten.
Das Horn ertönt, die bunten Bänder reißen,
das Schiff legt ab von der Pier.
Seemann bin ich, Seemann will ich heißen,
eine Träne im Aug’, lass ich den Hafen hinter mir.
Nach der Mittagswache und vor dem Abendessen schloss sich Ryuji in seiner von der sinkenden Sonne erleuchteten Kajüte ein und spielte die Platte immer wieder in gedämpfter Lautstärke ab. Er hörte die Platte so leise, weil er nicht wollte, dass seine Kollegen aufmerksam wurden und womöglich zum »Klönen« hereinkämen. Alle wussten das, und niemand störte ihn.
Wenn Ryuji das Lied hörte und mitsummte, kamen ihm mitunter die Tränen, genau wie dem Seemann im Text. Aber die Tränen stammten von einem Ort, den er nicht kontrollieren konnte, von einem fernen, dunklen und verletzlichen Teil seines Selbst, über den er ungeachtet seines Alters keine Macht hatte.
Aber wenn das Land tatsächlich seinen Blicken entschwand, vergoss er nie auch nur eine Träne. Geringschätzig sah er zu, wie die Kais, die Docks, die Kräne und die Dächer der Lagerhäuser unaufhaltsam außer Sicht gerieten. Das leidenschaftliche Feuer des Aufbruchs war nach einem Dutzend Jahren Seefahrt erloschen. Geblieben waren die sengende Sonne und ein scharfes Auge.
Er übernahm seine Wache, schlief, stand auf, übernahm die nächste Wache und schlief wieder. Da er darauf bedacht war, so viel wie möglich für sich zu sein, stauten sich seine Gefühle ebenso auf, wie seine Ersparnisse wuchsen. Je versierter er in astronomischen Beobachtungen wurde, je besser er die Sterne kannte, je geschickter er mit den Tauen und der Arbeit an Deck umging, je mehr er sich daran gewöhnte, den nächtlichen Gezeitenströmen zu lauschen, dem Puls und der Peristaltik des Meeres, je vertrauter er mit den prächtigen tropischen Cumuluswolken und den in allen sieben Farben des Regenbogens schimmernden Korallenriffen wurde, desto mehr füllte sich sein Sparbuch, auf dem sich inzwischen zwei Millionen Yen angesammelt hatten, eine für einen Zweiten Offizier außergewöhnliche Summe.
Früher hatte Ryuji es genossen, Geld auszugeben. Seine Jungfräulichkeit verlor er auf seiner ersten Reise nach Hongkong, als ein älterer Kollege ihn zu einer Frau vom Wasservolk der Tanka mitnahm.
Ryuji lag rauchend auf dem Messingbett und ließ die Asche seiner Zigarette vom Ventilator verwehen. Nachdenklich kniff er die Augen zusammen und verglich Qualität und Quantität seines Vergnügens in der letzten Nacht mit dem seiner ersten Erfahrung.
Vor seinem inneren Auge sah er die dunkle Kaimauer von Hongkong, das trübe, schwere Wasser, das daran leckte, und die friedlichen Lichter der vielen Sampans.
Jenseits der unzähligen Masten und eingezogenen Mattensegel leuchteten hoch über dem schwimmenden Tanka-Dorf die Fenster der Gebäude, und die Coca-Cola-Leuchtreklamen der Stadt Hongkong spiegelten sich schillernd im schwarzen Wasser und überstrahlten die bescheidenen Lichter im Vordergrund.
Der Sampan der Frau mittleren Alters mit Ryuji und dem älteren Matrosen glitt mit leisem Ruderplätschern zwischen den Booten hindurch. Als sie schließlich eine Stelle mit besonders vielen Laternen erreichten, sah er die hell erleuchteten Kabinen der Mädchen.
Ihre Boote waren so miteinander vertäut, dass sie einen Halbkreis bildeten. Die ihnen zugewandten Hecks waren zu Ehren lokaler Gottheiten mit roten und grünen Papierfahnen und brennenden Räucherstäbchen geschmückt, die Innenseiten der halbrunden Planen mit geblümtem Stoff bespannt. Dahinter befanden sich jeweils ein mit dem gleichen Stoff bedecktes Podest, und in den darüber angebrachten Spiegeln sah sich Ryuji in seinem Sampan schemenhaft vorübergleiten.