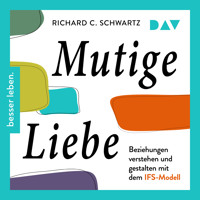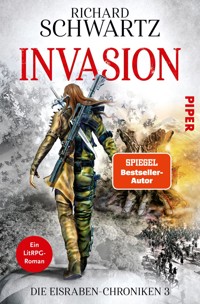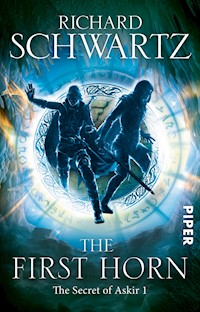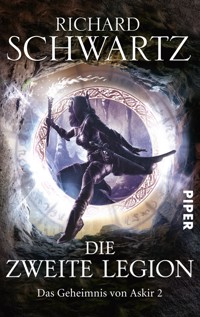8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Der Krieger Havald, die Halbelfe Leandra und ihre Gefährten sind auf der Suche nach einem Weg, um aus der exotischen Stadt Gasalabad nach Askir zu gelangen. Denn dort hoffen sie auf Unterstützung gegen den Tyrannen Thalak, der ihre Heimatlande mit Zerstörung bedroht. Doch Thalaks Macht reicht bis nach Gasalabad. Der finstere Herrscher setzt alles daran, durch Intrigen und Attentate die Gefährten in Gasalabad festzuhalten. Bald wissen sie nicht mehr, wer Freund und wer Feind ist, und geraten von einer tödlichen Gefahr in die nächste.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Für Barbara
ISBN 978-3-492-95455-6 Januar 2017 © Piper Verlag GmbH, München/Berlin 2008 Umschlaggestaltung: Guter Punkt, München Umschlagabbildung: Uwe Jarling Datenkonvertierung: CPI books GmbH, Leck
Was bisher geschah
Havald und seine Gefährten suchen in der sagenumwobenen Kaiserstadt Askir Hilfe gegen das tyrannische Imperium von Thalak, das ihre Länder zu überrennen droht. Auf dem Weg nach Askir gelangen die Helden in das Wüstenreich Bessarein und werden in finstere Intrigen um die Thronfolge des Landes verwickelt. Mehr und mehr stellt sich jedoch heraus, dass das Reich von Thalak auch in dieser Weltgegend die Fäden zieht und dass der Machtkampf, der in der Stadt Gasalabad ausgetragen wird, ebenso Havalds Kampf ist.
Als die Nekromanten Thalaks sich des Throns von Gasalabad bemächtigen wollen, können die Gefährten in letzter Minute die Gefahr abwenden: Havald, Leandra, Zokora und ihre Mitstreiter entlarven die magisch manipulierte Prinzessin Marinae und verhelfen ihrer Schwester Faihlyd auf den Löwenthron. Aber dadurch werden sie nur noch tiefer in die Wirren verwickelt und sind nun selbst Ziel der mörderischen Nekromanten und Nachtfalken, der Diener des Dunklen Gottes. Die Mission, die sie nach Askir führen soll, könnte für die Gefährten bereits in Gasalabad tödlich enden …
1. Freunde
»Guten Morgen, Esseri!«, ertönte eine fröhliche Stimme. »Haben die Götter das nicht wunderbar eingerichtet? Kaum hat man eine Nacht lang geschlafen, ist das, was vergangen ist, in die Ferne gerückt, der Kummer und die Sorge des Vortags sind gemildert. Das sanfte Licht der Sonne gibt einem neue Kraft und neuen Mut. Was war, ist vorbei, und ein neuer Tag beginnt!«
Armin.
Ich hätte ihn erschlagen können. Ich war geneigt, die Decke über meinen Kopf zu ziehen und mich auf die andere Seite zu drehen, aber ich kannte diesen Quälgeist, das würde ihn nicht abhalten.
»Warum bist du nicht im Palast bei deiner Verlobten?«, fragte ich, während mein ehemaliger Diener mit den hölzernen Läden der raumhohen Fenster zum Innenhof unseres Hauses klapperte und helles Licht in mein Zimmer strömen ließ.
»Weil Ihr, Esseri, mich mehr braucht als meine Liebste. Ihr habt es weit gebracht, aber ohne meine Hilfe seid Ihr in dieser Stadt verloren wie ein kleines Kind, das sich im Wald verirrt.«
Ich richtete mich im Bett auf, öffnete ein Auge, um Armin vorwurfsvoll anzusehen. Er war wieder als mein Diener gekleidet: eine blaue seidene Hose, Stiefel, die eine seltsam geschwungene Spitze hatten, ein weißes Hemd und eine blaue Weste mit goldenem Brokat. Zu bunt, wenn man mich fragte. Was sein farbenprächtiges Erscheinungsbild anging, hatte mein Diener jedoch bislang wenig Rücksicht auf meine Meinung genommen. Mit solchen Dingen, meinte er, kannte ich mich nicht aus. Über alldem trug er ein locker fallendes, weißes Gewand, einen Burnus mit einer leichten Haube, die im Moment zurückgeschlagen war und nur dem Zweck diente, das Licht der Sonne abzuhalten. So ähnlich wie Fensterläden – wenn sie nicht gerade zur Seite geschoben wurden.
»Also das hältst du von deinem Herrn, ja?«, fragte ich, gähnte dabei und warf einen bedauernden Blick auf die linke Seite des Betts, wo das zerknitterte Laken immer noch nach Leandra roch. Ich erinnerte mich vage daran, dass sie aufgestanden war und vergeblich versucht hatte, mich ebenfalls dazu zu bringen. Ich weiß nicht, wie lange es her war, dass ich hatte ausschlafen können, und wenn Armin nicht gekommen wäre, hätte ich es bestimmt noch länger im Bett ausgehalten.
Dieses Haus war ein Geschenk des alten Emirs, Erkul des Gerechten, des Vaters von Faihlyd, die vor wenigen Tagen zur Emira gekrönt worden war. Es war ihr sechzehnter Geburtstag gewesen, und da sie in der ganzen Stadt beliebt war, gab es ein großes Volksfest; für einen Tag lang schien es, als hätte die Goldene Stadt nur diese eine Seite: fröhlich, ausgelassen und frohgemut. So prachtvoll sich Feier und Krönung auch anließen, genau an Faihlyds Freudentag hatte sich eine finstere Intrige offenbart: Ihre ältere Schwester Marinae war unter den Einfluss eines Nekromanten geraten – oder eines Seelenreiters, wie man diese abscheulichen Diener des Namenlosen hier in Bessarein nannte –, und hatte den Thron des Emirats für sich beansprucht.
Wer immer Marinae beherrscht hatte, besaß große Macht, trotzte dem Emir und seinem Wunsch, Faihlyd zur Emira zu ernennen, und hatte dabei fast den gesamten Thronraum in seinem Bann gehalten, bis die Götter selbst eingriffen, zum einen, indem sie ein deutliches Zeichen gaben, wer ihre Gunst besaß, zum anderen durch die wundersame Wiedergeburt eines jahrhundertealten Geistes.
Dies war wohl das größte Wunder, das ich je gesehen hatte. Helis, die Schwester Armins, war in die Fänge eines solchen Nekromanten geraten, er hatte ihr die Seele gestohlen und damit auch das Talent, mit Tieren zu reden. Was von Armins Schwester übrig blieb, war eine junge Frau mit einfachstem, aber liebevollem Gemüt. Da man ihr auch das neugeborene Kind genommen hatte, war sie als Faraisas Amme im Thronsaal zugegen gewesen.
Dort hatte sie Eiswehr berührt, eine magische Waffe, ein Bannschwert, das einst von Askannon geschmiedet worden war, dem mächtigen Magier und Herrscher über ein legendäres Reich. Und in jenem Schwert war auf unerklärliche Art und Weise der Geist von Serafine gebunden, der Zeugmeisterin des Ersten Horns, mit dem alles seinen Anfang genommen hatte.
In dem Moment, da Helis das Schwert berührte, fand der Geist dieser Soldatin ein neues Zuhause in dem entseelten Körper der jungen Frau, und Serafine wusste sehr gut, wie man mit Seelenreitern zu verfahren hatte. Ihr Eingreifen hatte das Emirat gerettet und wahrscheinlich auch uns, selbst wenn es dazu führte, dass Faihlyd ihrer eigenen Schwester den Kopf abschlagen musste. So verlor die Emira ihren Vater, dessen krankes Herz all das nicht verkraftete, und eine geliebte Schwester im gleichen Moment. Dabei hätte es der bedeutsamste und schönste Augenblick ihres Lebens sein sollen.
Armin – Diener, sprachgewandter Witzbold und Führer einer Schaustellertruppe, Fürst des verbotenen Hauses des Adlers – war zugleich auch der heimliche Verlobte, wahrscheinlich sogar Gemahl der Emira. Auf der Suche nach seiner geraubten Schwester Helis hatte sein Weg den ihren gekreuzt. So waren Armin, ein Gaukler, und Faihlyd, die Tochter eines Emirs, Verbündete und nun auch Liebende. Denn kurz vor der Krönung hatten sie sich, von allen unbemerkt, an Bord meines Schiffes, der Lanze des Ruhms, getraut. Das letzte Mal hatte ich die Emira Faihlyd vor drei Tagen gesehen, als die Krönungsfeierlichkeiten, die wegen des Zwischenfalls vom Vortag abgebrochen worden waren, einen Tag später ihre Fortsetzung fanden. Ihre Trauer war spürbar, und auch Armin war niedergeschlagen, weil es ihm nicht gelang, seine Liebste aufzumuntern.
Ihn jetzt so wohlgemut zu sehen, war schön, aber dass er solch gute Laune ausgerechnet an diesem Morgen zur Schau stellte, war mir nicht ganz so willkommen.
Das Gebäude war einst die Münzerei des Alten Reichs in Gasalabad gewesen. In vielerlei Hinsicht war der Baustil unverkennbar, die präzise gesetzten Steine brauchten keinen Mörtel, schienen für die Ewigkeit gebaut. Es war, wie oft bei imperialen Bauten, von achteckiger Struktur, mit einem Innenhof. Die Fenster an der Außenwand waren klein und wehrhaft; schwere Läden, stabil verschlossen und verriegelt, erschwerten den Zugang. Die Außenmauer war, wie bei vielen Gebäuden der Goldenen Stadt, mit glasierten Ziegeln verziert, sie war hübsch anzusehen – und bot zugleich keinerlei Halt für ungeladene Gäste mit Kletterkünsten.
Der Innenhof hingegen war weit und luftig, ein Brunnen plätscherte dort im Sonnenlicht, umgeben von einem Ziergarten, dessen Rosen die Luft mit einem süßen Duft erfüllten.
Die Fenster meines Raums führten in eben jenen sonnendurchfluteten achteckigen Innenhof. Vor wenigen Tagen war dort alles verdorrt gewesen, der kleine Brunnen ausgetrocknet, aber durch das Wort des Emirs hatte sich eine wundersame Wandlung vollzogen: Eine Geste des Herrschers hatte das Haus in erstaunlich wenigen Tagen von einem verfallenen Gemäuer in ein herrschaftliches Domizil verwandelt.
Unser Haus lag am Platz des Korns, unweit des Hafens. Gasalabad schlief nie, und außerhalb unserer Mauern wurde das Korn verladen, das die Goldene Stadt am Leben hielt. Doch das Rollen schwerer Wagenräder, die Rufe der Händler oder die wortreichen und blumigen Beschwerden über den Preis der Waren drangen nur als ein fernes, gedämpftes Rauschen an mein Ohr.
Sonnenlicht fiel in den Raum und zeigte mir eine Pracht aus polierten Bodenhölzern, kostbaren Möbeln aus Rosenholz, einen kleinen Schreibtisch an der Seite sowie einen reich verzierten Schrank, in dem sich kostbare Gewänder befanden, die meisten von ihnen aus Seide, einem Stoff, den sich in meiner Heimat nur Könige und reiche Handelsherren leisten konnten.
Gähnend erhob ich mich, wickelte mir die leichte Decke um die Lenden und trat durch die geöffneten Fenster auf den umlaufenden Balkon des Innenhofs, wo auch Armin stand. Für den Moment war er still und hielt den Blick hinab in den Innenhof gerichtet.
Ich trat neben ihn und folgte seinem Blick. Dort unten auf der Bank saßen Leandra, die Liebe meines Herzens, und Faihlyd, die Emira von Gasalabad, und unterhielten sich leise, Faihlyd mit vielen schnellen Gesten, blitzenden Augen und schnellem Lächeln, Leandra ruhiger, aber nicht minder eindringlich. Hier, in der Abgeschiedenheit des Innenhofs verzichtete Leandra auf die Perücke, die sie sonst in der Stadt tragen musste. Kurzes Haar war in diesem Land ein Zeichen von Schande, und Leandras schönes langes Haar war im Kampf gegen einen Nekromanten und Verräter verbrannt. Weit weg von hier, in einem alten Tempel, in den eisigen Höhlen unter den Ausläufern der Donnerberge. Auch sie selbst war verbrannt, aber die Macht des alten Wolfsgottes hatte ihr die Gesundheit wiedergegeben und ihre schweren Wunden spurlos verschwinden lassen, nur ihr Haar war noch nicht wieder nachgewachsen.
Jetzt war es wie ein weißer Helm, nicht mehr als einen Fingerbreit lang, ein leichter, feiner Flaum, den ich gerne unter meinen Händen spürte. In Leandra floss das Blut der Elfen, sie war groß und schlank, ihre Ausbildung als Maestra und Schwertkämpferin hatte ihr Haltung und Muskeln verliehen. Faihlyd hingegen war eher klein und zierlich, mit langem pechschwarzen Haar und durchdringenden dunklen Augen, die lachen oder weinen konnten und denen währenddessen doch nichts entging.
Sechzehn Jahre war sie alt, hatte den Bruder, die Mutter und nun auch den Vater durch einen Anschlag verloren und stand selbst unter ständiger Bedrohung, ermordet zu werden. Dennoch hatte sie stets ein warmes Lächeln für jeden, und obwohl sie von stürmischem Wesen war, strahlte sie eine Freundlichkeit und zugleich Verlässlichkeit aus, die selten bei jemandem ihres Alters zu finden war. Auf den Straßen von Gasalabad nannte man sie die Hoffnung Bessareins, und wenn die Götter es fügten, dann war sie in wenigen Wochen nicht nur Emira des größten Emirats, sondern Kalifa des ganzen Reiches. Wenn die anderen acht Emirate ihrer Wahl zustimmen würden. Dies war nötig, weil der alte Kalif vor wenigen Monden ohne Erben verstorben war. Wo es eine Krone zu gewinnen gab, waren Intrigen, Verrat, Lüge und Mord nicht weit. Gerade als ich zu ihr hinab sah, lachte sie, einen Moment später folgte Leandras glockenhelles Lachen: Die beiden Frauen verstanden sich. Beide trugen sie eine enorme Verantwortung auf ihren Schultern.
»Ich freue mich, die Emira Faihlyd so wohlgemut zu sehen«, sagte ich leise zu Armin.
Er warf mir einen Blick zu und ein leichtes Lächeln. »Das hat einen Grund, und der hat uns auch hierher geführt.«
»Was ist das für ein Grund?«, fragte ich und streckte mich. Es knirschte und knackte vernehmlich. Mein verfluchtes Schwert, ebenfalls ein Bannschwert aus dieser unheimlichen Schmiede Askannons, gab mir mit jedem Leben, das es nahm, einen Teil meiner Jugend zurück, dennoch fühlte ich mich manchmal noch älter, als ich es ohnehin schon war.
Er seufzte und wandte sich mir ganz zu. »Esseri«, begann er leise. »Wisst Ihr, was ein gekröntes Haupt am meisten vermisst?«
Ich konnte es mir denken und nickte nur.
»Freundschaft ohne den Dolch im Ärmel«, fuhr Armin fort. »Leben zu können, wie es das Herz gebietet und nicht, wie die Krone es verlangt. Auch die Blume Eures Herzens, Essera Leandra, verfolgt ein Ziel, auch sie handelt nicht ohne Eigennutz, doch ihr Ziel und ihr Handeln stehen nicht im Widerspruch zu dem meiner schönen Löwin. Eure Freundschaft ist mir mehr wert, als Ihr es denken könnt, und so ist es auch bei meiner Blume. Allein diese Freundschaft ist schon genug für sie, und auch für mich. Die Ruhe dieses Gartens zu suchen, zu wissen, dass man unter Freunden ist und hier niemand einen Dolch im Ärmel trägt – ein weiteres Geschenk von unschätzbarem Wert.« Armins hageres Gesicht war ernst, als er mir tief in die Augen sah. »Freundschaft und Liebe sind Güter, die man nicht kaufen kann, selbst für all das Gold nicht, das in ihren Schatzkammern liegt.«
»Also wollt ihr etwas von uns«, sagte ich mit einem Lächeln, um meinen Worten die Spitze zu nehmen.
Er seufzte. »Musstet Ihr es so auf den Punkt bringen?«, fragte er mit leichtem Vorwurf in der Stimme, aber auch er lächelte. Manche Dinge waren eben so.
Aber das, was er vorher gesagt hatte, fühlte sich wahr an, und er hatte damit auch recht. Freundschaft allein ist schon ein hohes Geschenk. Armin war ein Mann mit vielen Gesichtern. Im Vergleich zu mir war er drahtig, sein Kopf war bis auf einen Zopf rasiert, er trug Tätowierungen und einen kleinen Spitzbart, der lustig zuckte, wenn er sprach. Ein kleiner Mann, der einen leicht zum Lächeln brachte und den man noch leichter unterschätzen konnte. Hinter diesen dunklen Augen lag ein wacher Geist, der mindestens so wendig war wie seine Zunge.
In einem Ritual war er von seiner Familie für tot erklärt worden, um allein aufzubrechen, seine entführte Schwester zu suchen. Er wusste, wen er jagte: ein Ungeheuer, einen Nekromanten und Seelenreiter. Jemanden, der vom Namenlosen verführt und von allen anderen Göttern verflucht worden war, einen Gegner, gegen den er kaum gewinnen konnte. Dennoch war es letztlich Armin gewesen, der den Nekromanten Ordun besiegt hatte. Dieser hatte seiner Schwester die Seele geraubt und auch mich beinahe mit einem schrecklichen Kuss bezwungen.
Mit meinem Schwert Seelenreißer hatte er Ordun gezwungen, die geraubten Seelen freizugeben, darunter auch die Seele seiner Schwester, die so endlich den Weg zu Soltars Toren fand, dem Gott, dem ich doch recht widerwillig diente und der die Seelen der Toten in ein neues Leben führte.
In Armin steckte so viel Unterschiedliches, dass ich ihn wohl kaum jemals richtig kennenlernen würde. Aber ich spürte, dass er wirklich mein Freund war.
»Was ist es, Armin?«
»Es geht um eure Mission, eure Ziele und um unsere Bestrebungen. Es geht um Feinde und Freundschaft, um Vertrauen und Verrat. Eure Freundin Sieglinde macht vielleicht eine Ballade daraus, und es wäre eine spannende Geschichte.« Er seufzte erneut. »Wir wissen, dass ihr nicht gerne hier in unsere Fallstricke verwickelt seid. Ihr bleibt, weil wir euch baten, unserer Hochzeit beizuwohnen, ihr habt meiner Löwin mehrfach das Leben gerettet, euer eigenes riskiert, und doch wollt ihr nur eines: so schnell wie möglich mit eurem Schiff nach Askir reisen.« Er sah mich offen an. »So habt ihr unsere Feinde zu den euren gemacht und vielleicht eure Feinde zu den unseren. Vielleicht ist es einerlei, und es sind ohnehin unser beider Feinde. So scheint es zumindest. Was meine Löwin mit Eurem Greifen bespricht, ist genau das, was ich Euch sagen will: Es gilt eine Allianz zu schmieden zwischen dem Greifen, dem Einhorn und der Rose, dem Löwen und dem Adler.«
Er schwieg und sah mich fragend an. Ich nickte nur leicht und lächelte beruhigend, ich fand nichts an seinen Worten, gegen das ich mich verwahren wollte.
»Gasalabad ist die Perle Bessareins. Kein anderes Emirat kommt ihr an Größe, Schönheit, Reichtum und Macht gleich – und an Schatten. Selbst wenn Faihlyd in ihrem Streben scheitern und nicht Kalifa werden sollte, so ist sie dennoch eine Macht und auch außerhalb der Grenzen ihres Reichs nicht ohne Einfluss.« Er sah zu mir. »Was sie Eurer Liebsten gerade verspricht, ist, diesen Einfluss und diese Macht an die Seite der Rose von Illian zu stellen. Eine Allianz zwischen unseren Häusern und eurem Königreich. Ob sie nun Kalifa sein wird oder nicht, auch Faihlyd wird nach Askir reisen und im Kronrat ihre Stimme für Euch erheben. Esseri, Havald, Freund. Sie hält immer ihr Wort. Es ist von Gewicht.«
»Ich führe kein Haus, Armin. Aber ich begrüße diese Allianz.«
»Das wird sie erfreuen. Aber es kann nicht stimmen, dass Ihr kein Haus führt. Die Maestra erzählte mir etwas anderes. Ihr seid ein Graf, Ihr führt die Rose und das Einhorn als Wappen. Ihr dient der Rose von Illian, Eurer Königin Eleonora, seit ihrer Geburt. Ihr tragt Titel, alte Titel, die auch in unserem Reich noch bekannt und anerkannt sind, ehrenhafte Titel, die, würdet Ihr sie nutzen wollen, Euch viele Türen öffnen würden. Bewahrer des Reiches …«
Ich schüttelte den Kopf. »Wenn jemand der Paladin unserer Königin ist, dann ist es Leandra. Sie trägt Steinherz, das Reichsschwert, und sie ist es, die für unsere Königin spricht.« Ich legte meine Hände auf das sonnenwarme Geländer aus kunstvoll bearbeitetem Stein und sah in den Garten hinunter. Dort schaute Leandra auf, begegnete meinem Blick und lächelte. Ich lächelte zurück und genoss diesen kurzen, vielsagenden Blickwechsel. Auch Faihlyd schaute auf, sah uns am Geländer stehen, schenkte uns beiden ein strahlendes Lächeln und Armin einen speziellen Blick. Sie winkte sogar, und ich hob die Hand zum Gruß.
»Ohne Leandra wären wir nicht hier«, sprach ich leise weiter. »Sie ist es, deren Mission wir folgen. Sie ist es, die das Unmögliche will: Hilfe gegen Thalak und die Befreiung unserer Reiche. Vielleicht ist das sogar möglich. Niemand weiß, was die Zukunft bringt. Aber wenn es gelingt, dann ist es ihr Werk.« Ich seufzte. »Was sie nicht wahrhaben will, ist, dass Roderic von Thurgau gestorben ist. Er starb in einer Schlacht, umgeben von guten Männern und loyalen Freunden.« Ich machte eine hilflose Geste. »Ich kann es nicht anders sagen, nicht anders erklären. Graf von Thurgau starb mit den vierzig Getreuen an jenem Pass. Es ist undenkbar, dass er überlebte. Es wäre ein Verrat an jenen, die mit ihm fielen.«
Armin sah mich lange an. »Schämt Ihr Euch zu leben, Herr?«, fragte er dann leise, und ich lachte bitter.
»Eines kann man dich nicht nennen, Armin. Du bist nicht blind.«
»Nein. Ihr irrt«, antwortete er. »Manchmal bin auch ich blind. Männer, so sagt mir meine Löwin, sind es oft. Aber in diesem Moment sehe ich sehr klar. Ich sehe, dass man vor allem weglaufen kann, nur nicht vor sich selbst. Auch Ihr könnt es nicht.«
Darauf gab es keine Antwort. Er wartete einen Moment. Ich sagte nichts, also sprach er weiter. »Wenn es Eurer Maestra gelingt, ein Bündnis gegen Thalak zu schmieden, dann nur, weil sie Hilfe hat. Und Gleiches gilt für die Löwin von Gasalabad und auch für mich. Wir brauchen eure Hilfe, so wie ihr unsere braucht.«
»Armin«, sagte ich. »Wir sind Freunde. Freunde helfen einander. Mehr braucht es für mich nicht. Was die Geschicke von Reichen und Königshäusern angeht, sprich mit Leandra. Mir jedoch genügt es, wenn du mir endlich sagst, wie ich helfen kann.«
»Zuerst gilt es, etwas herauszufinden. Etwas, das wir über Euch vermuten. Dazu müssen wir Euch etwas zeigen, von dem wir denken, dass Ihr es sehen könnt.«
»Ich bin gerade erst wach.« Ich sah zum Himmel, es schien mir kurz nach Mittag. »Es ist der erste ruhige Tag, seit wir unsere Reise begonnen haben, und du, mein Freund, hast mich zu früh geweckt und sprichst seitdem in Rätseln.«
Er nickte. »Es ist schwierig, es anders auszudrücken. Herr, stärkt Euch für den Tag, und wenn Ihr bereit seid, begleitet uns zurück in den Palast. Es ist vor allem Essera Falah, die Euch sehen möchte. Ihr Glauben an Euch, Esseri, ist so unerschütterlich wie ein Fels im Wind. Sie sagt, Ihr werdet die Antworten sehen können, die wir nur vermuten.« Er zuckte hilflos mit den Schultern. »Behält sie recht, ist es ein Zeichen und der erste Schritt auf einem Weg, den zu gehen man sich wohl überlegen sollte.«
»Geht es noch etwas verworrener, Armin?«, fragte ich.
»Essera Falah wünscht, dass Ihr sie in das Reich der Toten begleitet, um Euch Marinae und ihren Sohn, den Emir, anzusehen.«
Ich blinzelte, und Armin lächelte verlegen. »Genauer kann ich es Euch nicht sagen, Herr.«
»Das … ist unerwartet«, sagte ich dann. »Ich glaube, jetzt brauche ich wirklich erst einmal ein Frühstück.«
Unser Haus war groß und besaß neben dem Erdgeschoss zwei weitere Stockwerke mit etlichen kleinen und insgesamt sechzehn großen Zimmern. Mehrere von ihnen dienten repräsentativen Zwecken. Die meisten Zimmer hatte ich mir noch gar nicht angesehen, seit der Emir das Haus wieder hatte herrichten lassen. Ohne nachzusehen, wusste ich, dass jeder einzelne Raum prächtig eingerichtet war, mit Gold, Seide und edlen Bodendielen, kostbaren Möbeln und anderem Wertvollen und Schönen.
Die Küche jedoch war anders: ein großer Raum ohne jeden Schnörkel, auf ganzer Breite zum Innenhof offen. Auch von hier aus konnte ich Leandra und Faihlyd sehen, die sich noch immer am Brunnen unterhielten. Der Boden war mit Steinplatten gefliest, die Wände aus unverkleidetem grauen Stein. Die großen Herde kannte ich noch vom Gasthof Zum Hammerkopf. Eine stabile Tür führte von der Küche zum umlaufenden Gang im Erdgeschoss, der zu beiden Seiten in der großen Eingangshalle endete. Zwei weitere Türen führten zu kühlen Räumen mit dicken Mauern, die der Vorratshaltung dienten. Eine weitere schwere Tür gab den Weg in eine Räucherkammer frei, die hinter dem schweren Herd lag, und eine letzte Tür führte hinab in den Keller, wo ein anderes Geheimnis des Hauses verborgen war.
Die Küche war groß, einst mochte hier ein Koch sein Regiment über ein Dutzend Küchenhilfen geführt haben. Sie war mit Bedacht eingerichtet worden. Der große alte Tisch aus Eichenholz war vielleicht das einzige Möbelstück, das sich bereits im Haus befunden hatte, als wir es kauften. Er war einfach zu schwer, um ihn zu stehlen. Als das Haus restauriert wurde, hatte man den Tisch neu abgeschliffen und gesäubert, ließ ihn aber stehen, mit all seinen Kerben, den Zeichen und Worten, die gelangweilte Hände über die Zeiten in seine Oberfläche geritzt hatten. Er besaß Charakter und war groß genug für mindestens zehn Stühle. Es war wohl üblich, dass die Dienerschaft in der Küche aß.
Wir hatten keine Dienerschaft, jedoch einen kostbar ausgestatteten Speiseraum – mit Vasen, Blumen, kunstvollen Deckengemälden, einem verzierten Tisch aus Rosenholz und gepolsterten Stühlen. Und doch schien es mir, als hätten wir unabhängig voneinander entschieden, dass es diese einfachen Küchenräume waren, die uns am besten gefielen.
Hier brauchte ich wenigstens keine Angst zu haben, dass der Stuhl unter meinem Gewicht zusammenbrach. Außerdem musste ich mich hier nicht auf Kissen setzen, etwas, an das ich mich noch nicht so ganz gewöhnt hatte.
Ich fand Sieglinde vor, die mich mit einem freundlichen Lächeln begrüßte, während sie vergnügt an einer Arbeitsplatte neben dem großen steinernen Herd werkelte. Es machte ihr augenscheinlich Freude. Sie war die Tochter von Eberhardt, dem Wirt des Gasthofs Zum Hammerkopf, wo alles seinen Anfang genommen hatte. Auch sie war Trägerin eines Bannschwerts, Eiswehr, eines Schwerts, das in Bessarein legendär war. Mittlerweile war sie weit mehr als die Tochter eines Wirts oder eine Schankmagd, dennoch gefiel es ihr, uns zu bekochen oder zu bewirten. Es machte ihr nichts aus, hatte sie mir erklärt, sie finde eine innere Ruhe dabei, und es sei ein Unterschied, ob man etwas tun müsse oder zum Vergnügen tue.
Dass Eiswehr mit der Spitze auf eben jener Arbeitsplatte stand, ohne irgendwo angelehnt oder befestigt zu sein, war ein Beweis dafür, an was man sich alles gewöhnen konnte. Ich schenkte dem ungewöhnlichen Anblick keine Beachtung.
Am oberen Kopfende des Tisches saßen Zokora und Varosch, in ein leises Gespräch vertieft. Beide trugen die hier üblichen weiten und dunklen Gewänder von Leibwächtern, und speziell bei Zokora wirkten diese Kleider mehr als bedrohlich. Zokora war eine Dunkelelfe und stammte aus einem Volk, das in unserer Heimat einen Ruf legendärer Grausamkeit besaß; allein ihr Anblick konnte tapfere Männer flüchten lassen. Ihre Haut war schwarz wie Ebenholz, doch dass sie eine Elfe war, war leicht an ihren anmutigen Bewegungen und feinen Gesichtszügen zu erkennen. Anders als die Elfen, deren Blut in Leandras Adern floss, war sie klein und zierlich, vielleicht einen Hauch größer als Faihlyd, jedoch noch schlanker. Sie war eine Priesterin oder ein Paladin von Solante, der dunklen Schwester Astartes, wie die Dunkelelfen die Göttin nannten, die sie in ihren tiefen Höhlen verehrten. Auch ihr schwarzes Haar war kurz, sie hatte es ebenfalls beim Kampf gegen Balthasar verloren. Ich wusste von Varosch, dass er das bedauerte, denn er liebte es, den Seras das Haar zu bürsten oder zu Zöpfen zu flechten. Varosch war ein Adept des Boron und befand sich auf den vorgeschriebenen Reisejahren. Wenn er zu seinem Tempel zurückkehrte, konnte er sich entscheiden, ob er ihm dann als Priester beitreten und im Tempel des Gottes der Gerechtigkeit dienen wollte, oder ob er ein Leben außerhalb des Tempels anstrebte. Boron war der einzige mir bekannte Gott, der es seinen Dienern erlaubte, Waffen zu tragen und zu benutzen. Varosch war ein sehr präziser Schütze mit seiner Armbrust und hatte sich ursprünglich dem Händler Rigurd als Wächter für dessen Handelszug angeschlossen.
Jetzt war er Zokoras Liebhaber … eine mehr als ungewöhnliche Bindung, die offenbar jedoch zu beiden passte. Varosch sah freundlich auf und nickte Armin und mir zur Begrüßung zu, Zokora beachtete uns nicht. Wir waren nur Männer.
Ich selbst hatte mich unauffällig gekleidet, sehr zum Missmut von Armin, der bunte Farben liebte und manchmal den Vergleich mit einem Pfau nicht zu scheuen brauchte. Ich trug meine Stiefel, eine weite, lockere Leinenhose, ein Hemd und eine Weste sowie den hier üblichen Burnus. Um meine Hüfte lag Seelenreißers Schwertgurt. Das Schwert hielt ich in der Hand und stellte es neben mich, als ich mich setzte.
In der Küche roch es angenehm, denn Sieglinde hatte bereits verschiedene Kräuter zum Trocknen aufgehängt. Es duftete aus dem Ofen nach frischem Brot, und aus dem Garten kam der Geruch der vielen Blumen, die dort gepflanzt worden waren. Die Menschen von Bessarein liebten Blumen, gelegentlich fand sich vor der ärmlichsten Hütte eine einfache Kiste mit Erde und den schönsten Blumen. Die meisten kannte ich gar nicht, aber eines hatten sie gemeinsam: Sie blühten farbenprächtig und überlagerten mit ihrem kräftigen Duft oft auf dankbare Weise die anderen Gerüche der Stadt.
Es war warm, aber nicht zu warm. Oben unter der Decke hatte der längst verstorbene Baumeister des Alten Reiches mehrere Öffnungen in die Wand zur Halle gesetzt: So strömte kühle Luft aus dem Inneren des Hauses durch die Küche nach außen, auch dann, wenn der Herd in Gebrauch war. Die Temperatur blieb stets angenehm. Solche Kleinigkeiten waren es oft, die mich an diesem legendären Alten Reich beeindruckten. Sie legten Zeugnis über das Wissen ab, das in meiner Heimat verloren war, obwohl unsere Vorfahren selbst aus diesem Reich gekommen waren, um die neuen Kolonien zu besiedeln.
Dies war die Basis von Leandras Mission: dass die Neuen Reiche, unsere Heimat, Kolonien des Alten Reiches waren und wir somit Anspruch auf Schutz durch eben dieses Reich besaßen.
Janos, Natalyia und auch Serafine waren heute Morgen nicht anwesend. Serafine. Ich konnte mich noch immer nicht daran gewöhnen, dass das ehemals so glatte und leere Gesicht von Armins Schwester Helis nun Ausdruck und Charakter einer Frau besaß, die vor fast siebenhundert Jahren hier in Gasalabad als Tochter des damaligen imperialen Gouverneurs geboren worden war. Eine Frau, um die sich hier noch immer Legenden rankten.
Es war eine seltsame Mischung von Gefährten, die sich Leandras Sache angeschlossen hatten. Janos war entweder ein Agent der Königin oder aber der Brigant, der uns damals im Gasthof in Angst und Schrecken versetzt hatte, um von der wahren Gefahr abzulenken. Natalyia war eine ausgebildete Attentäterin des Herrschers von Thalak. Wenn ich daran dachte, spürte ich noch immer das eisige Brennen ihrer Stilette, die sie mir beim Angriff im Wolfstempel in die Seite gerammt hatte. Nur Zokoras Eingreifen hatte verhindert, dass Natalyia mich zu Soltars Hallen beförderte. Es mochte zwar längst überfällig sein, dass ich mich dort einfand, aber damals, wie auch im Moment, hatte ich es nicht so eilig.
Natalyia war Zokoras Gefangene gewesen und hätte beinahe die legendäre Grausamkeit der Dunkelelfen am eigenen Leib erfahren. Aber sie erhielt Gelegenheit, den Mord an Rigurd zu sühnen, und vor Kurzem hatte sie sich zwischen mich und einen Armbrustbolzen geworfen, der sie beinahe getötet hatte.
»Wo sind die anderen?«, fragte ich, als ich am Tisch Platz nahm und dankbar nickte, als Sieglinde mir einen heißen Becher Kafje hinstellte.
»Natalyia und Janos sind auf dem Markt, sie rüsten uns für unsere Reise zurück zum Hammerkopf aus«, antwortete Sieglinde mit einem Lächeln. »Serafine ist unten im Keller, sie sagt, sie müsse ihren Körper stählen.«
Im Keller war es mittags am kühlsten, es gab dort einen großen Raum, der sich zum Üben hervorragend eignete, auch wenn das Licht, das in mit Spiegeln versehenen Schächten vom Innenhof her hineinfiel, mitunter etwas dürftig war. Jetzt jedoch nicht, denn die Sonne stand hoch am Himmel und leuchtete die Schächte gut aus.
Ich dankte ihr und schaute zu Armin hinüber. Er sah, verstand meinen Blick und lächelte. Es war noch nicht so lange her, dass der Geist der Zeugmeisterin den Körper seiner Schwester beseelt hatte, und ich wusste noch nicht so recht, wie er dazu stand.
»Es ist ein Wunder, Esseri, eines, das ich diesem alten Geist, der dennoch schon immer Euer Freund war, nicht verüble. Helis ist bei Soltar sicher, die Tochter des Wassers und Helis sind sich so ähnlich, dass ich mir erlaube zu vergessen, dass sie nicht Helis ist. Manchmal tut es weh, sie zu sehen, aber meist spüre ich, dass es noch immer meine Schwester ist, die ich liebe, und will nicht hinterfragen.« Er lächelte leicht. »Es ist wie eine Gnade, sie zu sehen, lachend oder ernst, klug weit jenseits ihres Alters und doch in vielen Dingen Helis so ähnlich.«
Helis und Armin entstammten dem nach den Wirren um Askannons Abdankung verratenen und verbotenen Haus des Adlers, wie auch Serafine selbst, die den Beinamen Tochter des Wassers trug. Schon als ich Helis das erste Mal gesehen hatte, war mir die Ähnlichkeit zwischen ihr und Serafine aufgefallen, die ich zuvor einmal als geisterhafte Erscheinung in den Eishöhlen erblickt hatte.
Serafine selbst sagte, es gebe keinen erkennbaren Unterschied: Helis hätte sie selbst sein können, nur um Jahrzehnte jünger. Oder Jahrhunderte …
Helis war Zirkusartistin gewesen, und auch wenn ihre Entführung nun fast ein Jahr zurücklag, konnte man nicht behaupten, dass sie schlecht in Form war. Bei dem Gedanken musste ich lächeln: Nach Serafines Maßstäben waren höchstens Zokora oder Natalyia in guter Verfassung, und an den meisten Tagen übten Sieglinde und ich uns morgens nach Serafines Vorgaben. Manchmal schloss sich Janos uns ebenfalls an. Jedenfalls schienen die Übungen zu wirken, ich bewegte mich leichter und flüssiger als in den letzten Jahren, und auch Sieglinde wurde immer sicherer im Umgang mit ihrem Schwert. Ich sah hin zu ihr, unter ihrer Haut spielten schlanke Muskeln, die man dort zuvor nicht hatte sehen können.
Sie hatte in meinen Augen die größte Wandlung von uns allen vollzogen – von der Tochter eines Wirts hin zu einer Kämpferin, die unerschrocken den Gefahren ins Auge sah und in ihrer Bescheidenheit gar nicht merkte, dass sie so selbst zu einer Frau wurde, die anfing, ihre eigene Legende zu gestalten.
Armin hatte recht. Jeder meiner Gefährten verdiente eine eigene Ballade. Über mich gab es schon welche, aber ich mochte sie nicht hören.
Auch Armin erhielt einen Becher mit dem dampfenden Gebräu und lehnte sich in seinem Stuhl zurück. Er sah zufriedener aus, als ich ihn bisher kannte. Die Traurigkeit, die Faihlyd in den letzten Tagen umgeben hatte, schien vergangen, und das tat auch ihm gut.
»Wird die Essera Falah etwas dagegen haben, wenn Serafine mich in den Palast begleitet?«, fragte ich ihn.
Er sah überrascht auf und schüttelte den Kopf. »Warum?«
»Sie weiß vieles, vor allem über Nekromanten«, erklärte ich ihm. »Sie sieht die Dinge anders als ich oder du. Sie ist in anderen Bereichen aufmerksam, vielleicht bemerkt sie etwas, das wir übersehen würden.«
»Meint Ihr, sie ist mutig genug, um diesen Ort zu betreten?«, fragte er leise.
»Ich glaube, sie war schon näher an meinem Gott als jeder andere, den ich kenne. Sie wird sich nicht scheuen.«
Das Reich Soltars, in das ich der Essera Falah, Faihlyds Großmutter, folgen sollte, war, wenn ich das richtig verstanden hatte, ein Reich der Toten, das die Priesterschaft des Gottes hier im Palast des Mondes mit Gebeten und priesterlicher Magie aufrechterhielt. Dort war man dem Gott und dem Tod näher, als es sonst auf dieser Welt möglich war.
Mehr konnte oder wollte mir auch Armin nicht sagen, er hatte diesen Ort auch noch nie betreten, er wurde gefürchtet, und dies mit Grund. »Der Leibarzt der Essera, der Gelehrte Perin da Halat, erklärte es mir«, sagte Armin, als ich mich ankleidete. Er hielt mir eine leuchtend rote, bestickte Weste hin und schien enttäuscht, als ich eine andere aus einfachem hellen Leinen auswählte. »Er sagt, es sei ein Ort, an dem die Lebenden Antworten von den Toten erhielten, obwohl man nicht direkt mit ihnen sprechen kann. Dennoch greift der Tod nach einem.« Er schüttelte sich leicht. »Esseri, Ihr wisst, wie sehr uns hier die Sonne verwöhnt, doch dort ist es so kalt, dass Ihr Euren Atem sehen könnt. Es gibt ihn, diesen Ort, aber man spricht nicht darüber, und mir ist nicht wohl bei der Sache.« Jetzt sah er mich an. »Wenn Ihr erlaubt, werde ich Serafine selbst fragen, ob sie uns begleiten will«, sagte er leise und etwas scheu.
Ich nickte zustimmend, er trank noch einen Schluck Kafje, stand dann auf, zögerte einen Moment und verschwand im Abgang zum Keller.
»Das muss schwer sein für ihn«, sagte Varosch leise, als er zusah, wie sich die Tür hinter Armin schloss. »Serafine zu sehen …«
»Warum?«, fragte Zokora mit ihrer rauchigen Stimme. »Sie ist seine Schwester. Er tut gut daran, sie aufzusuchen.«
»Es ist der Körper seiner Schwester, aber der Geist Serafines«, sagte Varosch. »Das ist ein Unterschied.«
Zokora zog eine Augenbraue hoch. »Ich sehe keinen.«
Sie wandte sich mir zu und griff zugleich unter ihr Gewand. Sie nahm ihren Beutel heraus und ließ ein längliches Siegel aus Gold an einer feinen Kette in ihre Hand gleiten. Ich erkannte es wieder, es gehörte der Dunkelelfe, die wir auf dem Weg vom Gasthof zur Donnerfeste in diesen dunklen Höhlen im Eis eingefroren gefunden hatten.
»Wenn wir Sieglinde und Janos durch die Eishöhlen zurück zum Gasthof führen, hast du Zeit herauszufinden, ob jemand hier etwas über diesen Clan weiß.« Sie sah mich an. »Für die Menschen hier ist meine Art ungewöhnlich, aber nicht unbekannt. Ich will wissen, wo ich meine Schwestern finden kann. Wenn sie diesem Askannon dienten, wissen sie mehr über Menschen als ich.«
Ich nickte. »Ich werde mich darum kümmern und danke dir für das Vertrauen, das du mir mit dieser Bitte erweist.«
Ihre Augenbraue hob sich noch höher als zuvor.
»Das war keine Bitte«, korrigierte sie mich. »Es ist etwas, das du tun kannst, nicht mehr.«
Varosch und ich tauschten einen Blick aus und schmunzelten. Sieglinde lachte leise.
Zokora sah uns neugierig an. »Habe ich einen Witz gemacht?«
»Es war eine Bitte«, versuchte Varosch ihr zu erklären. »Du hast ihn gefragt, ob …«
»Es war keine Frage«, unterbrach sie ihn. »Es ist etwas, das er tun kann. Wenn er es nicht tun will, kann er es sagen.« Sie schüttelte irritiert den Kopf. »Menschen sind kompliziert.«
»Warum sollte er es tun, wenn es keine Bitte ist?«, fragte Varosch. Ich erkannte, dass dies die Fortführung eines längeren Gesprächs zwischen ihnen war.
»Weil er es kann«, sagte sie in der Art von jemandem, der geduldig einem Kind etwas erklärt. »Und auch, weil er es will.«
»Warum sollte er es wollen?«
»Wenn er es will, dann weiß ich, dass er es tut. Tut er es nicht, kümmere ich mich selbst darum.«
»Also tut er es, damit du weißt, dass er es tut?«, fragte Varosch, und Zokora verdrehte die Augen.
Sie sah zuerst mich an, dann Varosch, schließlich Sieglinde. »Weißt du, was ich meine? Schließlich bist du eine Frau und kannst denken.«
Sieglinde lächelte. »Nein, auch ich halte es für eine Bitte, Zokora.«
Zokora nickte und wandte sich dann wieder Varosch und mir zu. »Es ermüdet mich«, sagte sie, griff ihr Schwert und ging zur Tür hinaus. Wir sahen ihr nach.
»Ist sie verstimmt?«, fragte Sieglinde überrascht, doch Varosch lächelte und schüttelte den Kopf.
»Nein, ist sie nicht«, sagte er und lachte leise. »Sie gibt sich solche Mühe zu verstehen, wie wir denken, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass sie einfach die Geduld verliert, wenn wir derartig langsam begreifen.« Er grinste. »Sie nimmt es uns nicht übel. Eher wäre sie überrascht, wenn wir etwas schnell verstehen würden. Sie erwartet kein hohes Denkvermögen von Menschen, erst recht nicht von Männern.« Er grinste noch breiter. »Tatsächlich ist sie oft erstaunt, wenn das, was wir tun, einen Sinn ergibt.«
Sieglinde lachte.
»Die Argumentation werde ich mir merken«, sagte Leandra vom Garten her. Sie stand amüsiert da, Faihlyd neben ihr. »Sie ist nützlich.«
Sie kam zu mir, schmiegte sich an mich und sah verschmitzt zu mir hoch.
2. Das Urteil der Rose
Bevor ich mit Faihlyd und Armin ging, suchte ich noch einmal das Gespräch mit Leandra. Sie war in ihrem Zimmer.
»Was hältst du davon?«, fragte ich sie.
Sie musterte mich. »Ich weiß, dass du die Frage anders meinst, aber so kannst du nicht in den Palast.«
Ich sah an mir herab. »Was ist falsch daran?«
»Nichts. Aber für den Palast ist es ungeeignet.«
Ich seufzte. »Die Kleider sind frisch. Und sauber. Sie sind neu.«
»Du zeigst Essera Falah nicht den Respekt, den sie verdient«, erklärte Leandra mir. Ich sah es an ihrem Blick, sie meinte es ernst.
»Ich werde mich umkleiden«, seufzte ich. »Also, was hältst du davon? Ich habe das Gefühl, dass sich, wenn ich mit Faihlyd und Armin gehe, alles ändern wird und wir noch tiefer in die Geschicke des Emirats verstrickt werden.«
Diesmal seufzte sie. »Das wird sich wohl nicht mehr verhindern lassen. Ich verstehe nur nicht so genau, was sich die Essera Falah eigentlich von dir wünscht«, sagte sie.
Ich zuckte mit den Schultern. »Ich habe auch nicht die geringste Ahnung.« Ich trat an das Geländer zum Innenhof. »Es ist gerade im Moment und gerade heute vielleicht etwas zu viel verlangt, auf Ruhe zu hoffen.« Ich drehte mich zu ihr um. »Es ist nur Tage her, dass der Emir vor seinen Gästen und Freunden, vor den Augen seiner Tochter und seiner Mutter von einer Nekromantin ermordet wurde. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie das auf die Menschen in dieser Stadt wirkt und was in Faihlyd alles vorgehen mag. Wenn wir ihr und ihrer Großmutter helfen können …«
»Ich verstehe ja. Nur …«
Ich sah sie fragend an, und sie schüttelte den Kopf. »Nichts«, sagte sie dann. »Es ist, wie es ist. Ich fühle mich nur eingezwängt von alldem. Und ich finde nicht die richtigen Worte, all das zu beschreiben, was uns widerfahren ist.«
Sie saß am Schreibtisch im Arbeitszimmer, das Armin auf unser Geheiß hin hatte einrichten lassen. Vor ihr standen Tuscheglas und Federkiel, mehrere fein geschabte Pergamente lagen bereit, eines trug zur Hälfte ihre feine, sorgfältige Schrift. Es war geplant, dass Janos und Sieglinde bald durch das Tor im Keller dieser Botschaft zur Feste am Donnerpass zurückkehren sollten, um von dort aus durch die unterirdischen Höhlen zum Gasthof zu marschieren.
Dann sollten sie mit dem Pferd weiterreisen, die Kronburg in Illian erreichen und Königin Eleonora eben diese Nachricht, für die Leandra im Moment noch keine Worte fand, überbringen.
»Es ist ungewiss, ob sie überhaupt noch lebt«, fuhr Leandra leise fort. »Aber sie muss noch leben, muss festhalten, denn keiner der drei, die ihre Krone erben könnten, ist dieser Ehre würdig.« Sie sah mich verbittert an. »Nicht einer würde sich Thalak in den Weg stellen. So unterschiedlich ihre erbärmlichen Laster auch sind, darin sind sie sich einig: Sie würden Thalak das Tor öffnen und auf Gnade hoffen. Lieber Hund eines Hundes sein als aufrecht sterben!«
Von Kindheit an durch einen schweren Sturz ans Bett gefesselt, hatte die Königin keine eigenen Erben. Ich kannte die drei Cousins flüchtig. Als ich sie das letzte Mal gesehen hatte, waren sie kaum mehr als unerzogene Kinder, aber soweit ich wusste, hatten alle drei seitdem nur noch mehr Arroganz und Überheblichkeit entwickelt. Jasfar, eines der Drei Reiche, war bereits gefallen, die Kunde hatte mich durch Leandras Mund erreicht, bei unserer ersten Begegnung im Wirtshaus Zum Hammerkopf. Kelar, der Ort meiner Geburt, war geschleift und mit Salz bedeckt worden. Letasan, das zweite verbliebene Reich, war die Heimat meiner Wahl. Lange Jahre hatte ich dort glücklich gelebt, ich kannte es gut. Reich durch den Handel und die Silberminen, besaß es vielleicht die besten Gelehrten und Handwerker der Neuen Reiche. Suchte man ein gutes Schwert oder eine neue Rüstung, suchte man sie in Letasan. Besseren Stahl gab es nirgends, aber der König war mehr den Künsten und der Wissenschaft zugetan als dem Kampf. Er war ein guter Mann im Frieden, bedächtig und überlegt, hatte stets das Wohl seines Volkes vor Augen. Zugleich war er der denkbar schlechteste Befehlshaber: Bevor er zu einer Entscheidung kam, war die Schlacht bereits verloren.
Also lasteten Widerstand und Stolz der drei Reiche allein auf den Schultern von Königin Eleonora.
Ohne den Willen zum Widerstand halfen selbst die mächtigsten Mauern nicht gegen einen entschlossenen Feind.
Wie alt mochte die Rose Illians jetzt sein? Drei Dutzend und zehn? Vier Dutzend Jahre? Ein Alter, in dem manch anderer, der sein ganzes Leben lang gesund gewesen war, oftmals schon von allein starb.
»Wie fandest du sie vor, als du sie das letzte Mal gesehen hast?«, fragte ich leise. Ich erinnerte mich nur an ein kindliches Gesicht mit großen Augen, in denen ich Glauben und Vertrauen in das Unmögliche sah … und Leid und Trauer darüber, jemanden in den sicheren Tod zu schicken. Ihr war es niemals vergönnt gewesen, Kind zu sein.
»Schwach«, antwortete Leandra und sah auf das halb fertige Schriftstück hinunter. »Sie ist kaum mehr imstande zu essen, die ewigen Suppen ekeln sie an.« Sie wandte sich wieder mir zu, sah mit feuchten Augen zu mir hoch. »Wie kann sie dieses Leben nur ertragen? Muss sie sich nicht mit jeder Faser wünschen, endlich loslassen zu können, endlich die Ruhe zu finden, nach der sie sich sehnt?«
»Sie wird nicht gehen, bevor ihre Pflicht getan ist«, sagte ich. Es war so. Ich konnte nicht sagen, woher ich das wusste, aber etwas anderes erschien mir nicht möglich. »Schreib, was auch immer du schreiben willst. Janos wird die Botschaft persönlich überbringen.«
»Du glaubst an ihn?«, fragte Leandra.
Ich trat an sie heran und fuhr mit der Hand über ihr kurzes weiches Haar. »Ja, das tue ich.« Ich fasste einen Entschluss und zog einen Stuhl heran, um mich neben sie zu setzen. »Ich weiß nicht, ob ich wieder hier sein werde, bevor die beiden aufbrechen.«
Ich sah hinüber zu Steinherz, der mich aus unbarmherzigen rubinroten Drachenaugen zu mustern schien. Nein, dieses Schwert konnte mich nicht leiden.
»Du führst das Schwert des Reiches. Du hast der Königin deinen Eid geschworen. Gilt dieser Eid ihr oder dem Reich?«
»Es war ein seltsamer Eid«, sagte sie leise und schaute an mir vorbei ins Leere, als sie sich erinnerte. »Es war tiefste Nacht, als es an der Tür meiner Kammer klopfte. Zu meiner Überraschung war es die Hohepriesterin der Astarte, die vor meiner Kammer stand und mich bat, ihr zu folgen. Ich trug kaum mehr als ein Nachthemd, doch es blieb keine Zeit, mich passender zu kleiden. Durch geheime Gänge, die selbst ich nicht kannte, führte sie mich in das Gemach der Königin. Draußen vor der Tür standen die Wachen, doch auch die wussten nicht, wer sich in dieser Nacht um das Lager der Königin versammelt hatte. Es war eine erlauchte Gesellschaft, der Diener Soltars kniete neben ihrem Lager und betete für sie, bat seinen Gott, ihr die Kraft zu geben, weiter am Leben festzuhalten. Still und leise, mit grimmigem Gesicht und blutigem Gewand stand der Diener Borons daneben und musterte mich aus Augen, die tief in meine Seele zu blicken schienen, in seinen Händen eine alte, staubige und blutbeschmierte Reliquienkiste, die ich noch nie zuvor gesehen hatte.« Ihre Hand fand meine und nahm sie fest in den Griff, fast so stark, dass es wehtat, aber ich achtete nicht darauf. »In dieser Nacht waren Bewaffnete in das Heiligtum Borons eingedrungen und begingen das Sakrileg, sich gegen den Gott der Gerechtigkeit zu erheben. Sie kämpften sich blutig bis an den Reliquienraum heran. Alle Priester stellten sich ihnen in den Weg, unbewaffnet oder nicht, alle wurden erschlagen bis auf diesen einen. Sein Blut war Teil der Spur, die diese Unnennbaren hinterließen. Kennst du die Statue Borons im Tempel zur Kronstadt?«
Ich nickte nur. Ich hatte den Tempel nie betreten, aber er war nicht groß, vom Tor aus konnte man die Statue gut erkennen. »Dort trägt Boron keine Keule, sondern ein Schwert. Der oberste Diener Borons nahm genau diese Waffe und stellte sich den Tätern in den Weg … Und der Gott selbst führte seine Hand.« Sie schluckte. »Außer diesem überlebte keiner der Diener Borons den Angriff.« Borons Diener waren die einzigen Priester, die Waffen führen durften, doch die Priester, die im Tempel selbst dienten, trugen nie welche.
»Was war mit den Tempelwachen?«, fragte ich leise.
Sie schüttelte den Kopf. »Heimtückisch gemeuchelt, viele von ihnen im Schlaf. Niemals hätte man erwartet, dass es jemand wagen würde, den Zorn Borons so direkt herauszufordern.«
Auch wenn man das Wirken der Götter oftmals nicht direkt erkannte, hatte ich doch keinen Zweifel an ihrer Existenz und ihrer Macht. Zu oft hatte ich schon die schwere Hand Soltars auf meinen eigenen Schultern gespürt … Mich fröstelte. Boron stand für Gerechtigkeit, aber nicht für Gnade. Diese Männer, wer auch immer sie waren, konnten selbst im Tod dem Urteil des Gottes nicht entgehen. Soltar würde ihre Seelen seinem Bruder nicht vorenthalten. Es war warm hier drinnen, im Moment aber fror ich.
»Weiß Varosch davon?«
Sie schüttelte nur den Kopf. »Ich wollte es ihm nicht erzählen. Ich bin sicher, dass er einige der Brüder im Tempel kannte.«
Ich nickte. Ich fand ihre Entscheidung falsch, aber ich konnte sie verstehen.
»Wie ging es weiter?«
»Die Unnennbaren hatten ihr Ziel nicht erreicht, aber es offenbart: eine Reliquie, die selbst bei den Priestern Borons in Vergessenheit geraten war. Es war das Schwert, das früher in der Hand der Statue geruht hatte, bis man es im sichersten Raum des Tempels verwahrte.« Sie sah hinüber zu Steinherz, dessen rote Augen kalt funkelten; fast konnte ich den Zorn des Schwertes fühlen. Steinherz war anders als Seelenreißer, deutlicher in seiner Präsenz. Fast kam es mir so vor, als wäre es mit einem eigenen Willen ausgestattet. Dafür, dass es seine Aufgabe war, dem Träger die Gelassenheit eines steinernen Herzens zu gewähren, wenn dieser ein Urteil sprach, schien es mehr an Gefühlen in sich zu tragen als jedes andere Bannschwert, von dem ich je gehört hatte. Selbst ohne Seelenreißer hätte ich dieses Schwert nie an mich genommen. Wenn ich ehrlich war, fürchtete ich mich vor Steinherz mehr als vor meiner eigenen Klinge.
»Steinherz lag in jener Kiste, die der Priester neben dem Bett der Königin hielt?«, fragte ich.
Sie nickte bloß.
»Ich dachte, es wäre das Schwert des Reichs?«
»Das dachte ich auch. Doch das Schwert, das über dem Thron an der Wand hängt, ist nur eine Kopie.« Sie hielt die Hand in die Richtung ihres Schwertes und berührte den Knauf. Sachte, fast zärtlich, fuhr sie über den kunstvoll geschmiedeten Drachenkopf, dann sah sie mich an. »Ich weiß, warum«, sagte sie dann leise. »Man darf es nicht leichtfertig aufnehmen. Es ist … unbarmherzig, wenn man es aus seiner Scheide ruft. Es kennt keine Gnade, nur Wahrheit und Gerechtigkeit. Es sieht keine Fehler nach und ist voller Zorn auf eine Welt, die nicht geordnet ist. Und sieht es als seine Pflicht an, diese Welt zu ordnen.« Sie hielt kurz inne. »Keine Gnade zu spüren, in den kalten Bahnen der Gerechtigkeit und der Vernunft zu denken ist … befreiend. Man ist im Recht und weiß es, Zweifel sind nicht möglich. Kaum etwas gibt mehr Kraft, als zu wissen, dass es so ist. Wenn es mich danach wieder loslässt, erinnere ich mich daran, wie es ist, keine Gnade zu fühlen, ein Herz aus Stein in meiner Brust zu tragen. Es hüllt meine Seele in das tiefste und dunkelste Eis, macht sie unberührbar für jede Art von Einfluss oder Zauber … und es kennt nur ein Ziel, einen Wunsch, und in diesem sind wir gleich.«
Sie holte tief Luft. »In jener Nacht kniete ich vor unserer Königin, und sie nahm meinen Schwur entgegen, aber es waren ihre Worte, die ich sprach. Es war nicht der Eid des Paladins, den du kanntest, nein, dieser Schwur war besonders. Ich schwor auf ihr Leben, auf ihre Ehre, auf ihren Willen und auf ihren Glauben, das zu tun, was für die Reiche am besten ist.«
Sie sah mich mit weiten Augen an. »Hörst du? Sie ließ mich auf alle Reiche schwören, bei ihrer Ehre, aber nicht als ihre Weisung. Sie überließ mir die Entscheidung, was ich für gut befinden würde! Wie kann man einen solchen Schwur fordern? Wie konnte ausgerechnet sie es tun? Sie weiß doch, welche Last solche Worte bedeuten!«
Ich schloss die Augen, als ich mich an eine andere Zeit erinnerte, an ein kleines Mädchen, das mit angezogenen Knien unter einem Apfelbaum saß und neugierig beobachtete, wie Ser Roderic seine Rüstung flickte. Ein Gesandter aus Melbas hatte an diesem Tag ihrem Vater, dem König, einen wortreichen Schwur des dortigen Fürsten überbracht, zusammen mit Gold und Geschmeide. Mit Grund, denn es gab Anlass, an der Treue dieses Fürsten zu zweifeln. Der Schwur war lang und wortreich, kunstvoll in der Komposition und schmeichelnd in der Wortwahl, ein Meisterwerk der Diplomatie.
»Was hat der Fürst geschworen, Ser Roderic?«, hatte sie mich gefragt, und ich konnte mich an ihre Stimme noch sehr gut erinnern, an die Neugier in ihren Augen und das Lächeln, als sie in den Apfel biss. Es war der Tag, bevor sie stürzte, aber noch lag ein ganzes, unbeschwertes Leben vor ihr.
»Er schwor, sich nicht wieder ertappen zu lassen«, sagte ich, vielleicht etwas bissiger, als ich es hätte tun sollen. Ser Roderic hatte seine eigene Meinung zu solchen Schwüren, und wenn es nach ihm gegangen wäre, wäre er dem Fürsten auf seine Art begegnet. Direkter und eher wortkarg.
»Das ist kein guter Schwur«, sagte sie. »Ich dachte mir schon so etwas. Ich traue Menschen nicht, die zu viele Worte machen, damit suchen sie einen nur zu verwirren. Sie wollen alle etwas stehlen … und wenn es Gedanken sind.«
Wie alt war sie damals? Acht? Ich wäre für sie gestorben. In gewissem Sinne tat ich es später auch. Ich nickte nur. Was sollte ich sagen? Sie hatte recht. So viel Weisheit …
»Was ist ein guter Schwur, Roderic?«
»Das Beste zu tun, was möglich ist«, gab ich ihr Antwort. »Mehr kann man nicht verlangen.«
»Schwören, das Beste für das Reich zu tun?«
Ich nickte.
»Das sind nicht viele Worte, Roderic. Ich habe erst letzte Woche Euren Eid gelesen. Der war viel länger.«
Ich erinnerte mich, dass ich lachen musste.
»So, habt Ihr den Eid gelesen, Hoheit? Es mögen mehr Worte gewesen sein, aber er sagt das Gleiche aus.«
»Wenn Ihr so etwas sagt, klingt es einfach«, sprach sie und spuckte die Apfelsamen in ihre Hand. »Hier, Roderic, ich weiß, dass Ihr diese Samen mögt.«
Ich nahm sie mit einer Verbeugung an. »Danke, Hoheit.« Ich steckte die Samen sorgfältig in meinen Beutel zu den anderen, als sie weitersprach.
»Roderic, sagt, ist es wirklich so einfach?«
»Nein, manchmal ist es schwer. Doch ich denke nun mal so.« Ich widerstand dem Impuls, ihr durchs Haar zu fahren. »Aber ich bin auch ein einfacher Mann.«
Ihren Blick werde ich wohl nie vergessen.
»Täuscht Ihr nun mich, Roderic, oder Euch selbst?«
»Was ist?«, fragte Leandra. »Du bist auf einmal so weit weg.« Ich schüttelte den Kopf und sah zur Seite. »Nichts. Erinnerungen. Es ist nicht wichtig.«
Ich spürte ihren zweifelnden Blick, als ich aufstand und zum Balkon ging. Der blaue Himmel über uns schien mir wie ein Hohn und der Duft der Rosen aus dem Garten im Moment fast unerträglich.
»Sie tat es wohl, weil sie keine andere Wahl hatte«, gab ich ihr Antwort auf ihre Frage von vorhin. »So ist es ja meistens. Man hat keine Wahl.« Ich wandte mich wieder ihr zu und zwang mich, in ihre Augen zu sehen. Sie waren seltsam weich. »Wie ging es weiter?«
»Wie du dir denken kannst«, sagte sie leise. »Ich wurde von den Priestern gesegnet und an der Stirn gesalbt, dann öffnete der Diener Borons die Reliquienkiste und darin lag Steinherz. Ich zog es aus der Scheide, weckte es aus seinem Traum und gab ihm mein Blut … und das der Königin.«
»Wie …?«
Sie sah mich lange an, bevor sie weitersprach. »Es schien das Richtige. Wir hielten das Schwert gemeinsam, unser beider Blut auf der Klinge, als sie das Urteil über Thalak sprach.«
»Sie … ihr … ihr habt mit Steinherz in der Hand das Urteil über Thalak gesprochen?«, fragte ich, und ich spürte, wie etwas in mir zerbrach.
Sie sah, dass ich verstand, und ihre Stimme wurde noch weicher.
»Havald …« Sie schüttelte den Kopf. »Nichts …« Sie holte tief Luft, bevor sie weitersprach. »Danach gab sie mir den Ring und sandte mich aus, Ser Roderic zu suchen. Noch in derselben Nacht brach ich auf. Du hast recht, Havald. Es ist so. Ich kann weder rasten noch ruhen, bis Steinherz Thalak die Gerechtigkeit gibt, die er verdient.«
Ich sah auf die Klinge in ihrer Hand hinab, die rubinroten Augen lachten spöttisch. Was war Liebe gegen einen Schwur mit steinernem Herzen?
Ich setzte mich und stützte den Kopf schwer auf beide Hände. Ich erinnerte mich an die Karte aus dem Gasthof, die Leandra so liebevoll abgezeichnet hatte. Sah vor meinem geistigen Auge diese kleine Insel, das Wort Thalak daneben, sah die vielen Reiche, die zwischen uns und dem kleinen Ort lagen, alle nun unterworfen, alle dienten sie jetzt dem dunklen Herrscher. Auch von diesen Reichen waren wohl einige wehrhaft gewesen, hatten geglaubt und gehofft, gegen den eisernen Griff Thalaks bestehen zu können …
Ich hatte Leandra maßlos unterschätzt. Wenn ich zuerst noch gedacht hatte, es wäre ein unmögliches Unterfangen, die Reiche von der Bedrohung Thalaks zu befreien, wenn ich bezweifelt hatte, dass wir uns seiner Macht überhaupt erwehren, ihm überhaupt Widerstand leisten könnten, so fand ich Leandras Ziel nun weitaus erschreckender. Sie suchte nicht nur den Widerstand gegen den Gegner, sondern die vollständige Zerstörung seines Reiches. Sie wollte den Imperator selbst auf den Knien vor sich, wenn sie Gericht hielt.
Vielleicht entrang sich mir ein Stöhnen, ich weiß es nicht.
Leandra trat neben mich, legte eine Hand zärtlich in meinen Nacken, mit der anderen hielt sie das verfluchte Schwert. »Ich habe Zeit, Havald«, sagte sie leise. »Jahrhunderte, wenn es sein muss. Aber ich werde das Urteil vollstrecken. Ich glaube daran, und du selbst hast gesagt, dass mit Glauben alles möglich ist. Selbst wenn die Reiche untergehen, wird Thalak die Gerechtigkeit der Rose Illians erfahren.«
Sie beugte sich vor und gab mir einen Kuss auf meine Hand. »Glaube einfach an mich, Havald. Denn ich folge ebenfalls meinem Herzen.«
Ich schaute hoch und versank in diesen violetten Augen, die ich selten so weich und zugleich so entschlossen gesehen hatte. »Ich weiß das, Lea, ich weiß.« Ich erhob mich und hielt sie so fest ich konnte, atmete ihren Geruch ein. »Ich weiß, dass du deinem Herzen folgst.«
Einem Herzen aus Stein, vor langer Zeit in verfluchten Stahl geschmiedet.
»Schreib, was du willst, Leandra, sag ihr alles, was dir wichtig ist. Hab keine Sorge, dass deine Worte an ein falsches Ohr gelangen«, sagte ich dann leise, noch während ich sie eng umschlungen hielt. »Wenn Janos die Rose nicht mehr unter den Lebenden vorfindet, dann soll er die Nachricht zerstören. Wenn der Erbe das Reich verraten hat, soll Janos zurückkehren. Er ist bei uns von größerem Nutzen, als wenn er das tut, was er sonst tun würde.«
»Was würde er denn tun?«, fragte sie. Ich spürte ihren Atem an meiner Brust.
»Das, was er gelernt hat. Als Freischärler dem Feind ein Dorn in der Seite zu sein. Nächtliche Angriffe, zerstörter Proviant, vergiftete Brunnen …«
Ich konnte ihn sehen, Janos, wie er mit rußgeschwärztem Gesicht durch die Nacht schlich, ein mörderischer Schatten, an seiner Seite Sieglinde, die ihm folgen würde, bis das Unvermeidliche geschah.
»Andere werden das tun. Dafür brauchen sie ihn nicht. Gib ihm den Auftrag, nach Coldenstatt zu reisen. Was auch immer geschieht, es wird dauern, bis Thalaks Truppen den Norden erreichen. Selbst wenn die Krone verraten ist, wird es Zeit brauchen, bis seine Armeen den Ländern seinen Frieden aufgezwungen haben. Janos soll in Coldenstatt den Schmied Ragnar aufsuchen und ihm seine Axt zurückgeben. Sie gehört dem Schmied und ist sein Erbe. Und wenn Janos kann, soll er Leute finden, treue Leute, die für das Reich die Festung am Pass besetzen. Danach soll er versuchen, zu uns aufzuschließen, vielleicht haben wir bis dahin andere Tore gefunden.« Ich zögerte einen Moment. »Er soll Ragnar und vielleicht auch seiner Familie den Weg hierher weisen, auch durch das Tor. Man kann Ragnar vertrauen, er ist ein guter Mann. Du wirst ihn mögen.«
»Du gehst davon aus, dass dein Freund Ragnar Hof, Haus und Schmiede, vielleicht auch seine Familie und sein Glück verlassen wird, um sich uns anzuschließen?«
»Er wird es tun. So ist er. Wenn er seine Axt erhält, muss er so handeln.« Ich zog Leandra fester an mich. »Aber vielleicht muss er seine Familie nicht entwurzeln. Coldenstatt ist die jüngste und kleinste unserer Städte, doch das Land im Norden ist frei, die einzige Bedrohung dort ist die Kälte. Wenn die Feste am Pass geschlossen und besetzt ist, wird auch Thalak den Pass nicht bezwingen können, und solange die Feste selbst steht, wird Coldenstatt ein freier Ort für jene sein, die sich Thalaks Knute nicht beugen werden.«
»Und der Gasthof? Er liegt vor den Toren der Donnerfeste. Von ihm führt der Weg zum Wolfstempel! Wie sollen wir verhindern, dass Thalak die Macht des Tempels für sich nutzt?«
Ich sah zu ihr hinunter. »Wir? Wir können das nicht verhindern. Aber vielleicht jemand anders.« Ich löste mich widerstrebend von ihr. »Schreib, was du sagen willst und was ihr Kraft geben wird.«
Auf einem kleinen Tisch stand eine Schale mit Obst, dort lag auch ein Apfel. Ich nahm einen, schnitt ihn entzwei und löste mit der Spitze meines Dolches ein Samenkorn aus dem inneren Gehäuse.
»Wenn du deine Botschaft siegelst, drücke diesen Samen in das Wachs.«
Sie sah das Samenkorn in ihrer offenen Hand an und dann mich.
Ich küsste sie. »Es ist eine lange Geschichte, ich erzähle sie dir ein anderes Mal.«
Ich schloss ihre Tür leise und lehnte mich schwer dagegen. Von Hoffnung und Glauben zu sprechen war einfach. Selten hatte ich meine Worte so sehr bereut, aber bisher hatte ich auch nicht gewusst, wie unmöglich die Aufgabe war, die Leandra sich gestellt hatte. Liebe, so predigten die Dienerinnen Astartes, ist die größte Macht auf Erden. Doch gegen ein Herz aus Stein ist sie verloren.
Für meinen Geschmack waren die Gewänder hier zu leicht und zu bunt, solch kräftige Farben kannte man in meiner Heimat gar nicht. Ich hatte die Befürchtung, darin wie ein bunter Pfau auszusehen, also zog ich gedeckte, dunkle Farben vor.
Das letzte Mal hatte mir Leandra geholfen, die Gewänder für »Saik Havald« zusammenzustellen, Armin hatte ebenfalls seinen Anteil daran, auch wenn ich ihm in dieser Beziehung nicht ganz vertraute. Was ihn selbst betraf, schien er durchaus dazu bereit, mit einem Pfau in Konkurrenz zu treten.
Als unsere Gefährten vor einiger Zeit zu uns aufgeschlossen hatten, waren die Dienste eines Schneiders vonnöten gewesen. Ein paar Worte zu ihm, und er versprach mir, das zu liefern, was ich wollte. Irgendwann war ein großes, sorgsam verschnürtes Paket eingetroffen. Ich war nicht dazu gekommen, es zu öffnen, aber jemand hatte es ausgepackt und die Kleider sorgsam in dem großen Schrank verwahrt. Als ich die Türen des Schranks öffnete, konnte ich wieder nur den Kopf schütteln. Ich lebte ja nun wahrlich lange genug, aber eine solche Auswahl an Kleidern hatte ich noch nie besessen.
Ich fand, was ich suchte: dunkle weite Hosen aus feinem gewebten Leinen; ein dunkles Hemd mit weiten Ärmeln aus dem gleichen Stoff, der mir lieber und vertrauter war als Seide; neue weiche Stiefel, die tatsächlich wie versprochen auf Anhieb passten; eine weiche, aber schwere Lederweste aus drei Lagen, die mittlere aus überlappenden Stahlplättchen gefertigt – kaum der gleiche Schutz wie mein Kettenpanzer, aber besser als nichts –, darüber zog ich einen dunklen Wappenrock, allerdings ohne Wappen. Ich hatte das Recht, ein Wappen zu führen, die Rose und das Einhorn, aber das würde zu viele Erinnerungen wecken. Außerdem entschied ich mich für einen neuen breiten Gürtel mit Waffengehänge, Armschützer aus weichem, wie bei der Weste mit Metallplättchen verstärktem Leder, dazu kam ein strahlend weißer Burnus, der mich daran erinnerte, dass ich Armin fragen wollte, wie es möglich war, ein solches Weiß zu erschaffen. Bis ich nach Bessarein kam, war die hellste Farbe, die ich kannte, ein helles Grau. Eine verstärkte Stoffkappe aus dem gleichen dunklen Leinen wie Hemd und Hose, mit einem weich fließenden Nackenschutz und einem Schleier, der hier auch für Männer Benutzung fand, vervollständigte meine Kleidung und verwandelte mich in Saik Havald, einen Fürsten aus fremden Landen …
Der kleine Handspiegel aus poliertem Silber reichte nicht aus, mich in meiner ganzen Pracht darzustellen, dafür musterte ich mein Gesicht, das mir zurzeit seltsam fremd erschien.
Seelenreißer hatte mir meine Jugend wiedergegeben, dennoch hatte das Alter Spuren hinterlassen, mein Antlitz war schmaler und härter als zuvor, die tiefen Nasenfalten betonten eine zu große Nase, gegen die mir noch der Schnabel eines Adlers vorteilhaft erschien, und der kantig gestutzte Bart, der hier für Männer Mode war und ohne den man leicht für einen Eunuchen gehalten wurde, war pechschwarz, wenn auch mit Grau gesprenkelt, die Augen anders, als ich sie in Erinnerung hatte, mit schwereren Lidern und dunklen Pupillen. Ich versuchte mich zu sehen, wie es andere vielleicht taten, und konnte es nur erahnen.
Ich wirkte hart. Weitaus härter, als ich mich fühlte. Ich zuckte mit den Schultern. Die Götter gaben einem das Gesicht, man konnte es nur selbst leben. Trotz der Honigkuchen, die es hier gab und die mir viel zu gut mundeten, hatte ich abgenommen. Ich nahm einen Beutel, gab ein paar Silberstücke hinein, hängte ihn mir um den Hals und verstaute ihn unter dem Burnus. Einen anderen Beutel mit ein paar Kupfermünzen tat ich an meinen Gürtel, griff Seelenreißer und ging hinunter in die Küche.
»Ihr seht stattlich aus«, sagte Faihlyd mit einem Lächeln, bevor sie ihren Schleier vorhängte und in die Sänfte stieg. Ich sah ihr nach und schüttelte den Kopf. Serafine kletterte zu ihr in die Sänfte. Sie trug das dunkle Gewand einer Leibwächterin, und ich sah, wie sie hinter ihrem Schleier grinste, bevor sich der Vorhang schloss.
Armin zog mich am Ärmel, und ich machte es mir mit ihm zusammen in der anderen Sänfte bequem.
»Was amüsiert Euch, Herr?«, fragte Armin neugierig.
»Ich bin nicht mehr dein Herr«, sagte ich abwesend und zum wiederholten Male, als die Sänfte angehoben wurde und sich die Träger in Bewegung setzten. »Ich frage mich, über was die Frauen miteinander reden.«
»O Esseri, hätte der Tag hundert Stunden und ein Mann die Muße, all diese Zeit darauf zu verwenden, bräuchte er ein Jahr, den Sinn eines Blicks zu verstehen, den seine Frau mit einer anderen tauscht.« Er schüttelte den Kopf. »Wenn ich den Vorhang zur Seite schiebe und hinaussehe auf die Welt, ist es eine andere als jene, die eine Frau sieht.« Er zuckte mit den Achseln. »Die Götter haben es so eingerichtet, es wird seine Gründe haben.«
Damit hatte er wohl recht. Ich lehnte mich in den Kissen zurück. »Ich kann mich nicht daran gewöhnen, Sänften zu verwenden«, sagte ich dann. »In meinen Augen gehört es sich nicht, von anderen getragen zu werden.«