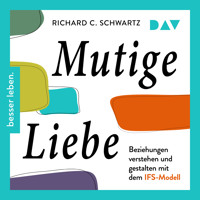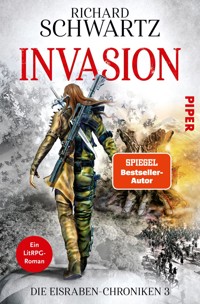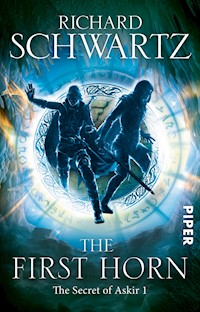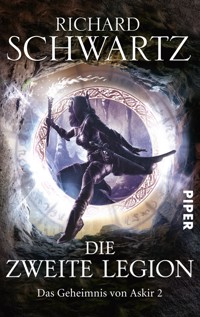8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Der Halbelfe Leandra steht eine gefährliche Mission bevor, die keinen weiteren Aufschub duldet. Zusammen mit dem Krieger Havald und ihren Gefährten ist sie auf dem Weg nach Askir, während der Nekromantenkaiser in seinem Versteck auf den Feuerinseln eine grausame Invasion vorbereitet. Es gelingt ihm, Leandra in seine Gewalt zu bringen, und Havald wird als Schiffbrüchiger an die Küste der Feuerinseln gespült. Leandra ist in höchster Gefahr: Wird sie der Beeinflussung der Nekromanten erliegen und zum Feind überlaufen? – Spannend bis zur letzten Seite: der atemberaubende neue Band aus Richard Schwartz' Erfolgszyklus »Das Geheimnis von Askir«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Entdecke die Welt der Piper Fantasy:
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
2. Auflage 2011
ISBN 978-3-492-95456-3
© Piper Verlag GmbH 2009 Umschlagkonzept: semper smile, München Umschlaggestaltung: Guter Punkt, München Umschlagabbildung: Uwe Jarling
Datenkonvertierung: CPI – Clausen & Bosse, Leck
Was bisher geschah
Die Drei Reiche werden durch das Imperium von Thalak bedroht, dessen Truppen über dunkle Magie verfügen. Der alte Krieger Havald, Besitzer des Bannschwerts Seelenreißer und unwilliger Jünger des Todesgottes Soltar, macht sich mit der Diplomatin Leandra und einer Gruppe zufällig zusammengewürfelter Gefährten auf, im legendären Askir Hilfe zu suchen. Der Ewige Herrscher ist jedoch verschwunden und hat das Reich in Unordnung zurückgelassen. Durch magische Tore gelangen Havald und seine Gefährten ins Wüstenreich Bessarein, einst ebenfalls Teil Askirs. Dort müssen sie feststellen, dass nicht nur ihre eigene Heimat von Thalak bedroht wird, sondern auch Askir, dessen mächtige Magie das eigentliche Ziel des dunklen Nekromantenkaisers aus dem Süden ist. Obwohl die Gefährten möglichst schnell die alte Reichsstadt Askir erreichen wollen, werden sie in Bessarein in die Umtriebe des Bösen und in Thronkämpfe verwickelt. Erst als Havald den Agenten Thalaks, einen mächtigen Nekromanten, ausschaltet, können er und seine Gruppe auf dem Seeweg nach Askir weiterreisen, aber auch sie sind aus dem Kampf nicht ungeschoren hervorgegangen …
1. Morgenrot
Wenn die Sonne aufgeht, so sagen die Priester, öffnet sich das Tor zu Soltars Hallen und der Gott erfüllt sein Versprechen den Menschen gegenüber: Auf die Nacht des Todes folgt neues Leben.
Solange sein Licht die Erde berührt, stehen die Tore zu seinen Hallen offen und ist noch Zeit für die Geister der Toten, zu ihm zu gelangen.
Hier oben, auf einem hochgetürmten Stapel aus Baumwollballen am Rand des Flusshafens von Gasalabad, schaute ich über die Stadt und ihre Mauern hinweg und sah sein Licht rot aus der Wüste aufsteigen.
Rot wie das Blut auf meinen Kleidern.
Der Flusshafen kannte auch zu solch früher Stunde kaum Ruhe, gut ein Dutzend Schiffe lagen hier an den Kais, flussaufwärts warteten zwei weitere Kornkähne aus Kasdir darauf, anlegen zu können. Drei andere wurden gerade entladen.
Vor Kurzem noch wäre mein Erstaunen groß gewesen, zu erfahren, welche Mengen an Korn diese Stadt jeden Tag verbrauchte. Es hätte mich fasziniert, zuzusehen, wie das Korn entladen, säcke- und körbeweise auf Eselskarren verbracht wurde und wie es sich in einer fast endlos langen Kette aus Gespannen und Lasttieren durch das enge Gedränge hier am Hafen seinen Weg bis zur Kornbörse suchte. Schon lange bevor der erste Kahn des Morgens hier anlegte, hatten dort an der Börse die Händler von Gasalabad über die Kurse entschieden und das Korn bereits verkauft, ob nun als einzelnen Sack oder ganze Schiffsladung.
Nicht nur Korn wurde verladen, jedes erdenkliche Gut fand seinen Weg hierher, unter anderem auch Baumwolle. Zu festen Ballen gepresst und verschnürt, wurde sie dann vier bis fünf Ballen hoch am Rand des Hafens gestapelt.
Auf einem dieser Stapel hatte ich mir einen Platz gesucht und saß dort wie auf einem hohen Thron, inmitten all des Trubels und doch seltsam unberührt davon.
Die Stadt erstreckte sich auch jenseits des Gazar; die Arena befand sich dort auf der anderen Seite und eine Garnison der Stadtsoldaten. Hunderte andere Gebäude drängten sich im Schutz der hohen Stadtmauer, doch ich kannte diesen Teil der Stadt kaum. Nur einmal, mitten in der Nacht, war ich durch diese Viertel zu unserem Haus zurückgekehrt.
Doch mein Blick galt nicht der Stadt selbst, sondern dem goldenen Licht des Morgens, das sich seinen Weg durch das offene Tor und die Schießscharten bahnte und die Zinnen in einem rotgoldenen Schein aufleuchten ließ.
Eben noch war der Himmel über den Zinnen von dunkler Nacht überzogen gewesen, jetzt wich sie mit jedem Atemzug dem Tag. Wo vorhin noch das Funkeln der Sterne zu sehen gewesen war, wurde der Himmel immer heller und verdrängte die Dunkelheit.
In dem Moment, wenn die Sonne die Erde nicht mehr berührt, schließen sich die Tore des Gottes wieder und trennen die Toten von den Lebenden.
Natalyia war nun sicher vor der Macht des Gottes ohne Namen.
Ich lehnte mich zurück und schloss die Augen.
»Du siehst übel aus.« Zokoras Stimme, dunkel und rauchig, unverwechselbar.
Es war müßig, darüber zu spekulieren, wie sie mich gefunden hatte. Von all jenen, die ich in der letzten Zeit kennengelernt hatte, verstand ich sie am wenigsten. Klein und zierlich, mit Haut in der Farbe von Ebenholz und dunklen, forschenden Augen, schien sie mir vertraut und zugleich auch unendlich fremd. In ihren Augen fand man einen Willen und eine Stärke, die ihre körperliche Größe vergessen machten. Sie war eine Prinzessin ihres Volkes, eine Priesterin der Göttin Solante, der dunklen Schwester Astartes, eine tödliche Kämpferin mit Magie und Stahl. Und – vielleicht – ein Freund. Ich hatte sie nicht kommen hören.
»Wo ist Natalyia?«, fragte sie.
»Sie ist tot.«
Ich öffnete ein Auge und schaute zu ihr hinüber. Sie saß neben mir, mit dem Rücken am gleichen Ballen, an den auch ich mich lehnte, nur dass sie so gerade saß, dass sie den Ballen gar nicht berührte. Sie trug das Gewand einer Leibwächterin, ein dunkler Schleier schützte ihre Augen. Ich wusste, dass das Licht des Tages zu grell für sie war. Jetzt aber löste sie den Schleier und schaute mich mit diesen dunklen Augen an. Es lag keine Überraschung in ihrem Blick, keine Trauer, nur Akzeptanz, als wäre es etwas, auf das sie lange gewartet hatte. Tief in ihren Augen schimmerte es rötlich.
»Es war also nicht so einfach wie gedacht?«
»Doch«, entgegnete ich. »Alle im Tempel sind ertrunken.«
»Was ist geschehen?«
»Sie wollte nur sichergehen, dass alle ersaufen, dabei kam sie dem Nekromanten zu nahe. Er zwang sie dazu, ihn an die Oberfläche zu bringen und vor dem Ertrinken zu bewahren. Es kam zum Kampf zwischen uns, danach war ich dem Tode nahe.«
Unwillkürlich sah ich nach oben. Dort, in einer Höhe, aus der Gasalabad selbst so klein erschienen war, dass ich die große Stadt mit meinem Daumen hätte bedecken können, hatte es sich entschieden. Es war die Macht des Nekromanten, die uns beide in diese Höhe entführt hatte, und als er starb, stürzte ich in den Fluss.
Niemand überlebte einen solchen Sturz. Auch ich nicht.
»Sie setzte sich Seelenreißer unters Herz, ließ sich in die Klinge fallen und gab ihr Leben, damit ich geheilt wurde.« Ich hörte mir zu, als ich das sagte. Meine Stimme klang mir fremd. So fern, so unbeteiligt. Ich hätte gern ausführlicher davon berichtet, aber ich konnte nicht.
»Sie starb, damit du lebst?«, fragte Zokora mit überraschend sanfter Stimme.
»Ja.« Ich zog meine Knie an, stützte mein Kinn darauf und blickte hinunter in den Hafen. Drei Flusssegler lagen dort vertäut, einer davon so groß wie die beiden anderen zusammen. Dieses Schiff wurde gerade beladen, ein großer Ballen schwang am Lastarm herum, um in den Laderaum abgelassen zu werden. Der Name des Schiffs war Lanze des Ruhms, und es gehörte mir. Schon vor Tagen hatten wir beschlossen, dass wir heute abreisen wollten. Ich erinnerte mich daran, dass ich am Tag zuvor noch gesagt hatte, wie froh ich darüber war, dass diese Stadt keinen von uns das Leben gekostet hatte.
Ein etwas voreiliger Gedanke.
»Sie hat mich nicht gefragt, ob ich leben will.«
»Warum hätte sie das tun sollen?«, meinte Zokora.
»Ich hätte nicht gewollt, dass sie ihr Leben für mich wegwirft.«
»Sie hat es nicht weggeworfen.«
»Das sehe ich anders.«
»Es dreht sich nicht alles um dich, Havald«, sagte sie. »Sie tat es für sich, weil es für sie das Richtige war.« Sie wandte sich mir zu, ihr Blick war intensiv. Der rötliche Funke in ihren Augen war deutlich zu erkennen.
»Es wäre nicht meine Wahl gewesen.«
»Aber es war ihre.«
Ich neigte den Kopf. »Ich weiß.«
Sie musterte mich, dann nickte sie. »Wo ist sie? Ist sie sicher?«
»Ich habe sie zum Tempel Soltars gebracht.«
Niemand wusste, wie mächtig Kolaron, der Herrscher von Thalak, wirklich war. Nur eins war gewiss: Er war ein Seelenreiter, und schon einmal hatte Natalyias Seele unter seinem Bann gelegen. Vor Kurzem erst war sie im Tempel im Namen Soltars getauft worden. Deshalb hatte ich sie dorthin gebracht, dort war sie sicher.
»Ich nehme Abschied von ihr«, teilte Zokora mir mit, glitt elegant von der Baumwolle und landete vier Ballen tiefer geschickt wie eine Katze. Dann war sie auch schon im Gedränge des Hafens verschwunden.
Ich blieb auf dem Ballen sitzen und sah eine Weile zu, wie die Lanze des Ruhms beladen wurde. Deral, der Kapitän, hatte um Erlaubnis gebeten, Ladung aufnehmen zu können. Er meinte, dass es eine Schande wäre, nach Askir zu segeln und keinen Profit dabei zu machen. Gerade schaute er zu, wie die Ladeluken verschlossen wurden, und erteilte dem Ersten Maat Anweisungen, dann rief ein anderes Besatzungsmitglied ihn zu sich. Am Ufer wartete eine junge Frau auf unseren Kapitän, dunkel gekleidet und mit einem Schleier verhüllt. Sie sprach ihn an, und er schüttelte den Kopf. Sie legte eine Hand auf seinen Arm, beugte sich vor und flüsterte ihm etwas ins Ohr.
Selbst auf die Entfernung sah ich seine Überraschung. Widerwillig, so schien es mir, nickte er, und ein Beutel wechselte seinen Besitzer. Die junge Frau ging an Bord, suchte sich achtern nahe der offenen Kabine ein Kissen und ließ sich dort nieder.
Ich hatte zugestimmt, Ladung aufzunehmen, mich aber gegen Passagiere ausgesprochen. Was also hatte die junge Frau zu unserem Kapitän gesagt, dass er gegen meine Anweisung handelte? Gestern noch hätte ich dringend wissen wollen, was sich eben dort zugetragen hatte, heute jedoch war meine Neugier gedämpft. Zu sehr war ich in meinen Gedanken gefangen. Was, bei allen Göttern, hatte Natalyia bewogen, sich in meine verfluchte Klinge zu stürzen?
In ihrem Großmut hatten die Götter manchen Menschen magische Talente geschenkt. Der eine war vielleicht dazu imstande, mit Tieren zu sprechen, ein anderer verformte Stein mit bloßen Händen. Natalyia war fähig gewesen, durch Stein zu gehen.
Doch die dunkle Gabe der Nekromantie, ein Geschenk des Namenlosen, um die Menschen zu versuchen, war etwas anderes. Mit diesem Talent vermochte ein Nekromant sich die Seele und das Talent eines Menschen anzueignen, ein Vorgang, der oft mit grausamer und tödlicher Folter einherging, denn niemand gab gern seine Seele auf.
Askannon, so sagt die Legende, habe die Bannschwerter dazu erschaffen, Nekromanten zu zwingen, die Seelen wieder freizugeben. Es hieß auch, dass diese Klingen ihrem Träger Schutz gegen die Seelenreiter bieten sollten. Davon hatte ich indes wenig bemerkt. Mehrfach schon hatte ich einem dieser Unheiligen gegenübergestanden, und bisher war es ihnen bemerkenswert gut gelungen, meinen Geist zu überwältigen.
Aber die Magie, die meiner Klinge innewohnte, kam der dieser Nekromanten verdächtig nahe. Wenn jemand unter dem fahlen Stahl fiel, gab Seelenreißer mir die Jahre, die dem anderen verblieben wären, und heilte zudem meine Wunden. Seelenreißer war alles andere als ein Stück unbeseeltes Metall. Es besaß eigene Fähigkeiten, so auch die, Lebendiges aufzuspüren, und ihm wohnte eine unbändige Gier inne, sich dieses Lebendige einzuverleiben. Meines Wissens war es auch das einzige Bannschwert, das meinem Gott geweiht worden war. Es gehörte Soltar, dem Gott des Todes.
Ich empfand das als passend, denn es war unwahrscheinlich, dass eine andere Klinge dem Gott mehr Seelen gesandt hatte als Seelenreißer. Es mochte eine heilige Klinge sein, nichtsdestotrotz hielt ich sie für verflucht.
Über zwei Jahrhunderte trug ich Seelenreißer nun, und lange war es mir möglich gewesen, mich seiner zu erwehren. Doch seitdem ich für einige Zeit mein Augenlicht verloren hatte und mich Seelenreißers Sicht anvertrauen musste – und seit dem Kampf in Fahrds Gasthof –, hatte sich das geändert.
Der Stahl war nichts Fremdes mehr, sondern Teil von mir. Obwohl ich Soltar oft genug ein Leben zuführte, war die Gier im Schwert verblieben. Die Gier, das Leben anderer in sich aufzunehmen.
Flussabwärts am Ufer, in etwa zweihundert Schritt Entfernung, befand sich ein großer, gewachsener Felsen. Gestern Nacht hatte ich an dieser Stelle dem Nekromanten gegenübergestanden, der sich selbst der Herr der Puppen nannte.
Nur durch seine Unachtsamkeit war es mir gelungen, ihn zu besiegen, allerdings ohne Hoffnung darauf, mein eigenes Leben retten zu können, denn durch seine Kräfte hatte er uns weit über die Stadt in die Höhe gehoben. Als er starb, stürzten wir beide hinab.
Während ich fiel, war ich froh darum, dass es mir gelungen war, Natalyia und die anderen vor diesem Ungeheuer zu bewahren. Ich hatte lange genug gelebt, es fiel mir nicht schwer, loszulassen.
Ich hatte mich nur in einem getäuscht: Ich überlebte den Aufprall, denn ich verfehlte das Ufer und schlug im Wasser auf. Es half nicht viel, nur wenige Atemzüge trennten mich noch von den Toren Soltars. Ich war froh gewesen, Natalyia zu sehen, wie sie sich über mich beugte, als ich im Sterben lag. Froh darüber, dass sie es war, die weiterleben würde.
Doch sie … sie stürzte sich in Seelenreißers verdammte Klinge … und gab mir damit ihr Leben.
Ich wusste nur noch nicht so genau, was ich mit diesem unverhofften neuen Leben anfangen sollte.
Man sollte meinen, ich hätte mich inzwischen daran gewöhnt. Doch so oft Seelenreißer mir auch die Leben meiner erschlagenen Feinde verliehen hatte, diesmal war es anders.
Natalyia hatte sich der Klinge freiwillig hingegeben. Ich hatte ihren Tod durch diesen verfluchten Stahl gespürt, sie kam ohne jeden Widerstand, ohne Zweifel, stellte sich der Waffe ohne Vorbehalt … und änderte damit alles, was zuvor gewesen war.
Den Legenden nach wandelte sich das Wesen dieser Schwerter im Laufe der Zeit. Bislang hatte ich davon nichts bemerkt. Dass Seelenreißer mächtiger wurde, das ja, aber er blieb die gleiche verfluchte Klinge. Nur seine Gier nach Leben wurde größer und mächtiger.
Doch das war vor Natalyia gewesen.
Die Klinge, die vor mir auf meinen Oberschenkeln lag, war nicht mehr die gleiche, mit der ich gestern Nacht diesen Nekromanten erschlagen hatte. Es war, als ob sie sich an Natalyia sattgetrunken und dieser Tod nun endlich doch ihren unermesslichen Durst gestillt hatte.
Ich hob die Hand und berührte Seelenreißer leicht am Griff. Zuvor war es so gewesen, dass die Klinge nur Lebendiges wahrnahm, alles andere blieb ihr verborgen. Nur das, was lebte, spürte sie auf wie ein Jagdhund. Es war eigentlich kein Sehen, eher ein Gefühl, das sie mir vermittelte.
Auch das hatte sich verändert.
Jetzt nahm sie alles wahr, den Ballen, auf dem ich saß, den Käfer, der sich unter mir einen Gang durch die Lagen feinster Baumwolle grub, die Schweißperlen auf meiner Stirn, das Blut, das in meinen Adern rauschte.
Zuvor hätte sie sogar nach dem kleinen Lebensfunken des Käfers gegiert, nun aber nahm sie ihn nur zur Kenntnis und blieb … ruhig.
Irgendwann zog ich meinen Beutel auf und nahm eine halbfertige Spielfigur heraus. Sie war aus Elfenbein und stellte einen der weißen Reiter dar. Noch war das Pferd nur angedeutet, doch schon jetzt zeigten einige Linien die Kraft und Eleganz des stolzen Tiers. Der Reiter war zierlich, seine leichte Reiterrüstung der Bessareiner Kavallerie nachempfunden, nur eine feine Kerbe hier, eine Andeutung dort.
Aber das Gesicht war bereits vollendet. Kaum größer als der Nagel meines kleinen Fingers, zeigte es Natalyias Züge. Ich musterte die Figur. Wie kam es, dass ich ihr diesen entschlossenen Gesichtsausdruck verliehen hatte, ohne es selbst zu bemerken? Dieser Reiter würde sich seinen Weg suchen, Mauern und Hindernisse überwinden, Schlachtenlinien und Verteidigungen überreiten, nichts würde ihn von seinem Kurs abbringen …
Einen Moment sah ich wieder, wie sie im Tempel gestanden hatte, soeben im Namen meines Gottes getauft. Sie schaute mich an, lachte und lud mich ein, zu ihr zu kommen. Ich erinnerte mich daran, wie ich mich abgewandt hatte. Wie leichtfertig man doch manchmal mit dem umging, was einem wichtig war. Vielleicht deshalb, weil man es nicht zugeben wollte.
Sorgsam verstaute ich die Figur wieder in meinem Beutel. Demnächst würden wir abreisen. Ich hoffte, dann die nötige Muße zu finden, um sie fertigzustellen.
Ich stand mühsam und mit knirschenden Sehnen auf, hängte das Schwert in meinen Gurt und kletterte die Ballen herab, steif und ungelenk wie der Greis, der ich hätte sein sollen.
Zokora hatte mich gefunden, aber ob sie daran denken würde, die anderen von meinem Sieg über den Nekromanten zu unterrichten, war zweifelhaft. Sie folgte ihrem eigenen Leitstern, und nicht alles, was sie tat, ergab für mich einen Sinn.
So dicht gedrängt es am Hafen auch zuging, die Leute machten mir Platz, wichen zurück und wurden bleich, als sie mich sahen. Es dauerte eine Weile, bis mein erschöpfter Geist es wahrnahm, dann noch einmal eine Zeit lang, bis ich den Grund verstand.
Das Blut, das meinen Umhang färbte, war nicht das des Nekromanten. Der Gazar hatte es aus dem feinen Leinen herausgewaschen. Es war Natalyias Blut. Ich hatte so lange auf dem Ballen gesessen, dass es getrocknet war.
Ich konnte es den Leuten nicht verdenken. Ich wäre mir selbst auch aus dem Weg gegangen.
2. Das Zeichen der Wächterin
»Sie wissen es schon«, teilte mir Varosch mit, als er mir die Tür zu unserem Haus öffnete. Er musterte zuerst meine Robe, dann mein Gesicht. »Es tut mir leid, mein Freund«, sagte er und legte eine Hand auf meine Schulter.
»Danke«, entgegnete ich unbehaglich. Ich wollte aus dieser Kleidung heraus. »Wo sind die anderen?«
»Sie sind in der Küche und haben sich gerade umgezogen, um zum Tempel zu gehen.«
»Hat Zokora es euch mitgeteilt?«, fragte ich, als ich die schwere Tür hinter mir zuzog und Varosch durch die Halle folgte. Wie er schlug ich einen Bogen und vermied es, unterhalb des schweren Kronleuchters hindurchzugehen, der hoch über uns unter dem Dach hing.
»Nein«, antwortete Varosch überraschend. »Die Emira hat einen Boten gesandt.« Er schaute mich fragend an. »Zokora ist bei Sonnenaufgang gegangen, ich weiß nicht, wohin. Habt Ihr sie gesehen?«
»Ja. Sie hat mich gesucht und gefunden. Sie ging weiter zum Tempel, um Natalyia ihren Respekt zu erweisen.«
Zokora konnte auf sich selbst aufpassen, dennoch sah ich die Erleichterung in Varoschs Augen. Wahrscheinlich hatte sie es nicht für nötig befunden, ihn zu informieren, als sie das Haus verließ. Oder den anderen mitzuteilen, was geschehen war.
Aber ein Bote von Faihlyd? Woher sollte die Emira denn wissen, was sich am Ufer des Gazar zugetragen hatte? Dann schalt ich mich einen Narren. Nichts geschah in Gasalabad, ohne dass die Tochter des Löwen davon erfuhr. Schließlich waren es ihre eigenen Soldaten gewesen, die mich unter dem leblosen Körper Natalyias hervorgezogen hatten. Dunkel erinnerte ich mich daran, dass sie mich hatten in Gewahrsam nehmen wollen. Kein Wunder, denn Seelenreißer ragte noch immer aus Natalyias Rücken. Obwohl ich versuchte, mich zu entsinnen, was danach geschehen war, war das Nächste, an das ich mich erinnerte, wie ich mit Natalyia auf den Armen den Tempel betrat. Auch das erschien mir seltsam unwirklich, wie in einem schlimmen Traum.
Kaum hatte ich die Halle durchquert, löste ich Seelenreißers Gurt und beeilte mich, die blutige Robe abzulegen. Ich ließ sie fallen, wo ich stand. Sollte Afala, unsere Haushälterin, sich darum kümmern, doch es war Varosch, der sich bückte und sie aufnahm.
»Ich will dieses Ding nie wiedersehen«, sagte ich. »Von mir aus kann sie verbrannt werden.«
»Ich weiß«, antwortete er und faltete die blutige Robe sorgsam zusammen. »Havald«, fuhr er dann fort. »Ich würde Euch gern später sprechen.«
Ich sah ihn scharf an, denn es lag ein seltsamer Unterton in seiner Stimme, den ich nicht zu deuten wusste. Erst jetzt bemerkte ich, dass er seine feinsten Gewänder trug, zudem war er gewaschen und frisch rasiert.
Ich nickte nur.
»Vielleicht nach dem Tempeldienst?«, fragte er.
Ich nickte erneut und ging in Richtung Küche, doch er legte mir die Hand auf den Arm.
»Sie werden gern warten, bis Ihr gebadet habt.«
Ich stand da und sah stupide auf meine blutverschmierten Arme herab. Wie konnte es sein, dass ich nicht bemerkt hatte, wie sehr ich von Blut überzogen war?
Für eine solch schwere Wunde hatte Natalyia nicht viel geblutet, Seelenreißer hatte das meiste aufgesogen, nur ein kleiner Teil war auf meine Kleidung gelangt. Doch es war genug hindurchgesickert, um mein Unterzeug und auch meine Haut zu beflecken. Den Göttern sei Dank, dass dieses Haus ein Bad besaß!
»Es ist nicht nötig, dass sie auf mich warten«, verkündete ich.
»Sagt, Havald, wie geht es Euch?«, fragte Varosch vorsichtig.
»Ihr seht doch, nicht der geringste Kratzer«, teilte ich ihm mit und ging in Richtung des Bads davon. Es war nicht weit. Nur die Treppe hinauf, dann die zweite Tür links, zwischen Leandras Gemach und dem meinen.
»Das ist es nicht, was ich meinte«, rief er mir nach, aber ich hörte es kaum.
Ich lag schon eine Weile im Bad, als Leandra hereinkam. Sie trug ihr weißes Kleid und ihre Perücke, komplett mit Schleier und einem feinen silbernen Band, das um ihre Stirn lag. Sie schloss die Tür, lehnte sich dagegen und musterte mich aus ihren violetten Augen.
Manchmal erschienen sie mir wie ein Spiegel zu ihrer Seele, zu anderen Zeiten hielten sie mich hingegen fern.
»Ist dir das Wasser nicht zu kalt?«, fragte sie.
»Nein«, antwortete ich. Das Wasser wurde vom Brunnen im Hof hoch zum Dach gepumpt, wo es in einem schwarz gekachelten Behälter landete; von dort aus wurde es durch ein System von Röhren wieder abgelassen. Nach der Nacht war das Wasser zwar nicht ganz so warm wie am Abend, aber es reichte mir. Ich schrubbte weiter meine Arme.
»Das ist Bräune. Die bekommst du nicht ab.«
Ich ließ die Bürste sinken und sah auf meine Arme herab. Sie waren vom vielen Schrubben gerötet und sahen fast wund aus. Dann schaute ich hoch zu ihr.
»Sie hat versucht dich zu töten, Havald.«
»Das ist wohl so«, antwortete ich. Das Gefühl von eisiger Kälte, als Natalyia mir ihre Stilette in den Körper gerammt hatte, war schwerlich eins, das man leicht vergessen konnte. »Aber nur beinahe. Heute hat sie mir das Leben gerettet. Das zählt.«
»Ja«, sagte sie, setzte sich an den Rand des Beckens und zog den Stoff ihres Kleids etwas zur Seite, damit es nicht ins Wasser geriet.
»Hast du sie geliebt?«
Was für eine Frage! »Ist das alles, was du wissen willst?«
»Es ist das Wesentliche.«
War es das? »Ich liebte sie. Nur … anders. Nicht genug.«
Sie sah mich fragend an, dann nickte sie sachte. »Wirst du noch lange brauchen?«
Wenn ich so weitermachte, würde ich mir noch die Haut von den Knochen schrubben. Ich seufzte und erhob mich aus dem Wasser. Sie zog scharf die Luft ein, die Augen auf meinen Rücken gerichtet.
»Was ist?«, fragte ich. Ich wollte es nicht zugeben: Ich liebte Leandra, aber im Moment war mir ihre Anwesenheit zu viel.
»Dein Rücken.«
»Was ist damit?«
»Die Narben sind verblasst.«
»Bei manchen wurde es auch Zeit«, sagte ich und griff nach dem frischen Gewand, das Afala mir bereitgelegt hatte. Vorhin war sie wie ein stummer Geist durch das Bad gehuscht. Sie war mit absoluter Sicherheit eine Spionin Armins, meines treuen Dieners, der nun der Gemahl der Emira von Gasalabad war. Abgesehen davon war sie eine hervorragende Haushälterin.
»Das meinte ich nicht. Die meisten der älteren Narben sind so gut wie verschwunden«, erklärte sie leise und strich mit den Fingerspitzen langsam über meinen Rücken. Ich hielt in der Bewegung inne, spürte ihre Berührung und ihren Atem auf meiner Haut. Sie roch nach Rosen. Nach mehr, nach Leandra. Ein warmer Duft … und in Gedanken sah ich sie wieder, wie sie damals zu mir gekommen war, im Gasthof Zum Hammerkopf, wo alles angefangen hatte.
Ich drehte mich um und küsste sie. Sie floss mir entgegen und raubte mir fast den Atem dabei. »Du solltest besser gehen«, sagte ich, als ich wieder reden konnte. »Sonst wird dein Kleid noch nasser.«
»Wäre das schlimm?«, fragte sie mit diesem Lächeln, das ich an ihr so liebte. Ihre Augen waren geweitet, und ich sah das rötliche Feuer darin. »Ich habe noch andere Kleider.«
Ich zog sie ins Wasser; es war nicht mehr blutig, ich hatte es zweimal erneuert. Jemand würde bald neues Wasser in den Behälter pumpen müssen.
Später hob sie ihren Kopf von meiner Schulter, wischte sich die Haare aus dem Gesicht – eine unnötige Geste, denn noch waren sie nicht wieder lang genug – und sah mich eindringlich an.
»Ich bin unendlich froh, dass du lebst«, flüsterte sie. Ich wollte etwas sagen, doch sie legte mir sanft einen Finger auf den Mund. »Ich bedauere, dass Natalyia starb. Aber ich bin ihr dankbar. Die Götter werden gnädig zu ihr sein.«
»Sie war ohne Schuld.«
»Das weiß ich doch.«
»Nein, ich meinte, sie war frisch getauft. Im Namen Soltars. Sie lebte nicht lange genug, um Schuld auf sich zu laden. Boron wird keinen Makel an ihr finden.«
Ihre violetten Augen erforschten mich. Ich zog sie enger an mich, und sie gab einen leisen Laut von sich.
»Ich hoffe nur, dass es so ist, wie die Priester sagen.«
»Du zweifelst daran?«, fragte sie überrascht.
Ich küsste sie. Diesmal war ich es, der ihr über das nasse Haar strich. Ein leises Geräusch ließ mich aufblicken, doch da war nichts, und trotzdem meinte ich, sich entfernende Schritte zu hören. Ich presste Leandra an mich und vergrub das Gesicht in ihrem Nacken. Manche nannten einen Ort ihre Heimat, für mich war es anders, denn meine Heimat lag bei ihr.
»Es wird Zeit«, sagte ich und löste mich widerstrebend von ihr. Ich sah ihr zu, wie sie aus dem Becken stieg, und bewunderte ihre elegante Gestalt, die Linie ihres Rückens. Warum nur fühlte ich mich manchmal so, als sei ich nur Gast bei ihr? Sie bückte sich, ließ ihr Gewand über sich gleiten und musterte skeptisch ihre Perücke, die etwas nass geworden war. Dann zuckte sie mit den Schultern und lächelte mich an. In ihren Blicken las ich so viel Gutes, dass meine trüben Gedanken mir plötzlich lächerlich vorkamen.
»Kommst du?«, fragte sie.
Ich schaute auf mein frisches Gewand hinab. Es lag achtlos zerknüllt im Wasser. »Gleich.«
Ich zog mir mein Gewand zurecht, zögerte einen Moment, dann hängte ich mir Seelenreißer in den Gürtel. Armin wäre zufrieden mit mir gewesen, es war eines der kostbarsten Gewänder, die ich besaß. Ich nahm an, dass diese Roben von ihm bestellt worden waren, denn ich hatte sie eben gerade erst im Schrank entdeckt. Ich ging nach unten, zur Küche, wo die anderen auf mich warteten.
Als ich hereinkam, stellte Afala mir unaufgefordert eine Tasse mit Kafje hin, weitaus stärker und bitterer, als ich ihn aus meiner Heimat kannte. Serafine und Leandra waren auch dort, nur Varosch war nirgends zu sehen.
Ich nahm die Tasse und wollte gerade zum Trinken ansetzen, als die Tür aufging. Taruk, unser Haushofmeister, kam mit einer raschen Verbeugung herein.
»Esseri«, sprach er, »jemand wünscht, Euch zu sprechen.«
»Und wer?«, fragte Leandra leicht ungehalten. Serafine dagegen ignorierte Taruk und musterte mich prüfend aus dunklen Augen.
»Armin di Basra«, sagte eine neue Stimme von der Tür her, als sich mein ehemaliger Diener mit einer tiefen Verbeugung zu Wort meldete. Er schenkte Taruk ein schnelles Lächeln. »Verzeiht, aber ich wollte nicht länger warten.« In der Tat wirkte er etwas gehetzt und sparte sich die üblichen blumigen Worte. Zudem trug er einfache Kleider, was bei Armin wahrlich eine Seltenheit war. Also hatte er vermeiden wollen, dass ihn jemand erkannte.
»Was gibt es denn, Armin?«, fragte Serafine nun doch überrascht. Helis war Armins Schwester. Ordun, ein Nekromant, hatte sie vor Jahren entführt, und Armin hatte einen heiligen Eid geleistet, sie zu finden und ihren Entführer zu bestrafen. Beides war ihm gelungen, doch zu spät für Helis: Der Nekromant hatte sie bereits ihres Geistes beraubt. Jetzt war es Serafine, die in Helis’ Körper steckte. Für manche war das ein Wunder, ein Zeichen der Gnade Soltars, denn einer seiner Priester meinte erkannt zu haben, dass die heutige Helis tatsächlich die wiedergeborene Serafine aus den Zeiten des Alten Reichs war. Also wäre Serafine tatsächlich Helis, und dies wäre ihr eigener Körper. Ein Wunder, in der Tat. Ich wusste nur nicht, was ich davon halten sollte. Götter handelten selten ohne Grund.
Nach den Ereignissen der letzten Tage war es in der Tat überraschend, Armin hier vor uns zu sehen. Er und Faihlyd hatten im Moment alle Hände voll zu tun.
»Es gibt ein Problem«, sagte er.
»Wann denn nicht?«, entgegnete ich etwas gereizter, als es vielleicht angebracht wäre. Armin und ich waren Freunde. Vielleicht. Kürzlich erst hatte ich ihm vorgeworfen, diese Freundschaft über alle Maßen ausgenutzt zu haben. Tatsächlich wäre Natalyia wahrscheinlich noch am Leben, hätten Armin und Faihlyd uns nicht in ihre Probleme hineingezogen.
Leandra warf mir einen mahnenden Blick zu. Armin mochte einst meinen Diener gespielt haben, aber jetzt war er an der Seite Faihlyds Herrscher über Gasalabad. Da ich es in letzter Zeit ihm gegenüber an Diplomatie hatte mangeln lassen, befürchtete sie wohl, das könnte sich nun wiederholen.
Armin warf mir einen verwundeten Blick zu. »Esseri, vergebt mir, aber das Herz meiner Löwin und auch mein eigenes ist schwer über Euren Verlust. Ihr wisst selbst, dass nichts von dem, was geschehen ist, unseren Wünschen entsprach. Wenn es nach unseren Herzen ginge, wäre es der Emir, der euch seine Dankbarkeit beweisen müsste. Wir alle haben in diesem Spiel verloren. Einige mehr als andere.« Er sah zu Helis hinüber, und seine Augen überschatteten sich. Serafine mochte Helis sein, aber sie war nicht die Helis, die er kannte.
»Armin«, sagte ich. »Sag, was du auf dem Herzen hast.«
»Nun, zum einen sind etliche Personen von Rang und Namen gestern Nacht auf unerklärliche Weise verschwunden«, teilte er uns mit und warf mir einen scharfen Blick zu. »Noch wissen wir nicht, wie viele es wirklich sind, nur dass einige von ihnen in hohem Ansehen standen. Allein das bringt Aufruhr in die Stadt. Zum anderen …« Er zögerte und schien nach den passenden Worten zu suchen.
»Er will euch davon abraten, zum Tempel zu gehen«, sagte Zokora hinter Armin, woraufhin dieser fast schuldbewusst zusammenzuckte. In der kurzen Zeit, seit Zokora und er sich kannten, hatte sie wohl einen nachhaltigen Eindruck bei ihm hinterlassen. Sie ging an ihm vorbei, gefolgt von Varosch, der ihr am Tisch einen Stuhl herauszog. Sie löste den Umhang von ihrer Schulter, reichte ihn an Varosch weiter und nahm elegant Platz.
»Er will uns bitten, die Abreise nicht weiter zu verzögern, tatsächlich hofft er, dass wir noch binnen einer Kerze abreisen.« Sie warf ihm einen Blick aus schwarzen Augen zu.
»Ich hätte es freundlicher ausgedrückt«, beschwerte sich Armin, bemerkte Leandras Blick und nickte hastig. »Aber es ist wahr. Auch wenn ich mich frage, woher sie es wissen kann. Ihr müsst verstehen, dass Faihlyd es nicht so wünscht. Ihr seid Freunde, und Freunde …«
»… setzt man nicht vor die Tür«, vollendete Zokora den Satz. Sie wandte sich Afala zu und deutete auf sie, auf die Tasse, die ich noch in der Hand hielt, dann auf sich selbst. Hastig schenkte ihr Afala einen Kafje ein. »Warum eigentlich nicht?«
»Weil es unhöflich wäre«, erklärte ihr Varosch mit einem Lächeln. Er trat hinter sie und legte seine Hand auf ihre Schulter, als ob er sie beruhigen wollte.
Dabei wirkte Zokora ruhig wie ein Fels. Aber er kannte sie auch besser als jeder andere.
»Das verstehe ich nicht«, meinte Zokora und nahm die Tasse von Afala entgegen. »Zu Feinden ist man höflich. Zu Freunden spricht man die Wahrheit.«
»Und was wäre das?«, fragte ich sie, während Armin noch nach den passenden Worten suchte.
»Im Tempel Soltars hat sich gestern Nacht ein Wunder ereignet. Der Engel des Todes brachte Soltar eine Seele, die einer Leibwächterin. Sie ruht nun, in feinsten weißen Marmor gebannt, vor den Füßen des Gottes. Der Platz der Ferne ist voller Menschen, die dieses Wunder sehen wollen.« Sie schaute zu mir herüber und hob eine Augenbraue.
»Es ist wahr, Esseri«, fuhr Armin hastig fort. »Es sind Tausende. Es heißt, der Engel des Todes wäre noch immer in der Stadt, Hunderte behaupten, ihn gesehen zu haben.«
Zokora blickte zu Varosch hoch und erlaubte sich ein feines Lächeln. »Auch der Tempel Borons kann sich des Andrangs kaum erwehren. Man glaubt wohl, das Ende der Welt sei nahe, und so mancher will sich seine Seele erleichtern.«
»Die Priester meines Gottes sind bekannt für ihre Geduld und Gründlichkeit«, antwortete Varosch. »Ich denke, jeder der Sünder wird Gerechtigkeit erfahren.« Er blickte zu Leandra. »Ich würde allerdings davon abraten, dass Ihr Euch ohne Eure Perücke sehen lasst.«
Als Leandra das erste Mal Gasalabad betreten hatte, trug sie die Perücke noch nicht. Wegen ihres Haars und ihrer bleichen Haut hatte man sie für die Weiße Frau gehalten, örtlichen Legenden nach ein weiterer Vorbote der göttlichen Gerichtsbarkeit. Auch damals schon hatten sich Dutzende beim Tempel des Boron gemeldet, um ihre Sünden zu beichten.
»Unter anderen Umständen würde es mich auch zum Lächeln bewegen«, meinte Armin betreten. »Nur ist religiöser Eifer selten von Verstand geprägt. Noch ist die Lage ruhig, doch die ersten Gerüchte kursieren bereits.« Er sah mich mit weiten Augen an. »Es ist Natalyia, nicht wahr, Esseri?«
»Ja«, sagte ich hart. »Er wollte sie, also habe ich sie ihm gebracht.«
»Habt Ihr sie ihm wirklich zu Füßen gelegt?«, fragte er, noch immer in diesem seltsam ergriffenen Tonfall.
»Ja«, seufzte ich. »Ich fürchte, ich war etwas ungehalten mit ihm.« Ich zuckte mit den Schultern. »Wo ist das Problem? Die Priester werden ein Ritual für sie abhalten, und wenn Soltar gnädig ist, gibt er ihrer Seele die Gestalt einer weißen Eule. Es würde ihr gefallen.«
»Aber sie ist aus Stein und schläft vor seinen Füßen.« Er rang mit den Händen. »Versteht Ihr nicht? Sie ist die Wächterin. Sie hält die silbernen Dolche in den Händen und wird für ihn sterben, wieder und wieder, so lange, bis der Krieg entschieden ist!«
Während wir ihn verständnislos ansahen, weiteten sich Serafines Augen, und ihr Mund formte sich zu einem O. »Götter!«, hauchte sie. »Das Zeichen der Wächterin!«
»Verzeiht«, sagte Leandra höflich, aber mit einer Stimme, die keinen Widerspruch duldete. »Vielleicht wäre es möglich, uns zu erklären, was genau das bedeuten soll.«
Armin öffnete den Mund, schloss ihn wieder und sah hilfesuchend zu Serafine hinüber. »Helis?«
Auch sie sprach eher zögernd. »Es ist eine örtliche Legende. Eine Prophezeiung.«
Ich seufzte leise. Auch wenn sich vor Kurzem erst eine Prophezeiung scheinbar erfüllt hatte, hielt ich nicht viel von diesen Dingen. Die Essera Falah, Faihlyds Großmutter, hatte mir diese Prophezeiung übermittelt. Im Nachhinein schien sie überaus klar, aber bevor es geschehen war, war sie nicht zu deuten gewesen. Jetzt erschienen mir die Worte der Weissagung wie ein Hohn. Was nützte einem ein solches Wissen, wenn man es erst verstand, nachdem alles vorbei war?
»Es ist eine Passage aus dem Buch der Götter.«
»Die da lautet?«, fragte ich ungehalten.
»Es wird eine Zeit kommen«, intonierte sie, »in der die Götter selbst miteinander im Zwist liegen. Soltar wird blutige Tränen weinen, und zu seinen Füßen wird eine reine Seele ruhen, um ihn zu schützen.«
»Das ist Unsinn«, widersprach ich. »Ich habe die Schriften Soltars studiert. Ich habe nie eine solche Passage gelesen. Oder von einem Buch der Götter gehört.«
»Ich habe von dem Buch gehört«, sagte Leandra überraschenderweise. »Es ist eine eher obskure Sammlung von Texten, deren Inhalt zu verworren ist, um einen Sinn zu ergeben.« Sie zuckte mit den Schultern. »Vor etwas über tausend Jahren kam jemand auf die Idee, das Gefasel von Geisteskranken niederzuschreiben, in der irrigen Ansicht, dass sich so die Zukunft offenbaren würde.« Sie schüttelte verständnislos den Kopf. »Wenn man genug Wortfetzen sammelt, wird über die Jahre das eine oder andere scheinbar einen Sinn ergeben, aber es ist und bleibt nur Zufall.«
»Was bedeutet obskur?«, fragte ich sie.
Sie wirkte überrascht. Warum? Sie war es, die eine Tempelbildung genossen hatte und die schlauen Worte kannte, nicht ich.
»Undurchsichtig.«
»Danke«, sagte ich und wandte mich an Zokora. »Du warst im Tempel. Hat Soltar blutige Tränen geweint?«
»Nein«, sagte sie. »Wenn doch, dann habe ich sie nicht gesehen.«
Das bezweifelte ich, Zokora entging so gut wie nichts.
Jetzt wandte ich mich an Armin. »Alles gut und schön, aber was hat das mit uns zu tun?«
»Wie Ihr schon oft festgestellt habt, o Herr der kühlen Vernunft, sind wir ein abergläubisches Volk«, antwortete er betreten. »Ihr wisst, wie es ist, wenn viele Menschen an einem Fleck sind. Irgendwie wird der Geist auf das verringert, was der Niedrigste der Menge zu bieten hat.«
Ungeachtet aller Prophezeiungen war das wohl unbestritten wahr.
»Es gibt bereits Gerüchte, dass der Engel des Todes mit einem geheimnisvollen Bey in Verbindung steht, eben jenem, der dem Priester das Garn reichte, mit dem die Hoffnung Gasalabads vor dem sicheren Tod bewahrt wurde.« Die Hoffnung Gasalabads, das war ein weiterer Beiname Faihlyds. Wieder rang er die Hände und schaute fast schon verzweifelt drein. »Esseri, meine Löwin befürchtet, dass es nicht lange dauern wird, bis jemand mit dem Finger auf Euch zeigt.«
»Ich bin nicht der Engel des Todes.«
»Das mag sein. Aber es war Euer Garn. Das ist nahe genug«, sagte Armin und wich zugleich meinem Blick aus. Zumindest die Essera Falah war davon überzeugt, dass ich dieser Engel des Todes war, insgeheim glaubten er und Faihlyd das wohl auch. »Wie dem auch sei, die Emira befürchtet, dass es zu Unruhen kommen könnte, wenn Ihr noch länger in der Stadt verweilt.«
Zokora seufzte. »Wie ich vermutet habe. Wir werden gebeten zu gehen.« Sie sah zu mir herüber. »Ist dein Kafje schlecht?«
Ich schaute etwas überrascht auf die Tasse herab, die ich in den Händen hielt, schüttelte den Kopf und nippte daran. Er war nur noch lauwarm. Ich tauschte einen Blick mit Leandra. Sie nickte bestätigend.
»Gut, Armin«, teilte ich meinem ehemaligen Diener mit. »Entrichte deiner Löwin unsere Abschiedsgrüße. Wir werden ihrem Wunsch Folge leisten und schnellstmöglich aufbrechen.«
Er verbeugte sich tief. »Esserin, die Häuser des Löwen und des Adlers stehen zutiefst in euer aller Schuld. Mit der Gnade der Götter wird meine Löwin Kalifa sein, wenn wir uns in Askir wiedersehen.« Er schaute von mir zu Leandra. »Sie wird ihre Stimme für Eure Sache erheben, Essera«, versprach er.
Insgeheim war ich erleichtert, nicht Soltars Haus betreten zu müssen. Ich hatte meinen Abschied von Natalyia bereits genommen und sah nicht ein, welchen Unterschied ein Ritual machen sollte. Nur eins missfiel mir noch.
»Ich sah sie dort liegen, Armin«, beharrte ich. »Sie ist aus Fleisch und Blut, nicht aus Stein.«
»Aber jetzt ist sie es«, sagte Zokora. »Ich habe sie gesehen.«
»Aber …«
»Sie hat sich schon einmal in Stein verwandelt, als sie das letzte Mal dem Tode nahe war.« Sie setzte ihre Tasse ab. »Vielleicht tat sie es wieder, nachdem du gegangen bist.« Sie wandte sich an Leandra. »Ist es in Askir auch so hell und heiß wie hier?«
»Ich glaube nicht«, antwortete Leandra, überrascht von dem Themenwechsel.
»Gut«, meinte Zokora. »Ich bin die Sonne leid.«
»Ich nehme an, ich habe noch etwas Zeit, Abschied zu nehmen?«, fragte Serafine mit Blick auf Armin.
»Ja, natürlich«, entgegnete ich. »Ihr hättet nicht zu fragen brauchen.«
»Es sah fast so aus, als hättet Ihr die Absicht gehabt, auf der Stelle aufzubrechen.«
So sehr hatte sie sich darin allerdings nicht getäuscht.
»Für einen Abschied wird Zeit sein.« Ich musterte Armin, der traurig dreinsah, dann reichte ich ihm die Hand. »Es ist mir eine Ehre, dich Freund zu nennen.«
Er ergriff meine Hand und drückte sie fester, als ich es ihm zugetraut hätte. Tränen standen plötzlich in seinen Augen.
»Ich werde Euch nie vergessen, Esseri«, hauchte er und ließ meine Hand los, um mich plötzlich zu umarmen. »Niemals!«
»Armin«, begann ich und tätschelte ihm unbeholfen die Schulter. »Ich …«
Genauso plötzlich ließ er mich wieder los und wandte sich hastig ab und Serafine zu, die ihn mit einem zarten Lächeln bedachte. Afala schaute verlegen drein und beeilte sich, den Tisch abzuräumen. Seit Darsans Tod hatte sie wenig gesagt und war eher noch stiller geworden. Aber auch ihre Augen glänzten.
»Gut«, sagte ich und räusperte mich. »Ich zumindest muss noch packen. Wir … wir sehen uns dann am Schiff.«
3. Ein schneller Abschied
Als wir vom Gasthof Zum Hammerkopf aufgebrochen waren, hatte noch alles, was ich besaß, in einen Rucksack gepasst. Jetzt füllten allein meine Kleider einen großen Schrank. Ich öffnete die Türen desselben, warf einen letzten Blick auf die prächtigen Gewänder, die mir Armin ausgesucht hatte, und schloss die Türen wieder. Mein Packen lag auf dem Bett, Seelenreißer stand daneben. Ich griff beides und verließ mein Zimmer.
Mir gegenüber lag Natalyias Zimmer. Einen Moment zögerte ich, dann öffnete ich die Tür. Es war noch alles so, wie sie es zurückgelassen hatte. Auf ihrem Bett lagen ihr Ranzen und ihre Reisekleidung; auch sie hatte bereits zum größten Teil gepackt. Alles war sorgsam aufgeräumt, ordentlich und sauber.
»Es ist seltsam«, sagte Zokora und trat lautlos an mir vorbei in das Zimmer. Sie musterte den Raum, und ihr Blick fiel auf den kleinen Altar zu Ehren Soltars, der auf einem Tisch neben dem Bett stand. Eine unangetastete Kerze stand davor. »Sie hat den Vater meiner Kinder erschossen. Du hast mir gesagt, es wäre möglich zu vergeben.« Sie sah mit dunklen Augen zu mir auf. »Wir glauben nicht an Vergebung, Havald.«
»Ich weiß.«
Sie hob die Hand, und ein Funke flog zu der Kerze und entzündete sie. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte.
»Unseren Kindern raten wir stets zur Vorsicht. Ein Freund kann ein Dolch im Rücken sein.« Vielleicht lächelte sie dabei, ganz sicher war ich mir nicht. »Ich lerne von dir, Havald, aber ich weiß nicht, ob ich wirklich alles lernen will.« Sie verließ mich so lautlos, wie sie gekommen war.
Ich ging mit Zokora und Varosch zusammen zum Hafen, Leandra hatte noch einige letzte Anweisungen für Taruk und Afala zu geben. Wenn es am Platz der Ferne Unruhen gab, dann war hier am Hafen jedenfalls nichts davon zu bemerken. Allerdings hörte ich hier und da den Namen Soltars und sah viele, die sein Zeichen ausführten.
Wir gingen langsam und schweigend. Weit war es nicht, aber auf der ganzen Strecke fühlte ich die Aufmerksamkeit der anderen auf mir ruhen. Wenn ich zu ihr hinüberblickte, schien Zokora immer gerade etwas anderes zu betrachten, Varosch hingegen sah mich unverwandt an.
Ich seufzte. »Was ist, Varosch?«, fragte ich ihn, als wir das Schiff erreichten.
»Später«, gab er mir Antwort. »Wenn wir mehr Muße haben.«
Das war mir recht. Ich mochte Varosch, aber im Moment war mir nicht nach Reden zumute. Die Planke zum Ufer war eingezogen, doch eine Bordwache sah uns und beeilte sich, die Planke auszubringen. Wir gingen an Bord, und schon im nächsten Moment eilte Deral, der Kapitän der Lanze, herbei.
»Wir warten nur noch auf die Esseras Leandra und Helis«, teilte ich ihm mit. »Ich nehme an, wir können aufbrechen?«
»Schon«, antwortete Deral, wirkte aber nicht besonders glücklich dabei. »Es gibt nur ein paar Probleme.« Ich sah ihn fragend an, und er hob beschwichtigend die Hand. »Es ist nichts Großes«, wiegelte er ab. »Aber ich kann das nicht allein entscheiden.«
»Wendet Euch damit an die Essera Leandra«, befahl ich ihm. »Im Moment will ich nicht behelligt werden.«
Einen Augenblick lang sah es aus, als ob er widersprechen wollte, dann verbeugte er sich tief und zog sich zurück. Wir gingen nach hinten zu unserer Kabine, und ich hielt überrascht inne, denn dort saß die junge Frau von heute Morgen, die ich schon fast vergessen hatte.
Sie trug weite schwarze Hosen in einem mir unbekannten Schnitt, eine Art Jacke mit breitem, stehendem Kragen, dazu seltsame Holzpantinen, die aus einem Brett und zwei Blöcken zu bestehen schienen. Ihr Haar war schwarz wie die Nacht und zu einem strengen, langen Zopf gebunden, der ihr fast bis auf den unteren Rücken reichte. Die größte Überraschung jedoch war ihr Gesicht. Es war runder, als ich es gewohnt war, mit einer gelblichen Färbung, die im ersten Moment kränklich auf mich wirkte, bevor ich verstand, dass es die Farbe ihrer Haut war. Der Mund war voll und weit geschwungen, die Nase flach, feine Augenbrauen betonten eine hohe Stirn, und die mandelförmigen Augen waren so dunkel wie die Zokoras. Und genauso ausdruckslos. So seltsam mir ihre Gesichtszüge auch erschienen, zusammen ergaben sie doch ein elegantes Bild.
»Havald, Ihr starrt sie an«, flüsterte Varosch, und ich blinzelte.
»Entschuldigt«, sagte ich zu der jungen Frau. »Euer Anblick hat mich überrascht.« Ich deutete eine Verbeugung an. »Mein Name ist Havald, ich bin der Besitzer dieses Schiffs. Darf ich fragen, wer Ihr seid?«
Einen Moment musterte sie mich intensiv und schaute dann wieder durch mich hindurch.
»Essera?«
Keine Reaktion.
Zokora war direkter. Sie trat an die junge Frau heran und schnippte mit den Fingern vor ihren Augen. Unser Gast blinzelte nicht einmal.
Zokora trat zurück und ging in die Kabine, ohne die Frau eines weiteren Blicks zu würdigen. Varosch versuchte ein Schmunzeln zu verbergen. Die junge Frau starrte immer noch durch mich hindurch. Also gut, wenn sie es so wünschte. Mir war es einerlei.
Ich legte meinen Packen in die Kabine und ging hoch aufs Achterdeck, wohin Varosch mir folgte. Sollte sich Leandra den Kopf über diese Frau zerbrechen. Auch Varosch hatte seinen Packen in die Kabine gelegt, doch er hielt seine Armbrust in den Händen und trug einen Köcher mit gut zwanzig Bolzen an seiner Seite. Dass hier im Hafen etwas geschah, war mehr als unwahrscheinlich, doch wir hatten gelernt, vorsichtig zu sein.
Ich lehnte mich neben ihn an die Reling und sah ihn fragend an. »Also, Varosch, was gibt es?«
Er seufzte. »Ich weiß nicht, ob es mir zusteht«, begann er, und ich hob die Hand, um ihn zu unterbrechen.
»Sag einfach, was du sagen willst.«
Er holte tief Luft. »Es ist nicht gut, mit seinem Gott im Zwist zu liegen«, platzte er dann heraus. »Es sind Götter. Sie wissen, was sie tun. Wenn nicht sie, wer dann?« Er fuhr sich über das Haar. »Ist es wahr, dass Ihr die Insel des Gottes betreten habt?«
»Es ist ein Podest aus Stein. Es ist Soltar geweiht, wie seine Statue auch. Aber es wurde von Menschenhand erschaffen.« Ich stützte mich auf die Reling und schaute hinaus auf das Wasser des Gazar. Es war jetzt kurz vor Mittag, die Sonne stand hoch am Himmel, und es war gleißend hell. Kein Wunder, dass sich Zokora in die Kabine zurückgezogen hatte. »Beides ist aus Stein. Es ist nichts Besonderes daran, außer dass es geweihter Stein ist.« Ich drehte mich um, sodass ich mit dem Rücken am Geländer lehnte, und musterte den Scharfschützen. »Es braucht dich nicht zu berühren, Freund Varosch«, sagte ich leise. »Es ist eine private Angelegenheit zwischen Soltar und mir.«
»Ist es nicht überheblich, so zu denken?«
»Das mag sein«, gab ich zu. »Aber es war nie anders.« Ich blickte zum Himmel auf. Dort sollten die Götter wohnen. Alle Götter. Also auch der Namenlose? Irgendwie passte es nicht zu ihm. Seine Anhänger jedenfalls suchten sich Verstecke, die vom Licht nie berührt wurden. Irgendwo weit unter uns nagten die Fische nun an den Leichen seiner Anhänger. Und an dreizehn unschuldigen Opfern.
»Darf ich fragen, wie das möglich ist?«
Ich seufzte. »Warum nicht? Es ist kein Geheimnis.« Ich wandte mich wieder ihm zu. »Ich war ein Kind, als ich einen Kanten Brot von seinem Altar stahl. Meine Schwester hatte Hunger, ich wusste mir nicht anders zu helfen. Einer seiner Priester ertappte mich dabei und gab mir einen Tritt, der mich in Soltars Namen taufte, denn ich landete im heiligen Wasser des Grabens.« Ich blickte in Varoschs ernstes Gesicht. »Seine Priester brachten mir viele Dinge bei und waren gut zu meiner Schwester und mir. Allein dafür hätte ich alles getan, was er von mir wollte. Aber …« Ich zuckte mit den Schultern. »Weißt du, Varosch, ich hatte nie eine Wahl. Hätte ich mich aus freien Stücken für ihn entschieden, wäre es vielleicht anders. So aber fühlt es sich an, als ob er mich zwingt, sein Werk zu verrichten.«
»Ihr folgt ihm nicht aus freiem Willen?«
»Doch«, sagte ich. »Es war mein freier Wille. Meine Wahl. Aber ich hatte nie eine andere. Nachdem der Herr der Puppen tot war und sein Tempel vernichtet, hoffte ich, er lässt mich gehen. Dann nahm er Natalyia und verweigerte mir den Zutritt zu seinem Reich.« Ich rieb mir die Augen im gleißenden Licht. »Ich folge ihm wie ein störrischer Esel, dem der Weg zu weit geworden ist. Und wie bei einem Esel hält er mir die Karotte hin oder benutzt den Stock.« Ich schüttelte den Kopf. »Ich sehe wenig Sinn in dem, was er von mir verlangt. Der Tempel des Namenlosen ist vernichtet, aber noch heute Nacht wird es an einem anderen Ort eine Andacht geben, neue Opfer für den Namenlosen. Vergiss nicht, es waren auch Schuldlose unter ihnen.« Dreizehn junge Frauen, die dem Namenlosen geopfert werden sollten.
Varosch nickte langsam. »Aber auch für sie war es eine Rettung.«
»Ich weiß nicht, ob sie das getröstet hat, als der Gazar sie ertränkte«, antwortete ich bitter. »Wenn ich nicht Soltars Schlachter wäre, würde ich mich sicher nicht so gegen ihn sperren.«
Er schaute mich fragend an.
»Was ich meine, ist, dass ich Gefallen daran finden könnte, meinem Gott zu dienen, wenn ich ein Priester wäre. Ich verstehe und bewundere die Priesterschaft, egal wessen Gottes Diener man ist.«
»Nicht ganz egal, hoffe ich«, warf er ein, und ich lachte leise, mein erstes Lachen seit der letzten Nacht. In meinen Ohren klang es etwas bemüht.
»Nein, nicht ganz egal.« Ich suchte seinen Blick. »Die Menschen kommen zu den Priestern, weil sie Hilfe suchen, Führung oder Rat. Nicht immer kann man etwas für sie tun, das sah ich deutlich im Tempel in Kelar. Oft blieb den Priestern dort nicht viel anderes, als Trost zu spenden. Aber auch das ist von Wert.«
»Die Stadt stand unter Belagerung, nicht wahr?«
»Richtig. Es fehlte an allem. Die Priester taten, was sie konnten, doch es gab keine einschläfernden Tränke mehr. Ich hörte die Schreie der Verwundeten, sah die Gesichter der Priester, die einen Verletzten verzweifelt festhielten, während ein anderer die Wunden versorgte. Als ich größer und stärker wurde, half ich dabei.« Ich schaute auf meine Finger. »Wunder habe ich dort keine bemerkt. Keine wundersame Genesung, nur das Wissen und das Handwerk eines Arztes. Ich habe nie ein Wunder gesehen. Dann hielten die Priester der drei Götter eine Augurie ab und befanden, dass jemand, der bereit wäre, durch Soltars Tor zu treten, die Stadt retten könnte.«
»Die Geschichte, die Janos im Gasthof erzählte.«
»Ja.«
Janos und Sieglinde waren nun schon länger unterwegs. Ich fragte mich, wie es ihnen ergangen war. So oder so, es würde noch Wochen dauern, bis wir mehr erfahren konnten. Es war ein weiter Weg vom Hammerkopf nach Illian, und es mochte gut sein, dass das Land bereits in Thalaks Hände gefallen war.
Kelar wurde gerettet, zumindest damals, aber es war nicht mehr als ein Aufschub gewesen. Nachdem die Stadt schließlich doch an ihn gefallen war, hatte der Imperator von Thalak den Befehl gegeben, sie zu schleifen. Nichts wurde am Leben gelassen, weder Mann noch Frau noch Kind noch Hund. Der Boden war gesalzen worden, die Brunnen vergiftet. Ich verdrängte den Gedanken und sprach weiter.
»Priester können den Menschen helfen. Manche sind begnadet, ich habe einen kennengelernt, der seine Gaben dazu einsetzte, den Armen zu helfen. Er war empört darüber, dass der Tempel ihn zu mir schickte.« Ich schaute einem Wasserdrachen zu, wie er gemächlich durch den trüben Gazar glitt; nur eine leichte Welle und die Kuppeln seiner Augen verrieten ihn.
»Ich hingegen habe getötet. Und komme nicht davon los. Ich habe es versucht. Versuchte ein normales Leben zu führen. Irgendwann erlernte ich das Handwerk eines Kunsttischlers. Ich mag es, Dinge mit meinen Händen zu erschaffen oder zu gestalten. Ich bin leidlich gut darin.«
»Ich habe Eure Figuren gesehen. Es ist mehr als nur ein leidliches Talent.«
»Danke.« Ich neigte den Kopf. »Aber mein größtes Talent liegt darin, andere zu Soltar zu führen. Sei es nun Feind oder Freund.« Ich sah ihn eindringlich an. »Bislang ist noch jeder, der mich in einen Kampf begleitet hat, einen frühen Tod gestorben. Diesmal habe ich Soltar angefleht, mich vor allen anderen zu nehmen. Eine Weile sah es sogar so aus, als müsste diesmal niemand sterben.« Ich schaute zu dem Felsen am Ufer. »Eine trügerische Hoffnung. Er ließ es nicht zu. Er hat wohl andere Pläne für mich.«
»Pläne? Habt Ihr mir nicht erklärt, es gäbe keine Vorbestimmung? Dass der Mensch handeln könnte, wie sein Gewissen ihn leitet?«
»Schon«, seufzte ich, »aber man folgt seinem Pfad, weil man ist, wer man ist. Ich liege nicht im Zwist mit meinem Gott, er liegt im Zwist mit mir. Jeder meiner Schritte folgt meinem Willen und ist von mir allein bestimmt. Ich habe die Wahl.« Ich vollführte eine Geste, die Gasalabad umschloss. »Es ist wie beim Shah. Ich schaue, was ich tun kann und welcher Zug der richtige für mich wäre. Dann entscheide ich mich, ihn zu tun oder zu lassen. Aus freiem Willen. Aber was nützt es mir, wenn er schon vorher weiß, welcher Zug das sein wird? Denn wohin ich auch gehe, auch durch meine eigene Wahl, er lässt mir keine Ruhe. Bislang fand sich immer etwas zu tun für Seelenreißer. Doch ich bin des Tötens müde.« Ich sah Varosch direkt in die Augen. »Er weiß es. Er muss es wissen. Wie du sagst, er ist ein Gott. Er muss wissen, wie müde ich bin, wie leid ich es bin, sein Schlachter zu sein. Wäre es nicht gerechter, mich gehen zu lassen?«
Er musterte mich sorgfältig und suchte in meinen Zügen nach irgendetwas. »Seid Ihr des Lebens müde, Havald? Wartet Ihr nur darauf, zu sterben? Es war schon einmal so, nicht wahr?«
»Ja. Nicht nur einmal. Aber das war, bevor ich Leandra und auch dich kennenlernte. Das ist es, was ich meinte, als ich davon sprach, dass er mir wie einem Esel die Karotte und den Stock gibt. Wenn ich nicht leben will, dann wäre Natalyias Opfer ohne jeden Sinn gewesen. Das kann ich nicht zulassen. Also werde ich leben. Aber ich bin jetzt ein alter Esel. Du weißt, wie es um so einen bestellt ist. Sie werden immer störrischer. Und jetzt ist es so, dass ich glaube, dass er mir etwas schuldet, nicht ich ihm.«
Lange Zeit sagte Varosch nichts, dann seufzte er. »Ich möchte nicht mit Euch tauschen, Havald. Ich kann nur versuchen, Trost zu spenden. Die Götter, so heißt es, haben einen Plan für uns. Und der ist so groß, dass wir ihn nicht verstehen können. Vielleicht offenbart sich ihr Plan für Euch noch. Vielleicht gibt es etwas, das all das wert ist. Vielleicht zeigt sich eines Tages, dass es gut war, so wie es ist.«
»Du meinst, wenn ich verstehe, dann kann ich ihm vergeben?«
»Abgesehen davon, dass ich diesen Gedanken noch immer für überheblich halte, ja, Havald, genau das meine ich. Übrigens irrt Ihr.«
»Worin?«
»Ihr seid nicht nur sein Schlachter.«
»Wie das?«
»Ihr habt bislang jeden Seelenreiter erschlagen, der Euren Weg kreuzte, und damit viele Seelen aus stärkeren Fesseln befreit als jene, die Euch selbst halten.«
Ich erinnerte mich an das geisterhafte Gesicht des Emirs, als seine Seele ihren Weg zu Soltar fand. Es war das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, dass eine Seele mich wahrnahm. Vielleicht aber hatte ich mir sein dankbares Lächeln auch nur eingebildet.
»Bevor ich Leandra kennenlernte, hatte ich noch nie einen Seelenreiter gesehen. Wenn es sein Wille ist, dass ich Nekromanten erschlage, warum ist mir nicht früher einer über den Weg gelaufen?«
»Vielleicht war es noch nicht die Zeit dafür.« Er verbeugte sich leicht und wandte sich zum Gehen.
»Varosch.«
Er hielt inne und schaute zu mir zurück.
»Du wärst ein guter Priester.«
Ein schnelles Lächeln huschte über seine Lippen. »Ich weiß. Selbst Zokora sagt das.« Er ging zur Treppe, die vom Achterdeck herabführte, und blieb noch mal stehen. »Havald, sagt, wenn Ihr die freie Wahl gehabt hättet, wenn es möglich gewesen wäre, für welchen Gott hättet Ihr Euch entschieden?« Er grinste mich an, ging die Treppe hinab und ließ mich allein zurück.
Eine gute Frage, fand ich, eine, die ich mir so noch nicht gestellt hatte.
Ich brauchte nicht lange zu überlegen. Astarte war mir zu … zu freundlich, zu vergebend. Boron war mir zu steif. Also blieb ohnehin nur …
Jemand räusperte sich hinter mir, und ich drehte mich um. Es war der Steuermann, der hier seinen Platz am hohen Ruder der Dhau beanspruchte. Ich stand im Weg. Also trat ich zur Seite und begab mich hinab aufs Deck. Dort standen Leandra und Serafine und unterhielten sich mit Deral, während die Leinen gelöst wurden.
Ich schaute zurück ans Ufer und suchte nach bekannten Gesichtern. Es wäre eine nette Geste gewesen, wenn Faihlyd oder Armin erschienen wären, vielleicht sogar die Essera Falah. Nun, sie würden ihre Gründe haben, es nicht zu tun.
Die Lanze des Ruhms bewegte sich unter meinen Füßen. Endlich war es so weit, wir legten ab. Wenn alles gut ging, würden wir bald Askir mit eigenen Augen sehen können. Ich hoffte nur, dass Leandra nicht zu sehr enttäuscht wurde.
4. Von Schiffen und Städten
Diese Schiffe, so hatte ich gelernt, nannte man Dhaus. So gut kannte ich mich in der Seefahrt nicht aus, doch die Unterschiede zu den Schiffen, die ich kannte, waren mit bloßem Auge zu erkennen. Die Schiffe meiner Heimat waren große behäbige Segler mit quadratischen Segeln, die vor die Masten gespannt wurden. Rahsegler nannte man sie wohl. Die größten unter ihnen besaßen vier Masten und Dutzende von Segeln. Die Lanze des Ruhms besaß einen Mast und nur ein einzelnes großes, dreieckiges Segel.
Die meisten Dhaus waren für den Flusshandel bestimmt, die Lanze des Ruhms, so hatte mir Deral wiederholt versichert, war jedoch hochseetauglich. Sie übertraf auch die meisten anderen Flusssegler, die wir auf unserer Reise sahen, um gut das Dreifache in ihrer Größe. In der Konstruktion schienen diese Schiffe irreführend einfach. Die meisten von ihnen wurden nicht in einer Werft gebaut, sondern irgendwo an einem Flussufer, meist das Werk einer einzigen Familie, die das Wissen um den Bau der Schiffe über die Generationen weitergab. Es gab keine Pläne, nur das Augenmaß, das überlieferte Wissen und handwerkliche Kunst. Ein scharf zulaufender, erhöhter Bug, ein schlanker Rumpf, oft nicht einmal geschlossen, ein langgezogenes, erhöhtes Heck mit einer offenen Kabine darauf, in der unser Rudergänger stand, der sich gegen das Seitenruder stemmte. Die Lanze des Ruhms war groß genug, dass sie neben dem Laderaum auch eine große Kabine im Heck besaß. Die stand uns zur Verfügung. Die Mannschaft dagegen, auch Deral, schlief unter Deck in Hängematten.
Zum Kochen gab es eine kleine, mit Blechen beschlagene Feuerstelle, auf der über sorgsam bewachten Kohlen in einem kleinen Kessel gekocht wurde. Tatsächlich aber war es eher üblich, am Ufer anzulegen, um für Mittag Rast zu machen. Auf längeren Reisen und auf hoher See war das jedoch nicht möglich. Dann würde die Mannschaft sich von hartem Trockenbrot ernähren, von Früchten und anderen haltbaren Dingen.
»Wasser«, hatte mir Deral erklärt, als wir die Reise planten, »Wasser ist das eigentliche Problem. Bevor wir den Gazar verlassen und ins offene Meer steuern, müssen wir Wasser und frischen Proviant aufnehmen. Üblicherweise hätten wir das in Janas getan.« Er hatte mir einen fast schon vorwurfsvollen Blick zugeworfen. »Es scheint mir allerdings, dass wir uns besser an anderer Stelle versorgen sollten.«
Damit hatte er wohl recht. Janas, die größte Küstenstadt Bessareins und nach Gasalabad das mächtigste der Emirate, unterstand dem Turm, einem Haus, das mit dem Haus des Löwen, der Emirsfamilie von Gasalabad, und somit jetzt auch mit uns verfeindet war. Einst hatte Janas dem Haus des Adlers gehört, dem Haus, dem Armin vorstand. Vor Jahrhunderten hatte eine Intrige das Haus entmachtet und fast vollständig vernichtet. Ich wusste auch, dass Armin noch immer davon träumte, Janas für sich zurückzugewinnen.
Ich wünschte ihm Glück dabei, aber das sollte er nun besser allein bewerkstelligen. Niemand von uns verspürte noch den Ehrgeiz, ihm dabei zu helfen.
Ich mochte das Schiff besitzen, doch wir waren kaum mehr als Passagiere. Deral hatte sich unmissverständlich dazu geäußert: Die Kabine gehörte uns, damit wir ihm und der Mannschaft nicht im Weg herumstanden. Jetzt, wo das Schiff langsam Fahrt aufnahm, zeigte sich die Weisheit seiner Worte. Die Leute hatten genug zu tun, eilten hierhin oder dorthin, hoch auf die Wanten, oder stützten sich mit dem ganzen Gewicht gegen die langen Stangen, mit denen sie das Schiff vom Ufer abstießen.
Für mich hatte eine Flussfahrt etwas Beschauliches an sich, für Deral nicht. Ständig war er in Bewegung, stand im Bug und starrte mit zusammengekniffenen Augen ins Wasser, musterte das Ufer oder rief neue Befehle hoch zum Steuermann, der das große Ruder oft nur einen Fingerbreit bewegte.
Der Sinn solcher Befehle erschloss sich mir nicht. Der Gazar war der größte Fluss, den ich jemals gesehen hatte, die Ufer waren fast einen Pfeilschuss weit voneinander entfernt, manchmal sah man sie kaum. Andere Schiffe, von denen es reichlich gab – von anderen Dhaus bis hin zu großen Lastkähnen, die entweder der Strömung folgten oder mit Ochsengespannen flussaufwärts gezogen wurden –, waren meist kleiner. Ihnen wich Deral nie aus, nur bei den Kähnen, die schlecht auf die Ruder reagierten, machte er eine Ausnahme. Mehrfach sah es so aus, als würde die Lanze des Ruhms ein anderes Schiff unter die trüben Wasser des Gazar pflügen, doch bislang war jedes der kleineren Schiffe letztlich ausgewichen. Auch wenn das manchmal mit lautstarken und verblüffend farbigen Beschwerden, gereckten Fäusten und groben Flüchen vonstatten ging.
Auch Deral sparte nicht mit unflätigen Worten, wenn er ein anderes Boot oder Schiff vertrieb. Er stand breitbeinig da, drohend die Hände in die Hüfte gestemmt, das Gesicht wie versteinert, als bereite er sich auf eine Kollision vor. Als es schien, als wäre er darauf erpicht, ein Boot voll mit jungen Frauen und Kindern zu rammen, räusperte ich mich.
»Können wir wirklich nicht ausweichen?«
Er warf mir einen Blick zu, der mich und meine Einmischung in die tiefsten Höllen verdammte, und seufzte dann, als läge die Last der Weltenscheibe auf seinen Schultern.
»Gebt mir den Speer dort«, wies er mich in einem etwas ungeduldigen Tonfall an. Die langen Speere waren entlang der Reling verteilt, wo es metallene Ösen gab, die sie hielten. Vorher hatte ich sie nicht bemerkt, sie dienten wohl der Verteidigung gegen Piraten, die weiter flussabwärts, nahe Janas, eine Gefahr darstellen sollten. Aus dem gleichen Grund hatte die Lanze des Ruhms mit vierzehn Mann auch mehr Besatzung als eigentlich notwendig. Jeder der Männer war hartgesotten, kampferprobt und von Armin handverlesen. Es war ehemals sein Schiff gewesen, und noch immer war ich mir nicht sicher, ob die Loyalität der Leute nicht doch mehr ihm galt als uns.
Ich reichte dem Kapitän den gut vier Schritt langen Speer. Eine unhandliche Waffe, aber gut dafür geeignet, andere Boote von unserem Schiff fernzuhalten. Deral warf einen letzten drohenden Blick auf das Boot mit den Frauen und Kindern, dem es dann doch noch gelungen war, im letzten Moment auszuweichen, und trat mit dem Speer in der Hand an die Reling. Dort stieß er die Waffe mit überraschender Kraft ins Wasser, und zu meinem Erstaunen blieb sie stecken. Er zog Hand über Hand den Speer wieder heraus und zeigte mir die Spitze. Dort war Lehm und Sand haften geblieben.
»Unter unserem Kiel haben wir im Moment kaum mehr als drei Handbreit Wasser«, erklärte er mir, als er mir den Speer wieder in die Hand drückte. Ein Blick forderte mich auf, das Utensil wieder an die Stelle zu tun, wo es hingehörte. Doch Deral war mit seiner Lektion noch nicht fertig.
»Seht Ihr, da vorn … das leichte Kräuseln im Wasser?« Ich erkannte es zuerst nicht, dann nickte ich. »Dort staut sich das Wasser über einer Erhebung im Flussbett.« Er fixierte das Gekräusel, als wäre es sein persönlicher Feind. »Es sind Sandbänke, Esseri«, erklärte er. »Verräterische Hinterlassenschaften ruchloser Dschinns, die sich einen Spaß daraus machen, ehrbaren Schiffern wie mir das Leben zu erschweren. Jede Nacht kommen sie und schieben die Sandbänke von einem Ort zum anderen, bauen Fallen, leiten die Strömung um und wollen uns dazu verleiten, auf diese Sandbänke aufzulaufen. Wenn das geschieht und wir uns nicht lösen können, wird jemand am Ufer es sehen. Er wird mit einem breiten Grinsen davonreiten, und in der Nacht werden die Flusswölfe kommen, in kleinen flachen Booten, um an uns zu zerren wie an einem waidwunden Tier. Wenn wir auflaufen und nicht loskommen, sterben wir.« Seine blassgrauen Augen glitzerten. »Kleinere Schiffe weichen größeren aus. Das ist Gesetz. Wenn ich jedoch ausweiche und auflaufe, bringe ich uns vielleicht um.« Er sah mit zusammengekniffenen Augen hoch zum Mast und bellte einen Befehl. Ein Tau wurde angezogen, und das Segel bewegte sich kaum merklich.
»Wenn die Wölfe kommen, überlasse ich Euch gern das Töten. Bis dahin erlaubt mir, dafür zu sorgen, dass wir nicht waidwund werden.« Damit wandte er sich von mir ab und ließ mich stehen.