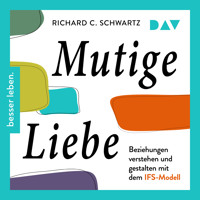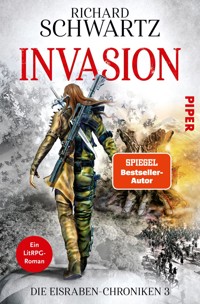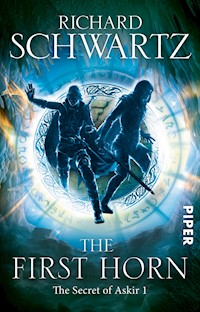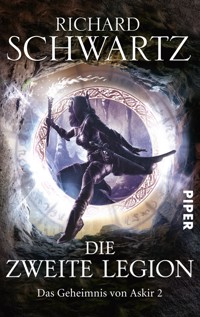
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Ein mysteriöser Wanderer aus dem legendären Reich Askir trifft im Gasthof »Zum Hammerkopf« ein. Er unterrichtet den Krieger Havald und die Halbelfe Leandra über die Zersplitterung des sagenhaften Reiches. Leandra, Havald und einige Gefährten machen sich auf zum magischen Portal, um die Bewohner Askirs davor zu warnen, dass der brutale Herrscher Thalak auch sie zu unterjochen droht. Das Portal soll die Gefährten unmittelbar nach Askir führen; doch stattdessen landen sie im gefährlichen Wüstenreich Bessarein … Der zweite Band des aufregenden Fantasy-Zyklus »Das Geheimnis von Askir« verblüfft erneut mit hochgradiger Spannung und intensiver Atmosphäre. High Fantasy der Superlative!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Entdecke die Welt der Piper Fantasy:
Dieses Buch widme ich meinen Eltern, die immer an mich glaubten, meinen Freunden, die mich unterstützen, und natürlich Kai, Christian, Robbie und Volker, die mir halfen, Askir zum Leben zu erwecken.
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
2. Auflage 2011
ISBN 978-3-492-95453-2
© Piper Verlag GmbH 2007 Umschlagkonzept: semper smile, München Umschlaggestaltung: Guter Punkt, München Umschlagabbildung: Uwe Jarling
Datenkonvertierung: CPI – Clausen & Bosse, Leck
1. Tore und Steine
Ich lehnte mich zufrieden in meinen Stuhl zurück. Eberhard, der Wirt des Gasthofs Zum Hammerkopf, hatte sich in der Küche selbst übertroffen, und ich fühlte mich angenehm gesättigt. Es war gemütlich in der Gaststube und warm genug, um einen kühlen Schluck Fiorenzer Wein zu genießen. Vielleicht war es sogar etwas zu warm, aber ich bezweifelte, dass sich jemand beschweren würde.
Vor drei Wochen hatte hier, am Fuß des Donnerpasses, ein magischer Eissturm gewütet und uns mit seiner Kälte zu erdrücken gedroht. Nur durch das Opfer tapferer Männer und Frauen war es gelungen, den Verursacher des Sturms zu besiegen und seine Macht zu brechen. Nie wieder wollte ich diese Kälte spüren. Oder mich beschweren, wenn es mir zu warm war.
Der Sturm war also vorbei, doch der Winter ganz gewiss nicht, und so blieben wir eingeschneit. Aber jetzt erschien mir der Winter, obwohl klirrend kalt, als mild.
Eberhard besaß ein großes Lager mit ausreichend Proviant und Brennholz, die Gesellschaft war – mit wenigen Ausnahmen – angenehm, und der Frühling würde irgendwann kommen. Ich hatte es nicht eilig.
Was konnte einem Mann besseres passieren, als mit einer bezaubernden Frau eingeschneit zu sein?
Ich stellte den Wein ab, erlaubte mir ein dezentes Gähnen und ergriff mein Schnitzmesser und das Stück Holz, aus dem die Königin werden sollte. Dem Holz Figuren zu entlocken war weniger eine Kunst als eine Gabe, die Gabe, im Holz das zu sehen, was es werden wollte … In diesem Fall hatte ich lange nach dem passenden Stück gesucht.
In der Maserung des Holzes konnte ich sie bereits sehen, die weiße Königin. Auch das war keine große Kunst, hatte ich doch noch am Morgen ihr schlafendes Gesicht in aller Ruhe studieren können.
Leandra, Maestra de Girancourt.
»Ich sage euch, er führt etwas im Schilde! Wundert ihr euch denn nicht, dass er erst ankam, nachdem alles vorbei war?«
Irritiert sah ich auf. Diese quengelnde Stimme gehörte Holgar, einem Händler aus Losaar. Er war einer der weniger angenehmen Zeitgenossen hier im Raum. Ich wusste nicht, wie oft er schon erzählt hatte, dass er nun ruiniert sei, dass jener Sturm ihn seine Existenz gekostet habe, der Pass vor der Zeit geschlossen worden sei und dass es nur recht und billig wäre, gestände man auch ihm einen Teil des Schatzes zu, den wir unter dem alten Gasthof gefunden hatten.
Die Blicke, die er auf diesen Vorschlag hin erhalten hatte, brachten ihn wohl dazu, seine Taktik zu ändern. Ich fragte mich insgeheim, wie lange es wohl noch dauern mochte, bis ihn jemand draußen vor dem Tor im Schnee fand. Tiefgefroren.
Astarte lehrt uns, dass es nicht weise ist, einem anderen Menschen Unglück zu wünschen, aber Holgar, so fand ich, konnte die Geduld eines Heiligen strapazieren. Heilige indes waren schwer zu finden – und schon gar nicht im Hammerkopf.
Jetzt versuchte er schon seit einiger Zeit, Misstrauen gegen den einzigen Gast zu schüren, der diesen verheerenden Eissturm nicht erlebt hatte. Er sprach von Kennard, einem Mann mittleren Alters, Geschichtsgelehrtem und Geschichtenerzähler. Was Holgar ihm zum Vorwurf machte, war, dass er, kurz nachdem der Sturm abgeflaut war, hier erschienen war. Und dass er, nach Holgars gelehrter Meinung, zu viel über das Alte Reich wusste.
»Warum fragt ihn niemand, woher er kommt? Und vor allem, wie er es durch den Sturm geschafft hat. Du, Maria, ich will noch einen Wein!«
Mit einem Seufzer legte ich das Schnitzmesser zur Seite. Ich wollte nicht riskieren, dass sich mein Ärger im Holz niederschlug.
Maria, eine der Töchter des Wirts, warf ihm einen halb geduldigen, halb amüsierten Blick zu. Ich bewunderte sie ob ihrer Ruhe, als sie gemessenen Schritts zu seinem Tisch ging und ihm Wein nachschenkte. Mit verkniffener Miene nahm er einen Schluck und sah sich zornig um. Es schien, als ob er keine Anhänger finden würde, denn niemand saß mehr an seinem Tisch, selbst jene nicht, die ihm zuvor als Wächter gedient hatten. Also führte er, vom Wein beflügelt, ein Gespräch über die Tische hinweg, während die anderen sich redlich bemühten, ihn zu ignorieren.
Als ich zu ihm hinübersah, bemerkte er es wohl, denn sein Blick fiel nun auf mich.
»Ha! Ein Held wollt Ihr sein … Doch Ihr lasst Euch an der Nase herumführen wie eine Sau! Aber das ist ja wohl passend, nicht wahr, Schweinehirte?«
Ich stand auf. Im Lauf eines langen Lebens hatte ich etwas Geduld gelernt. Etwas, nicht viel. Vielleicht auch etwas Weisheit. Da mir nun die Geduld ausging und meine Weisheit mir riet, ihn nicht zu erschlagen, suchte ich Abstand zwischen mich und sein Geplärre zu bringen.
Meine Atemfahne stand vor mir in der Luft, als ich die Tür zum Hof öffnete. In den Schnee waren Gänge gegraben worden, die zum Brunnen in der Mitte des Hofes, zur Schmiede und zu den Stallungen führten. Und zu dem eingeschneiten Tor, genauer gesagt, zu einer Mannpforte darin.
Wer die Geschichte des Hammerkopfs nicht kannte, mochte sich vielleicht ein wenig über den wehrhaften Charakter des Gasthofs wundern. Aber er war nicht immer ein bloßer Gasthof gewesen, sondern ein Depot für eine ganze Armee: die Armee des Alten Reiches im Nordwesten, die ausgezogen war, um dieses Land von den Barbaren zu befreien.
Fast tausendzweihundert Männer waren zu Zeiten unserer Ahnen von hier aus losmarschiert, um das Land zu befrieden, und nicht einer kehrte je in seine Heimat zurück.
Ohne darüber nachzudenken, lenkte ich meine Schritte hinüber zu der Mannpforte. Jenseits des Tores führte der Gang im Schnee zu einem kleinen Hügel. Dort hatten wir nach dem Sturm die Toten begraben, mit ihnen auch neun Soldaten jenes Alten Reiches, deren Leichen wir tief unter dem Gasthaus gefunden hatten.
Es war nicht meine Absicht zu lauschen. Es ging ein leichter Wind, und dieser trug Eiskristalle über den in den Schnee gegrabenen Gang, sodass ein ständiges Knistern und Rascheln meine Schritte übertönte. Dennoch waren die Worte deutlich zu verstehen.
»Ihr habt leicht reden, Meister Kennard. Für Euch ist das dunkle Imperium, das verfluchte Thalak, nicht mehr als ein Fleck auf einer Landkarte. Für mich hingegen ist es ein unerbittlicher Feind, und mein Plan war es, Hilfe zu finden. Hilfe von jenem, der unsere Vorfahren einst hierher schickte, um seine eigene Macht zu festigen.«
»Es tut mir leid, Maestra, aber ich sagte Euch schon, Askannon gab seinen Thron schon vor Jahrhunderten auf. Das Reich Askir existiert nicht mehr, es ist zerfallen in sieben Königreiche, die sich kaum mehr ein Imperium nennen können.«
Leandra lachte bitter. »Seht Ihr nicht die Ironie, Meister Kennard? Dieser verfluchte Knotenpunkt der Magie unter unseren Füßen ist der Grund, warum unser Land besiedelt wurde! Um ihn zu schützen, brachte dieser machthungrige Magier Askannon unsere Vorfahren ins Land. Zugleich ist dieser Ort aber auch die Saat unserer Vernichtung, denn Thalak will nichts anderes als die Macht, die zu unseren Füßen schlummert.«
»Ich weiß das wohl, Sera«, entgegnete ihr die ruhige Stimme Kennards, des Mannes, der sich den Unwillen Holgars zugezogen hatte. Es war die Stimme eines Geschichtenerzählers, klar und weich, eine Stimme wie ein guter Wein. Man konnte sie endlos lange genießen. Vielleicht hatte auch er seine Stimme als einen Dank der Feen erhalten. Wie Sieglinde.
Sieglinde, die älteste Tochter des Wirts, war wohl die Person, die sich durch die Geschehnisse der letzten Wochen am meisten verändert hatte. Nicht nur, dass in ihr das Erbe der Feen erwacht war, sie trug auch den Geist eines jener Soldaten aus längst vergangener Zeit in sich. Zwar sagte Sieglinde, dass dieser sie schon fast verlassen habe, wie es versprochen war, doch hatte er Dinge zurückgelassen: Wissen, Reife und Selbstsicherheit. Täglich übte sie nun mit Janos, einem anderen Überlebenden, den Schwertkampf und wurde von Tag zu Tag besser darin. Was nicht verwunderlich war, wenn man bedachte, dass sie vom Anführer der Truppe das Bannschwert Eiswehr geerbt hatte. Vor vielen Jahrhunderten hatte der Sergeant das erste Mal versucht, die Macht des Eiswolfs zu brechen. Auch damals hatte ein magischer Eissturm dieses Land heimgesucht.
»Aber es ist noch kein Grund, alle Hoffnung fahren zu lassen«, fuhr Kennard fort und riss mich aus meinen Gedanken.
»Ach? Ist es nicht?« Leandras Stimme klang hart. So hart, wie ich sie noch nie vernommen hatte.
»Ihr seid eine Maestra. Warum nutzt Ihr nicht die Macht der Magie dort unten?« Die Frage weckte erst recht meine Aufmerksamkeit. Es lag eine seltsame Spannung in den Worten.
Leandra lachte bitter. »Ihr solltet es besser wissen. Diese schlafende Macht würde mich verhöhnen. Sie verspricht Rettung für unser Land, aber würde ich auch nur wagen, sie zu berühren, würde sie mich verbrennen, noch schneller als Balthasar brannte! Und selbst wenn ich es könnte, ich würde es dennoch nicht wagen, denn eine solche Macht ist nicht für mich bestimmt. Ich bin nicht weise genug.«
Kennard lachte leise. »Und dadurch zeigt Ihr Eure Weisheit, Maestra.«
Ich wollte mich gerade zu erkennen geben, als Leandra weitersprach. »Weisheit? Was nützt sie mir? Aber ich bin selbst schuld. Ich war eine Närrin, meine ganze Hoffnung auf einen Haufen Ruinen zu stützen!«
»Was für Ruinen, Maestra?«, fragte Kennard überrascht.
»Die Ruinen von Askir, welche denn sonst.«
»Ich sprach nicht von Ruinen, Sera. Askir existiert noch. Das Reich wurde zwar aufgegeben, aber die imperiale Stadt blüht und gedeiht noch immer.«
Ich räusperte mich und trat um die Ecke. Leandra und Kennard standen vor dem Denkmal, das wir den tapferen Soldaten des Alten Reiches gesetzt hatten. Kennard war gekleidet in ein Gewand aus Leinen und darüber einen langen Mantel mit Kapuze. Bis auf einen kleinen Dolch in seinem Gürtel und einen stabilen Wanderstab mit stählernen Beschlägen war er unbewaffnet. Er nickte mir grüßend zu, während Leandra ihn noch immer fassungslos ansah. Dann drehte sie ihren Kopf langsam zu mir.
»Hast du das gehört, Havald? Kennard sagt, die Stadt existiert noch!« Ich ging auf sie zu und ergriff ihre Hand. Sie drückte sie mit überraschender Kraft und schenkte mir einen Blick, bei dem mir warm wurde. Dann wandte sie sich wieder an Kennard. »Was soll mir das nützen? Das Imperium ist vergangen, so habt Ihr uns selbst berichtet.«
Kennard nickte. »Ja, aber die sieben Königreiche stehen in einer Allianz. Sie sind zerstritten, jedes königliche Haus sucht seinen eigenen Vorteil, aber alle zusammen bilden sie das, was einst das Imperium war. Und fände sich jemand, der die Häuser dazu bewegen könnte, ihre kleinlichen Streitereien aufzugeben, wären sie sehr wohl in der Lage, Eurem Land zu helfen. Vielleicht besser noch, als Askannon es gekonnt hätte. Es wird sich auch eine Gelegenheit dazu ergeben, wenn Ihr sie nur zu nutzen versteht.«
»Von welcher Gelegenheit sprecht Ihr, Meister Kennard?«, fragte Leandra mit Hoffnung in den Augen.
»Einmal alle sieben Jahre, zum Frühlingsfest, treffen sich die sieben Königreiche zu einer Kronratssitzung. Diese währt drei Wochen oder länger.« Er schien amüsiert. »Denn bevor sie die Sitzung beenden können, müssen sie einen Konsens erarbeiten. Das dauert manchmal seine Zeit.«
»Einen Konsens?«, fragte ich. »Ich hatte einmal das Pech, anwesend zu sein, als ein Staatsvertrag geschmiedet wurde. Kein Hofnarr hätte eine bessere Posse erfinden können. Mir scheint oft, dass eine Krone nicht nur aufs Haupt, sondern auch auf den Verstand drückt. Vier Wochen stritt man sich darum, wem nun eine bestimmte Insel gehörte. Kein Schaf hätte auf diesem Felsbrocken leben wollen. Er war kaum größer als ein Schiff.«
»Ein Schiff kann sinken«, gab Kennard zu bedenken. »Ein solcher Brocken nicht. Je nachdem, wo er liegt, mag er von Wichtigkeit sein.«
Ich lachte. »Mitten im Nirgendwo, im Meer der Stürme. Ich hörte, dass die Kartografen des Königs ihn einen Mond lang suchen mussten, bevor sie ihn fanden. Meine Frage lautet: Wer hindert diese Könige daran, das Übliche zu tun und ihren Streit mit Stahl zu schlichten?«
Kennard sah mich an, und sein Grinsen wurde breiter. »Sie haben Angst, dass Askannon zurückkehrt. Als er abdankte, verfügte er, dass dieser Kronrat abgehalten wird, und drohte zurückzukehren, wenn sie sich nicht an dieses Edikt hielten.«
»Und sie tun es?«
»In gewisser Weise«, sagte Kennard, und sein Gesicht wurde wieder ernst. »Es ist kein offener Krieg, aber oft leiden die Delegationen an seltsamen Krankheiten, oder es treten andere widrige Umstände auf. Bei der letzten Sitzung erstickte der König von Northgart an einem Apfel.«
»Ich verstehe«, sagte Leandra. »Solcherart Diplomatie kenne ich nur zu gut. Wann findet der nächste Kronrat statt?«
»Nächstes Jahr zum Frühlingsfest.«
»Das sind weniger als vier Monate! Und der Pass ist verschlossen!«, rief sie enttäuscht.
Es tat mir weh, die Hoffnung aus ihren Augen schwinden zu sehen. »Wir werden es nie schaffen«, fuhr sie leiser fort. Doch dann lächelte sie schief. »Es wäre wohl ohnehin vergeblich gewesen. Ich stelle mir vor, wie ich vor diesen gekrönten Häuptern stehe und versuche sie zu überzeugen, uns beizustehen … Es wäre wahrscheinlich misslungen.« Sie ballte die Hand und drückte damit die meine noch fester. »Aber, bei den Göttern, ich hätte es gern versucht. Selbst wenn sie mich zehnmal ausgelacht hätten.«
Der Gelehrte schüttelte den Kopf. »Niemand hätte Euch ausgelacht, Maestra. Viele Dinge sprechen für Euch. Zum einen tragt Ihr das Blut von Elfen in Euren Adern, Elfen sind in Askir hoch geachtet. Und Ihr tragt ein Bannschwert – Steinherz. Allein der Anblick dieses Schwertes garantiert, dass man Euch anhören wird.«
»Aber ich komme unmöglich rechtzeitig dorthin! Und in sieben Jahren ist es zu spät. Dann sind wir bereits verloren.«
Kennard nickte zögernd. »Es widerstrebt mir, Euch zustimmen zu müssen, Maestra. Ich hätte Euch gern geholfen.«
»Vielleicht kannst du es doch, Geschichtenerzähler.« Diese leise Stimme gehörte Zokora, einer der seltsamsten Gefährtinnen, mit denen ich jemals in den Kampf gezogen war.
Als Zokora so unerwartet hinter ihm erschien und in das Gespräch eingriff, wirbelte Kennard herum, die Beine gespreizt, die Arme nach vorn haltend, die rechte Hand flach ausgestreckt, seinen Stecken unter dem linken Arm in der Achselhöhle verankert und weit zur Seite gezogen.
Zokora grinste zufrieden.
Anders als Leandra war sie eine reinrassige Elfe, allerdings gehörte sie zu dem Stamm, mit dem man kleine Kinder erschreckte. Dunkelelfen. Und wurden diese Kinder irgendwann erwachsen, hatten sie allen Grund, darum zu beten, niemals ihrem Albtraum gegenüberstehen zu müssen. Die Wahrheit war schlimmer als die Ammenmärchen.
Hier und heute war die Dunkelelfe in ein dunkles Gewand gekleidet und wirkte verhältnismäßig normal, bis auf die Farbe ihrer Haut, die dunklem Mahagoni glich. Sie war gut einen Kopf kleiner als Leandra und zierlich. Wenn man sie so ansah, konnte man sich leicht fragen, wieso man vor ihr Angst haben sollte. Ich jedoch hatte sie erst kürzlich in ihrem Element gesehen, unten in den eisigen Höhlen, wo nie ein Sonnenstrahl hinreichte. Da war ihr Lächeln blutig gewesen, ihre Augen wie rotglühende Kohlen. Sie hatte dem Nekromanten Balthasar länger widerstanden als jeder andere von uns. Ich wusste, dass sie zu der Grausamkeit, von denen jene Ammenmärchen berichteten, fähig war. Noch verwunderlicher als ihre Anwesenheit auf der Erdoberfläche war jedoch die Tatsache, dass sie und Leandra sich gut verstanden. Aber Zokora tat nie etwas ohne Überlegung oder tiefere Absicht. Auch in diesem Moment wollte sie eine Reaktion Kennards herbeiführen. Dies war ihr ja auch gelungen.
Leandra und ich sahen den zur Abwehr bereiten Geschichtsgelehrten überrascht an, während Zokora den Mann mit einer gewissen Genugtuung musterte. »Ich habe schon häufiger gehört, dass es einem erfahrenen Stockkämpfer möglich sein soll, einen Schwertkämpfer zu besiegen«, sagte sie und zog eine Augenbraue hoch. »Bist du vielleicht doch nicht ganz so harmlos, wie du tust?«
»Verzeiht, Zokora«, sagte Kennard und nahm seine alte Haltung wieder ein, entspannt auf seinen Stock gestützt. »In den Jahren meiner Wanderschaft musste ich notgedrungen lernen, mich zu verteidigen. Ich fürchte, Ihr habt mich erschreckt.«
Zokora legte den Kopf auf die Seite. Mir fiel ein, dass dies dem Schulterzucken bei einem Menschen gleichkommen sollte, aber manchmal machte sie diese Geste auch, wenn sie etwas studierte. In diesem Fall Kennard.
»Überrascht ist das bessere Wort.«
»Auch das, ja. Ich habe Euch nicht kommen gehört.«
»Das war Absicht.« Zokoras Lächeln wurde breiter. »Meinst du, wir könnten einen freundschaftlichen Waffengang wagen? Ich habe noch nie gegen einen Stockkämpfer gefochten.«
Kennards Augen funkelten, und wenn ich mich nicht täuschte, las ich Amüsement und Vorfreude darin. »Ich stehe Euch gern zur Verfügung, wenn Ihr mir die Bedeutung Eurer Bemerkung erläutert. Wie soll ich Maestra de Girancourt helfen können? Gäbe es dazu eine Möglichkeit, hätte ich sie schon ergriffen.«
»Erzähl ihr von den magischen Toren. Wir wissen, dass sich eines hier im Hammerkopf befindet. Vielleicht kann man ein solches Tor verwenden, um nach Askir zu gelangen.«
Kennard sah sie einen Moment lang an, dann verzogen sich seine Lippen zu einem Lächeln. »In der Tat, vielleicht findet sich so ein Weg. Aber sagt, Zokora, warum tut Ihr das und lasst Euch in die Geschicke von Halbelfen und Menschen verstricken?«
Zokora musterte ihn noch immer. »Havald versuchte vor ein paar Tagen, mir diese so genannte Freundschaft zu erklären, welche die Menschen so hoch schätzen. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist das ein kurioses Ding, frei von Eigennutz. Ich übe gerade.«
»Wisst Ihr denn auch über die Tore Bescheid?«, wollte nun Leandra von Kennard wissen.
Kennard griff mit der Hand unter seinen Mantel, und als er sie wieder herauszog, hielt er eine Pfeife darin. Eine gute Idee, fand ich, und nahm meine eigene Pfeife heraus. Zokora sah uns beide an und rümpfte die Nase, was bei Kennard wiederum ein kurzes Schnauben hervorrief.
Hier draußen war der Schnee beinah doppelt mannshoch. Mittlerweile ging ein recht kräftiger Wind, der die Flocken in schillernden Eiskaskaden über unsere Köpfe trieb, ein funkelndes Spektakel, das hier unten im windgeschützten Gang fast ein behagliches Gefühl auslöste. Es war noch immer kalt, aber das schreckte uns nicht. Nicht mehr.
»Nun«, begann Kennard mit der ruhigen Stimme des Erzählers, als er seine Pfeife bedächtig stopfte, »ein paar Dinge habe ich über diese Tore zu sagen. Sie waren einer der Schlüssel zur Macht des Imperators. Durch sie konnte er innerhalb von wenigen Momenten seine Truppen im ganzen Reich bewegen, sie entsetzen, verstärken und versorgen. So wichtig sie auch für ihn waren, sie bargen doch eine Gefahr für das Reich. Denn sobald ein Feind ein solches Tor in Besitz nahm, wäre es ihm vielleicht möglich gewesen, die stolzen Mauern der Reichsstadt zu umgehen und so mit einem Schritt ins Herz des Imperiums vorzudringen. Es ist nicht bekannt, ob der Kaiser imstande war, die Tore zu deaktivieren. Fast scheint es, als sei dies nicht der Fall gewesen, denn er unternahm große Anstrengungen, sie zu schützen. Dieser Schutz, so weiß ich heute, war mehrfach gestaffelt. Zum einen befanden sich die Tore selbst, bis auf wenige Ausnahmen, an geheimen Orten. Diese Orte waren wiederum durch starke Mauern und manchmal auch Fallen geschützt oder wurden durch Magie oder anderes bewacht. Oft lagen sie zum Beispiel im Kern eines Labyrinths. Der nächste Schutz war der Schlüssel zu den Toren selbst. In den meisten Fällen findet man in einem alten imperialen Tor ein silbernes oder goldenes Achteck in den Boden eingelassen. In seinen Eckpunkten befinden sich Vertiefungen, welche die so genannten Torsteine aufnehmen, ebenso im Zentrum des Achtecks. Jemand, der die Geheimnisse der Tore kannte, legte acht von zehn Torsteinen in einer bestimmten Reihenfolge in die Vertiefungen und zum Schluss den neunten in das Zentrum. Damit wurde dann das Tor aktiviert und alles, was sich innerhalb des metallenen Bandes befand, wurde fortgeschafft. Ragte etwas über dieses Band heraus, wurde es abgetrennt wie von der schärfsten aller Klingen, ob es nun aus Stahl war, Holz oder lebendigem Fleisch. Die Steine jedoch, die verwendet wurden, um das Tor zu bedienen, blieben zurück. Kam man im gewünschten Zieltor an, lagen dort andere Steine in den Vertiefungen, folgten einem anderen Muster, führten weiter zu einem anderen Tor. Es ist zu vermuten, dass es auch Tore gibt, die in Sackgassen enden.«
Er zog an seiner Pfeife, bis die Glut griff und eine Rauchwolke nach oben stieg, wo sie vom Eiswind verweht wurde. Auch meine Pfeife brannte, und ich meinte schon die Wärme des Pfeifenkopfs zu spüren.
»Nicht nur, dass man neun von zehn Steinen in der richtigen Reihenfolge auslegen musste, der Anfang dieser Reihenfolge war auch bei jedem Tor anders. Mal zählte man von der Tür zum Torraum aus, mal ging es links herum, mal rechts, manchmal wurde eine Farbe doppelt gelegt, mal blieb einer der Schlüsselpunkte leer. Ihr seht, wenn man nicht genau wusste, wohin man wollte, und die notwendigen Muster nicht kannte oder verstand, führte einen ein solches Tor überall hin, vielleicht sogar ins Nichts. Auf jeden Fall nicht dorthin, wo man hinwollte. Wie man sich denken kann, wurde das Geheimnis dieser Kombinationen streng gehütet. Nur auserwählte Personen erhielten die Schlüssel, und oft nur solche, die sie unmittelbar benötigten. Die Anführer der Clans waren solche Personen, sie erhielten so genannte Torbücher, Bücher, die selbst magisch waren und dem Imperator vielleicht sogar meldeten, welche Tore benutzt wurden.« Er sah Leandra an. »Ihr braucht also nicht nur das Wissen um ein Tor, das Euch Eurer Bestimmung näher bringt, Ihr braucht auch die Torsteine. Selbst mit ihnen könntet Ihr nur einen Schritt auf diesem Weg tun, denn obwohl man mittlerweile das eine oder andere magische Tor gefunden hat, ist man nie auf irgendwelche Torsteine gestoßen. Es heißt, Askannon habe sie alle eigenhändig eingesammelt, bevor er seinen Thron aufgab.«
»Mist«, sagte ich. »Ich dachte schon, wir hätten einen Weg gefunden. Aber uns fehlt das Anordnungsmuster.«
»Und die Steine«, bemerkte Kennard.
Ich lachte. »Wir haben Steine. Mehr als einen vollen Satz, fünfundzwanzig Stück. Ein Geschenk des Sergeanten.«
Kennard pfiff leise durch die Zähne. »Er hat sie unter Verschluss gehalten? Kein Wunder, dass Balthasar hier gefangen war. Aber Ihr braucht immer noch ein Tor.«
»Eberhard fand unter dem Innenhof eine Halle. Dort befindet sich ein solches Tor. Wenigstens denke ich, dass es eins ist, es entspricht Eurer Beschreibung. Ein goldenes Band, gut zwei Daumen breit, ausgelegt in der Form eines Achtecks.«
»Wie groß ist es?«, fragte Kennard.
Ich sah Leandra fragend an. Sie hatte sich das Achteck näher angesehen. »Bestimmt zwanzig Fuß im Durchmesser«, sagte sie.
»Dann ist es ein Tor, das für Fracht bestimmt ist. Die Steine, habt Ihr sie dabei?«
Ich zögerte einen Moment, dann zog ich den Beutel hervor, entnahm ihm einen der Steine und hielt ihn hoch. Er war blutrot und funkelte trotz des trüben Lichts, als ob er eine Flamme in sich barg. Allein durch seine Größe war er von unschätzbarem Wert, doch als Schlüssel zu magischen Toren gänzlich unbezahlbar.
Kennard musterte ihn kurz und nickte dann. »Das sind Steine für ein kleineres Tor. Die Steine der Frachttore waren größer, fast faustgroß. Ich fürchte, Ihr müsst für diese erst ein passendes Tor finden.«
»Faustgroß?«, fragte ich überrascht. »Wo gibt es denn solche Steine?«
»Es heißt, er habe sie erschaffen«, antwortete Kennard. »Wie dem auch sei, Ihr braucht die richtigen Steine.«
»Und das Muster«, sagte Zokora. Sie funkelte Kennard herausfordernd an.
»Ihr traut niemandem, nicht wahr?«, fragte Kennard.
»Zumindest niemandem, der mir achtlos die Erfüllung meines größten Wunsches prophezeit. Du bist mir immer noch eine Erklärung schuldig.«
Vor wenigen Tagen hatte Kennard der dunklen Elfe fast nebenbei die Geburt von Zwillingstöchtern vorausgesagt, für Dunkelelfen ein Zeichen von besonderer Gunst ihrer Götter.
»Nein, bin ich nicht.« Kennard hob sein Kinn und sah Zokora eisig an. »Nehmt es als ein Geschenk. Sofern Ihr auf Euch achtet, werdet Ihr in zweiundzwanzig Monden Mutter zweier Töchter werden. Und wählen müssen. Zwischen Euch, Euren Töchtern und Eurem Volk.«
Zokora sah ihn eine Weile an. Es schien mir, als gingen Blitze zwischen diesen Augenpaaren hin und her. Überraschenderweise war es Zokora, die zuerst den Blick senkte.
Kennard wandte sich wieder mir zu. »Der Sergeant gab Euch mehr als die Steine. In seinem Logbuch vermerkte er drei Anordnungsmöglichkeiten und auch einen Hinweis auf den Ort, wo Ihr das Tor finden könnt.«
Ich erinnerte mich wieder an das geisterhafte Zusammentreffen mit den Soldaten des Ersten Horns. Der Sergeant hatte von mir Besitz ergriffen, und meine eigenen Hände hatten das Logbuch von seinem gefrorenen Körper genommen. Seitdem trug ich es stets bei mir, auch wenn ich es nicht lesen konnte. Es war in einem Code geschrieben. Aber Kennard verstand die Schrift und den Code.
Auch wenn es mir gegen den Strich ging, Holgar hatte in gewisser Weise recht. Solange ich Kennard nicht vertrauen musste, konnte es mir zwar einerlei sein, doch es gab durchaus die eine oder andere offene Frage zu ihm. Wie war er wirklich zum Hammerkopf gekommen? Ich war mit an der Tür gewesen, als ihm Eberhard, der Wirt, Einlass gewährte. Außer einer dünnen Frostschicht auf seiner Kleidung wies nichts darauf hin, dass er sich tagelang zu Fuß durch den Schnee gekämpft haben sollte. Und wenn er auch – bis auf seine Prophezeiung zu Zokoras ungeborenen Kindern – bisher noch kein einziges Mal magisches Talent gezeigt hatte, war ich mir dennoch sicher, dass er mehr war als ein einfacher Geschichtenerzähler oder Gelehrter.
»Ist das alles, was du uns über die Tore sagen kannst?«, fragte Zokora.
Kennard sah sie an, und wieder spielte dieses leichte Lächeln um seine Mundwinkel. Er nickte.
Zokora ging in einer einzigen schattenhaften Bewegung auf. Ich sah den Stahl ihres Schwertes glitzern, als sie Kennard ansprang, dann ertönte ein Stakkato von metallenen Schlägen auf hartem Holz.
Ich wusste nicht, was beeindruckender war, die Schwertarbeit der Dunkelelfe, die ich bislang nicht hatte studieren können, oder die scheinbar gelassenen Doppelkreise, welche die Enden von Kennards Stock beschrieben.
Leandra und ich tauschten einen Blick, als wir gemeinsam zurückwichen. Auch sie war sich nicht sicher, ob die Dunkelelfe wirklich einen freundschaftlichen Waffengang meinte. Wir hatten beide die Hände am Knauf unserer Schwerter, doch gegen wen hätten wir kämpfen sollen oder wollen?
So abrupt wie der Kampf begonnen hatte, endete er auch. Nach einem heftigen Schlag flog Zokoras Klinge an mir vorbei, die Spitze zuerst, um tief im Schnee hinter mir zu versinken. Zokora atmete schwerer als zuvor, aber man konnte nicht behaupten, dass sie außer Atem war. Kennard hingegen stand der Schweiß auf der Stirn, und seine Brust hob und senkte sich in mächtigen Atemzügen.
»Bist … du … nun … zu … frieden?«
Zokora legte den Kopf auf die Seite. Dann nickte sie. »Ich denke, meine Fragen sind beantwortet.«
»Welche … Fragen?«
Sie lächelte. »Ich werde dir meine Fragen nennen, wenn du mir meine Antwort gibst.«
Kennard lachte kurz. »Es gibt … Fragen, auf die … kann ich … verzichten.« Er deutete vor mir und Leandra eine kurze Verbeugung an, drehte sich um und ging.
Wir warteten einen Moment, ich ging sogar so weit, nachzusehen, ob er nicht doch im Schneegang stehen geblieben war, und lauschte.
»Warum habt Ihr das getan, Zokora?«, brach Leandra das Schweigen.
»Es ist, wie ich sagte: Ich wollte Antworten auf meine Fragen.«
»Und – habt Ihr sie?«
»Wie lange ist es her, dass dich jemand im Schwertkampf besiegte?«, kam ihre überraschende Gegenfrage an mich.
Ich zuckte mit den Schultern. »Lange.«
»Könntest du mich besiegen?«
»Was soll das, Zokora? Ich habe nicht die Absicht, mit Euch zu kämpfen.«
»Beantworte meine Frage.«
Ich seufzte. »Das weiß ich nicht. Ich weiß es nie vorher, hinterher bin ich meistens überrascht, dass ich noch lebe.«
»Ich habe gesehen, wie du dein Schwert führst. Ich denke, es käme auf die Umstände an. Du hast keine Finesse. Dein Stil ist fürchterlich. Das ist nicht deine Schuld, all die angeblich so perfekten Schwertkämpfer, die deine Klinge vorher führten, haben dir nichts als Fehler beigebracht. Aber du hast ihre Erfahrung, ihren Willen und ihre Unterstützung. Wenn du dein Bannschwert führst, kann es sein, dass du gewinnst. Führst du eine gewöhnliche Klinge, gewinne ich.«
Das war ganz meine Rede: Ich war kein Held oder Schwertmeister. Ich hatte meine Klinge weder gewollt noch verdient. Es war Zufall oder ein Fluch Soltars. Aber dennoch muss ich zugeben, dass ich ob dieses Vorwurfs etwas pikiert war.
»Und was wollt Ihr jetzt damit sagen?«
»Kennard hat mich mühelos geschlagen. Er spielte mit mir, dann, als er außer Atem kam, beendete er es. Die Schlagfolge, die mir mein Schwert aus der Hand schlug, hatte einen zweiten Teil. Das Ende seines Stabes hätte mein Zentrum«, sie tippte sich an die Brust, »zerstört. Er hielt den Schlag zurück, sodass ich nur eine leichte Berührung spürte.«
»Ihm ging schnell die Luft aus«, versuchte ich zu beschönigen.
Zokora warf mir einen mitleidigen Blick zu. »Dir wäre vorher das Leben ausgegangen, Havald.« Sie streckte die Hand aus, und ihr Schwert kam aus dem Schnee zu ihr. Sie schob es in die Scheide. »Kein sterblicher Mensch sollte im Stande sein, mich im fairen Kampf zu besiegen. Er aber ist es.« Sie blickte nachdenklich in die Richtung, in die Kennard verschwunden war. »Ich frage mich nur, wie es in einem unfairen Kampf aussieht.«
Damit drehte auch sie sich um und ging, ließ Leandra und mich allein an den Gräbern zurück.
Ich sah ihr nach. »Ich hoffe, sie kommt nicht auf die Idee, es auszuprobieren«, sagte ich dann.
Leandra schmiegte sich an mich und sah zu mir hoch. »So, du hast also versucht, Zokora die Bedeutung von Freundschaft zu erklären?«
Ich zuckte mit den Schultern. »Sie hat danach gefragt.«
Leandra lachte, ich spürte es am ganzen Körper. »Wie wolltest du ihr das denn anhand unserer Freunde erklären?«
2. Das Maß der Vernunft
Als Leandra und ich in den Gastraum zurückkehrten, hießen uns die prasselnden Feuer in den beiden Kaminen an den Längswänden willkommen. Holgar saß an seinem Tisch und murmelte irgendetwas in seinen Becher. An einem anderen Tisch saßen Janos und Sieglinde, zusammen mit Zokora und Varosch, der sorgfältig Zokoras Schwert polierte. Torim, ein Bergarbeiter, und Ulgar, ehemals eine Wache Holgars, saßen auch dabei. Sie spielten Würfel um einen Einsatz aus Kupferpfennigen. Hinter der Theke stand Eberhard auf einem Schemel und wischte die Oberseite der Fässer hinter der Theke ab, während Maria die Tische putzte.
Kennard saß an dem Tisch, den Leandra und ich gern benutzten. Als wir hereinkamen, sah er auf und lächelte.
»Maria, Tee für uns alle«, sagte er zu der Tochter des Wirts. Sie lächelte ihm zu, nickte und eilte in die Küche. Kaum dass wir uns gesetzt hatten, war sie schon wieder zurück und brachte auf einem Tablett eine irdene Teekanne und drei Schalen.
Als ich Kennard das erste Mal gesehen hatte, war er mir als ein Mann erschienen, der wohl gut und gern drei Dutzend und zehn Jahre erlebt hatte. Er war groß und schlank, besaß die Schultern eines Athleten und die Bewegungen eines Tänzers. Wie schon häufiger dachte ich beim Anblick seines Gesichts, dass ich ihm schon einmal irgendwo begegnet war, aber noch immer fiel mir nicht ein, wo.
Sein Haar hatte die Farbe von altem Eis und obwohl voll, war es militärisch kurz geschnitten, seine grünen Augen waren aufmerksam und funkelten oft amüsiert. Tiefe Lachfalten strahlten aus den Winkeln seiner Augen, die Nase hätte zu einem Adler gepasst, und das energische Kinn mit seinem schmalen Mund machte das Ganze zu einem Gesicht, das Energie und Durchsetzungsvermögen zeigte. Dennoch war es glaubhaft, dass er ein Gelehrter war: Die Spitzen der Finger seiner linken Hand waren eingefärbt mit Tinte, und er schrieb viel in eines seiner Bücher.
Ein seltsamer Mann, dieser Kennard. Aber er war mir sympathisch, und er lachte gern und häufig.
»Ihr schnitzt gerade die Königin?«, fragte er und deutete auf das Stück Holz, das ich auf dem Tisch zurückgelassen hatte.
»Könnt Ihr sie schon erkennen?«, fragte ich ihn, während Leandra vorsichtig die grobe Figur aufnahm und von allen Seiten betrachtete.
»O ja«, sagte er lachend und sah bedeutsam von mir zu Leandra.
»Hast du mich als Modell gewählt?«, fragte Leandra.
»Welch besseres Modell könnte ich finden«, sagte ich und deutete im Sitzen eine galante Verbeugung an.
»Wer wird die schwarze Königin?«
»Da fragt Ihr noch?« Kennard warf einen Blick hinüber zu Zokora. »Da gibt es wohl wenig Auswahl.« Er zog an seiner Pfeife. »Wenn Ihr wollt, übersetze ich Euch nun gern die Passage mit der Beschreibung des Tores und der Muster, die es braucht, um aktiviert zu werden.«
»Denkt Ihr, wir können es noch benutzen nach der langen Zeit?«, fragte Leandra.
Kennard verzog abschätzend das Gesicht, während ich vorsichtig das Logbuch aus meinem Wams holte. »Vieles von dem, was Askannon erschuf, ist noch immer wirksam. Warum nicht auch die Tore? Wissen kann es niemand, denn außer Euch besitzt niemand mehr die Steine, um es herauszufinden.«
Er nahm das Logbuch mit einer Ehrfurcht entgegen, die zu dem Respekt eines Gelehrten gegenüber alten Dokumenten passte, aber noch öffnete er es nicht, sondern ließ lediglich die flache Hand auf dem alten Leder ruhen.
»Zwei Dinge solltet Ihr noch wissen, Havald. Als Askannon seine Krone niederlegte, übertrug er die Regierung der alten imperialen Stadt auf den Kommandanten der Bullen, den Herzog. Dieser ist sein Statthalter und regiert immer noch nominell im Namen des Imperators. Wenn Ihr Euer Ziel erreicht, würdet Ihr großes Wohlwollen ernten, gebt Ihr ihm dieses Buch.« Er sah Leandra ernst an. »Das andere betrifft zum größten Teil Euch, Maestra. In den sieben Königreichen ist die Verwendung von Magie oft verpönt. Ihr habt gesehen, was Balthasar mit dem Bergarbeiter tat, als er ihm die Seele raubte. Es ist schwer, zwischen sauberer Magie und den dunklen Künsten eines Nekromanten zu unterscheiden. Die Menschen in den sieben Reichen fanden eine einfache Lösung: Sie verbrennen gern jeden, der ansatzweise magische Fähigkeiten besitzt. In vier der sieben Reiche ist das Wirken von Magie verboten und führt zum Scheiterhaufen.«
»Und in der imperialen Stadt?«
Kennard lächelte. »Auch dort begegnet man Magie mit Misstrauen, wird sie aber kaum verbieten können. An der Stadt selbst haftet zu viel Magie.«
Wohl war mir bewusst, dass Holgar im Hintergrund die ganze Zeit vor sich hin gebrabbelt hatte, aber wenn er nicht zu laut wurde, war ich fähig, ihn zu ignorieren. Andere wohl nicht, denn das Poltern eines umgestoßenen Stuhls und das Geräusch fallenden Geschirrs hinter mir ließ mich herumfahren.
Varosch war aufgesprungen und hatte den Händler gepackt, die Faust zum Schlag erhoben.
»Ihr seid alle blind!«, rief der Händler und versuchte verzweifelt, sich Varoschs zu erwehren. »Sie hat euch alle behext! Ich sage Euch, es wird Euch genauso gehen wie meinem Freund Rigurd! Auch er lag zwischen ihren Lenden, und seht, was es ihm eingebracht hat!«
Varosch traf den Händler mit der Faust, und dieser taumelte zurück, fiel fast über einen Stuhl. Er wischte sich den blutigen Mund ab und blitzte den Wächter an. »Einen wehrlosen Mann schlagen, ja, das könnt Ihr!«
Varosch trat den Stuhl zur Seite, und Holgar flüchtete hinter einen der großen Tische. »Ja, schlagt mich, schlagt zu, mein Freund, zeigt, wie sie Euren Verstand benebelt und Euer Blut zum Kochen bringt!« Fast gelang es ihm, Varoschs nächstem Schlag auszuweichen, aber nur fast; der Händler schwankte, prallte gegen die Wand und entging mit knapper Not dem folgenden Angriff des aufgebrachten Mannes. Holgars Wange war aufgeplatzt und blutig, Varosch sah aus, als wolle er ihn zu Brei schlagen, aber der Händler schien mir in der Tat wie von Sinnen. Einen wutentbrannten Mann weiter anzustacheln zeugte in meinen Augen nicht gerade von Vernunft. Wenn niemand eingriff, dann konnte das ein übles Ende nehmen. Die meisten anderen waren wohl gewillt, dem Spektakel zuzusehen, Mitleid konnte Holgar ja kaum erwarten. Ich hatte selten jemanden gesehen, der sich leichter die Missgunst anderer zuzog, als diesen Händler. Ich erhob mich, um dazwischenzugehen.
»Seht ihr nicht, dass sie nichts anderes ist als eine Hure? Sie liegt bei jedem, der ihr gefällt, wie eine läufige Hündin«, rief Holgar.
Varosch stieß ein unartikuliertes Knurren aus und wäre Holgar wohl über den Tisch hinweg an den Hals gegangen, hätte ich ihn nicht zwischenzeitlich erreicht und ihn im letzten Moment zurückgehalten.
»Sie ist ein Ungeheuer!«, schrie Holgar lauthals. Der Mann kannte einfach kein Ende. »Seht ihr denn nicht, was sie tut? Dort habt ihr den Beweis!«
Er zeigte mit seiner blutverschmierten Hand in eine Ecke des Gastraums, wo eine Person saß, die wir alle gern übersahen.
Es war eine hübsche Frau, mit langen, geflochtenen braunen Haaren und einem markanten Gesicht. Sie war sorgsam gekleidet und saß aufrecht da, jede Falte ihres Gewands fiel so, wie sie sollte, wie dekoriert. Wie jeder andere von uns versuchte auch ich sie nicht zu beachten, wenn Zokora sie fütterte, wusch und ankleidete, all dies direkt hier im Gastraum. Vielleicht kannte Zokora wirklich kein Schamgefühl, aber ich vermutete, dass es ein subtiler Teil der Strafe war, die Zokora sich für sie ausgedacht hatte.
Diese Frau hatte vor nicht ganz zwei Wochen mit einer Armbrust Zokoras Liebhaber, den Händler Rigurd, erschossen.
Und wäre Zokoras eigener Schuss seinerzeit daneben gegangen, hätte diese Frau mein Leben beendet; ich hatte also ebenfalls wenig Grund, diese namenlose Frau zu mögen. Zokora aber hatte sie genau in dem Moment mit einem Pfeil aus ihrem Blasrohr getroffen, als sie mir die Kehle durchschneiden wollte. Das war während unseres letzten verzweifelten Ansturms auf den unterirdischen Tempel gewesen, wo der Nekromant Balthasar die Magie beschwor, die uns alle getötet hätte.
Niemand von uns wusste, welches Gift Zokora auf ihren Blasrohrpfeil gestrichen hatte, doch seine Wirkung war beängstigend. Wenn Zokora den Arm ihrer Gefangenen anhob, so hielt diese ihn so, stundenlang mitunter, bis Zokora ihn wieder für sie senkte.
Eine lebensgroße Puppe. Das Einzige, was das Gift nicht berührte, waren die Augen. Und vor allem diese Augen machten die Frau so attraktiv: wunderschöne bernsteinfarbene Augen, aus denen Verzweiflung, Angst und Hoffnungslosigkeit einen flehend ansprangen.
Jedes Mal wenn sich Zokora ihrer mit diesem scheinbar liebevollen Lächeln annahm, sie wusch oder neu kleidete, ihr die Haare kämmte oder sie fütterte, konnte man die Stimme der Dunkelelfe hören, wie sie ihrem Opfer genauestens beschrieb, welche Folter bevorstand. Wie andere zog auch ich es vor, nicht anwesend zu sein, wenn sich Zokora um ihre Gefangene kümmerte, dennoch hörte ich oft genug diese leise Stimme. Bis jetzt hatte sich Zokora nicht mit einer Silbe wiederholt. Das, was die Elfe mit solch offensichtlicher Vorfreude und Genugtuung beschrieb, wäre ein schlimmes Ende für jeden Menschen, grausam, aber doch ein unwiderrufliches Ende. Aber Zokora war im Stande zu heilen. Dieser namenlosen Frau, der einzigen Überlebenden aus Balthasars Gruppe, standen Jahrzehnte der Folter bevor. Folter und anschließende Heilung und wieder Folter. Immer wenn ich daran dachte, wurde mir schlecht, zumal ich Zokora jedes Wort glaubte. Doch die Dunkelelfe hatte nicht nur mich darauf hingewiesen, dass sie nach ihrem eigenen Recht handele und uns Menschen auch keine Anweisungen gebe, wie wir mit unseren Gefangenen zu verfahren hätten. Die tiefen Höhlen unter der Erde waren es, welche die Dunkelelfen für sich beanspruchten und als ihr Reich bezeichneten, und dort in den eisigen Tiefen hatte Zokora diese Gefangene gemacht.
Dennoch, mehr als ein Mal hatte ich schon mit dem Gedanken gespielt, die Frau mit einem Dolchstoß zu erlösen.
»Holgar, das gibt Euch nicht das Recht, so über sie herzuziehen«, sagte ich, während Varosch unter meinen Händen um seine Fassung rang. »Sie ist uns nur fremd, wie wir ihr fremd sind«, fügte ich beruhigend hinzu. Doch Holgar war der Vernunft nicht zugänglich.
»Sie hat auch nicht das Recht, Menschen zu versklaven! Bei den Göttern, sie gibt es offen zu! Und seht Varosch hier, einst einer der ruhigeren und besonneneren Männer meiner Wache. Nun ist er außer sich, weil sie ihn zwischen ihre Beine nahm, noch bevor Rigurd in seinem Grab lag. Seht die Mordlust in seinen Augen. Welchen Beweis braucht Ihr noch, dass sie ihn verhext hat?«
Diesmal brauchte ich all meine Kraft, um Varosch zurückzuhalten, doch ohne die Worte der Dunkelelfe wäre es mir vielleicht nicht gelungen.
»Varosch«, erklang Zokoras ruhige Stimme. »Halte ein. Er ist es nicht wert.«
Ich spürte, wie Varosch sich zur Ruhe zwang. Ich sah ihn an. »Kann ich Euch loslassen?«
Er nickte. »Ihr könnt, Ser Havald. Auch wenn ich nichts lieber täte, als dieser gehässigen Krähe den Schnabel zu stopfen.«
Ich nahm meine Hände von seinen Schultern. »Zokora hat recht. Und glaubt mir, es ist nicht weise, sich von solch gehässigen Worten provozieren zu lassen. Ihr folgt nur seinem Spiel, wenn Ihr Euch darauf einlasst. Hört lieber auf Eure Vernunft …«
»Ihr seid wahrlich der Richtige, um so etwas zu predigen. Ihr seid der anderen Elfenhure nicht weniger verfallen als Varosch der seinen!«, brüllte Holgar dazwischen.
Ich glaube, letztlich zog mich Janos von Holgar weg. Ich achtete nicht darauf, wer es war, zu sehr genoss ich es, endlich meiner Wut freien Lauf zu lassen. Viel zu lange schon versprühte dieser kleine, bösartige Mann ungestraft sein Gift. Hätten mich Janos und Varosch nicht gebremst, ich hätte ihn womöglich erschlagen. So aber konnte ich ihn nur einmal treffen, dann zogen mich die anderen zurück.
Mein Schlag war glücklich gesetzt. Holgar schloss sein grobes Schandmaul und rutschte, seines Bewusstseins beraubt, hinter den Tisch.
»Ser Havald. Denkt an die Vernunft«, hörte ich Varosch sagen.
Janos lachte. »Ja, Ser Havald, zeigt Weisheit!«
Ich funkelte Janos an, aber ich hätte wissen müssen, dass er sich nicht beeindruckt zeigen würde. Einen Kopf kleiner als ich, war er ungleich massiger, und selbst als er einen Banditenanführer gemimt hatte, hatte ihn der Schalk nie ganz verlassen. Seine einzige Antwort war ebenfalls schallendes Gelächter.
Ich schüttelte ihre Hände ab, richtete mein Gewand und warf ihnen beiden einen Blick zu, der sie veranlasste, noch lauter zu lachen. Dann wandte ich mich hoheitsvoll um und kehrte zu Leandra und Kennard zurück. Unter seinem Tisch fing Holgar an zu schnarchen.
»Fühlst du dich nun besser?«, fragte Leandra mit eisiger Stimme, als ich mich niedersetzte. »Glaubst du, es gefällt einer Frau, wenn man sich wegen ihr prügelt wie ein räudiger Köter?«
»Er hat dich Hure genannt.«
Sie zuckte mit den Schultern. »Hätte ich jeden erschlagen, der mich so nannte, wäre die Kronburg zu Illian nun entvölkert. Es ist sinnlos, kleinen Menschen Verstand einhämmern zu wollen. Du erweist mir jedenfalls keine Ehre, wenn du so reagierst.«
»Gut. So siehst du es. Aber ich habe ihn nicht geschlagen, um dir einen Gefallen zu tun, sondern um meinetwillen. Dieser Hund verpestet hier seit Tagen die Luft … Irgendwann ist es dem geduldigsten Menschen zu viel.«
»Und du bist wahrlich ein Muster an Geduld«, sagte sie, aber sie lächelte wieder. Ihre Hand fand die meine. »Vergiss ihn. Und folge deinem eigenen Ratschlag.«
Kennard räusperte sich. Er hatte inzwischen reichlich ungerührt das Buch des Sergeanten studiert. »Da der Hund nun schnarcht, vermag ich vielleicht Euer Interesse zu wecken. Es geht um den Weg zum nächsten Tor.«
»Ich höre.«
Kennard wies mit dem Stiel seiner Pfeife nach Norden. »Das nächste Tor, für das die Steine passen, befindet sich in der Donnerfeste.«
Ich sah ihn an und stöhnte. »Nein, nur das nicht! Genauso gut könnte es sich auf einem der Monde befinden.«
Das Gebirge, vor dem der Gasthof Zum Hammerkopf lag, war als die Donnerberge bekannt. Der Pass durch die eisigen Höhen trug ebenfalls diesen Namen, Donnerpass, und die alte Feste, die hoch über dem Pass in den Felsen gebaut war, kannte man als die Donnerfeste. Vor Jahrhunderten schon war der einzige Zugang zu dieser Festung, welche einst den Pass bewachte und den Barbaren den Zugang zu den drei Reichen verwehrte, weggebrochen. Nur ein Adler konnte die alte Festung noch erreichen, selbst einer Bergziege wäre die Wand zu steil.
Ich konnte Leandras Ernüchterung spüren, als wäre es meine eigene. Bei jedem Schritt tauchten neue Widrigkeiten auf.
»Habt Ihr die Feste schon einmal gesehen, Meister Kennard? Sie liegt mitten in einer Steilwand. Eine hohe Mauer aus glattem Stein verschließt den Pass, eine Mauer so hoch und stark, als hätte ein Titan sie gebaut, und darin ist dann das Tor zum Pass. Es heißt, es hätte Jahre gedauert, in dieses Tor ein Loch zu schlagen, das groß genug ist, einen Wagen passieren zu lassen. In Zeiten des Winters ist das Tor unter Schnee und Eis begraben, aber nie reicht der Schnee an die Krone dieses Walls oder an die Feste heran.«
»Es gibt Wege, die steilste Wand zu erklimmen«, sagte Kennard. »Man muss sie nur suchen und finden.«
Ich ließ mich in meinen Stuhl zurückfallen und griff nach meinem Becher Wein. »Ich weiß nicht, wie lange die Festung schon nicht mehr zugänglich ist, aber es gibt mehr als genug Geschichten über sie. Wir wissen ja nun, wer sie erbaute, dieses Rätsel ist also gelöst, aber sie gilt immer noch als verwunschen. Es heißt, dass niemand, der sie je betrat, sie auch wieder verließ. Geister soll es dort geben und Ungeheuer, die in den alten Mauern hausen.«
»Ich frage mich nur, wer davon erzählt hat, wo doch niemand je wieder herauskam«, sagte Kennard mit einem feinen Lächeln.
Ich hasste es, wenn jemand seine Argumente derart mit Logik verzierte. Es klang dann immer so … vernünftig.
»Ebenso gut könnten wir versuchen, den Pass doch zu überqueren. Ein sinnloses Unterfangen.«
»Vielleicht nicht«, sagte Leandra. »Die Feste liegt an der höchsten Stelle des Passes, das ist richtig, aber von hier aus am ersten Fünftel des Weges.«
»Es wird schwierig genug sein, überhaupt so weit zu kommen. Die Kälte wird unser größtes Problem sein, der Schnee wird uns ermüden, und wenn uns ein Sturm überrascht, wird man uns erst im Frühjahr finden. Dieses Schicksal hat hier schon so manch anderen Reisenden ereilt.«
»Hhm«, meinte Kennard. »In diesem Buch gibt es Hinweise auf einen Gang, der von hier zur Feste führen soll.«
»Das sind gut zwanzig Meilen«, sagte ich. »Niemand baut einen Gang, der so lang ist.«
»Das ist auch nicht nötig«, hörte ich Zokoras Stimme. Sie war an unseren Tisch getreten. Ich schaute zu ihr hoch und empfand, wie schon häufig, ihre Schönheit als verwirrend. Wäre nicht die dunkle Farbe ihrer Haut, sie und Leandra hätten Schwestern sein können. Beide besaßen sie die feinen Linien ihrer elfischen Vorfahren, schmale, gerade Nasen, edel geschwungene Lippen, hohe Wangenknochen … Gesichtszüge, die man in Fresken an alten Tempelwänden fand oder auch auf den Büsten längst vergangener Herrschergeschlechter. Vielleicht war Schönheit nicht das richtige Wort, eher wäre Charakter angebracht, es war die Summe der Einzelteile, die mich so berührte. In einem solchen Gesicht Zokoras kalte Augen zu sehen erschien mir immer als befremdlich, als müsste es anders sein, als müsste auch ihr Blick jene Wärme zeigen, die so oft in Leandras violetten Augen stand. Aber Zokoras Augen waren schwarz wie Kohle oder dunkelste Nacht. Nur selten hatte ich in ihnen eine Regung gesehen. Einmal sah ich Wut, Schmerz und Hass in ihnen, und damals hatten sie unheilvoll in dunklem Rot geglüht.
Viel mehr als das jedoch irritierte mich ihre Fähigkeit, immer wieder unbemerkt in meinen Rücken zu gelangen. Ich könnte schwören, sie wusste das ganz genau und tat es absichtlich, auch bei nichtigen Gelegenheiten. So wie jetzt. Warum, bei den Göttern, konnte sie nicht einfach, wie jeder andere Mensch auch, zu uns treten?
»Wie meint Ihr das?«, fragte Leandra und rückte auf ihrer Bank zur Seite, um Zokora Platz zu machen.
Die Dunkelelfe setzte sich geschmeidig wie eine Katze. »Der gesamte Vorläufer dieses Gebirges ist von Höhlen durchzogen«, erklärte sie. »Einst staute sich hinter den Donnerbergen ein altes Meer. Es suchte und fand seinen Weg durch den Stein, die Höhlen unter uns zeigen die Spuren dieses gewaltigen unterirdischen Stroms.«
Ich erinnerte mich an die glitzernden Höhlen mit ihren vereisten, mächtigen Säulen. Ich nickte: Nur Wasser hatte die Kraft, solche Katakomben zu formen.
»Ihr habt selbst Teile des Wegs gesehen, von dem der Kerl hier spricht.« Zokora sah Kennard herausfordernd an, aber der lächelte bloß.
»Richtig«, stimmte Leandra ihr zu. »Wir haben Spuren von Steinmetzarbeiten gesehen und einmal eine Brücke. Aber manches war auch von Zwergenhand.«
»Die Zwerge sind noch länger verschwunden als die Legionen dieses Reiches, von dem du dir wohl noch immer Rettung versprichst«, ergänzte die Dunkelelfe.
»Woher wisst Ihr das alles?«, fragte ich sie.
Zokora sah mich an. »So wie du deinen Weg auf der Oberfläche findest, finde ich meinen in den Höhlen. Ich kenne das dunkle Land. Glaub mir, die Zwerge sind schon sehr lange fort. Sie haben nur ihre Wächter zurückgelassen.«
Nur. Ich erinnerte mich an die untoten Zwerge, die Jahrhunderte nach ihrem Tod, von Magie bewegt, noch immer das zu schützen suchten, für das sie ihr Leben gegeben hatten. Ich war dankbar dafür, dass andere vor uns die meisten dieser Untoten beseitigt hatten.
»Von ihnen sollte es nicht mehr viele geben«, sagte ich hoffnungsvoll.
Leandra beugte sich vor und musterte Zokora. »Ihr schlagt also vor, dass wir diesem alten Weg folgen sollen? In der Hoffnung, dass er noch intakt ist und uns in die Nähe oder gar in die Feste hineinführt?«
»Er mag verschlungen sein, aber ich bin mir sicher, dass er kürzer und leichter zu passieren ist als der Weg an der Oberfläche. Hier oben ist Schnee, dort unten Eis. Ich mag Eis lieber, es ist fest, und behandelt man es mit Respekt, bleibt es, wo es bleiben soll, und rollt nicht mit Getöse über einen hinweg.« Sie schüttelte sich leicht, als ob sie frieren würde.
»Habt Ihr schon mal in einer Lawine gesteckt?«, fragte ich sie erstaunt.
»Fragen, Havald. Immer wieder Fragen! Warum stellst du Fragen, deren Antworten ohne Bedeutung für dich sind?«
»Ihr habt meine Neugierde geweckt«, antwortete ich ehrlich.
Sie schüttelte den Kopf. »Menschen färben ab. Ich rede nun schon selbst zu viel. Wenn ihr diesen Weg geht, werde ich euch führen. Das war es, was ich euch sagen wollte.« Sie erhob sich. »Varosch fragt nichts. Das gefällt mir besser«, fügte sie bedeutungsvoll hinzu und sah zu ihrem Liebhaber hinüber.
Ich hielt sie mit einer Geste auf. »Es war nicht nur Wissbegier. Wenn wir uns zu diesem Pass begeben, besteht auch für uns die Gefahr, in eine Lawine zu geraten. Wenige überleben das. Könnt Ihr mir sagen, wie Ihr diesem weißen Grab entrinnen konntet?«
Sie musterte mich einen Moment lang. Dann nickte sie. »Schwimmen.«
Wir sahen ihr nach, wie sie zu dem anderen Tisch zurückging.
»Sie hat gute Ohren«, bemerkte Kennard.
»Sie folgt öfter unserer Unterhaltung«, antwortete ich ihm, »obwohl ihr Neugier doch so verpönt ist.«
Kennard schmunzelte.
»Wie meint sie das mit dem Schwimmen?«, fragte Leandra.
Ich zuckte mit den Schultern. »Sollten wir in so eine Lage geraten, so hoffe ich, dass es sich uns offenbart.« Ich nahm einen Schluck Wein, den letzten, denn ich sah den Boden meines Bechers. Auch die Flasche war leer. Ich warf Kennard einen Blick zu, vor ihm stand ebenfalls ein Becher. Voll.
»Nehmt einen Schluck Tee«, riet er mir.
Der Tee war mittlerweile kalt. Ich trank ihn trotzdem.
»Was ist?«, fragte Leandra. »Ich sehe, dass du über etwas grübelst.«
»Sollte ich jemals in eine Lawine geraten, hoffe ich, dass ihr Rat nicht wörtlich gemeint ist.« Ich betrachtete die Teeschale in meinen Händen. »Ich habe das Schwimmen nie erlernt.«
3. Der Zweite Bulle
Dieser alte Gasthof barg einiges an Geheimnissen. So auch einen Raum, den wir erst vor Kurzem entdeckt hatten: das Arbeitszimmer des Kommandanten der Anlage, als noch der goldene Drache, die Fahne Askannons, über dem Trutzturm wehte.
An der Wand hinter dem Schreibtisch hing, brüchig und vom Alter zermürbt, eine Karte. Leandra war fasziniert von ihr, denn sie war der Ansicht, dass die Karte die ganze Welt zeigte. Vielleicht. Für mich sah es jedoch nicht wie eine Scheibe aus.
Seit einigen Tagen verbrachte sie ihre Nachmittage damit, diese alte Karte sorgfältig zu kopieren. Sie mochte es, wenn ich ihr dabei Gesellschaft leistete. Ich konnte sie zwar sonst stundenlang ansehen, aber ich schätzte nicht unbedingt den Anblick, den sie bot, wenn sie, die Zunge zwischen den Zähnen und vor sich hinmurmelnd, seltsame Zeichen auf Pergament bannte.
So hatte ich nachmittags Muße. Die ersten Tage war mir das willkommen. Ich reinigte und reparierte meine Ausrüstung, erforschte die Keller des Gasthofs, schnitzte weitere Figuren für das Shah-Spiel, das ich Leandra versprochen hatte. Ich striegelte mein Pferd, ölte den Sattel, sah Lisbeth, der jüngsten Tochter Eberhards, beim Kochen zu und ging allgemein den Leuten, die selbst etwas zu tun hatten, auf die Nerven.
Ich hätte etwas anderes lernen sollen als das Kriegshandwerk. Gab es mal keine Schlachten zu schlagen, merkte man, dass einem eine sinnvolle Beschäftigung fehlte. Sieglinde lieh mir ein Buch mit alten Balladen. Ich sagte Danke und blätterte darin herum, aber so recht wollte es mir nicht gefallen.
Also war ich geradezu erfreut, als ich Metall auf Metall erklingen hörte: Jemand übte sich in der Schwertkunst. Das Geräusch kam aus der Schmiede, die den größten offenen Raum nach den Stallungen besaß.
Ich bemühte mich, leise zu sein, als ich die Tür zur Schmiede öffnete. Janos und Sieglinde befanden sich beim Waffentraining. Trotz der Kälte waren beide nur leicht bekleidet, Janos’ Oberkörper war nackt, Sieglinde hatte ihre Brüste mit einem Tuch gebunden.
Das verriet mir Janos’ Herkunft. Obgleich die Klingen, die sie führten, stumpf waren, zeigte doch jeder Fehler seine deutliche und schmerzhafte Wirkung. Nur in Tolmar übte man so den Schwertkampf.
Für einen Moment bewunderte ich Sieglindes schlanke Gestalt. Janos schonte sie nicht, ihre blasse Haut war bereits von blutigen Striemen gezeichnet, aber auch er blutete aus einem Schnitt, der schräg über seine Brust verlief. Eine Schwellung an der rechten Schulter versprach gegen Abend ein schöner Bluterguss zu werden.
Als sie voneinander abließen und Janos ihr einen Fehler erklärte, räusperte ich mich.
Sieglinde lächelte mir zu, während Janos weniger erfreut schien, mich zu sehen. Ich konnte ihn verstehen.
»Ich sehe, Ihr macht Fortschritte«, sagte ich und ließ mich auf dem schweren Amboss nieder. Jemand, wahrscheinlich Sieglinde selbst oder eine ihrer Schwestern, hatte auf einem alten Werktisch ein Tuch ausgebreitet, darauf ruhten Wurst und Käse sowie eine Handvoll Winteräpfel. Ruchlos stahl ich mir einen Apfel und biss hinein.
»Ja«, sagte Janos knapp. Er warf mir einen Blick zu, der mir zu verstehen gab, dass ich die grazile Person neben ihm nicht zu eindringlich betrachten sollte. Ich lächelte amüsiert zurück und erinnerte ihn mit meinem Blick daran, dass es noch nicht so lange her war, dass man Sieglinde hatte vor ihm schützen wollen.
»Es ist Serafine«, sagte Sieglinde. »Sie ist allerdings unzufrieden mit meiner Kondition, ich ermüde noch zu schnell.«
Serafine war der Name jenes Geistes aus dem Ersten Horn, der von ihr Besitz ergriffen hatte, als wir aufgebrochen waren, den Tempel des Eiswolfs zu finden. Dennoch war sie nicht besessen, sie war sie selbst, nur … etwas anders. Die Geister hatten versprochen, uns wieder zu verlassen. Ich selbst war ebenfalls kurz auf diese Weise vom Geist des Anführers der Truppe, dem Sergeanten, besessen gewesen, nun jedoch war er, wie angekündigt, gegangen. Nur manchmal regten sich Erinnerungen, von denen ich nicht sicher war, ob es meine eigenen waren.
Sieglinde hingegen, so schien es mir, hatte den Geist der Kundschafterin mit offenem Herzen in sich aufgenommen. Als Tochter eines Wirts hatte sie gelernt, wie man einen Gasthof bewirtschaftete, die Ereignisse der letzten Wochen aber hatten ihr gezeigt, wie wenig sie sich schützen konnte, wenn man ihr Böses wollte.
Serafine, eine Streiterin des Alten Reiches, hatte mehr über das Kämpfen vergessen, als die meisten je lernten. Ich hegte den Verdacht, dass Sieglinde den Geist gebeten hatte, länger bei ihr zu verweilen. Ich hatte sie einmal darauf angesprochen, und sie antwortete mir, dass sie schon wisse, was sie tue.
»Wie meint Ihr das?«, fragte ich sie jetzt. »In diesem letzten Waffengang habt ihr Euch doch gut gegen Janos verteidigen können.«
Sie schüttelte den Kopf. »Nein. Das ist nur deswegen, weil er mich schont. Der männliche Oberarm ist kräftiger als der weibliche, und selbst wenn ich bis an mein Lebensende trainiere, werde ich nie seine Kraft besitzen. Aber ich bin schneller als er und präziser. Ich lerne, wie ich seine Klinge abgleiten lassen kann, dabei meine Kräfte einteile und auf einen Fehler von ihm warte.« Sie fuhr sich über ihr kurzes Haar. »Aber er macht keine Fehler.«
Janos lächelte. »Fehler tun weh.«
Ich nickte. »Müsst Ihr darauf bestehen, so zu trainieren? Ihr werdet es morgen bereuen. Ein wattierter Waffenrock schützt wenigstens etwas.«
»Mir ist es recht so«, entgegnete sie. »Jeder Schmerz erinnert mich besser an einen Fehler als alles andere.« Sie lächelte schelmisch. »Außerdem lenkt es ihn manchmal ab.«
Ich zog eine Augenbraue hoch. »Nur manchmal?«
»Havald, Ihr habt ein eigenes Liebchen, dem Ihr Komplimente machen könnt. Tut mir den Gefallen und belasst es auch dabei«, knurrte Janos.
Ich lachte, ich konnte nicht anders. »Verzeiht, Janos«, sagte ich dann, als er mich böse ansah. »Aber …«
Er hob die Hand. »Schon gut. Ich frage mich nur, wie lange man mich damit noch an der Nase ziehen wird.«
»Wie seht Ihr selbst Eure Fortschritte?«, fragte ich Sieglinde und hielt diesmal meinen Blick auf ihrem Gesicht.
Sie zuckte mit den Schultern. Götter. Ein Wunder, dass es nicht Janos war, der grün und blau geschlagen wurde.
»Ich muss ausdauernder und schneller werden. Serafine sagt, dass Geschwindigkeit Kraft mehr als ersetzen kann.« Sie blickte etwas zweifelnd drein.
»Sie hat recht damit. Ihr solltet weitermachen, bevor die Kälte Euch steif werden lässt.«
»Wollt Ihr uns noch ein wenig zusehen?«, fragte Sieglinde.
»Oder vielleicht selbst einen Waffengang wagen? Ich sehe Euch niemals üben«, setzte Janos nach.
Ich schüttelte den Kopf. »Ich wäre Euch nicht von Nutzen. Zokora bescheinigte mir gerade eben, dass ich keine Ahnung von Schwertarbeit hätte. Also würde ich Sieglinde nur schlechte Manieren beibringen. Man soll bei einem Lehrer bleiben, heißt es.«
»Ihr seid alle beide verrückt«, sagte Janos später am Abend. »Ihr wollt euch noch einmal in die Eishöhlen wagen und durch diesen Tunnel nahe an die Festung gelangen. Und dann wollt ihr ein altes magisches Tor verwenden. Wenn ihr all das überlebt, wollt ihr nach Askir reisen, in eine Konferenz gekrönter Häupter hineinplatzen, um dann dort um Hilfe gegen Thalak zu bitten. Anschließend kommt ihr mit einer Armee, Schiffen und Magie zurück und versetzt Thalak eine Niederlage, die so vernichtend ist, dass er aufgibt. Ist das so in etwa der Plan?«
Leandra nickte.
»Nicht ganz«, sagte ich. »Aber so in etwa.«
»Was fehlt?«, fragte Janos.
»Das Alte Reich ist wesentlich dichter besiedelt als die Länder hier.« Ich stopfte meine Pfeife.
»Und?«
»Kelar war eine unserer größten Städte. Zumindest bevor Thalak sie erobert hat. Ich bin mit solchen Zahlen nicht gut, aber ich glaube nicht, dass Kelar je mehr als fünfzigtausend Einwohner hatte.« Meine Pfeife zog, und ich lehnte mich zurück.
»Ich verstehe noch nicht, worauf Ihr hinauswollt, Havald«, sagte Sieglinde.
»In den sieben Königreichen, so nennt sich das, was einst das Imperium war – wie groß ist ihre größte Stadt, Meister Kennard, wie viele Menschen leben dort?«
»Das wäre dann die imperiale Stadt Askir«, sagte der Gelehrte. Er sah mich aufmerksam an. »Ich denke, dass dort etwas über zwei Millionen Menschen leben.«
»Was ist eine Million?«, fragte Varosch.
»Tausend mal tausend.«
»Das ist nicht möglich!« Sieglinde sah Kennard fassungslos an. »Ihr meint das nicht ernst, oder?«
»Doch«, sagte Kennard.
»Ich kann das nicht fassen«, meinte Sieglinde. »In dieser Stadt leben fast mehr Menschen als in unseren drei Reichen zusammen?«
Kennard nickte. »In den sieben Königreichen leben etwa einundzwanzig Millionen Menschen. Grob geschätzt.«
»Ich wusste nicht, dass es auf der ganzen Weltenscheibe so viele Menschen gibt«, sagte Varosch. Er war gerade dabei, Zokora den Nacken zu massieren. Das fünfte Mal heute Morgen. Meine Vermutung war, dass er es gerade lernte.
»Ich auch nicht«, sagte Zokora. Sie blickte von mir zu Kennard und zurück. »Niemand wusste das«, fügte sie hinzu und wurde sehr, sehr nachdenklich.
»Wie wäre es, wenn Ihr uns endlich den Rest Eures Plans erklären könntet?«, fragte Janos ungehalten.
»Geduld. Ich bin dabei.« Ich sah Leandra an. »Wie viele Menschen, denkt ihr, zählt unser Land?«
»Ich kann nur für Illian sprechen, aber es ist das größte der drei Königreiche. Dort werden es wohl so um die fünfhunderttausend sein.«
»Nun. Da habt Ihr Eure Antwort, Janos. Askannon wusste, was er tat, als er diese Kolonien hier gründete. Unser Land ist reich und fruchtbar. Die Länder hier sind – oder waren – fast so groß wie das Imperium. Wir haben etwas, was die Menschen im Alten Reich nicht haben: Platz. In Askir haben sie dafür etwas anderes.«
Alle sahen mich erwartungsvoll an. »Was? Nun sagt es endlich.« Janos fixierte mich.
»Das Wissen, wie man eine Legion aufstellt, ausbildet, versorgt und befehligt. Alle Armeen, die ich je kannte, liefen nicht nur auf den Füßen ihrer Soldaten, sondern auch auf einer Straße aus Papier. Wenn Askir nicht untergegangen ist, gibt es Archive. Dort finden wir alles, was wir brauchen. Und Menschen, die sich wahrscheinlich an ihre alte militärische Macht erinnern.«
»Ihr hofft, ein Buch zu finden, in dem steht, wie man eine Legion nach altem Muster ausbildet? Und Leute, die Euch helfen, eine Legion aufzustellen?« Janos sah mich fassungslos an.
Kennard lächelte.
»Du willst nach Askir gehen und Legionen aufstellen?«, fragte Leandra.
»Es ist eine Sache der menschlichen Natur«, sagte ich und genoss die Wärme des Pfeifenkolbens in meiner Hand. »Denkt euch, ihr lebt in einem Land, das einst das mächtigste Imperium der Weltenscheibe war. Ich wette mein Pferd, dass es dort jede Menge Balladen gibt, die das alte Imperium glorifizieren. Es wurde nie besiegt, oder?«
Kennard schüttelte den Kopf. »Der Imperator dankte ab. Das war alles.«
»Freunde, was meint ihr, wie viele junge Männer träumen dort von diesen alten Zeiten? Ihr wisst doch, früher war immer alles besser. Das Abenteuer ruft und solche Dinge.«
Janos nickte bedächtig. »Das könnte funktionieren. Aus den verloren gegangenen Kolonien nach Askir marschieren, lautstark anklopfen und an alten Ruhm erinnern. Dann Soldaten anwerben und nach den Regeln des Imperiums selbst ausbilden. Aber wie wollt Ihr das anstellen? Woher sollen Sold und Ausrüstung der Männer kommen?«
Ich winkte Eberhard heran. Der Wirt kam und blickte fragend in die Runde.
»Ein Glas Fiorenzer für jeden hier, Meister Eberhard. Aber das ist nicht alles, könntet Ihr uns berichten, was Ihr jenseits des zugemauerten Kellers gefunden habt?«
»Gern, Ser. Ein riesiges Lager, voll mit Waffen und Rüstungsteilen.«
»Danke, Eberhard.« Ich sah mich um und musste grinsen, als ich sah, wie die anderen langsam verstanden.
»Bei den Göttern. Dies war ja ein Depot! Ein Ausrüstungslager! Ich hätte es fast vergessen!«, sagte Janos dann leise, beinahe ehrfürchtig.
»Ich kann euch noch etwas dazugeben«, sagte Kennard. Wir sahen ihn überrascht an. Er lächelte und winkte Eberhard zu sich. »Meister Eberhard. Habt Ihr irgendwo die Flagge gefunden?«
»Welche Flagge, Ser?«
»Die Flagge der Legion.«
»Nein, Ser.«
»Im Büro des Kommandanten steht noch ein alter Schreibtisch, nicht wahr?«
Der Wirt nickte.
»Geht dorthin und versucht, die Stirnwand des Schreibtischs zu lösen. Dort wurden die Flaggen oft verstaut. Schaut, ob Ihr sie findet, und bringt sie uns.«
»Sofort.«
Eberhard eilte davon.
Kennard lächelte, als er unsere Blicke sah. »Es ist ein seltsames Ding mit den Traditionen, Legenden und Balladen. Sagt, was ist eure Meinung: Hat die Zweite Legion hier ihre Mission erfüllt?«
»Ja«, sagte ich. »Das Land wurde befriedet und die Magie gebannt. Sie waren erfolgreich.«
»Aber keiner überlebte«, sagte Leandra leise.
Kennard ließ seinen Blick nicht von mir. »Aber das ist nicht wichtig. Die Zweite Legion hat ihren Auftrag erfüllt. Seht, Eberhard kommt zurück.«
So war es. Und er trug eine große, flache Kiste aus Zedernholz. Sorgsam legte er sie auf einen Nachbartisch. Wir standen alle auf.
»Lasst mich«, sagte Leandra, als Eberhard den Deckel der Kiste abheben wollte. Eberhard nickte, und Leandra trat an den Tisch heran. Sie holte tief Luft und löste den Deckel.
Dort lag die Flagge, zusammengelegt. Vorsichtig entfaltete Leandra sie, während wir gebannt zusahen. Ich glaube, niemand von uns blieb unberührt.
Die Flagge war etwa eine Mannshöhe hoch und anderthalb lang. Sie war rot, blutrot. Oben, in der linken Ecke, prangte der imperiale Drache. Entlang des oberen Randes lief eine Reihe Symbole oder Wappen. Der schwarze, schnaubende Bulle war bis ins kleinste Detail in das schwere Tuch gestickt. Zwischen seinen Hörnern trug er zwei goldene I.
In goldenen Lettern standen unter den silbernen Hufen die folgenden Worte:
Für Askir, den Kaiser, die Ehre und unsere Pflicht
Wo wir stehen, da weichen wir nicht.
»Der Zweite Bulle«, sagte Kennard und strich sacht über die eingearbeiteten Wappen und Symbole. »Drei Kriege führte Askannon. Der Zweite Bulle war immer dabei. Und er war immer siegreich.« Er blickte hoch. »Sie ist die berühmteste aller Legionen. Auch weil sie spurlos verschwand und niemals jemand wieder etwas von ihr hörte. Es gab und gibt Dutzende Legenden und Balladen über sie.« Kennard wandte sich zu mir. »Ser Havald. Ihr erschreckt mich. Wenn Ihr einen Geist neu beleben wollt, dann hättet Ihr schwerlich einen finden können, der mehr die Gemüter des alten Imperiums bewegt, als dieser es tun wird. Hiermit werden Euch alle Türen offen stehen.«