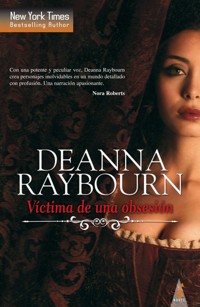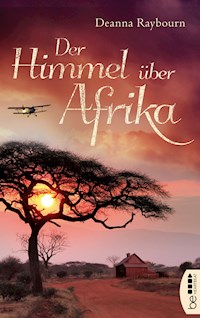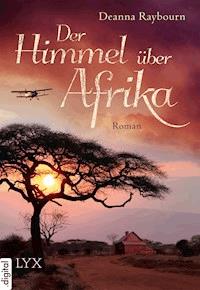
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Paris, 1923: Die junge Delilah Drummond führt ein ausgelassenes Leben. Gesellschaftliche Konventionen kümmern sie wenig. Doch als ihr neuester Skandal hohe Wellen schlägt, trifft ihre Familie eine Entscheidung: Bis Gras über die Sache gewachsen ist, soll Delilah nach Kenia reisen und auf der Farm ihres Stiefvaters endlich zur Ruhe kommen. Schneller als ihr lieb ist, findet sie sich in dem ihr fremden Land wieder und vergeht fast vor Heimweh. Doch dann lernt sie den Abenteurer Ryder White kennen, dessen Liebe für die Schönheit und die Gefahren Afrikas sie berührt wie nichts zuvor. Kann er sie überzeugen, dass der fremde Kontinent auch für sie eine Heimat sein könnte?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 579
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Inhalt
Titel
Zu diesem Buch
Widmung
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Danksagung
Die Autorin
Impressum
DEANNA RAYBOURN
Der Himmel über Afrika
Roman
Ins Deutsche übertragen von
Anja Mehrmann
Zu diesem Buch
Paris, 1923: Delilah Drummond genießt die Goldenen Zwanzigerjahre in vollen Zügen. Was andere von ihr denken, kümmert sie wenig – bis ihre Eltern endgültig genug haben. Delilahs neuester Skandal schlägt so hohe Wellen, dass ihnen nichts anderes übrig bleibt, als sie aus der Gesellschaft zu entfernen, bis Gras über die Sache gewachsen ist. Schneller als ihr lieb ist, befindet sich Delilah auf dem Weg nach Nairobi. Auf Fairlight, der Farm ihres Vaters, soll sie endlich zur Vernunft kommen. Doch dort erwarten Delilah nichts als Probleme: Schlechte Ernten und ein korrupter Farmverwalter rauben ihr jeden Nerv. Auch die Verwaltung der Kolonie scheint ihr beim Aufbau der Farm ständig nur Steine in den Weg legen zu wollen, sodass Delilah es kaum erwarten kann, den fremden Kontinent endlich wieder verlassen zu dürfen – bis sie den Abenteurer Ryder White kennenlernt. Seine Liebe für die Schönheit und Gefahren Afrikas berührt sie wie nichts zuvor, und als ihr Vater Fairlight zu verlieren droht, kann Delilah sich mit einem Mal keinen besseren Ort vorstellen, um glücklich zu werden …
Für Valerie Gray, begnadete Lektorin und Zauberkünstlerin. Die Begegnung mit ihr hat mich zu einer besseren Schriftstellerin gemacht.
1
Glauben Sie die Geschichten nicht, die Sie über mich gehört haben. Ich habe nie jemanden umgebracht, und ich habe auch nie einer anderen Frau den Ehemann weggenommen. Na ja, wenn ich einen unbeaufsichtigt herumliegen sähe, würde ich vielleicht draufspringen, aber ich habe mir nie einen genommen, der nicht genommen werden wollte. Und ich hatte nie vor, nach Afrika zu gehen. Daran ist nur das Wetter schuld. Es war ein scheußlicher Tag in Paris, grau und düster und verregnet, als ich zur Suite meiner Mutter ins Hôtel de Crillon gerufen wurde. Zu diesem Anlass hatte ich mich sorgfältig gekleidet, nicht weil Mossy das etwas bedeutet hätte – meine Mutter ist in solchen Dingen merkwürdig schnörkellos. Aber ich wusste, in schicken Kleidern würde ich mich besser fühlen angesichts der Tortur, die mich erwartete. Also zog ich ein göttliches kleines Kleid von Molyneux aus scharlachroter Seide an, setzte den dazu passenden Glockenhut auf, krönte das Ganze mit einer pfiffigen Chinchillastola und verließ meine Suite. Dann stieg ich in den Aufzug und fuhr die zwei Stockwerke zu ihrer Zimmerflucht hinauf.
Das schwedische Dienstmädchen meiner Mutter öffnete mit mürrischem Blick die Tür.
»Guten Tag, Ingeborg. Ich hoffe, es geht Ihnen gut?«
Der Blick wurde noch mürrischer. »Ihre Mutter ist besorgt um Sie«, sagte sie kühl. »Und ich mache mir Sorgen um Ihre Mutter.« Schon vor meiner Geburt hatte Ingeborg sich Sorgen um meine Mutter gemacht. Die Tatsache, dass ich eine Steißgeburt war, reichte ihr, um mich für immer in Ungnade fallen zu lassen.
»Ach, regen Sie sich nicht auf, Ingeborg. Mossy ist stark wie ein Ochse. Alle in ihrer Familie sind mindestens hundert geworden.«
Erneut warf Ingeborg mir einen finsteren Blick zu und führte mich ins Wohnzimmer der Suite. Mossy war dort, natürlich, und hielt inmitten einer Gruppe von Gentlemen Hof. Das war nichts Neues. Seit ihrem Debüt in New Orleans ungefähr dreißig Jahre zuvor hatte es ihr nie an männlicher Aufmerksamkeit gefehlt. Sie stand in Reitkleidung vor dem Kamin, einen Ellbogen auf den marmornen Kaminsims gestützt, und ließ beim Reden eine Wolke Zigarettenrauch ausströmen.
»Aber das ist doch nicht möglich, Nigel. Es tut mir leid, aber das geht einfach nicht.« Sie stritt sich mit ihrem Ex-Ehemann, doch man musste sie gut kennen, um das zu merken. Mossy hob niemals die Stimme.
»Was geht nicht? Hat Nigel dir einen skandalösen Vorschlag gemacht?«, fragte ich hoffnungsvoll. Alle Männer drehten sich gleichzeitig zu mir um, und Mossy verzog den Mund zu einem breiten Grinsen.
»Hallo, mein Liebling. Komm her und gib mir einen Kuss.« Ich tat wie mir befohlen und küsste sie rasch auf die gepuderte Wange. Aber nicht rasch genug. Sie kniff mich heftig, als ich mich abwandte. »Du warst ungezogen, Delilah. Zeit, die Zeche zu bezahlen, Liebling.«
Ich blickte mich in dem Raum um und lächelte die Gentlemen nacheinander an. Nigel, mein ehemaliger Stiefvater, war ein rundlicher Engländer mit rötlicher Gesichtsfarbe und einem Herzleiden, und in diesem Augenblick sah er aus, als wäre er vor zehn Minuten gestorben. Dass auch Quentin Harkness anwesend war, machte mich glücklich, und ich stellte mich auf die Zehenspitzen, um ihn zu küssen. Wie Mossy hatte auch ich mein Teil an ehelichen Missgeschicken abbekommen. Quentin war der zweite. Er war ein schrecklicher Ehemann, aber als Ex ist er traumhaft und als Rechtsanwalt sogar noch besser.
»Wie geht es Cornelia?«, fragte ich ihn. »Und den Zwillingen? Können sie schon laufen?«
»Ja, in der Tat, seit letztem Monat. Und Cornelia geht es gut, danke«, sagte er höflich. Ich hatte nur aus Höflichkeit gefragt, und das wusste er. Cornelia war vor unserer Hochzeit mit ihm verlobt gewesen, und sie hatte sich ihn zurückgeholt, noch bevor die Tinte auf unseren Scheidungspapieren getrocknet war. Ihre Kinder aber waren goldig, und es freute mich, dass er offenbar glücklich war. Aber Quentin war Engländer. So war es meistens schwer zu erraten, was er wirklich empfand.
Ich beugte mich vor. »Stecke ich in großen Schwierigkeiten?«, flüsterte ich. Er neigte sich zu mir herab, sein Mund streifte kaum spürbar den Rand meines Bubikopfes.
»In ziemlich großen.«
Ich zog eine Schnute und nahm Platz auf einem der zerbrechlich wirkenden Sofas, die überall im Raum verteilt standen. Dann kreuzte ich artig die Knöchel, genau wie mein Benimmlehrer es mir beigebracht hatte.
»Wirklich, Miss Drummond, ich glaube, Sie sind sich des Ernstes der Lage nicht bewusst«, fing Mossys englischer Anwalt an. Ich versuchte angestrengt, mich an seinen Namen zu erinnern. Weatherby? Enderby? Endicott?
Ich lächelte breit und stellte die beträchtliche Summe unter Beweis, die Mossy in meine kieferorthopädische Behandlung investiert hatte.
»Ich versichere Ihnen, er ist mir bewusst, Mr –« Ich brach mitten im Satz ab und sah die Andeutung eines Lächelns über Quentins Gesicht huschen. Zum Teufel mit ihm. So ruhig wie möglich fuhr ich fort: »Das heißt, ich bin mir ziemlich sicher, dass am Ende alles wieder in Ordnung kommt. Natürlich habe ich die Absicht, Ihre ausgezeichneten Ratschläge zu berücksichtigen.« Diesen besonders besänftigenden Ton hatte ich von Mossy gelernt. Im Allgemeinen wandte sie ihn bei Pferden an, aber ich hatte festgestellt, dass er bei Männern genauso gut funktionierte. Vielleicht sogar noch besser.
»Dessen bin ich mir ganz und gar nicht sicher«, erwiderte Mr Weatherby. Oder vielleicht auch Mr Endicott. »Ihnen ist doch sicher bewusst, dass die Familie des verstorbenen Prinzen mit rechtlichen Schritten droht, um wieder in den Besitz der Volkonsky-Juwelen zu gelangen?«
Ich seufzte und durchsuchte meine Handtasche nach einer Sobranie-Zigarette. Als ich die Zigarette in die lange Spitze aus Elfenbein gesteckt hatte, waren Quentin und Nigel schon bei mir, um mir Feuer zu geben. Ich ließ zu, dass beide mir die Zigarette ansteckten – es gehört sich nicht, jemanden zu bevorzugen –, und blies einen raffinierten kleinen Rauchring aus.
»Oh, das ist famos«, sagte Mossy. »Du musst mir zeigen, wie das geht.«
»Du machst es mit der Zunge«, sagte ich. Quentin verschluckte sich fast, doch ich wandte mich Mr Enderby zu und blickte ihn aus weit aufgerissenen Augen an. »Misha hatte keine Familie«, erklärte ich. »Seine Mutter und seine Schwestern haben mit ihm Russland während der Revolution verlassen, aber sein Vater und sein Bruder waren bei der Weißen Armee. Sie und alle anderen männlichen Familienmitglieder sind in Sibirien getötet worden. Misha ist nur entkommen, weil er zu jung zum Kämpfen war.«
»Da wäre die Gräfin Borghaliev«, hob er an, doch ich winkte ab.
»Feathers! Die Gräfin war Mishas Gouvernante. Sie mag zwar zur Familie gehören, ist aber nur eine Cousine, und eine sehr entfernte noch dazu. Gewiss hat sie keinerlei Anrecht auf die Volkonsky-Juwelen.« Und selbst wenn sie eines gehabt hätte – ich hatte nicht die Absicht, auf die Juwelen zu verzichten. Die ursprüngliche Kollektion war im Verlauf von mehr als drei Jahrhunderten zusammengestellt worden, und sie war alles, was die Volkonskys mitgenommen hatten, als sie flohen. Mishas Mutter und seine Schwestern hatten sie aus Russland hinausgeschmuggelt, indem sie den Schmuck in ihre Kleider eingenäht hatten, jedes Stück einzeln, außer dem größten. Den Kokotchny-Smaragd hatte Mishas Mutter an einer unaussprechlichen Stelle versteckt, und auch wenn es nie jemand erwähnt hat, bin ich überzeugt davon, dass ihr Gang ein wenig merkwürdig ausgesehen haben muss, als sie ihr Vaterland verließ. Sie hatte angenommen – zu Recht, wie sich herausstellte –, dass die Beamten sich scheuen würden, an einer solch intimen Körperstelle zu suchen, und nach einer gründlichen Wäsche glänzte der Smaragd so strahlend wie immer, mit all seinen achtzig Karat. Das war jedenfalls die offizielle Geschichte der Juwelen. Ich wusste manches, was nicht in den Zeitungen stand, Dinge, die Misha mir als seiner Ehefrau anvertraut hatte. Und eher hätte ich mein eigenes Haar in Brand gesteckt als zuzulassen, dass dieses boshafte alte Weib die Wahrheit erfuhr.
»Das mag stimmen«, sagte Mr Endicott mit strenger Miene, »aber sie redet mit der Presse. Kurz nach dem Selbstmord des Prinzen und angesichts Ihrer recht laschen Art zu trauern ergibt das Ganze ein ziemlich geschmackloses Bild.«
Ich blickte Quentin an, doch der betrachtete eingehend seine Fingernägel, ein alter Trick, der bedeutete, dass er nichts sagen würde, bevor er nicht dazu bereit war. Und der arme Nigel sah aus, als hätte er Magenschmerzen. Nur Mossy wirkte empört, und ich lächelte, um ihr zu zeigen, dass ich ihre Unterstützung zu schätzen wusste.
»Es gibt keinen Grund, darüber zu lachen, Liebling«, sagte sie, drückte ihre Zigarette aus und zündete sich eine neue an. »Weatherby hat recht. Es ist eine schwierige Situation. Gerade jetzt kann ich es nicht gebrauchen, dass man deinen Namen in den Dreck zieht. Und Quentins Kanzlei läuft sehr gut. Glaubst du, er würde sich freuen, wenn sich um seine Exfrau ein Skandal zusammenbraut?«
Ich blickte sie aus schmalen Augen an. »Liebes, was meinst du damit, dass du es nicht gebrauchen kannst, wenn mein Name gerade jetzt durch den Dreck gezogen wird? Was geht bei dir vor?«
Mossy sah Nigel an, der im Sessel ein wenig das Gewicht verlagerte. »Mossy ist zur Hochzeit des Duke of York mit Lady Elizabeth Bowes-Lyon eingeladen, die diesen Monat stattfindet.«
Ich blinzelte. Die Hochzeit jenes Mannes, der in der Thronfolge an zweiter Stelle stand, war das gesellschaftliche Ereignis des Jahres, und für Mossy hätte es eigentlich die Grenzen des Erlaubten überschreiten müssen. »Die Queen empfängt keine geschiedenen Frauen. Wie in aller Welt hast du das geschafft?«
Mossys Lippen wurden schmal. »Es ist ein privater Anlass, nicht bei Hof«, berichtigte sie. »Außerdem weißt du, dass ich den Strathmores von jeher sehr zugetan bin. Die Countess ist eine meiner allerliebsten Freundinnen. Es ist schrecklich liebenswürdig von ihnen, dass sie mich zum großen Tag ihrer Tochter einladen, und ich darf sie auf keinen Fall mit irgendwelchen Gerüchten in Verlegenheit bringen.«
Aha, Gerüchte. Diese schönfärbende Umschreibung, die ich seit meiner Kindheit kannte, der Fluch über meiner Existenz. Ich dachte daran, wie oft wir umgezogen waren, von England nach Spanien, nach Argentinien, nach Paris, und jedes Mal war uns das Gespenst des Geredes auf den Fersen. Mossys Liebesaffären und ihre geschäftlichen Unternehmungen waren legendär. Schon zum Frühstück konnte sie mehr Skandale verursachen als die meisten Frauen in ihrem ganzen Leben. Sie war überlebensgroß, meine Mossy, und während sie dieses sehr große Leben lebte, hatte sie aus Versehen und nebenbei etliche Leute mit ihren zierlichen Schuhen in Größe achtunddreißig zertreten. Sie hatte das nie verstanden, auch jetzt nicht. Sie stand in einer Hotelsuite, die pro Nacht mehr kostete, als die meisten Leute in einem Jahr verdienten, und sie konnte dafür mit dem Kleingeld zahlen, das sie noch in den Taschen hatte. Doch sie würde niemals verstehen, dass sie andere geschädigt hatte, um so weit zu kommen.
Natürlich merkt sie es sofort, wenn ich etwas Falsches tue, dachte ich gereizt. Wenn eine ihrer Ehen scheiterte, konnte sie nichts dafür, aber wenn ich mich scheiden ließ, dann lag das daran, dass ich mir nicht genug Mühe gab oder nicht wusste, wie eine Ehefrau sich zu verhalten hat.
»Hör auf zu schmollen, Delilah«, befahl sie. »Du bist viel zu alt, um einen Flunsch zu ziehen.«
»Ich ziehe keinen Flunsch«, erwiderte ich und klang dabei ungefähr wie vierzehn. »Wissen Sie, Mr Weatherby, die Leute verstehen meine Beziehung zu Misha einfach nicht. Unsere Ehe war vorbei, lange bevor er sich eine Kugel in den Kopf gejagt hat.« Mr Weatherby zuckte sichtlich zusammen. Ich versuchte es noch einmal. »Für Misha war es keine Überraschung, dass ich mich scheiden lassen wollte. Und dass er sich sofort nach dem Erhalt der Scheidungspapiere umgebracht hat, ist nicht meine Schuld. An dem Morgen habe ich Misha sogar noch gesehen und ihm gegenüber betont, dass alles ganz anständig zugehen sollte. Ich bin mit all meinen Ehemännern befreundet.«
»Ich bin der einzige, der noch lebt«, warf Quentin ein – nach meinem Dafürhalten allerdings wenig hilfreich.
Erneut streckte ich ihm die Zunge heraus und wandte mich wieder an Mr Weatherby. »Was die Juwelen angeht: Mishas Mutter und seine beiden Schwestern sind 1919 an der Spanischen Grippe gestorben, bei der Epidemie. Er hat den gesamten Schmuck geerbt und ihn mir zur Hochzeit geschenkt.«
»Dass der Schmuck an ihn zurückgegeben wird, war Teil der Scheidungsvereinbarung«, gab Weatherby zu bedenken.
»Es gab aber keine Scheidung«, sagte ich triumphierend. »Misha hat die Papiere nicht unterzeichnet, bevor er sich die Kugel gegeben hat. Darum bin ich offiziell Witwe und habe ein Anrecht auf das Vermögen meines Ehemannes, denn er ist gestorben, ohne ein Testament oder Nachkommen zu hinterlassen.«
Mr Weatherby zog ein Taschentuch heraus und wischte sich über die Brauen. »Wie dem auch sei, Miss Drummond, die ganze Angelegenheit wird in der Presse sehr unvorteilhaft dargestellt. Wenn Sie in dieser Angelegenheit ein wenig veschwiegener sein könnten, vielleicht Trauer tragen oder Ihren rechtmäßigen Namen benutzen könnten.«
»Delilah Drummond ist mein rechtmäßiger Name. Ich habe nie den Namen oder den Titel eines Mannes angenommen, und das werde ich auch niemals tun. Ehrlich gesagt finde ich, dass es ein bisschen zu spät ist, um mich Fürstin Volkonsky zu nennen.« Quentin zuckte leicht zusammen, doch ich sah darüber hinweg. Tatsächlich hatte ich erlebt, wie Mossy ihren Namen öfter gewechselt hatte, als ich Finger an einer Hand habe, und das war schrecklich wegen der Tischwäsche und des Tafelsilbers. Viel vernünftiger, bei einem einzigen Monogramm zu bleiben. »Das ist ein dummer, altmodischer Brauch«, fuhr ich fort. »Ihr Männer habt uns die letzten viertausend Jahre gezwungen, unsere Namen zu ändern. Warum machen wir es nicht einfach andersherum? In den nächsten paar Jahrtausenden nehmt ihr unsere Namen an, und dann sehen wir mal, wie euch das gefällt.«
»Gebiete ihr Einhalt, bevor sie richtig in Fahrt kommt«, sagte Mossy zu Nigel. Sie hasste es, wenn ich über Frauenrechte sprach.
Nigel beugte sich in seinem Sessel vor, ein freundliches Lächeln lag auf seinem liebenswürdigen Gesicht. »Meine Liebe, du weißt, dass dir immer meine besondere Zuneigung gegolten hat. Für mich bist du wie eine Tochter.«
Ich erwiderte das Lächeln. Nigel war immer mein Lieblingsstiefvater gewesen. Seine erste Frau hatte ihm zwei stumpfsinnige Söhne geschenkt, und sie waren schon im Internat, als er Mossy heiratete und wir mit ihm auf seinen Landsitz zogen. Er hatte es genossen, zum ersten Mal ein Mädchen um sich zu haben, und er hat mich nie belästigt, wie es einige andere Stiefväter getan haben. Ein paar hatten sogar versucht, den Vater für mich zu spielen, hatten sich in meine Schulausbildung eingemischt, die Gouvernanten mit Fragen darüber gequält, was ich aß und welche Fortschritte mein Französisch machte. Nigel kümmerte sich einfach um seine Angelegenheiten, und er ließ mir freie Bahn in der Bibliothek und der Küche, wie es mir gerade gefiel. Wenn er mich sah, tätschelte er mir voller Zuneigung den Kopf und fragte mich, wie es mir ging, bevor er wieder verschwand, um sich um seine Orchideen zu kümmern. Er brachte mir Reiten und Schießen bei und wie man beim Pferderennen auf Sieg setzte. Ich habe es ziemlich bedauert, als Mossy ihn verließ, aber es war typisch für Nigel, dass er sie kampflos ziehen ließ. Ich war fünfzehn, als wir unsere Sachen packten, und am letzten Morgen, als Kisten und Koffer verschlossen und im Hausflur gestapelt wurden und es im Haus schon auf eine Art hallte, die mir nur allzu vertraut war, fragte ich ihn, wie er sie einfach so gehen lassen konnte. Er lächelte sein trauriges Lächeln und sagte, dass er sich bei seinem Heiratsantrag auf einen Handel eingelassen habe. Er habe ihr versprochen, dass er ihr – falls sie ihn heiratete – nicht im Weg stehen würde, sollte sie eines Tages ihre Meinung wieder ändern. Vier Jahre lang war sie bei ihm geblieben – zwei Jahre länger als bei irgendeinem anderen Mann. Ich hoffte, dass ihn das ein wenig trösten würde.
Nigel fuhr fort: »Wir haben lange darüber diskutiert, Delilah, und wir sind übereingekommen, dass es das Beste für dich ist, wenn du dich ein wenig aus der Öffentlichkeit zurückziehst. Du siehst dünn und blass aus, meine Liebe. Ich weiß, für die Schönheiten der feinen Gesellschaft ist das heutzutage modern«, fügte er mit einem wehmütigen Schimmer in den Augen hinzu, »aber ich würde dich so gern wieder mit rosigen Wangen sehen.«
Zu meinem Entsetzen spürte ich, dass mir die Tränen kamen. Ich fragte mich, ob ich vielleicht eine Erkältung ausbrütete. Heftig blinzelnd wandte ich den Blick ab.
»Das ist sehr freundlich von dir, Nigel.« Es war liebenswürdig, aber das hieß noch lange nicht, dass er mich überzeugt hatte. Mit neuer Entschlossenheit drehte ich mich um.
»Weißt du, ich habe die Zeitungen gelesen. Diese Borghaliev hat bereits ihr Schlimmstes getan. Sie ist eine kleingeistige, gemeine Kreatur, und sie verbreitet kleingeistigen, gemeinen Klatsch, den nur kleingeistige, gemeine Leute hören wollen.«
»Du sprichst von der feinen Gesellschaft von Paris, Liebes«, warf Mossy ein. »Und von London. Und New York.«
Ich zuckte die Achseln. »Was andere von mir denken, interessiert mich nicht.«
Mossy hob resigniert die Hände und machte Anstalten, sich eine weitere Zigarette anzuzünden, doch Quentin beugte sich vor und sagte leise zu mir: »Ich kenne diesen Blick, Delilah, diesen Blick einer Eiskönigin, der bedeutet, dass du glaubst, über all dies erhaben zu sein und dass nichts davon dich berühren kann. Denselben Blick hattest du, als die Gesellschaftsreporter sich vor Begeisterung überschlugen, weil sie über unsere Scheidung schreiben konnten. Aber ich fürchte, diesmal wird diese Haltung edelmütigen Leidens nicht ausreichen. Es ist nämlich die Rede davon, Druck auf die Behörden auszuüben, damit sie offizielle Ermittlungen einleiten.«
Ich zögerte. Das war allerdings etwas anderes. Offizielle Ermittlungen würden unschön und zeitaufwendig werden, und die Presse würde sich darauf stürzen wie eine durstige Katze auf einen Napf Milch.
Quentin fuhr fort, und seine Stimme wurde beschwörend, als er seinen Vorteil zu nutzen versuchte. Er wusste immer, wann er mich am Haken hatte. »Das Wetter hier ist scheußlich, und ich weiß doch, wie sehr du die Kälte hasst. Warum verreist du nicht einfach, der Sonne entgegen, und überlässt alles mir? Deine französischen Anwälte und ich können sie bestimmt überzeugen, die Sache fallenzulassen, aber das wird ein bisschen dauern. Warum verbringst du die Zeit nicht irgendwo in der Sonne?«, fügte er mit derselben honigsüßen Stimme hinzu. Diese Stimme war sein größter Vorzug, sowohl als Anwalt als auch als Liebhaber. Mit dieser Stimme hatte er mich an dem Abend, an dem wir uns kennenlernten, zum Nacktbaden im Gartenteich des Bischofs von London überredet.
Doch er warf Mossy vielsagende Seitenblicke zu, und ich sah, wie ihre Lippen schmal und die Fingerknöchel der Hand, in der sie ihre Zigarette hielt, weiß wurden. Sie war weitaus besorgter, als sie zugab, doch irgendwie hatte Quentin sie davon überzeugt, dass sie es ihm überlassen sollte, mit mir fertigzuwerden. Sie fixierte das schwarze Seidenband, das ich mir um das Handgelenk gebunden hatte. In der Schickeria hatte ich damit so etwas wie eine Mode begründet. Andere Frauen mochten Bänder aus Spitze oder Satin tragen, die zu ihren Ensembles passten, doch ich trug nur Seide und nur Schwarz, und Mossy konnte den Blick nicht von diesem Streifen Stoff abwenden, als ich mit dem Finger darüber rieb.
Ich nahm noch einen tiefen Zug von meiner Zigarette, und Mossy verlor endgültig die Geduld mit mir.
»Hör auf herumzuspielen, Delilah.« Ihre Stimme klang schrill, und sogar sie selbst merkte es. Sie mäßigte den Ton und redete mit mir, als wäre ich ein Pferd, das sie beruhigen müsste. »Darling, ich wollte es dir eigentlich nicht sagen, aber ich fürchte, dir bleibt in dieser Sache keine Wahl. Heute Morgen habe ich ein Telegramm von deinem Großvater bekommen. Es scheint, dass sich der Klatsch und Tratsch der Gräfin Borghaliev weiter herumgesprochen hat als nur in den Cafés von Paris.Es stand sogar im Picayune. Momentan ist er sehr wütend auf dich.« Das konnte ich mir ohne Weiteres vorstellen. Mein Großvater – Colonel Beauregard L’Hommedieu von der 9th Louisiana Confederate Cavalry – war der wildeste Kreole, den New Orleans je gesehen hatte, doch von den Frauen seiner Familie erwartete er manierliches Betragen. Mit mir und Mossy hatte er da kein Glück gehabt, doch es bereitete ihm keine Mühe, den Geldhahn nach Belieben auf- oder zuzudrehen, um seinen Willen durchzusetzen.
»Wie wütend?«
»Er hat gesagt, wenn du nicht verschwindest, ohne Aufsehen zu erregen, streicht er dir die finanzielle Zuwendung.«
Ich drückte meine Zigarette aus und verstreute Asche auf dem weißen Teppich. »Aber das ist Erpressung!«
Mossy zuckte mit den Schultern. »Es ist sein Geld, Liebling. Er kann damit genau das tun, was er will. Was du von deinem Großvater bekommst, gibt er dir nach Belieben, und zurzeit beliebt es ihm nach ein wenig mehr Diskretion deinerseits.« Damit hatte sie recht. Der Colonel hatte sein Testament bereits aufgesetzt, und Mossy und ich kamen darin nicht vor. Er verfügte über ein beträchtliches Vermögen – Stadthäuser im French Quarter, gewerbliche Immobilien am Mississippi, Rinderfarmen und Baumwollfelder und dazu sein Kronjuwel, Reveille, die Zuckerplantage an der Stadtgrenze von New Orleans. Und jeden Morgen Land, jedes Rind und jede Baumwollkapsel würde sein Neffe bekommen. Es hatte seinen Preis, verrufen zu sein, und Mossy und ich würden ihn zahlen müssen, wenn der Colonel eines Tages starb. In der Zwischenzeit war er ziemlich großzügig mit Zuwendungen, doch er gab niemals etwas, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Je besser wir uns benahmen, desto mehr erhielten wir. In dem Jahr, in dem ich mich von Quentin scheiden ließ, hatte ich keinen Cent von ihm gesehen, doch danach hatte er sich wieder freigebig gezeigt. Dennoch war es ein wenig ermüdend, den Zug seiner Leine über fünftausend Kilometer hinweg zu spüren.
Ich merkte, dass meine Laune sich wieder verschlechterte. »Das Geld des Colonels ist nicht alles.«
»Aber fast«, murmelte Quentin. Es hatte ihn beinahe ein Jahr gekostet, das Durcheinander der Erbschaften, Pensionen, Unterhaltszahlungen und sonstiger Zahlungen zu entwirren, aus denen meine Finanzen bestanden. Ein weiteres Jahr hatte er gebraucht, um sich zu erklären, auf welche Weise ich stets weit mehr ausgab, als ich besaß. Mit seiner Hilfe und ein paar geschickten Investitionen hatte ich es annähernd wieder in die schwarzen Zahlen geschafft. Der Großteil meines Einkommens diente noch immer dazu, die letzten Gläubiger zu befriedigen, und es würde noch lange dauern, bis ich wieder eine nennenswerte Rendite erzielen würde. Die Zuwendungen des Colonels ermöglichten mir Kleider aus Paris und Urlaub in St. Tropez. Ohne sie würde ich sparen müssen – etwas, das mir vermutlich nicht besonders gefallen würde.
Erneut wandte ich den Blick ab und sah aus dem Fenster, beobachtete, wie der Regen gegen das Glas schlug. Es war trostlos dort draußen, genau wie in England. Die letzten Monate des Jahres 1922 waren bedrückend gewesen, und 1923 kündigte sich mit kaum besserem Wetter an. Egal, wo ich hinging, es war grau und öde. Während ich zusah, verwandelten die Regentropfen sich in Graupel und prasselten heftig gegen das Glas. Himmel, dachte ich niedergeschlagen, warum kämpfe ich eigentlich darum, hier bleiben zu können?
»Also gut. Ich gehe«, sagte ich schließlich.
Mossy seufzte erleichtert, und sogar Weatherby wirkte ein kleines bisschen glücklicher. Die erste und höchste Hürde hatte ich genommen; sie hatten es geschafft, dass ich einwilligte fortzugehen. Nun fragte sich nur noch, wohin sie mich schicken würden.
»Amerika?«, schlug Quentin vor.
Ich warf ihm einen skeptischen Blick zu. »Verdammt unwahrscheinlich, Liebling.« Angesichts des Volstead Acts – der landesweiten Prohibition – und der Sullivan Ordinance, die es Frauen verbot, auf öffentlichen Plätzen zu rauchen, hätte ich in New York in der Öffentlichkeit keinem dieser Laster frönen können. Für ein Mädchen wurde es immer schwieriger, sich zu amüsieren. »Ich protestiere gegen die Einmischung der Bundesregierung in die Rechte des Individuums.«
»Protestierst du nicht vielmehr gegen den Mangel an anständigen Cocktails?«, murmelte Quentin.
»Nein, sie hat recht«, mischte Mossy sich ein. »Schließlich reist sie nicht einmal mit ihrem amerikanischen Reisepass, sondern mit dem britischen.«
Quentin warf Nigel einen kurzen Blick zu. »Ich glaube tatsächlich, Sir Nigel, dass Ihr ursprünglicher Vorschlag Afrika weiterer Überlegung wert ist.« Darüber hatten sie also diskutiert, als ich hereinkam – Afrika. Bei dem Wort wollte Mossy erneut Theater machen, und Nigel wies sie sanft zurecht. Mossy hasste Afrika. Dorthin war er mit ihr in die Flitterwochen gefahren, und um Haaresbreite hätte sie sich deshalb von ihm scheiden lassen. Irgendetwas mit Schlangen im Bett.
Nigel war als junger Mann nach Afrika gegangen, damals, als es noch ein Protektorat namens Britisch-Ostafrika war und nur ein Versprechen dessen, was es eines Tages vielleicht werden würde. Damals war es roh und jung, und die Luft vibrierte vor Möglichkeiten. Er hatte ein ansehnliches Stück Land gekauft und ein Haus am Ufer des Lake Wanyama gebaut. Er nannte es Fairlight, wegen des rosafarbenen Glanzes, den die untergehende Sonne auf den See legte, und er hatte vorgehabt, den Rest seines Lebens an diesem Ort zu verbringen, Vieh zu züchten und zu malen. Doch sein Herz war schwach, und so war er dem Rat seines Arztes gefolgt und hatte Fairlight verlassen, um mit nichts als gescheiterten Plänen und einem Tagebuch nach Hause zurückzukehren. Er warf nie einen Blick in das Buch; er sagte, dass er dann Heimweh nach jenem Ort bekäme, was merkwürdig klang, weil England seine Heimat war. Aber ich ging oft in seine Bibliothek und nahm es aus dem Regal. Ich behandelte es mit derselben Ehrfurcht, die ein Glaubender angesichts des Heiligen Grals empfinden würde. Dieses Tagebuch war ein geheimnisvoller Gegenstand, gebunden in die Haut eines Krokodils, das Nigel auf seiner ersten Safari erlegt hatte. Es war mit mattbrauner Tinte vollgeschrieben, voller Skizzen und mit Knochen, Perlen und Stückchen von Eierschalen versehen – eine lebendige Erinnerung an seine Zeit in Afrika und an einen Traum, der sich noch einmal aufbäumte, bevor er endgültig starb.
Als wäre der Einband nicht groß genug, um ganz Afrika zu umfassen, ließ das Buch sich nicht zuklappen, und ich saß stundenlang da und las und fuhr mit dem Finger über die schmale blaue Linie des Flusses, tauchte den kleinen Finger in das saphirblaue Becken des Lake Wanayama und folgte den hohen grünen Abhängen des Mount Kenya. Es gab sogar kleine Zeichnungen von Tieren, manche heiter, andere ziemlich albern. Affen tollten auf den Seiten herum, und auf einer vorzüglichen Zeichnung verbeugte sich ein Leopard vor einem Elefanten, der eine Krone trug. Es gab winzige Aquarellskizzen von Blumen, die so üppig und bunt waren, dass ich ihren Duft beinahe riechen konnte. Oder vielleicht lag das an den hauchdünnen Blüten, die Nigel zwischen den Seiten gepresst hatte und die nun braun und zerdrückt waren. Er beschwor Afrika für mich in diesem Buch herauf. Ich konnte es ganz deutlich vor meinem inneren Auge sehen. Immer hatte ich mir gewünscht, er könnte uns dorthinbringen, und insgeheim gehofft, dass Mossy ihre Meinung ändern und beschließen würde, Afrika zu lieben, damit ich selbst sehen konnte, ob der Leopard sich wirklich vor dem Elefanten verbeugte.
Aber das tat sie nie, und bald darauf packte sie unsere Sachen und verließ Nigel. Die Jahre vergingen, und ich vergaß meinen Traum von Afrika. Bis zu einem frühen Aprilmorgen mit Schneeregen in Paris, an dem ich die Nase voll hatte von Zeitungen und Tratsch und Gerede und einfach nur von allem fort wollte. Afrika. Schon das Wort besaß Zauberkraft für mich, und ich nahm einen tiefen Zug von der Zigarette, überrascht, dass meine Finger leicht zitterten.
»Also gut«, sagte ich gedehnt. »Ich gehe nach Afrika.«
2
Quentin hob sein Champagnerglas. »Einen Toast. Auf meinen tapferen Liebling Delilah und auf alle, die mit ihr gehen. Bon voyage!«
Kaum vierzehn Tage waren vergangen, doch ich hatte bereits alle Vorkehrungen getroffen. Ich hatte Kleidung bestellt, Koffer gepackt und Papiere besorgt. Das klingt einfach, doch tatsächlich bedeutete es endlose Besuche bei Couturiers und Ausrüstern, in Buchläden und stickigen Büros, um Tickets, Formulare und Genehmigungen zu besorgen. Am Ende war ich erschöpft, also beschloss ich natürlich, noch einmal richtig auf den Putz zu hauen und das Beste aus meinem letzten Abend in Paris herauszuholen. Quentin hatte vorausgesehen, dass ich ein wenig niedergeschlagen sein würde, und er hatte es so eingerichtet, dass er mich ausführen konnte. Alles in allem war es ein ziemlich mieser Tag gewesen. Fast ein Dutzend Mal wollte ich einen Rückzieher machen, was Afrika betraf, aber an diesem Morgen erschien Mossy in meiner Suite und schwenkte die neueste Ausgabe einer ordinären französischen Zeitung, der es irgendwie gelungen war, Fotos des toten Misha am Ort seines Selbstmordes zu kaufen. Sie wagten zwar nicht, sie zu veröffentlichen, aber die Beschreibungen waren grauenhaft genug, und sie hatten sich schauderhafte Freiheiten bei der Prosa erlaubt.
»›Der Fluch der Drummonds‹«, murmelte Mossy. »Wie können sie es wagen! Ich bin keine Drummond. Irgendwann im Jahr 1891 war ich ungefähr zehn Minuten lang mit Pink Drummond verheiratet. Ich kann mich kaum noch an sein Gesicht erinnern. Wenn sie über einen Fluch schreiben wollen, der auf den Frauen unserer Familie liegt, dann sollten sie über den L’Hommedieu-Fluch schreiben«, sagte sie und knallte die Tür hinter sich zu, um ihren Worten Nachdruck zu verleihen.
Und damit hatte ich jede Hoffnung aufgegeben, das Exil vermeiden zu können, und fing an, mir Cocktails einzugießen. Als Quentin mich abholte, war ich leicht beschwipst, aber er war verschwenderisch mit dem Champagner, und als wir im Club d’Enfer ankamen, war ich restlos betrunken.
Ich schwärmte für den Club d’Enfer. Wie der Name erwarten lässt, war das Etablissement eine Nachbildung der Hölle. Unter der Decke hing roter Satin in der Form von Flammen, und karminrote Lichter tauchten alles in eine sündhafte Glut. Ein durchtriebener kleiner Teufel stand an der Tür und begrüßte die Gäste, indem er mit seinem gespaltenen Schwanz raschelte und den Leuten mit seiner Forke ins Hinterteil piekte.
Quentin rieb sich den Allerwertesten. »Also wirklich, musste das denn sein?«
»Oh, Quentin, sei kein Spielverderber. Das hier hat swing.«
Hinter uns stieß meine Cousine Dora einen spitzen Schrei aus, als die Forke ihren Po berührte.
»Spar dir die Mühe«, sagte ich zu dem Teufel. »Sie ist Engländerin. Du wirst dort nichts finden als knochige Missbilligung.«
»Delilah, also wirklich«, protestierte sie, doch ich hörte schon nicht mehr zu. Ein dämonischer Kellner winkte uns zu einem Tisch in der Nähe der Bühne, und noch bevor wir Platz genommen hatten, bestellte Quentin Champagner.
Um uns pulsierte Musik, eine merkwürdige, misstönende Melodie, die an jedem anderen Ort völlig fehl am Platz gewesen wäre, in den Club d’Enfer jedoch passte sie ausgezeichnet.
Als wir saßen, näherte sich der Inhaber. Er – oder sie? – war eine eigenartig androgyne Kreatur mit den Gesichtszügen einer Frau und der Stimme eines Mannes in einem perfekt geschnittenen Smoking. Bei meinem ersten Besuch des Clubs hatte das Wesen sich mir als Régine vorgestellt und schien weder weiblich noch männlich zu sein. Oder beides. Ich hatte gehört, dass Régine eine Vorliebe für stark behaarte Männer oder Frauen mit Pferdegesichtern hatte, was ich beides nicht war.
Régine beugte sich tief über meine Hand, doch dann klemmte er oder sie sie entschlossen in ihre oder seine Armbeuge.
»Mein Herz ist betrübt, Mademoiselle! Wie ich höre, ist Paris im Begriff, einen seiner leuchtendsten Sterne zu verlieren.«
Solch blumige Sprache war im Umgang mit Régine ganz normal. Ich lächelte wehmütig.
»Ja, man hat mich nach Afrika verbannt. Offenbar bin ich zu unanständig, um in Paris zu bleiben.«
»Ein Verlust für die Stadt. Und reisen Sie allein in das pays sauvage?«
»Nein. Meine Cousine begleitet mich. Régine, kennen Sie Dora? Dora, bitte begrüß doch Régine.«
Dora murmelte etwas Höfliches, aber Régines Blick hatte sich belebt, als sie Doras lange, kummervolle Gesichtszüge musterte. »Noch ein großer Verlust für Paris.«
Dora senkte den Kopf, und ich betrachtete sie prüfend. »Dodo, wirst du etwa rot?«
»Natürlich nicht«, versetzte sie. »Das Licht ist rot.«
Régine zuckte die Schultern. »Ein unverzichtbarer Trick. Im Club d’Enfer müssen Sie wirklich glauben, auf einer Reise durch die Hölle zu sein.« Und damit küsste sie Dora die Hand. Die Röte in Doras Gesicht vertiefte sich, bevor Régine verschwand, um noch Champagner und einige köstliche Knabbereien für uns zu bestellen.
Quentin schüttelte den Kopf. »Ich muss zugeben, dass ich ein wenig besorgt um dich bin, Delilah. Afrika erinnert nicht im Entferntesten an Paris, weißt du. Oder New York. Oder St. Tropez. Oder auch nur an New Orleans.«
Ich nippte an dem Champagner und ließ mir die hübschen goldenen Bläschen heiter zu Kopf steigen. »Ich werde schon zurechtkommen, Quentin. Nigel hat mich mit Empfehlungsschreiben versorgt und mir freundlicherweise sein bestes Gewehr zum Geschenk gemacht. Ich bin gut vorbereitet.«
»Nicht die Rigby!«, sagte Quentin, doch er klang nicht überzeugt.
»Doch, die Rigby.« Es war das zweite Gewehr, mit dem ich schießen und das erste, das ich lieben lernte. Nigel hatte es bestellt, bevor er nach Afrika gegangen war, und es war ein prächtiges Ungetüm von Feuerwaffe – elf Pfund schwer und von so großem Kaliber, dass es einen Elefanten zu Fall gebracht hätte.
Quentin schüttelte den Kopf. »Nur Nigel ist so sentimental zu glauben, dass eine .416 die passende Waffe für eine Frau ist. Kannst du sie überhaupt hochheben?«
»Hochheben und besser damit schießen als alle seine Söhne. Darum hat er sie mir gegeben und nicht ihnen. Sie werden wütend sein, wenn sie merken, dass die Rigby verschwunden ist.« Ich grinste.
»Was ich ihnen nicht verübeln kann. Das Gewehr muss Nigel an die tausend Pfund gekostet haben. Du hast doch an Munition gedacht?«
»Natürlich habe ich das! Liebling, mach nicht so einen Wirbel. Ich werde hervorragend zurechtkommen. Außerdem passt Dora auf mich auf«, sagte ich und deutete mit dem Kinn auf die Stelle, an der sie saß und mürrisch in einem Ei mit scharfer Füllung herumstocherte.
»Arme Dora«, sagte Quentin, und vielleicht lag sogar ein Quäntchen aufrichtigen Mitgefühls darin. Quentin hatte Dora immer gerngehabt, so, wie man auch einen leicht inkontinenten Schoßhund gernhat. Die Tatsache, dass sie einem Spaniel auffallend ähnlich sah, war dabei nicht hilfreich. Sie war pflichtbewusst und langweilig und hatte nur an zwei Dingen im Leben Interesse – Gott und Gärten. Wir waren entfernte Cousinen, zweiten oder dritten Grades – die Äste des Stammbaums der Familie Drummond waren hoffnungslos verknotet. Doch sie war eine arme Verwandte aus der Familie meines Vaters, und als solche stand sie stets auf Abruf zur Verfügung, wenn ich einen Anstandswauwau brauchte. Sie war mir bereits um die halbe Welt gefolgt, und ich fragte mich, ob sie meiner Person ebenso überdrüssig war wie ich ihrer.
Sie blickte von ihrem Ei auf und lächelte Quentin an, während ich weiterredete. »Dora wird es nicht leicht haben, fürchte ich. Meine Zofe hat gekündigt, als ich ihr sagte, dass wir nach Afrika gehen würden. Und es lohnt sich nicht, eine neue auszubilden, nur damit sie von einer Kobra gebissen wird und irgendwann an der Cholera stirbt. Also wird Dora meine Zofe sein und mir gleichzeitig den Anschein von Ehrbarkeit verleihen.« Sie machte Anstalten zu protestieren, aber ich redete weiter. »Ich habe sie aus dem Salon direkt zu LaFleur’s geschleppt, damit Monsieur ihr beibringt, mir die Haare zu schneiden.« Dass ich mich in die Wildnis Afrikas stürzen würde, war keine Entschuldigung für ein ungepflegtes Äußeres. Mein glatter schwarzer Bubikopf brauchte regelmäßige und sehr akkurate Pflege, und es war naheliegend gewesen, Dora diese Aufgabe zu übertragen. Ich hatte ihr gesagt, sie sollte sich das Ganze als eine Art Baumbeschnitt oder wie Heckenpflege vorstellen.
Quentin lachte laut, ein sicheres Zeichen dafür, dass der Champagner ihm allmählich zu Kopf stieg.
Ich fixierte ihn mit meinem gewinnendsten Gesichtsausdruck. »Du kannst mir einen Gefallen tun, während ich weg bin.«
»Was immer du willst«, antwortete er unverzüglich.
»Ich habe mein Automobil in einer Garage in London abgestellt.« Ich griff in meine winzige, perlenbestickte Tasche, zog den Schlüssel heraus und schnippte ihn in sein Champagnerglas. »Hol es gelegentlich heraus und fahr ein wenig damit.«
Er starrte auf den Schlüssel, um den herum sich Bläschen gebildet hatten. »Der Hispano-Suiza? Aber der ist brandneu!«
Das war er in der Tat. Ich hatte ihn erst zwei Monate zuvor in Besitz genommen. Ein halbes Jahr lang hatte ich mir die Beine in den Bauch gestanden, bis sie die Farbe endlich richtig hinbekamen. Ich hatte den Händler angewiesen, das Automobil im Scharlachrot meines Lippenstiftes zu lackieren, was der Mann offenbar nicht verstehen konnte, bis ich schließlich einen karminroten Abdruck meiner Lippen auf der Wand in seinem Büro hinterließ. Ich hatte den Wagen mit Polstern in Leopardenmuster bestellt, und immer, wenn ich ihn fuhr, fühlte ich mich wild und stilvoll, wie eine moderne Boudicca, die britannische Königin mit ihrem Streitwagen.
»Ja, und darum will ich, dass er gefahren wird«, erklärte ich Quentin. »Dieses Automobil ist wie eine Frau. Wenn es ein ganzes Jahr herumsteht und nichts zu tun hat, setzt es Rost an. Und etwas so Schönes verdient es, ausgefahren und vorgeführt zu werden.«
Er fischte in dem Glas nach dem Schlüssel und trug eine so verwunderte Miene zur Schau, als hätte ich ihm gerade die Kronjuwelen in den Schoß gelegt. Sorgfältig trocknete er den Schlüssel mit seinem Taschentuch ab und steckte ihn in seine Tasche. Cornelia würde das nicht gefallen, aber das kümmerte weder mich noch Quentin.
Und dann stimmte die Kapelle ein Tanzlied an, etwas Sinnliches, Pulsierendes, und Quentin stand auf und reichte mir die Hand. »Tanzen?« Ich erhob mich, und er lächelte Dora an. »Der nächste Tanz gehört uns, in Ordnung?«
Sie winkte ihm zum Abschied zu, und ich schmiegte mich in seine Arme. Quentin war ein himmlischer Tänzer, und es lag etwas wunderbar Vertrautes in der Art, wie unsere Körper sich gemeinsam bewegten.
»Das hier habe ich vermisst, weißt du«, sagte er und streifte mit den Lippen mein Ohr.
»Nicht, Liebling«, sagte ich leichthin. »Dein Schnurrbart kitzelt.«
»Darüber hast du dich noch nie beklagt.«
»Ich hatte keine Gelegenheit dazu. Als wir ein Jahr verheiratet waren, wollte ich immer, dass du ihn abrasierst.«
Er umarmte mich fester. Der Rhythmus der Trommeln wurde drängender. »Manchmal denke ich, dass ich ein riesengroßer Idiot war, weil ich dich habe gehen lassen.«
»Werde nicht sentimental«, befahl ich ihm. »Mit Cornelia bist du viel besser dran. Und ihr habt die Zwillinge.«
»Die Zwillinge sind magenkrank und kurzsichtig. Sie kommen ganz nach ihrer Mutter.«
Ich lachte, als er mich durch eine Reihe komplizierter Schritte führte und mich dann wieder in seine Arme schwang. Er fühlte sich solide an. Quentin hatte nie die weichliche Art der Engländer an sich gehabt. Dafür war er viel zu versessen auf Kricket und Polo.
Ich fuhr ihm leicht mit der Hand über die Schulter und spürte, dass er erschauerte.
»Delilah, wenn du nicht gerade vorhast, mich für die Nacht heraufzubitten …«
Er beendete den Satz nicht. Es war nicht nötig. Wir wussten beide, dass ich das tun würde. Seit der Scheidung hatten wir mehr Nächte miteinander verbracht als während unserer Ehe. Natürlich nicht, als ich mit Misha verheiratet war. Das wäre ganz falsch gewesen. Aber es schien dumm zu sein, auf ein Schäferstündchen zu verzichten, wenn wir beide zufällig in derselben Stadt waren. Im Grunde genommen hatte Cornelia nichts von mir zu befürchten. Ich hatte ihn gehabt, und ich hatte ihn gehen lassen. Ganz gewiss würde ich nicht versuchen, ihn mir wieder zu nehmen. Tatsächlich glaubte ich sogar, ihr einen Gefallen zu tun. Nach einer Nacht mit mir war Quentin stets in fröhlicher Stimmung; es muss das Zusammenleben mit ihm leichter gemacht haben. Außerdem wurde er so sehr von Schuldgefühlen gequält, dass er jedes Mal mit einem teuren Geschenk für Cornelia nach Hause fuhr. Lächelnd blickte ich Quentin in die Augen und fragte mich, was sie diesmal bekommen würde. Im Schaufenster von Cartier in der Rue de la Paix hatte ich traumhafte Smaragdohrclips gesehen. Ich machte mir im Geiste eine Notiz, ihm davon zu erzählen.
Wir tanzten, und das Orchester spielte weiter.
Am nächsten Morgen verabschiedete ich mich von Paris und betrachtete es durch den Schleier eines ordentlichen Katers. Dora, die sich auf zwei Gläser Champagner beschränkt hatte, war entsetzlich munter. Paris hatte sein bestes Kleid angelegt, um sich von uns zu verabschieden. Die warme Frühlingssonne lugte durch die perlgrauen Röcke des Morgennebels, und eine leichte Brise strich durch das Laub der Bäume auf den Champs-Élysées und ließ es rascheln, als wollte jedes Blatt uns zum Abschied winken.
»Es könnte wenigstens wie aus Eimern schütten«, murmelte ich gereizt. Außerdem war ich ärgerlich, weil Mossy Weatherby geschickt hatte, der dafür sorgen sollte, dass ich den Zug nach Marseille auch wirklich bestieg. »Sagen Sie, Mr Weatherby, haben Sie vor, uns bis nach Mombasa zu begleiten? Oder trauen Sie uns zu, dass wir allein durch den Suezkanal fahren?«
Weatherby überhörte die Stichelei wohlweislich. Er überreichte mir einen prallen Koffer aus Saffian, der mit Papieren und Banknoten gefüllt war. »Hier sind Ihre Reisedokumente, Miss Drummond, und ein wenig Reisegeld von Sir Nigel, falls unerwartete Ausgaben auf Sie zukommen. Außerdem sind Empfehlungsbriefe darin.«
Ich bedachte ihn mit einem Lächeln, so scharf und spitz, dass ich Glas damit hätte schneiden können. »Wie vollkommen edwardianisch.«
Weatherby nahm Haltung an. »Es könnte hilfreich sein, in Kenia gewisse Leute kennenzulernen. Den Gouverneur zum Beispiel.«
»Tatsächlich? Werde ich ihm begegnen?«
Er atmete hörbar ein und schien um Geduld zu ringen. »Miss Drummond, ich glaube, Sie verstehen nicht ganz, in welcher Lage Sie sich befinden. Alleinstehenden Frauen ist es nicht gestattet, sich in Kenia niederzulassen. Sir Nigel hat erhebliche Mühen auf sich genommen, um Ihre Einreise zu ermöglichen. Der Gouverneur selbst hat die Genehmigung erteilt.«
Er fuchtelte mit einem Stück Papier voller offiziell aussehender Stempel herum. Ich spähte auf die Unterschrift. »Sir William Kendall.«
»Wie gesagt, der Gouverneur – und ein alter Freund Ihres Stiefvaters aus seiner Zeit in Kenia. Zweifellos wird er sich in Ihrem neuen Leben in Kenia als nützliche Verbindung erweisen.«
Ich schob die Genehmigung in meine Aktenmappe und übergab sie Dora. »Es ist sehr freundlich von Nigel, sich solche Mühe zu machen, aber ich habe kein neues Leben in Kenia, Mr Weatherby. Ich werde mich nur so lange dort aufhalten, bis alle aufhören, die Dinge so kompliziert zu machen. Wenn die Schlagzeilen vergessen sind, komme ich zurück«, erklärte ich ihm. Ich wollte noch mehr sagen, aber genau in diesem Moment gab es einen kleinen Aufruhr auf dem Bahnsteig. Eilige Schritte waren zu hören, eine Rempelei und schließlich das Gebell von Jagdhunden auf heißer Spur.
»Da ist sie!« Es waren Fotografen, und bevor sie ein brauchbares Bild schießen konnten, hatte Weatherby mich schon in den Zug geschoben und die Tür zugeworfen, wobei er Dora beinahe auf dem Bahnsteig zurückgelassen hätte. Sie kämpfte sich in den Zug und ließ die drängende Reportermeute hinter sich.
»Also wirklich«, murmelte Dora. Irgendwie war ihr Hut in dem Gedränge zerdrückt worden, und sie betrachtete ihn traurig.
»Versuch nicht, ihn zu reparieren, Dodo. So sieht er besser aus als vorher«, sagte ich. Ich ging ans Fenster und zog es herunter. Sofort stürzten die Fotografen auf den Zug zu, brüllten und ließen Blitzlichter zucken. Ich bedachte sie mit einer leicht ordinären Geste und einem breiten Grinsen. »Fotografiert, so viel ihr wollt, Jungs. Ich bin auf dem Weg nach Afrika!«
Als wir in Marseille an Bord des Schiffes gingen, hatte meine ausgelassene Stimmung sich verflüchtigt. Ich war es durchaus gewöhnt zu verreisen. Es gefiel mir, unterwegs zu sein, allen anderen einen Schritt voraus, und zu fahren, wohin meine Laune mich trieb. Allerdings hasste ich es, wenn man mir vorschrieb zu verreisen. Tatsächlich verletzte es mich sogar. Mossy hatte jede Menge Skandalgeschichten in der Presse überlebt, und nie hatte sie ins Exil gehen müssen. Natürlich war keiner ihrer Ehemänner je unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen. Sie hatte sich von allen scheiden lassen, außer von meinem Vater, dem armen Peregrine Drummond, Gott und aller Welt bekannt unter dem Namen Pink. Gleich nach den Flitterwochen war er in den Burenkrieg gezogen, ohne auch nur zu wissen, dass ich unterwegs war. Er starb an der Ruhr, bevor er sein Gewehr angerührt hatte – eine traurige Fußnote zu dem, was laut Mossy ansonsten ein verdammt gutes Leben gewesen war. Er war abenteuerlustig und charmant und teuflisch gut aussehend, und niemand konnte recht daran glauben, dass er sterben würde, als er sich in einen Eimer erbrach. Das war wirklich eine sehr banale Art, diese Welt zu verlassen.
Da es gut möglich war, dass Mossy den Titelerben der Drummonds erwartete, verbrachte sie die Schwangerschaft, indem sie auf dem Anwesen der Familie herumsaß und auf ihr Junges wartete. Sobald die Wehen begannen, fielen die fünf Brüder meines Vaters aus London in Cherryvale ein und liefen vor Mossys Zimmer auf und ab, bis der Arzt mit der Nachricht auftauchte, dass der Älteste von ihnen jetzt der unangefochtene Erbe des väterlichen Titels war. Mossy erzählte mir, dass sie die Champagnerkorken und gedämpften Freudenschreie durch die Tür hören konnte. Sie hätten sie nicht unterdrücken müssen. Wenn sie Mutter eines Erben geworden wäre, wäre sie gezwungen gewesen, bei ihren Schwiegereltern in Cherryvale zu bleiben. Da ich jedoch ein Mädchen und daher für niemanden sonderlich interessant war, durfte sie gehen. Die Aussicht, das Anwesen verlassen zu können, begeisterte sie so sehr, dass sie ihnen mit größtem Vergnügen selbst eine Runde Champagner spendiert hätte.
Und so kam es, dass sie mich einpackte, sobald sie wieder gehen konnte, und mit mir und Ingeborg ins Savoy zog, wo der Zimmerservice uns umsorgte. Mossy kehrte nie nach Cherryvale zurück, doch als meine Großeltern noch lebten, hielt ich mich in den Schulferien dort auf. Den Großteil der Zeit verbrachten sie damit, meine Haltung und meinen Akzent zu korrigieren. Endlich hörte ich auf, mit hängenden Schultern dazusitzen, nachdem ich gezwungen worden war, mit einem Exemplar von Fordyce’s Sermons auf dem Kopf stundenlang in der langen Gemäldegalerie in Cherryvale auf und ab zu gehen. Den schleppenden Louisiana-Tonfall hingegen, der sich auf meiner Zunge häuslich eingerichtet hatte, bin ich nie wieder losgeworden. Er wurde jeden Sommer stärker, wenn ich nach Reveille zurückkehrte, doch im Schulhalbjahr ließ er wieder nach, weil ich ihn zu unterdrücken versuchte, wenn die Mädchen sich über mich lustig machten. Ich bekam den Bogen einfach nicht raus mit diesen flachen, tonlosen englischen Vokalen, und irgendwann wurde mir klar, dass es viel leichter war, einfach das erste Mädchen zu verprügeln, das mich verspottete. Wegen Schlägereien bin ich von vier Schulen geflogen, und Mossy verzweifelte fast an der Aufgabe, eine Lady aus mir zu machen.
Doch ich beherrschte die Umgangsformen – die meisten jedenfalls – und debütierte 1911 in London. Mossy war wegen ihrer Scheidungen bei Hof nicht zugelassen, und so blieb es meiner Drummond-Tante überlassen, mich anständig in die Gesellschaft einzuführen. Sie tat es mit wenig Anmut und noch weniger Begeisterung, und ich vermutete, dass etwas Geld den Besitzer gewechselt hatte. Ich steckte mir meine schicken Prince-of-Wales-Straußenfedern ins Haar, fuhr in einer Kutsche zum Palast und knickste zweimal vor dem Königspaar. Am nächsten Abend besuchte ich meinen ersten Debütantinnenball, und zwei Tage später brannte ich mit einem schwarzhaarigen Jungen aus Devonshire durch, dessen Familie ihn fast enterbt hätte, weil er eine Amerikanerin geheiratet hatte, die als Mitgift nichts als Skandale vorzuweisen hatte.
Johnny war das egal. Er wollte nur mich, und da ich nur ihn wollte, lief alles wie am Schnürchen. Der Colonel steuerte als Geschenk ein nettes Sümmchen Bargeld bei, und Johnny bekam etwas Geld von seiner Familie. Er wollte schreiben, also kaufte ich ihm als Hochzeitsgeschenk eine Schreibmaschine, und er saß an unserem kleinen Küchentisch und haute in die Tasten, während ich die Koteletts anbrennen ließ. Jeden Abend las er mir seine Artikel und Auszüge aus seinem Roman vor, und schließlich fand ich heraus, wie ich das Anbrennen verhindern konnte. Als das Buch fertig war, hatte ich sogar gelernt, einen ordentlichen Auflauf zuzubereiten. Wir waren stolz aufeinander, und alles, was wir taten, schien neu zu sein, als würde es überhaupt zum ersten Mal von jemandem getan. Ob es sich um Sex handelte, um Prosa oder um Marmelade auf Toast – wir hatten es erfunden. Unsere gemeinsame Zeit war heiter, und als ich meine Erinnerungen hervorholte, um sie mir anzusehen, musste ich angestrengt nach einem Schatten Ausschau halten. Zerbrach der Spiegel, als ich mich auf den Rand der Badewanne setzte und ihm beim Rasieren zusah? Habe ich Salz verschüttet, wenn ich ihm Eier briet? Nistete eine Eule im Gebälk des Dachbodens? Ich war mit Omen großgezogen, mit schlechten Vorzeichen schon gestillt worden. Nicht von Mossy. Sie war ein neues Geschöpf, eine moderne Frau, obwohl ich beobachtet hatte, wie sie den Rosenkranz betete, als sie glaubte, dass ich es nicht sehe.
Aber da waren noch die anderen. Die verblühte alte Mutter des Colonels, Granny Miette, ihre Pflegerin Teenie und deren Tochter Angèle. Sie waren die Hüter meiner Kindheitssommer in Reveille, und sie pflegten die alten Sitten und Gebräuche. Sie wussten, dass nicht alles so ist, wie es scheint, und dass man die Schatten dessen, was einem bevorstand, im strahlend hellen Licht des eigenen Glücks bereits erkennen konnte. In Louisiana vergeht die Zeit langsamer, jede Minute verrinnt wie zäher, kalter Sirup. Reichlich Zeit, um zu sehen, wenn man es wollte, und herauszufinden, wo man nachgucken musste.
Während der Zeit mit Johnny achtete ich nicht auf Vorzeichen. Wenn ich einen Kleiderschrank öffnete und aus dem Augenwinkel etwas flattern sah, sagte ich mir, dass es Motten waren und sonst nichts, und dann legte ich Lavendel und Zedernholz in den Schrank, um sie zu vertreiben. Wenn ich einen Geschirrschrank aufmachte und einen Schatten vorbeihuschen sah, sagte ich mir, dass es Mäuse waren. Und dann kaufte ich eine Katze, den fiesesten Mäusefänger, den ich finden konnte. Ich schickte jemanden wegen goldfarbener Vetiverwurzel nach Reveille und trug das getrocknete Gras in kleinen Bündeln in meiner Tasche bei mir. Es war der Duft nach Sonnenlicht und Heimat, scharf und erdig und grün wie Zedern, und ich nähte eine Handvoll davon in die Uniform, die Johnny 1914 anzog.
Die Uniform kehrte zurück – oder zumindest Teile davon. Deutsche hatten ihn in der Schlacht an der Marne in Stücke gesprengt, und ich kann mich kaum noch erinnern, was danach geschah. Ein schwarzer Vorhang verdeckt diese Zeit, und ich ziehe ihn niemals beiseite, um einen Blick dahinter zu werfen. Es ist ein Ort, den ich in meiner Erinnerung nicht besuche, und es hat lange gedauert, bis ich ihn endlich verlassen konnte. Als ich wieder aus der Versenkung auftauchte, schnitt ich mir das Haar ab, kürzte meine Röcke und zog los, um nachzuholen, was ich in der Welt verpasst hatte. Es war ein interessanter Ausflug gewesen, zweifellos, doch die Dinge mussten mir irgendwie entglitten sein, da sie mich nun in die Verbannung nach Afrika führten. Ich hatte meine Angelegenheiten mit Stil erledigt, manchmal war ich sogar diskret gewesen. Aber die Welt konnte hart sein für ein Mädchen, das sich nur ein bisschen amüsieren wollte, und ich fühlte mich ziemlich ausgenutzt, als der Zug rumpelnd in den Bahnhof von Marseille einfuhr.
Beim Anblick des Schiffes kehrten meine Lebensgeister sofort zurück. Ich hatte die Wahl, ob ich mit einer britischen Gruppe oder später mit einer deutschen auslaufen wollte, aber ich hatte es rundheraus abgelehnt, mit einer Horde von Krauts nach Mombasa überzusetzen. Wegen Johnny hatte ich noch immer einen Groll auf sie und gönnte ihnen keinen Penny meines Geldes. Eine Woche früher in See zu stechen bedeutete zwar, die Schlussvorstellung von Cocteaus Antigone zu verpassen, aber ich ließ mich nicht umstimmen. Und als ich die Besatzung sah, machte es mir nicht einmal etwas aus, die Chanelkostüme und die Picasso-Sammeltassen zurückzulassen. Die Jungs waren absolut entzückend, jeder einzelne von ihnen, und während der folgenden vierzehn Tage hegte ich meinen Groll mit Stil. Der Steward an Deck sorgte dafür, dass mein Stuhl immer an der besten Stelle stand, in der Nähe der Sonne, aber bequem im Schatten, als wir uns weiter südwärts bewegten. Sobald ich mich morgens dort niederließ, stand er mit einer Reisedecke und einer Tasse heißer Bouillon bereit. Der Kellner befeuchtete leicht die Tischdecke an meinem Platz, damit mein Teller bei rauer See nicht wegrutschte und der Wein sich nicht auf meine französische Seide ergoss. Die älteren Offiziere führten mich abwechselnd auf die Tanzfläche, und die jüngeren sammelten reihenweise leere Flaschen ein. Wir dachten uns Botschaften aus, die wir darin versiegelten, eine alberner als die andere, und warfen sie über Bord, bis der Kapitän unserem Treiben ein Ende setzte. Doch er entschädigte mich dafür, indem er mich einlud, während der restlichen Reise an seinem Tisch zu sitzen, und ich entdeckte, dass er der beste Tänzer von allen war. Die arme Dodo war schwer seekrank und verkroch sich die gesamte Reise über in ihrer Kabine, mit einem Eimer zwischen den Knien und feuchten Umschlägen auf der Stirn.
Als wir an der alten portugiesischen Festung St. Jesus vorbei in den Hafen von Mombasa einliefen, fühlte ich mich tatsächlich schon viel besser. Ich hatte die Offiziere mit endlosen Fragen über die Stadt bestürmt, und sie redeten durcheinander, bis ich kaum noch zu Wort kam. Ich lernte ziemlich viel über Mombasa, obwohl sich mein Wissen auf Orte beschränkte, die für Seemänner reizvoll waren. Hätte ich einen Drink gebraucht oder eine Tätowierung oder eine billige Hure, dann hätte ich gewusst, wo ich das kriegen konnte, aber Fünf-Sterne-Hotels schienen knapp zu sein. Sie sagten, wenn wir am frühen Morgen in den Hafen einführen, könne ich mit dem Mittagszug direkt nach Nairobi fahren, ins Landesinnere, wo die weißen Kolonisten sich ihre Siedlungen erkämpft hatten. Der Kapitän hatte einen Onkel, der landeinwärts gefahren war, und er unterhielt mich mit Geschichten über Flusspferde in den Gärten und Leoparden auf den Bäumen. Ich wusste auch ein bisschen aus Nigels Erzählungen, aber das Wissen des Kapitäns war frischer, und obendrein bot er mir seinen Reiseführer zum Nachlesen an.
»Seien Sie vorsichtig mit den Eingeborenen«, warnte er mich. »Lassen Sie sich nicht von ihnen ausnutzen. Wenn Sie Rat brauchen, wenden Sie sich an einen Engländer, der das Land und die Gepflogenheiten kennt. Sie müssen unbedingt den Club in Nairobi besuchen. Es ist die beste Adresse, um etwas Gesellschaft zu haben und alle Neuigkeiten zu erfahren. Natürlich können Sie nicht beitreten, denn Sie sind eine Lady, aber als Gast eines Mitglieds wird man Ihnen Eintritt gewähren. Selbstverständlich wollen Sie sich unter Ihresgleichen mischen, aber machen Sie einen großen Bogen um alles Politische.«
»Politik! Und das hier am Ende der Welt?«, neckte ich ihn.
Der Kapitän hatte schöne Augen, doch sein Blick war so ernst, dass er die Wirkung schmälerte.
»Allerdings. Rhodesien hat im letzten Jahr die Unabhängigkeit von der Krone erlangt, und viele Menschen sind der Meinung, dass Kenia als nächstes an der Reihe ist.«
»Und wird England das Land so einfach gehen lassen wie Rhodesien?«
Eine senkrechte Falte grub sich zwischen seine Augenbrauen. »Schwer zu sagen. Wissen Sie, England interessiert sich eigentlich nicht für Afrika im Ganzen, im Grunde nicht. Es geht um die Kontrolle über Suez.« Er schlug den Reiseführer auf und zeigte auf die Landkarte, die darin lag. »Frankreich, England und Deutschland haben in Afrika Kolonien gegründet, um Suez im Auge zu behalten. Gegenwärtig haben wir einen gewissen Vorsprung«, sagte er mit einer Spur britischen Stolzes, »aber vielleicht ändert sich das. Alles hängt von der britischen Regierung in Whitehall ab und davon, wie nervös man dort wegen Indien ist.« Er zog eine Linie von Indien aus westwärts, zum Arabischen Meer, in den Golf von Aden und dann in einer scharfen Kurve durch die Enge des Roten Meeres bis nach Suez an der Spitze von Ägypten. »Sehen Sie? Wer Ägypten kontrolliert, kontrolliert auch den Suez und damit den Zugang zu den Reichtümern Indiens.«
Ich fuhr mit dem Finger über die schmale Linie des Nils. Einer seiner Arme, der Blaue Nil, schlängelte sich bis nach Äthiopien, doch der andere verlief durch Uganda und verlor sich dann irgendwo jenseits davon. »Und wer den Nil kontrolliert, kontrolliert Ägypten.«
»Das stimmt«, räumte er ein. »Derzeit kontrollieren wir Briten Ägypten, und der Suez ist sicher, aber die Dinge könnten sich ändern, wenn entdeckt wird, dass die letztendliche Quelle des Weißen Nils auf feindlichem Gebiet liegt.«
»Grund genug für England, an Kenia festzuhalten.«
»Nicht nur das«, sagte er und faltete die Karte bedächtig wieder zusammen. »England hat eine Verpflichtung den Indern gegenüber, die sich dort angesiedelt haben.«
»Inder? In Kenia?«
»Tausende«, sagte er grimmig. »Ja, während des Krieges haben sie ihren Teil getan, zweifellos. Aber es lässt sich nicht leugnen, dass sie die Dinge hier unendlich viel schwieriger gemacht haben. Sie setzen sich für das Recht auf Grundbesitz ein, und in Whitehall ist mancher geneigt, es ihnen zu gewähren.«
»Darüber sind die weißen Siedler sicher nicht glücklich.«
»Die Spannungen verstärken sich, und Sie tun gut daran, jeden Anschein von Parteinahme für die eine oder andere Seite zu vermeiden. Auch wenn niemand davon ausgehen wird, dass eine so reizende Lady wie Sie sich mit solchen Fragen abmüht«, fügte er hinzu. Seine Ritterlichkeit überraschte mich ein wenig.
»Kommen Sie bloß nicht auf die Idee, mit mir zu flirten«, warnte ich ihn und gab ihm einen leichten Klaps auf den Arm. »Ich weiß, dass Sie drüben in Southampton eine Frau haben.«
Er schenkte mir ein betrübtes Lächeln. »Das stimmt. Aber trotzdem darf ich mich an Ihrer unschuldigen und angenehmen Gesellschaft erfreuen.«
»Solange wir uns einig sind, dass es unschuldig bleibt«, antwortete ich und bedachte ihn mit einem schelmischen Blick.
Er lachte und füllte meinen Drink auf. »Mein Schiff und ich sind Ihnen stets zu Diensten, Miss Drummond. Womit können wir Sie unterhalten?«
Ich neigte den Kopf und tat, als müsste ich nachdenken. »Ich würde gern das Schiff steuern.«
3
Ich steuerte das Schiff tatsächlich, und beinahe hätte ich eine Insel gerammt, doch der Kapitän war sehr verständnisvoll, und wir schieden als Freunde. Als ich mit Dodo – die immer noch ziemlich mitgenommen aussah – von Bord ging, versammelte sich die Besatzung, um uns zum Abschied zu winken. Die Männer feuerten sogar einen Salutschuss ab. Ich warf ihnen Kusshände zu, bis Dodo mir schließlich fast den Arm auskugelte.
»Delilah, musst du dich immer so unmöglich aufführen?«, zischte sie. Ich versuchte, es nicht persönlich zu nehmen. Sie sah noch sehr blass aus und hielt inniglich ihren Eimer umklammert.
»Das liegt nicht an mir, Liebes. Die Jungs haben sich versammelt, um zuzusehen, wie wir an Land gehen. Es wäre unhöflich, das nicht zur Kenntnis zu nehmen.« Ich winkte ein letztes Mal, als ich in das Automobil stieg, das darauf wartete, uns zum Bahnhof zu bringen. Dodo würgte in ihren Eimer, während sie sich mit meinem Schmuckkästchen und einem Bücherstapel abmühte, der von einem Lederriemen zusammengehalten wurde. Die Bücher waren ein Geschenk der Crew, und jedes war mit einer wohlbedachten Widmung versehen.
Die Stadt Mombasa war so seltsam und wild, wie ich erwartet hatte, die Luft war feucht und von schweren Gerüchen nach Gewürzen, Rauch und Eseln erfüllt. Ich schnupperte genüsslich, doch Dodo stöhnte nur immer wieder leise vor sich hin, bis wir uns schließlich sicher im Zug niedergelassen hatten und uns von der Stadt entfernten.
Ich schob das Fenster herunter, ließ den Duft der Gewürze und einen Hauch des Holzrauchs, den die Lok ausstieß, herein. »Hier, Dodo, setz dich ans Fenster und steck den Kopf hinaus wie ein Hund. Die frische Luft wird dir guttun.«