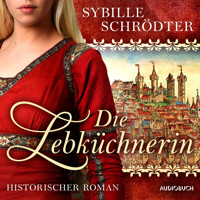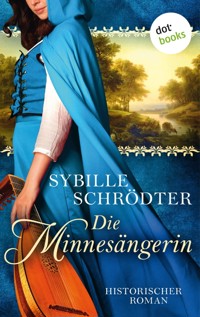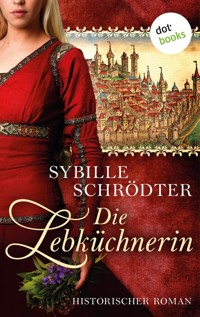2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Liebe über alle Grenzen hinweg Jamaika, 1883. In einem prachtvollen Anwesen an der wunderschönen Montego Bay wächst die junge und ungestüme Valerie bei ihrer Großmutter Hanne Sullivan auf. Als sie zum ersten Mal dem gutaussehenden James Fuller begegnet, ist sie sofort von seinem Charme verzaubert – doch seine Familie begegnet Valerie aufgrund ihrer dunklen Hautfarbe mit Abscheu. Mit einem Gefühl von Scham und Wut zieht sie sich vor James zurück und verlangt von ihrer Großmutter, endlich die Wahrheit ihrer Herkunft zu erfahren. Hanne sieht, dass es Zeit wird, das lange Schweigen zu lüften und erzählt eine tragische Geschichte von Liebe, Hass und der unsterblichen Hoffnung auf ein Glück entgegen aller Widerstände – bis zum Ende aller Tage … Ein mitreißender Karibik-Roman voller Schicksal und unerfüllter Träume für alle Fans von Tara Haigh und Catherine Tarley.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Über dieses Buch:
Jamaika, 1883. In einem prachtvollen Anwesen an der wunderschönen Montego Bay wächst die junge und ungestüme Valerie bei ihrer Großmutter Hanne Sullivan auf. Als sie zum ersten Mal dem gutaussehenden James Fuller begegnet, ist sie sofort von seinem Charme verzaubert – doch seine Familie begegnet Valerie aufgrund ihrer dunklen Hautfarbe mit Abscheu. Mit einem Gefühl von Scham und Wut zieht sie sich vor James zurück und verlangt von ihrer Großmutter, endlich die Wahrheit ihrer Herkunft zu erfahren. Hanne sieht, dass es Zeit wird, das lange Schweigen zu lüften und erzählt eine tragische Geschichte von Liebe, Hass und der unsterblichen Hoffnung auf ein Glück entgegen aller Widerstände – bis zum Ende aller Tage …
eBook-Neuausgabe August 2025
Dieses Buch erschien bereits 2012 unter dem Titel »Das Haus an der Montego Bay« bei Piper.
Copyright © der Originalausgabe 2012 Piper Verlag GmbH, München
Copyright © der Neuausgabe 2025 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Shutterstock/terekhov igor, BimineNatcha und AdobeStock/ana
eBook-Herstellung: dotbooks GmbH unter Verwendung von IGP (mm)
ISBN 978-3-98952-880-2
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people . Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected] . Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Sybille Schrödter
Der Himmel über Montego Bay
Roman
Prolog
Der Kaufmann hätte einen seiner Angestellten in das Lager schicken können, um die Rumfässer zu inspizieren, aber es hätte ihm etwas gefehlt, wenn er nicht täglich die knarrende Treppe hinab in sein Reich gestiegen wäre. Allein die Mischung aus würzigem Eichenholz und herbem Rumaroma! Der vertraute Duft schwebte über allem. Bis ans Ende seiner Tage würde er diesen letzten Kontrollgang am Abend machen.
Noch war an den Tod allerdings nicht zu denken. Der Kaufmann ging schließlich erst auf die vierzig zu, und dank seiner schönen, jungen Frau fühlte er sich in letzter Zeit eher verjüngt als gealtert. Beschwingt schlenderte er zwischen den zu beiden Seiten hoch aufgestapelten Fässern hindurch. Über zwanzig Jahre war er jetzt Herr über das Spirituosenimperium, nachdem sein Vater auf einer Überfahrt zu den karibischen Zuckerrohrinseln über Bord eines Schiffes der Westindischen Flotte gegangen war. Im Jahr 1810 hatte er das Geschäft mit dem Alkohol fast von der Schulbank aus übernehmen müssen. Gemeinsam mit seinem Bruder hatte er es zu voller Blüte gebracht. Der Spirituosenhandel lieferte seinen legendären Rum bis an den Hof des schwedisch-norwegischen Königshauses.
Er war mächtig stolz darauf, dass ihr Rum auch im Rohzustand der geschmacksintensivste und trinkbarste von allen war. Dass ihre Brennmeister auf den Inseln die besten ihres Fachs waren, war seiner Meinung nach einer der wichtigsten Gründe für den Erfolg ihrer Marke, hinzu kam die perfekte Arbeitsteilung zwischen ihm und seinem Bruder. Der war um zwei Jahre älter, der Abenteurer der Familie, und lebte seit dem Tod des Vaters in Christiansted, der Hauptstadt von Saint Croix, wo sich die Brennerei befand. Sein Bruder war zuständig für die firmeneigenen Zuckerrohrplantagen und die Herstellung des Rums, der Kaufmann hingegen kümmerte sich zu Hause in der zweitgrößten Hafenstadt des dänischen Gesamtstaates um den Verkauf, die einheimische Schnapsbrennerei und die Herstellung des dem Europäer mundenden Rums. Durch seine Heirat befand er sich sogar im Besitz eigener Schiffe und war dadurch zum reichsten Gesamthandelskaufmann der Stadt geworden.
Er selbst hatte allerdings zeitlebens keinen Fuß auf eine der Briggs oder gar auf die neue Bark gesetzt, um seinen Bruder im fernen Saint Croix zu besuchen. In diesem Punkt war er abergläubisch, weil sein Vater schließlich bei Sturm über Bord eines solchen Zweimasters gegangen war und sein Seemannsgrab in den Tiefen des Ärmelkanals gefunden hatte. So hatte er seinen Bruder seit über zwanzig Jahren nicht mehr gesehen. Damals war der Bruder nur kurz aus seiner karibischen Heimat zurückgekehrt, um eine reiche Kaufmannstochter aus Kopenhagen zu heiraten. Die Ehe schien nicht besonders glücklich, wie er aus den vielen Briefen schloss, die er aus Saint Croix bekam. Sein Bruder erwähnte seine Frau jedenfalls nie auch nur mit einem einzigen Wort. Bis auf das eine Mal neun Monate nach der Eheschließung, als sie ihm einen Sohn geboren hatte, auf den er sehr stolz war. Endlich ein Erbe! Und dieser Sohn war nun schon vor über einem Jahr von Saint Croix gekommen, um bei ihm, seinem Onkel, im Kontor das Kaufmännische zu erlernen.
Sein Neffe war nicht viel älter als seine Frau und ein von Ehrgeiz getriebener junger Mann. Zwar erwies er sich als geeignet für das Geschäft, doch menschlich war er dem Kaufmann eher fremd geblieben. Er empfand ihn als zu überheblich, und es missfiel ihm, dass er die Angestellten bisweilen wie Sklaven behandelte. Offenbar hatte er dieses Gebaren bei seiner Arbeit auf den Zuckerrohrplantagen übernommen. Ein ewiger Streitpunkt zwischen dem Kaufmann und seinem Neffen. Der Kaufmann lehnte die Sklavenhaltung vehement ab. Sein Neffe war der Meinung, die Herrschaft über die Schwarzen entspränge einem Naturgesetz. Die Dispute führten indessen zu nichts. Sein Neffe war unbeherrscht und verbissen. Der Kaufmann dagegen war ein Lebemann, der den weltlichen Genüssen nicht abgeneigt und dem es zu enervierend war, sich mit diesem Burschen bis aufs Blut zu streiten.
Der Kaufmann seufzte, während er stehen blieb, die mitgebrachte Funzel auf dem Boden abstellte und zwischen zwei Fässern eine Korbflasche Rum hervorholte. Er liebte das herbe Zeug, bevor es mit Wasser vermischt auf Trinkstärke gebracht wurde. Nur so konnte er die holzige Würze herausschmecken. Für ihn war dieser Schluck genauso ein Hochgenuss wie das Pfeiferauchen. Es würde ihm etwas fehlen ohne sein allabendliches Ritual, bevor er sich später auf seinem Anwesen vor den Kamin setzte oder sich ins warme Bett legte, um seine junge Frau in den Arm zu nehmen.
An diesem Abend trank er hastig einen zweiten Schluck, denn es quälte ihn die bange Frage, ob sie überhaupt Kinder bekommen konnte. Oder ob es gar an ihm lag, dass sich nach über einem Jahr Ehe immer noch kein Nachwuchs ankündigte. Und dabei hätte der Kaufmann, Senator und Betreiber des größten Spirituosenhandels der Stadt so gern einen eigenen Nachkommen gehabt. Er war der Ansicht, es wäre dem Familienunternehmen förderlich, wenn zwei Männer sich die Spitze teilten. Wenn es sein müsste, würde er sogar einer Tochter dieselben Rechte zugestehen. Doch seine Frau wurde nicht schwanger. Nun hatte er zumindest vorgesorgt für den unwahrscheinlichen Fall, dass ihm der Kindersegen verwehrt bleiben und ihm etwas zustoßen sollte. Dann nämlich, so hatte er bei dem alten Notar hinterlegt, würde seine Frau die Hälfte des Imperiums und sein privates Vermögen erben.
Er schüttelte sich, während er einen dritten Schluck nahm. Seit Jahren schon beschäftigte er sich mit der Frage, wie man den Rum noch weicher und runder machen könnte. So war und blieb es ein raues Getränk, das mit Vorsicht zu genießen war. Und das außer ihm kaum jemand pur zu sich nahm. Dementsprechend fühlte er sich bereits beim dritten kräftigen Schluck leicht benebelt. Dabei war er ganz nahe daran, eine Idee zu entwickeln, wie das Getränk für den Abnehmer noch genießbarer gemacht werden konnte.
Seiner Meinung nach waren Wohl und Wehe eines Rums abhängig von der Art des Destillierens. Er wusste allerdings auch aus der Obstbrennerei, dass mit jedem Brennen zwar der Alkoholgehalt stieg, der Geschmack jedoch immer fader wurde. Seit Jahren schon tüftelte er insgeheim an einer Destille, die beide Vorteile verband, also ergiebiger war. Gerade gestern erst hatte er seiner Frau davon erzählt, ihr die geheime Lade in seinem Schreibtisch und die darin verwahrten Zeichnungen seiner noch nicht vollendeten Destille gezeigt. Seine Frau war sehr böse geworden, als er ankündigte, sie für den Fall seines Ablebens in dieses Geheimnis einweihen zu wollen. Er solle nicht so etwas Schreckliches sagen, hatte sie geschimpft und ihm unter Tränen versichert, er sei bei besserer Gesundheit als manch junger Mann. Er hatte nicht durchblicken lassen, dass er genau wusste, auf wen sie dabei angespielt hatte. Im Gegenteil, er tat ihr gegenüber so, als hätte er keine Ahnung, wem ihr Herz zumindest zum Zeitpunkt der Heirat gehört hatte. Er war zufrieden mit dem, was er von ihr bekam, und das wurde immer mehr. Nicht dass er sich einbildete, sie liebte ihn leidenschaftlich, aber sie respektierte ihn. Dessen war er sich sicher. Und sie wünschte sich genauso intensiv ein Kind wie er ...
Doch ihre heftige Reaktion hatte den Rumhändler davon abgehalten, ihr von dem Testament zu ihren Gunsten zu berichten. Dem Umstand, dass ein Mann sich in seinem Alter zumindest in Gedanken mit dem möglichen Ableben beschäftigen musste, mochte sie sich nicht stellen.
Einen Schluck noch, dann tauche ich aus meiner Unterwelt auf, dachte er entschlossen, als er hinter sich ein Knarren vernahm.
»Ist da jemand?«, fragte er, während er panisch nach seiner Petroleumlampe griff und sich blitzartig umwandte. Doch mehr als seinen Schatten auf der weißen Wand, dort, wo keine Fässer gestapelt waren, entdeckte er nicht. Seinen Schatten!
Ich höre schon Gespenster, dachte er und nahm noch einen Schluck. Wenn es so um ihn bestellt war, dass er jetzt schon Geister sah, wollte er auch nicht mit dem Teufelszeug geizen. Dann würde er heute eben nur noch berauscht ins Bett fallen.
Da war es schon wieder! Er bildete sich das nicht ein. Außer ihm musste noch jemand im Lager ein! Er hielt den Atem an. Ob es von der anderen Seite des Ganges kam? Leise schlich er bis zum Ende und lugte vorsichtig um die Ecke. Als er mit der Lampe leuchtete, war auf den ersten Blick nichts Verdächtiges zu erkennen. Dann stutzte er. Was war das? In der Mitte des Ganges stand ein Fass. Das war ungewöhnlich. Er näherte sich zögernd. Was hatte das Fass mitten im Weg zu suchen? Jetzt drang ihm der strenge Geruch von Rum in die Nase. So intensiv konnte es gar nicht aus den verschlossenen Fässern riechen. Hier stimmte etwas nicht! Da sah er den Grund: Die oberen drei Reifen waren abgeschlagen worden, sodass das Fass sich aufgefächert hatte und der Deckel hineingefallen war. Deshalb verströmte die braune Flüssigkeit ihr Aroma so intensiv.
»Verdammich noch eins, wer macht denn so was?«, murmelte er und fragte sich, wem seiner Angestellten er wohl zutrauen würde, dass er sich hier unten im Keller heimlich Rum abfüllte. Und nicht einmal versuchte, die Spuren seines Vergehens zu beseitigen. Kopfschüttelnd beugte sich der Kaufmann über das offene Fass.
Da knarrte es erneut hinter ihm, doch er schaffte es nicht einmal mehr, sich umzudrehen, weil ihn eine Hand grob mit dem Kopf in das Fass stieß. Sein Bruder hatte ihn als Kind einmal mit dem Kopf in die Ostsee getaucht. Genauso fühlte sich das hier an. Nur dass das Salzwasser nicht so schrecklich in seinem Gesicht und seinen Augen gebrannt hatte wie der Rum. Die Angst war dieselbe. Die Angst zu ertrinken. Unfähig, einen Laut hervorzubringen, weil er in dem Augenblick verloren hatte, in dem er seinen Mund öffnete und die Flüssigkeit ihm in den Rachen drang. Das wusste er wohl. Er versuchte nach hinten zu treten und um sich zu schlagen, aber er trat und schlug ins Leere. Wenn er dem Dieb bloß erklären konnte, dass er den Vorfall vergessen würde, dass so ein kleiner Fehltritt es nicht wert sei, einen Mord zu begehen ...
Als könne der Angreifer Gedanken lesen, lockerte sich der mörderische Griff und er schöpfte Hoffnung. Bereute der Schuft seine Tat und entschied sich, nicht zum Mörder werden? Doch dann hörte er eine wütende Stimme brüllen: »Nun mach schon!« Sie kam ihm bekannt vor ...
Der Druck auf seinen Kopf verstärkte sich wieder. Er hatte vergeblich auf Gnade gehofft. Ein paarmal bemühte er sich, den Kopf zu heben, aber die Pranken, die ihn untertauchten, waren stärker. Lange würde er den Mund nicht mehr zu geschlossen halten können. Er brauchte Luft zum Atmen.
Wie von ferne und gedämpft drang ein Lachen an seine Ohren, ein hämisches Lachen, und auch wenn er es nur schwach wahrnahm, wusste er sofort, wem es gehörte. Die laute Stimme hatte soeben sein Todesurteil verkündet. Und in diesem Augenblick ahnte er, dass es keine Tat war, um einen kleinen Diebstahl zu vertuschen, sondern ein von langer Hand geplanter Mord mit einem großen Ziel.
Er öffnete den Mund und wollte um Hilfe schreien, doch die braune Flüssigkeit, die jetzt wie ein Wasserfall in seinen Hals schoss, ersparte ihm weiteres Leiden.
Teil I
Wie ich dich liebe? Laß mich zählen wie.
Ich liebe dich so tief, so hoch, so weit, als meine Seele blindlings reicht, wenn sie ihr Dasein abfühlt und die Ewigkeit.
Kapitel 1: Montego Bay, Jamaika, Februar 1883
Das imposante Haus, das in der gleißenden Sonne schneeweiß leuchtete, lag auf einem grünen Hügel über der Bucht.
In Montego Bay nannte man es Sullivan-House, benannt nach seiner Eigentümerin, Misses Hanne Sullivan, die bei ihren englischen Nachbarn nur Anne Sullivan hieß, da ihnen der Name Hanne nicht geläufig war. Jedermann in Montego Bay kannte den Weg zum weitaus prächtigsten Anwesen der ganzen Gegend. Von Weitem wirkte der imposante Bau im gregorianischen Stil wie eine Mischung aus Schloss und Burg. Ein Eindruck, der sich verstärkte, je näher man dem Gebäude kam. Der Weg dorthin führte zunächst durch eine Allee von Palmen, dann folgte zu beiden Seiten eine Reihe rot blühender Hibiskusbüsche.
Valerie liebte es, die lange Auffahrt hinaufzugaloppieren. Sehr zum Kummer ihrer Großmutter, die in ständiger Sorge schwebte, ihr könnte etwas zustoßen. Dabei munkelte man, dass die »nordische Lady«, wie die reiche alte Dame in einer Mischung aus Respekt und Furcht in Montego Bay genannt wurde, früher selbst einmal eine passionierte Reiterin gewesen wäre. Valeries Großmutter hatte dafür nur ein Kopfschütteln übrig, wie sie überhaupt niemals über ihre Vergangenheit redete. Dabei rankten sich die wildesten Gerüchte um Anne Sullivan. Hinter vorgehaltener Hand wurde sie gar von weniger freundlichen Zeitgenossen die »schwarze Frau« genannt. Doch das alles schien an Valeries Großmutter abzuprallen.
Sie war die stolzeste Frau, die Valerie jemals gekannt hatte, und sie war völlig anders als die alten englischen Ladys, die in den übrigen Herrenhäusern in Montego Bay lebten. Grandma, wie Valerie ihre Großmutter liebevoll nannte, nahm im Gegensatz zu den anderen Damen in keiner Weise am gesellschaftlichen Leben teil. Sie hasste die Vorstellung, zu den Ladys zum Tee oder mit ihnen zum Dinner zu gehen. Nein, sie lebte zurückgezogen auf ihrem Anwesen, und wenn sie überhaupt einmal von ihrem Hügel kam, dann ließ sie sich in einer geschlossenen Kutsche fahren.
Sie sah auch anders aus als die Damen, die Valerie in Grand- mas Alter kannte. Sie war sehr groß, hatte einen aufrechten Gang und besaß kein einziges graues Haar. »Das liegt in meiner Familie«, pflegte sie zu sagen, wenn Valerie für ihr weiches, helles Haar schwärmte.
Grandma trug ausschließlich schwarze elegante Kleider. »Warum trägst du immer nur Schwarz?«, hatte Valerie sie einmal als Kind gefragt.
»Weil ich das vor einer halben Ewigkeit beschlossen habe, nachdem mir etwas Wertvolles genommen worden ist«, hatte Grandma erwidert. Mehr gab sie nicht preis.
Das wenige, was Valerie wusste, war, dass Grandma keine Engländerin war, wenngleich sie die Sprache perfekt beherrschte. Und dass sie aus der zweitgrößten Hafenstadt des ehemaligen Dänischen Gesamtstaates stammte, aus Flensburg. Einer Stadt, die inzwischen zur preußischen Provinz Schleswig-Holstein gehörte.
Das allerdings hatte Valerie nicht in der Schule gelernt. Wenn man sie Geschichte lehrte, dann die des englischen Königshauses. Nein, das hatte Großmutter ihr beigebracht. Jedes Mal, wenn sie über ihre Heimatstadt sprachen, wurden Grandmas Augen feucht, und sie überspielte das, indem sie ihre Enkelin mit Informationen über Flensburgs wechselhafte Geschichte fütterte. Wenn Valerie es jedoch wagte, persönliche Fragen zu stellen, wehrte Grandma ab. Valerie hatte lediglich in Erfahrung bringen können, dass sie dort noch Verwandte hatte, die mit dem bekannten Hensen-Rum handelten, der auf Großmutters Zuckerrohrplantage in einer sagenumwobenen Destillerie gebrannt wurde, dann in Fässer gefüllt und zum Abtransport nach Flensburg bereitgemacht wurde.
Valerie kannte den Geschäftsführer von Grandmas Unternehmen, Mister Kilridge, der Großmutter in regelmäßigen Abständen Besuche abstattete. Dann zogen sich die beiden in den Salon zurück, und niemand durfte sie stören. Selbst Valerie nicht! Dabei hatte Grandma ihr von Kindheit an eingetrichtert, dass sie einst Herrin über das Unternehmen sein würde. Valerie fragte sich allerdings, wie sie das je bewerkstelligen sollte, wenn Grandma sie von allem fernhielt. »Du wirst alles noch früh genug erfahren«, pflegte ihre Großmutter zu sagen, wenn Valerie voller Ungeduld nachfragte. Mit denselben Worten wehrte sie auch Valeries Fragen nach dem Grund ab, warum sie im Gegensatz zu ihrer Großmutter pechschwarzes Haar und einen ganz und gar nicht blassen Teint besaß. Valerie sah vielmehr stets aus, als hätte sie den Tag ohne Sonnenschirm im Freien verbracht, was sich für eine junge Lady keinesfalls gehörte.
Diese dumme Hautfarbe, dachte sie erbost, denn in diesem Moment konnte sie nicht mehr länger verdrängen, was ihr soeben im hochherrschaftlichen Salon der Fullers widerfahren war. Sie gab ihrem Pferd die Sporen, während sie spürte, wie die Zornesröte in ihr aufstieg.
Es hatte ein netter Nachmittag beim Tee werden sollen, diese erste Begegnung mit James Fuller nach der Geschichte mit dem Pferd. Seine Mutter war neugierig gewesen, die junge Frau kennenzulernen, die ihren Sohn zum Held der gesamten Frauenwelt Montego Bays gemacht hatte. Deshalb hatte sie Valerie zum Tee eingeladen. Wenn Valerie daran dachte, wie sehr sie sich darauf gefreut hatte, James wiederzusehen, wurde sie nur noch wütender. Und wie fest sie sich vorgenommen hatte, bei seiner Mutter einen guten Eindruck zu machen ... Doch anstatt beweisen zu können, dass sie drei Sprachen beherrschte, Klavierspielen konnte, überaus gebildet und eine exzellente Reiterin war, taxierte Misses Fuller die ganze Zeit über verstohlen Valeries Gesichtsfarbe. So lange, bis Valerie es nicht mehr aushielt. Sie wählte den Augenblick, als James den Salon kurz verlassen hatte. Wahrscheinlich hatte er das angespannte Schweigen nicht mehr ertragen. Natürlich hätte Valerie ihren Mund halten sollen, aber das entsprach nicht ihrem Naturell. Und sie war schließlich freundlich und höflich geblieben und hatte lediglich eine kleine Bitte geäußert.
»Misses Fuller, wenn mir etwas von Ihrem köstlichen Teekuchen im Mundwinkel hängt, so sagen Sie es mir bitte. Ich würde umgehend Abhilfe schaffen.«
In dem Moment ließ Misses Fuller ihre freundliche Maske fallen. Wie eine Verbrecherin starrte sie Valerie an. »Wer sind Sie? Ich erkenne Mischlinge auf den ersten Blick. Sie können mir nichts vormachen. Sie besitzen zwar ein spitzes Näschen, einen relativ schmalen Mund und blaue Augen, aber kann mir mal einer erklären, woher Sie dieses pechschwarze Haar und den dunklen Teint haben? Da stimmt doch was nicht bei der ›nordischen Lady‹ da oben auf ihrem Hügel! Das haben wir immer gewusst!«
Valerie war wie erstarrt. Dass sie in der feinen Gesellschaft Montego Bays manchmal schief angeguckt wurde, daran hatte sie sich gewöhnt. Dass jemand derart unverfroren über ihre Herkunft spekulierte, war ihr jedoch noch nicht vorgekommen, und sie war nicht gewillt, so mit sich reden zu lassen. Denn das hatte ihr Grandma schon als Kind beigebracht: Kümmere dich nie darum, was die Leute reden. Trage den Kopf hoch, und lass dich niemals in die Niederungen derer ziehen, die andere Menschen verurteilen. Sie sind es nicht wert, dass du dich mit ihnen beschäftigst.
Diese mahnenden Worte waren Valerie in Fleisch und Blut übergegangen. Als in der Schule einmal ein Mädchen mit dem Finger auf sie gezeigt hatte, war sie wie eine Furie auf es losgegangen. Die Lehrerin hatte sie daraufhin bestraft, aber bei ihren Mitschülerinnen hatte sie sich einen höllischen Respekt verschafft. Alle wollten ihre Freundin sein. Und so war es geblieben. Valerie war immer ein beliebtes Kind gewesen und inzwischen zu einer begehrten Partie geworden.
Deshalb musste Valerie angesichts von Misses Fullers unverschämtem Verhalten auch nicht lange überlegen. Sie sprang von dem unbequemen Sofa auf und scherte sich nicht darum, dass sie dabei versehentlich ihre Tasse umwarf und der Tee sich über die blütenweiße Tischdecke ergoss.
»Auf Wiedersehen, Misses Fuller«, zischte sie, während sie hocherhobenen Hauptes zur Garderobe eilte, wo ihr der schwarze Butler stumm das Reitcape reichte.
Draußen vor der Tür wäre sie fast mit James zusammengestoßen. Er sah sie wie einen Geist an. »Miss Sullivan? Was ist geschehen? Wo wollen Sie hin?«
»Nach Hause! Ihre Frau Mutter hat sich in Spekulationen über mein Haar und meine Hautfarbe ergangen. Ich bin doch kein Stück Vieh!«
»Aber, Miss Sullivan, das hat sie bestimmt nicht so gemeint. Wissen Sie, Sie müssen das verstehen. Mutter kommt aus einer Familie, in der, ja, dort hat man bis zuletzt Sklaven gehalten, Großvater war ein Mann mit Prinzipien. Er war stolz darauf, niemals eine seiner Sklavinnen angerührt zu haben. Er verachtete die Zuckerbarone, die sich an den Schwarzen vergingen, denn er hasste es, wenn sich das Blut vermischte ...«
Valerie wandte sich daraufhin wortlos von dem jungen Mann ab und eilte zu den Stallungen. Was er als Entschuldigung vorbrachte, machte das Ganze nur noch schlimmer. Denn noch etwas hatte Grandma ihr beigebracht: Nicht die Hautfarbe eines Menschen war entscheidend für seinen Charakter, sondern seine Herzensbildung. »Und glaube mir, mein Kind«, pflegte sie oft versonnen zu sagen, »ich habe in meinem bewegten Leben schlechte weiße Menschen und gute schwarze Menschen kennengelernt.« Es kostete Valerie jedes Mal große Überwindung, nicht danach zu fragen, warum Grandma immer so einen verträumten Gesichtsausdruck bekam, wenn sie diesen Satz sprach.
Valerie verspürte auf einmal die unbändige Lust, noch einmal umzudrehen und über den Strand zu galoppieren, aber Grandma erwartete sie zum Essen. Und das gemeinsame Abendessen war im Hause Sullivan ein Muss. Genau wie das Cribbage-Spiel danach. Dieses urenglische Kartenspiel beherrschte Grandma wie eine echte englische Lady. Valerie bedauerte zunehmend, dass Grandma diese Passion nicht mit anderen Damen ihres Alters teilte. Denn was wäre, wenn sie, Valerie, eines Tages heiraten und Grandma verlassen würde? Dann hätte die arme Frau keinen Menschen mehr, mit dem sie sich vergnügen konnte. Diese Vorstellung machte Valerie schwer zu schaffen. Und sosehr sie sich danach sehnte, am Strand entlangzupreschen, sie ritt nun langsamer, damit Grandma nicht allein beim Blick aus dem Fenster einen Herzschlag erlitt. Wie so oft wartete die alte Dame bestimmt bereits ungeduldig in der ersten Etage des prächtigen Herrenhauses und verschwand erst im allerletzten Moment, um ihr Verhalten vor Valerie zu verbergen. Dabei wusste Valerie schon seit ihrer Kindheit, dass Grandma jedes Mal am Fenster stand, wenn sie die Rückkehr ihrer Enkelin erwartete.
Valerie stieß einen tiefen Seufzer aus und zwang sich, keinen flüchtigen Blick nach oben zu werfen, je mehr sie sich dem Haus näherte. In der Schule hatten die Mitschülerinnen oft mit leichtem Gruseln festgestellt, dass es ein Abklatsch von Rose Hall war, jenem unheimlichen, inzwischen längst verfallenen Haus in der Nähe von Montego Bay, in dem eine grausame weiße Frau ihre Männer angeblich ermordet und Sklaven zu Tode gequält hatte. Und man munkelte auch, dass diese Frau, die im Volksmund »weiße Hexe« genannt wurde, des Voodoo-Zaubers mächtig gewesen sein sollte. Heute wusste Valerie, dass die äußere Ähnlichkeit der Häuser darin begründet lag, dass Rose Hall im Jahre 1760 von demselben Architekten für einen Zuckerbaron entworfen worden war.
Ein flüchtiger Blick auf das Fenster im oberen Stockwerk bewies Valerie, dass Grandma tatsächlich bis eben dort gestanden hatte, denn die Gardine bewegte sich, obwohl an diesem heißen Tag kein einziger Luftzug durch das Haus ging.
Valerie übergab ihren Hengst Black Beauty dem Stallburschen und tätschelte dem Pferd zum Abschluss den Hals. Was für ein schönes Tier! Und was für ein Glück, dass sie es bekommen hatte, wenn auch auf seltsame Weise. Grandma hatte sich nämlich strikt geweigert, ihr ein eigenes Pferd zu schenken, aus dieser blödsinnigen Angst heraus, wie Valerie fand, ihr könne etwas zustoßen. Ihr wurde etwas wehmütig ums Herz, während sie auf den Eingang zueilte. In Gedanken war sie bei jenem Tag, an dem sie in den Besitz dieses wertvollen Tieres gelangt und der untrennbar mit James Fuller verbunden war. Aber diesen jungen Mann wollte sie, nach allem, was ihr vorhin widerfahren war, niemals wiedersehen. Dennoch stand ihr sein Bild so intensiv vor Augen, dass es beinahe schmerzte.
Es war vor zwei Monaten passiert. Sie erinnerte sich an jede Einzelheit, als wäre es gestern gewesen: An jenem Tag war Valerie Zuschauerin bei einem Pferderennen. Am Start waren alle jungen Männer der feinen englischen Gesellschaft, vor Kraft strotzende Kerle, die aus allen Ecken der Insel nach Montego Bay gekommen waren, um sich mit den anderen zu messen. Es war kein professionelles Rennen, sondern ein Wettbewerb der jungen Männer. Es ging um Prestige und Macht. Geld hatten sie alle genug, die Söhne der wohlhabenden Handelshäuser. Nein, bei diesem Ereignis ging es allein darum, zu beweisen, was für gute potenzielle Ehemänner sie waren. Und das vor den heiratsfähigen Damen. Valerie war mit ein paar Freundinnen dort. Kichernd und hinter vorgehaltener Hand tauschten sie sich über ihre Favoriten aus. Valerie gefiel James Fuller mit Abstand am besten. Ein blond gelockter, hochgewachsener Engländer, dessen Schwester Cecily ihre beste Freundin war. Schon seit ihrer Kindheit waren sie unzertrennlich. Sehr zum Kummer von Cecilys Mutter und Valeries Großmutter. Offenbar gab es eine abgrundtiefe Abneigung zwischen diesen beiden Frauen, über die Valerie aber trotz mehrfacher Nachfrage bislang nichts Näheres hatte erfahren können. Strahlend verriet Valerie ihrer Freundin, dass sie James Fuller von allen jungen Männern am attraktivsten fand.
»Mach dir keine Hoffnungen«, flüsterte Cecily ihr daraufhin ins Ohr, »bei uns zu Hause bestimmt Mutter, wen wir heiraten, und sie hat bereits eine für ihn ausgeguckt!«
Valerie zuckte mit den Achseln. Es war ja nicht so, dass sie sich in den Reiter unsterblich verliebt hatte. Aber sein Pferd war das Schönste von allen! Die Spannung stieg, dann fiel der Startschuss. Die Pferde schossen aus ihren Boxen. Alle bis auf eins! Der schwarze Hengst von James Fuller blieb stehen. Er rührte sich nicht vom Fleck. Der Reiter versuchte alles, vergeblich! Valerie hielt den Atem an.
»O weh, das arme Tier!«, bemerkte Cecily entsetzt, und Valerie wusste genau, was sie damit sagen wollte. Aller Augen waren nämlich auf James Fuller gerichtet und nicht auf die Pferde, die ins Rennen gegangen waren. Nein, die ganze feine Gesellschaft ergötzte sich voller Schadenfreude an dem störrischen Pferd, das sein Besitzer offenbar nicht im Griff hatte. Schlimmer konnte ihn sein Pferd gar nicht blamieren. Ein Pferdebesitzer, dem sein Tier nicht gehorchte, gab sich der Lächerlichkeit preis.
Valerie war derart aufgeregt, dass sie an den Fingernägeln kaute. Sie wünschte sich von Herzen, dass James Fuller die Zügel seines Pferdes ergriff und sich zurückzog. Doch er stieg ab, stand völlig verschwitzt und verzweifelt vor dem Tier und schien zu überlegen, wie er mit dieser Schmach umgehen sollte. Nimm dein Pferd und verlass die Box, betete Valerie. In dem Augenblick brachen die Schiedsrichter das Rennen ab. Einer nach dem anderen kehrte zu den Boxen zurück, die meisten Reiter mit einem Grinsen auf den Lippen. Hier ging es nicht ums Gewinnen, sondern darum, was man den Damen bot. Und alle waren sich sicher, dass sie eine gute Figur machten – alle, bis auf James Fuller, der immer noch fassungslos vor seinem ungehorsamen Pferd stand und nicht wusste, was er tun sollte.
»Feigling!«, brüllte jemand aus den Zuschauerreihen.
»Wer bestimmt bei euch? Das Pferd oder du?«, schrie ein anderer.
Valerie war erschüttert. Dachte denn keiner daran, dass das Schicksal des edlen Tieres damit besiegelt war? Dann begriff sie, dass die Zuschauer genau das herausforderten.
»Sei ein Kerl!«, ertönte es aufpeitschend.
Er wird sich doch nicht provozieren lassen, ging es Valerie bang durch den Kopf. Sie hatte den Gedanken noch gar nicht zu Ende geführt, als der junge Mann eine Waffe zog. Sein Gesicht war inzwischen wutverzerrt, seine Nerven zum Zerreißen gespannt, während er auf das stolze Tier zielte.
Valerie schrie auf.
»Nein! Nein, tun Sie das nicht!«
Er sah verblüfft in ihre Richtung. Für sie gab es kein Halten mehr. Sie überquerte die Absperrung und rannte auf Pferd und Reiter zu. Mit ausgebreiteten Armen stellte sie sich vor das Tier.
»Gehen Sie aus dem Weg!« James war außer sich vor Zorn und inzwischen offensichtlich fest entschlossen, die Blamage mit Gewalt aus der Welt zu schaffen.
»Dann müssen Sie zuerst mich erschießen!« Valerie trat keinen Schritt zur Seite. James musterte sie intensiv. Alle Härte war aus seinen Gesichtszügen gewichen. Ein Lächeln umspielte seine Lippen. »Das werde ich tunlichst vermeiden«, erwiderte er und ließ die Waffe sinken.
Von den Zuschauerrängen ertönte kein einziger Laut mehr. Es herrschte Totenstille. Valerie hielt den Atem an. Sie wusste, was die Meute dachte. Wie würde sich James Fuller aus der Affäre ziehen? Er konnte sich doch nicht von einer Frau – und schon gar nicht von der Enkelin der geheimnisvollen »nordischen Lady« – ausbremsen lassen.
Valerie stieß einen tiefen Seufzer aus. Auch bei Nähe betrachtet gefiel ihr der junge Mann, ja, sogar noch besser als von ferne, aber daran mochte sie in diesem Moment keinen Gedanken verschwenden. Sie hatte eine größere Mission zu erfüllen: Das prächtige Pferd durfte nicht sterben!
James Fuller fand als Erster die Sprache wieder.
»Was erwarten Sie von mir?«
Valerie sah ihm direkt in die Augen.
»Nehmen Sie nicht mehr am Rennen teil und bringen Sie Ihr Pferd von hier weg!«
»Sie meinen also, ich soll alles vergeben und vergessen?«
»Ja, sehen Sie, Ihr Pferd hat es nicht böse gemeint. Was wissen Sie, warum es nicht losgerannt ist. Das kann viele Gründe haben, aber deshalb müssen Sie es doch nicht erschießen!«
»Ich will es nicht mehr sehen. Es muss mir aus den Augen«, erwiderte James. Der Ton seiner Stimme war hart, aber sein Blick blieb weich.
»Gut«, erklärte Valerie kämpferisch und packte die Zügel an. »Dann geben Sie es mir!«
James sah sie fassungslos an. »Sie wollen mein Pferd?«
Valerie nickte. »So ist es Ihnen aus den Augen und muss nicht büßen. Das ist doch eine gute Lösung.« Valerie entging es nicht, dass aus seinen Augen Bewunderung sprach.
Er überlegte einen Augenblick, bevor er nach draußen wies. »Nehmen Sie es eben mit. Meinetwegen!«
In dem Moment wurde in den Zuschauerbänken ein Raunen laut, und dann applaudierte jemand. Andere fielen ein. Valerie heftete den Blick auf die Reihen der Zuschauer. Ihre Freundin Cecily war von ihrem Sitz aufgesprungen.
»Bravo, James!«, brüllte sie begeistert.
In ihr Rufen fielen die übrigen Damen der feinen Gesellschaft, um die es bei diesem Schauspiel ging, euphorisch ein. Sie standen auf und klatschten frenetisch Beifall. James war ihr Held und stellte alle anderen Männer in den Schatten, obwohl er das Rennen nicht gewonnen, ja, nicht einmal daran teilgenommen hatte. Die jungen Damen wollten etwas anderes als einen verschwitzten Sieger.
»James, James!«, ertönten viele helle Frauenstimmen.
»Danke, James«, bedankte sich Valerie bei ihm. Ihre Stimme klang rau und tief. »Darf ich?«, fügte sie leise hinzu, während sie auf das Pferd stieg.
»Ich bitte darum!«, erwiderte er höflich, doch aus seinen Augen sprach mehr. Eine Mischung aus Bewunderung und Zuneigung. »Ich wünsche Ihnen alles Glück mit meinem Pferd. Sie sind eine wunderbare Frau. Wissen Sie das?«, flüsterte er.
Valerie warf ihm einen wohlwollenden Blick zu. Wenn er wüsste, wie wunderbar ich ihn erst finde, dachte sie verträumt und gab dem Pferd vorsichtig die Sporen. Unter dem Beifall aller heiratsfähigen jungen Frauen Montego Bays ritt Valerie auf dem schönen Hengst davon. Sie wusste gar nicht, wie er hieß. Er war schwarz wie die Nacht. Und so wunderschön. »Black Beauty«, raunte sie, »bei mir heißt du Black Beauty!«
»Sag mal, wo warst du denn bloß? Du bist den ganzen Nachmittag fort gewesen!« Grandmas aufgeregte Stimme holte Valerie aus ihren versponnenen Gedanken. Sie blickte ihre Großmutter schuldbewusst an. In der Tat hatte sie sich einfach davongeschlichen, weil sie ja wusste, dass Grandma die Fullers nicht besonders gut leiden konnte. Cecily wäre eine Ausnahme, betonte Grandma immer. Sie käme ganz nach ihrer Großtante. Jedes Mal, wenn Valerie nachfragte, entwich Grandmas Mund nicht mehr als ein langer Seufzer. Valerie war ja schon froh, dass Grandma ihr den Kontakt zu Cecily nicht gänzlich verbot, wie sie es bereits manches Mal getan hatte, wenn sie die Eltern ihrer Freundinnen nicht mochte. Cecilys Besuche duldete Grandma, aber sie hatte ihrer Enkelin das Versprechen abverlangt, ihrerseits das Haus der Freundin niemals zu betreten ...
Und nun hatte sie gegen dieses Verbot verstoßen! Natürlich hatte sie sich nicht getraut, Großmutter zu gestehen, dass Misses Fuller sie zum Tee eingeladen hatte. Sie war sich sicher, dass Grandma es ihr untersagt hätte. Und sie war doch so entsetzlich neugierig gewesen und hatte dummerweise gehofft, bei James Mutter einen guten Eindruck zu machen. Nun bedauerte sie zutiefst, dass sie freiwillig einen Fuß in das Haus der Fullers gesetzt hatte. Und nur, weil sie James hatte wiedersehen wollen. Und was hatte er getan? Sie mit seiner unverschämten Mutter allein gelassen!
Plötzlich fiel Valerie ein, dass Cecily sich seit dem Tag des Rennens nicht mehr bei ihr hatte blicken lassen. Und warum war sie beim Tee nicht dabei gewesen? Misses Fuller hatte behauptet, Cecily wäre in Kingston. Aber das würde ich doch wissen, durchfuhr es Valerie bang. Da stimmte etwas nicht! Darüber nachzugrübeln war jetzt allerdings nicht der richtige Zeitpunkt, denn Valeries Großmutter sah sie fordernd an. Sie erwartete offenbar eine Erklärung für Valeries langes Fortbleiben an diesem Nachmittag. Valerie suchte in Gedanken krampfhaft nach den richtigen Worten.
»Träumst du?«, fragte Grandma unwirsch.
»Nein, nein, ich, ich will dir ja sagen, wo ... ich, ich meine ... wo ich gewesen bin«, stammelte Valerie.
»Ich höre!«
Valerie räusperte sich ein paarmal. Verweigerte Grandma ihr nicht auch ständig Antworten auf ihre drängenden Fragen?
»Ich möchte es dir nicht sagen!«, hörte sich Valerie da bereits mit bebender Stimme sagen.
»Was soll das heißen?«, gab ihre Großmutter fassungslos zurück.
»Du hast ständig Geheimnisse. Warum verrätst du mir nicht, warum du partout nicht willst, dass ich das Haus der Fullers betrete?«
Täuschte sich Valerie, oder war Grandma bleich geworden?
»Gut, ich nenne dir den Grund, nachdem du mir gesagt hast, wo du dich den ganzen Nachmittag herumgetrieben hast!«
Valerie kämpfte mit sich, ob sie eine Ausrede erfinden sollte. So wie sie es getan hatte, als ihre Großmutter wissen wollte, wie sie zu dem wertvollen Pferd gekommen war. Doch dann entschloss sie sich, der Großmutter keine Lügen aufzutischen. Auch wenn die Wahrheit ihr einigen Ärger einbringen würde.
»Ich war bei den Fullers, aber tröste dich, ich werde das Haus nie wieder betreten. Es war entsetzlich!«
»Du warst hinter meinem Rücken im Haus von Elizabeth Fuller?«
Valerie nickte schuldbewusst. »Ich weiß, ich hätte es dir sagen sollen, aber ich hatte Sorge, du würdest es mir nicht erlauben ...«
»Worauf du dich verlassen kannst!«, schnaubte Grandma. »Was hattest du da zu suchen?«
Valerie kämpfte mit sich. War das wirklich der geeignete Zeitpunkt, Grandma die ganze Wahrheit zu gestehen? »Wollen wir uns nicht zum Essen hinsetzen, und ich erzähle dir in aller Ruhe, was geschehen ist?«
Grandma schüttelte unwirsch den Kopf. »Nein, das Essen kann warten.« Sie machte dem Dienstmädchen Asha ein Zeichen, mit dem Servieren der Speisen noch zu warten. »Was hattest du im Haus von Elizabeth Hamilton ... ich meine Fuller zu suchen?«
»Ich habe dir doch von dem Rennen erzählt und dass mir ein junger Mann sein Pferd geschenkt hat, statt es zu erschießen?«
Grandma stöhnte auf. »Ja, dieser Dummkopf aus Kingston!«
»Er war nicht aus Kingston, sondern aus Montego Bay. Es war James Fuller!«
»Und warum hast du mich belogen?«, fragte Grandma in scharfem Ton.
»Was hättest du wohl gesagt, wenn ich dir erzählt hätte, dass mir James Fuller ein teures Rennpferd geschenkt hat?«
»Ich hätte gesagt, das gibst du sofort zurück!«
»Eben!«
»Du gibst es sofort zurück. Verstehst du?« Grandma war einen Schritt auf Valerie zugetreten und funkelte ihre Enkelin bedrohlich an.
Valerie aber verschränkte die Arme vor der Brust und zischte: »Nein, ich werde mich nicht von Black Beauty trennen. Und wenn es dir hundertmal nicht passt, dass ich ihn von James Fuller bekommen habe. Was weiß ich, warum du etwas gegen diese Familie hast. Wahrscheinlich noch so ein Geheimnis, das dich umgibt, wie der blaue Nebel die Gipfel der Blue Mountains. Aber ich habe es satt, darauf Rücksicht zu nehmen. Ich gebe das Pferd nicht her!«
Grandma und sie standen einander gegenüber wie zwei Kämpferinnen, eine stolzer als die andere.
»Und was ist dir dort im Hause der Hamiltons widerfahren?« Grandmas Ton war eiskalt.
»Willst du das wirklich wissen?«, gab Valerie wütend zurück.
»Ich höre!«
Valeries tapfere Fassade brach plötzlich wie ein Kartenhaus zusammen. Tränen rannen ihre Wangen hinunter. Sofort gab auch Grandma ihre unversöhnliche Haltung auf. Sie zog die Enkelin an ihre Brust und drückte sie zärtlich.
»Nicht weinen, mein Engel. Merke dir: Kein Hamilton bringt uns je zum Weinen!«
»Aber was redest du immer von Hamiltons?«, schniefte Valerie.
Grandma seufzte. »Das ist eine lange Geschichte. Hamilton ist der Geburtsname von Misses Fuller. Wie dem auch immer sei, bitte gräme dich nicht. Und vergieß keine Träne wegen dieser Leute. Also, was hat sie dir angetan?«
Grandma trat einen Schritt zurück, legte ihre Hand unter Valeries Kinn und blickte sie durchdringend an.
»Sie hat mich eingeladen. Ein Dienstbote hat mir die Nachricht überbracht, dass ich heute zum Tee kommen solle. Sie wolle gern die Frau kennenlernen, die James’ Blamage in einen Sieg umgewandelt habe. Ich habe dir doch erzählt, dass alle jungen Frauen diesem Mann applaudiert haben, nicht wahr?«
»Ja, ja, aber nun erzähl schon. Was ist vorgefallen?«
»Sie hat mich die ganze Zeit neugierig und voller Skepsis gemustert: Ich glaube, am liebsten hätte sie mir ein Stück Haut herausgekratzt, um es zu untersuchen. Da habe ich sie gefragt, ob mir ein Krümel ihres Kuchens im Mundwinkel klebt. Sie hat mich angefahren, dass ich wohl ein Mischling sei und dass etwas faul sei im Haus der ›nordischen Lady‹.«
Valerie erwartete nun eine Strafpredigt Grandmas, stattdessen nahm die alte Dame sie erneut in den Arm.
»Wenn man ein netter Mensch wäre, würde man zu ihrer Entschuldigung vorbringen, dass sie nichts dafür kann, weil sie die Erziehung ihres Vaters unreflektiert übernommen hat ...«
Valerie befreite sich aus der Umarmung und blickte ihre Großmutter verwundert an. »Das hat James auch gesagt!«
Den Einwurf überhörte Grandma geflissentlich. »Was Elizabeth Hamilton angeht, bin ich allerdings nicht nett. Sie hat sich nie die Mühe gemacht, die Ansichten ihres Vaters zu hinterfragen so wie ihre Tante. Keiner hat sie gezwungen, dümmlich nachzuschwätzen, was die Männer im Haus von sich gegeben haben!«
»Dann kennst du sie also näher?«
»Sagen wir mal lieber so: Ich kannte Hamiltons Schwester, also, die Schwester ihres Vaters, Tante Jane«, erwiderte Grandma ausweichend.
Valerie verdrehte die Augen. »Immer das Gleiche! Wenn ich etwas anspreche, bekomme ich einen Brocken hingeworfen. Wovor hast du Angst? Dass ich dich nicht mehr bewundere, wenn ich erfahre, wie du als junge Frau gewesen bist? Dass Geheimnisse gelüftet werden, die dich in schlechtem Licht erscheinen lassen?«
»Jane Hamilton war meine Freundin. Die Einzige, die ich jemals hatte, seit es mich nach Jamaika verschlagen hat!« Grandma senkte den Kopf.
»Oder hast du davor Angst, ich könne jemals erfahren, dass schwarzes Blut in meinen Adern fließt?«
Grandma sah erschrocken auf. »Wie kommst du darauf?«
Valerie stieß einen tiefen Seufzer aus. »Erklär mir endlich, warum ich nicht deine blonden Locken geerbt habe!« Sie griff nach einer gerahmten Fotografie ihrer Eltern und deutete mit dem Finger darauf. »Mutters Haar ist auch hell, wenn ich mich nicht täusche, und Vater, gut, er hat dunkles Haar, aber er ist auch kein Schwarzer. Großmutter, sprich doch endlich!«
Grandma ließ sich auf einen Stuhl fallen. »Glaube mir, mein Kind, du sollst einmal alles erfahren, was deine Familie betrifft. Bitte, hab Geduld bis zu deinem einundzwanzigsten Geburtstag!«
Valerie hob abwehrend die Hände. »Warum, Grandma? Warum soll ich warten? Glaubst du, ich bin nicht reif genug? Ich bin achtzehn Jahre, und ich bin stark. Ganz gleich, was ich erfahren werde, es bringt mich nicht aus der Fassung. Aber ich möchte, sollte ich noch einmal von einer dummen Gans wie Misses Fuller derart auf den Prüfstand gestellt werden, eine Antwort parat haben. Und wenn ich ihr erwidern müsste: Ja, ich bin ein Mischling, so ist mir das tausendmal lieber, als unwissend zu bleiben.«
Valerie blickte ihre Großmutter flehend an, als diese sich erhob und langsam zur Anrichte hinüberging. Zum ersten Mal wurde Valerie Zeugin, wie die stolze Haltung der Großmutter vor ihren Augen in sich zusammenfiel. Sie ging gebückt und wirkte wie eine alte Frau. Valerie schlug die Hände vors Gesicht. Das hatte sie doch nicht gewollt.
»Grandma, es tut mir leid. Ich habe kein Recht, so in dich zu dringen. Es war nur mein Zorn auf James und seine Familie ...«
Grandma wandte sich zu ihr um. Sie wirkte bleich und schwach. »Nein, Valerie, du irrst. Natürlich hast du ein Recht, alles über deine Familie zu erfahren. Ich war als junge Frau genauso wie du. Glaub es mir. Ungestüm, leidenschaftlich und ungeduldig! Mein Begleiter in schweren wie in guten Zeiten war dieses Buch. Zum Teil war es mein einziger Vertrauter. Wie eine gute Freundin. Dann gab es ein Ereignis in meinem Leben, da habe ich aufgehört zu vertrauen, selbst diesem Buch nicht mehr. Doch vor vielen Jahren, nachdem deine Eltern gestorben sind, habe ich schonungslos alles niedergeschrieben, was ich lieber für mich behalten hätte, um endlich zur Ruhe zu kommen. Danach wurde ich zu der Frau, die du kennst. Nie wieder wollte ich auch nur einen Gedanken an die Vergangenheit verschwenden. Mir konnte keiner mehr etwas anhaben ...« Grandma griff in die rechte Schublade und holte ein dickes Buch mit einem braunen Lederumschlag hervor. Sie drückte es an ihr Herz und warf einen entrückten Blick an Valerie vorbei in die Ferne. »Ich habe viele Jahre nicht mehr daran gedacht, und ich habe Angst, dass mich alles wieder überfällt und mich auffrisst wie eine tödliche Krankheit«, murmelte sie.
Valerie hielt den Atem an. Sie bedauerte zutiefst, darauf gedrungen zu haben, in Grandmas Geheimnisse eingeweiht zu werden. Und zum ersten Mal kamen ihr Zweifel, ob es wirklich besser wäre, wenn sie die Wahrheit um ihre Herkunft kannte. Was, wenn sie dieses Wissen nicht entlasten, sondern eher beschweren würde? Doch nun gab es kein Entrinnen mehr, denn Grandma legte das schwere Buch vor ihrer Enkelin auf den Tisch. »Ich habe nur eine Bitte, mein Kind. Bitte urteile nicht vorschnell über mich und andere. Im Übrigen möchte ich den Weg in die Vergangenheit nicht noch einmal gehen, und sei es nur als deine Begleiterin. Du bist also allein auf dich gestellt. Ich möchte nichts davon wissen. Alle Fragen wird dir dieses Tagebuch beantworten.«
Erschrocken schob Valerie das Buch von sich weg. »Nimm es zurück! Ich will es nicht. Ich will überhaupt nichts mehr wissen«, stieß sie ängstlich hervor.
»Nein, mein Kind, nimm es an dich. Es gehört dir. Und wenn du es nicht lesen möchtest, verwahre es in deiner Schublade. Aber von heute an kannst du allein entscheiden, ob du etwas erfahren willst oder nicht. Ich sehe ein, dass es unsinnig wäre, bis zu deinem einundzwanzigsten Geburtstag zu warten. Du musst dich allein entscheiden, ob du dein Herz an James Fuller verschenken möchtest oder nicht ...«
»Hör auf mit James Fuller! Die Entscheidung ist längst getroffen! Ich hasse ihn und will ihn niemals wiedersehen.«
Ein wissendes Lächeln umspielte Grandmas Mund, und sie strich ihrer Enkelin zärtlich eine Haarsträhne aus dem Gesicht. »Was habe ich dir stets gepredigt? Urteile niemals vorschnell. Und vor allem: Versuche nie, dein Herz zu betrügen.«
Valerie lief knallrot an. Es ist zum Verrücktwerden, dachte sie, woher weiß sie, dass er mir nicht gleichgültig ist, geschweige denn, dass ich ihn nicht hasse, sosehr ich mir das auch wünschte?
Unwirsch griff sie nach dem Tagebuch ihrer Großmutter.
»Gut, ich nehme es mit! Aber ich werde es nicht anrühren. Es interessiert mich nämlich nicht. Vor allem, was soll das alles, wenn du mir im Vorwege untersagst, mit dir darüber zu sprechen!«
»Ich habe nicht gesagt, dass du gar nicht mit mir darüber reden kannst«, entgegnete Grandma in sanftem Ton. »Wenn du die ganze Wahrheit kennst, werde ich dir mit Rat und Tat zur Seite stehen. Doch du musst zunächst alles wissen, bevor du weitreichende Entscheidungen für dein Leben treffen kannst.«
Valerie sah ihre Großmutter verzweifelt an. »Aber ich will gar keine solchen Entscheidungen treffen! Ich möchte am Strand entlanggaloppieren, mir schöne Kleider nähen lassen, meine Freundinnen treffen ...«
»Mein Liebling, mach dir nichts vor. Du hast mir heute bewiesen, dass du kein Kind mehr bist. Und ich habe deine Kindheit so lange hinauszögern wollen, wie es nur geht. Aber du bist bereits, ob du es willst oder nicht, ob ich es schrecklich finde oder nicht, zu einer jungen Frau herangewachsen, die ihren eigenen Weg gehen muss. Oder hast du noch nie einen Gedanken daran verschwendet, dass du mich eines Tages verlassen wirst?«
Valerie wand sich. Wie oft hatte sie sich in den letzten Monaten mit dieser Frage gequält, was wohl wäre, wenn sie mit James ... nein, sie wollte das nicht zulassen, aber es ließ sich nicht verdrängen. Seit sie James Fuller begegnet war, hatte sie an nichts anderes mehr gedacht. Was würde aus Großmutter werden, wenn sie das Haus verließ?
»Nein, daran habe ich noch nie gedacht«, entgegnete sie wahrheitswidrig. »Aber wenn du mich loswerden willst«, fügte sie trotzig hinzu.
Großmutter lächelte. »Du hast dir also vorgestellt, den Rest deines Lebens als Gesellschafterin einer wunderlich gewordenen Alten zu verbringen?«
»Ach, lass mich doch in Ruhe!«, schnaubte Valerie. Sie fühlte sich, als habe Grandma ihr wieder einmal bis auf den Grund der Seele geblickt. Zornig schnappte sie sich das dicke Buch. In der Tür drehte sie sich noch einmal um. »Glaube ja nicht, dass ich es an mich nehme, um meine Entscheidung bezüglich Mister James Fullers zu überdenken. Der Mann ist mir gleichgültig. Hörst du? Völlig gleichgültig!«
Schmunzelnd sah Hanne Sullivan ihrer Enkelin hinterher. Wenn sie bloß wüsste, wie ähnlich wir uns sind, dachte sie und beschloss, sich auf der Veranda ihr Lieblingsgetränk zu genehmigen. Gewiss war sie die einzige Person auf der Insel, die in diesem feucht-heißen Klima Wasser mit heißem Rum trank.
Sie läutete nach Asha, die den Wunsch nach Alkohol vor dem Essen mit einem unwirschen Kopfschütteln quittierte. »Ich denke, Sie sollten ihn als Dessert nach dem Dinner genießen, Missus.«
»Das Abendessen fällt heute aus«, entgegnete Valeries Großmutter trocken. »Und du sollst nicht immer Missus zu mir sagen. Das erinnert mich an die Zeiten der Sklaverei. Misses Sullivan ist mir lieber.« Jetzt lächelte sie.
Asha aber sah sie ungläubig an.
»Das Abendessen fällt aus? Was sind das für neue Moden? Aber das hat es noch nie gegeben. Ojemine! Seit ich für Sie arbeite, Missus, ich meine Misses Sullivan, ist so etwas kein einziges Mal vorgekommen, und das sind nun, wenn ich richtig zähle, bereits über vierzig Jahre. Ojemine!« Sie streckte die Arme zum Himmel und begann zu jammern. »Ojemine, und der schöne gesalzene Fisch mit den Okras. Was mache ich bloß damit? Stattdessen trinkt die Missus kill devil auf nüchternen Magen.« Asha schüttelte sich.
»Asha, du übertreibst, ich trinke den Rum mit heißem Wasser. Kill devil war der pure untrinkbare Rum, den deine armen Vorfahren von ihren Herren zum Saufen bekommen haben, damit sie die Arbeit auf den Zuckerrohrplantagen überhaupt aushalten konnten. Und was den Fisch angeht, schlage ich vor, du gibst ein fürstliches Essen für alle Angestellten!«
Statt sich zu freuen, funkelte Asha Misses Sullivan aus ihren dunklen, beinahe schwarzen Augen missbilligend an. »Aber natürlich, Missus Sullivan, aber wenn Sie wieder einen Rausch haben, ich bring sie nicht ins Bett.«
»Habe ich das verlangt?«, gab die Dame des Hauses spitz zurück. Das Lächeln war aus ihrem Gesicht verschwunden. Sie wusste es zu schätzen, dass sich Asha um sie sorgte, seit sie sie ein paarmal beim Trinken ertappt hatte. Und wahrscheinlich spürte die Gute, dass das so ein Abend werden konnte. Aber sie konnte jetzt keine Predigten gebrauchen.
»Bring mir bitte den Grog!«, verlangte Misses Sullivan in schärferem Ton als beabsichtigt. Als Asha sich daraufhin wortlos und mit wütender Miene auf dem Absatz umdrehte, ahnte Misses Sullivan, dass sie ihre Hausangestellte schwer beleidigt hatte. Und nichts lag ihr ferner als das.
»Asha, bitte warte! Der Tag heute ist ein besonders schwieriger. Glaube mir!«
Die Hausangestellte blieb stehen und wandte sich Misses Sullivan erneut zu. Ihre Gesichtszüge hatten sich entspannt.
»Heute ist der Tag, vor dem ich mich die letzten achtzehn Jahre am meisten gefürchtet habe«, murmelte Misses Sullivan. »Miss Valerie ist erwachsen geworden!«
Asha stieß einen tiefen Seufzer aus. »Wie bei Miss Henny. An dem Abend ist das Essen auch ausgefallen und ... ojemine, ich möchte gar nicht daran denken.«
Valeries Großmutter rang sich zu einem Lächeln durch. »Das weißt du noch?«
Asha nickte eifrig.
»Wir können nur hoffen, dass es dieses Mal ein glückliches Ende nimmt«, seufzte die alte Dame.
»Wird schon, Missus, ich mache den Grog fertig. Ich verspreche, er wird extrastark.« Mit diesen Worten entfernte sich die Haushälterin.
Hanne stieß einen tiefen Seufzer aus und ließ ihren Blick über die Bucht schweifen. Für sie gab es keinen schöneren Ort auf Erden als diesen. Wenngleich das Haus auf Saint Croix auch einzigartig gewesen war. Und doch schweifte sie in Gedanken an einen ganzen anderen Ort ab, wo es oft kalt und nass gewesen war. Das Haus hatte ebenfalls auf einem Hügel gestanden, umgeben von einem riesigen Park, doch wo hier Zedern, Palmen und Mahagonibäume wuchsen, hatte es dort Eichen, Birken und Buchen gegeben ... Und man hatte nicht auf smaragdfarbene ruhige Wasser des karibischen Meeres geblickt, sondern auf die graublauen Wellen der Ostsee ... Die Sehnsucht, dieses Haus noch einmal in ihrem Leben wiederzusehen, hatte sie lange Zeit nicht mehr verspürt. In diesem Moment aber wallte sie stärker denn je auf. Hanne wusste allerdings, dass es ihr nicht vergönnt sein würde, jemals wieder einen Fuß auf Heimaterde zu setzen. Diese Chance hatte sie ungenutzt verstreichen lassen.
Plötzlich dachte sie an Valerie und stellte sich vor, wie sie das Tagebuch mit spitzen Fingern in eine Schublade steckte, fest entschlossen, es niemals anzurühren, dann im Zimmer auf und ab lief, am offenen Fenster stehen blieb, um den betörenden Duft der Hibiskusblüten einzuatmen. Und wie sie sich der Schublade dann zögernd nähern, das Buch hervorkramen und schließlich den Deckel aufklappen würde. Hanne stellte sich vor, wie sie eine Weile auf der Titelseite verweilte. Sie würde erst Schwierigkeiten haben, die verschnörkelte Jungmädchenschrift zu entziffern, aber nachdem sie die Buchstaben erfasst hatte, würde sie die folgende Widmung lesen:
Tagebuch der Reederstochter Hanne Asmussen, Geschenk ihrer Mutter Jette zum achtzehnten Geburtstag. Anno 1830.
Kapitel 2: Flensburg, Juli 1830
Sie glauben, ich merke es nicht, dass sie Sorgen haben, aber sie können es schwerlich verstecken. Mutter wird immer blasser und dünner. Und sie hustet ständig. Wenn ich sie frage, ob sie krank ist, beeilt sie sich immer, mir zu versichern, dass alles in Ordnung sei. Dabei bleibt sie auffällig häufig ganze Tage im Bett liegen. Da stimmt etwas nicht, warum sprechen sie nicht darüber? Bei Vater liegt der Fall wesentlich einfacher. Er wird immer ungerechter und aufbrausender, und ich ahne, warum. Bei Tisch wird ja von nichts anderem geredet. Die Erwachsenen denken wohl, ich verstehe nicht, wovon sie sprechen, aber da haben sie sich getäuscht.
Es ist eine Tragödie. Vater steht kurz vor dem Ruin. Er hat über die Hälfte seiner Schiffe durch den verdammten Krieg verloren. Mutter schimpft ständig auf die Engländer, die Gewinner, während Vater kein gutes Haar am dänischen König lässt, der sich ja unbedingt mit den Franzmännern verbünden musste, wie er es ausdrückt. Dann gibt es bei Tisch jedes Mal einen handfesten Krach. Mutter nennt Vater einen »deutschen Dickschädel«, Vater Mutter ein »dänisches blindes Huhn«. Ich merke im Alltag allerdings kaum, dass Vaters Vermögen schwindet. Ich bekomme immer noch alles, was mein Herz begehrt, und wir wohnen auch noch immer oben auf dem Hügel, umgeben von einem riesigen Park, der zu unserem Haus gehört. Es ist der größte Landschaftsgarten der ganzen Stadt und Vaters ganzer Stolz. Wer hat schon geheimnisvolle Grotten in seinem Park und einen Wasserfall?
Mein liebster Ort ist die Spiegelgrotte, ein unterirdischer Achteckbau, der durch die dreizehn Spiegel unendlich groß wirkt. Vater sagt immer, das solle die Unendlichkeit der Welt symbolisieren. Doch gerade vor ein paar Wochen hat Vater uns bei Tisch gestanden, dass uns nun nur noch die Hälfte des Gartens gehört. Und ausgerechnet den Teil mit dem Wasserfall und der Spiegelgrotte hat er verkauft. Und nur, weil der reiche Kaufmann Pit Hensen, der unlängst das angrenzende Gelände erworben und Clausens Haus in einen Protzbau verwandelt hat, Vaters Notlage ausgenutzt und ihm viel Geld für unseren Garten geboten hat. Es wundert mich, dass der Mann sich nicht gleich ein Schloss errichtet hat. Welches Haus braucht denn schon zehn Türme? Vater flucht nun den ganzen Tag offen auf den neuen Nachbarn, denn eigentlich hatte er Senator Clausens Haus nach dessen Tod noch dazukaufen wollen. Jetzt hockt dieser Geldsack unter meinem Wasserfall, schimpft er den ganzen Tag. Allein deshalb hasse ich diesen Kerl. Weil er Vater unglücklich macht! Doch daran kann ich natürlich ermessen, wie schlecht es um Vaters Finanzen bestellt sein muss. Dass er von dem so verhassten Menschen Geld angenommen hat.
Und dann kam vorige Woche auch noch die Nachricht vom Untergang der Brigg Else von Flensburg, Vaters bestem Schiff, mithilfe dessen er wie so viele andere Reeder nicht nur die Waren der anderen transportieren, sondern endlich auch seine eigenen Waren verkaufen und den Profit des Handels selbst einstreichen wollte. Ich musste den Salon verlassen, als der Kapitän der Condor Vater die traurige Botschaft überbrachte, aber unser Mädchen Anna hat den Herren einen Grog serviert und jedes Wort brühwarm an mich weitergegeben.
Die Condor war in der Nähe gewesen, als das Unglück geschah und hatte die vierzehn Mann Besatzung retten können. Auch meinen Schwager Heinrich Andresen, den Kapitän der »Else«, aber der lag nun mit einer Kopfverletzung danieder und hatte Vater die Nachricht nicht selbst beibringen können. Ich war daraufhin umgehend zu Lenes Haus am Holm gerannt, aber dort habe ich es nicht lange ausgehalten. Lene hat nur geweint, obwohl Heinrich wieder ganz munter ist. Heinrich hat nach seiner Genesung verraten, dass Vater alles auf eine Karte gesetzt und verloren hat. Es sei ja nicht nur der Verlust des Schiffes, der ihn schmerze, sondern er habe all sein Vermögen für die Ladung ausgegeben, unter anderem für Lebensmittel und gelbe Ziegel. Das Schiff ist voll beladen im Atlantik havariert.
Ich bin recht nachdenklich nach Hause zurückgekehrt und habe Vater auf das Elend ansprechen wollen, aber er hat nur in einem fort gemurmelt: »Ich bin ruiniert! Ich bin ruiniert!«
Aber selbst, wenn ich in Zukunft keine schönen Kleider mehr bekommen werde, der Kummer meines Vaters kann mich nicht gänzlich von meiner rosaroten Wolke holen, denn ich bin verliebt. Und was gibt es Schöneres? Ich muss arg aufpassen, dass ich nicht singend durch das Haus schwebe, während Vater am Boden zerstört ist. Denn ich kann gar nicht anders, als an ihn zu denken, und dann werde ich so glücklich, dass ich singen und tanzen muss.
Ich bin mir ganz sicher, dass ich ihn heiraten werde, auch wenn er bei Vater noch nicht um meine Hand angehalten hat. Ich werde nie vergessen, wie ich ihn das erste Mal sah. Auf dem Hochzeitsball meiner Freundin Nele. Er war in Begleitung eines unverschämten Kerls, der mich gegen meinen Willen zum Tanzen zwingen wollte, obwohl ich ihm einen Korb gegeben hatte. Kein Wunder, der ungehobelte Geselle ist der Neffe unseres neuen Nachbarn. Wie der Herr sots Gescherr, wie unsere Küchenhilfe immer zu sagen pflegt. Er sieht nicht übel aus, dieser Christian Hensen, aber er hat ein unmögliches Betragen. Man munkelt, er habe in Saint Croix, wo er aufgewachsen ist, die Sklaven beaufsichtigt. Ach, ich möchte es gar nicht näher wissen. Er hat jedenfalls stechende Augen und einen bösen Blick. So, als würde ihm die Welt gehören. Ich erwähne ihn nur deshalb, weil sein Freund mich vor seinen Grobheiten gerettet hat. Er hat diesem Christian gesagt, dass man hier mit den Damen nicht so umgehen dürfe, und dann hat er mir den Arm gereicht. Als ich mit ihm zum Tanz gegangen bin, habe ich Christian noch einen flüchtigen Blick zugeworfen. Er hat mich angesehen, als wolle er mich umbringen und seinen Freund gleich mit.
Aber der Tanz hat mich alles vergessen lassen. Ich hatte nur Augen für meinen Retter. Er ist einen halben Kopf größer als ich, und seine Augen sind so blau und klar wie die Ostsee an einem heißen Sommertag, wenn kein Lüftchen weht. Man möchte darin versinken. Sein Haar ist hell und von der Sonne ausgeblichen, denn er lebte auch auf Saint Croix, bevor er vor ein paar Wochen auf einem Schoner von den Karibikinseln nach Flensburg kam. Das habe ich aber alles erst nach dem Tanz erfahren, als er mich in den Garten entführt hat. Er hat eine tiefe Stimme und schon viel von der Welt gesehen. Das imponiert mir mächtig. Ich wollte wissen, wie er als Däne auf die westindischen Inseln gelangt ist. Er heißt Hauke Jessen. Seine Familie stammt ursprünglich aus Kopenhagen. Sein Großvater war Kapitän bei der Westindien-Kompanie. Und der blieb eines Tages in Saint Croix, weil er sich in eine Engländerin verliebt hat, Haukes Mutter. Er ist nie wieder nach Hause zurückgekehrt und hat dort eine Familie gegründet. Hauke ist da geboren.
»Wer einmal auf den westindischen Inseln gelebt hat, kehrt niemals zurück«, hat Hauke an dem Abend in schwärmerischem Ton geseufzt. »Und warum bist du jetzt hier?«, habe ich ihn gefragt. Ich glaube, er fand mich anfangs ein wenig vorlaut, denn ich bin nicht sehr begabt darin, einen Mann anzuschmachten. Dazu bin ich auch viel zu groß. Die meisten Frauen auf dem Fest sind mindestens einen Kopf kleiner als ich und können immer so herrlich zu ihren Männern aufschauen. Mit dem gewissen Augenaufschlag! Deshalb hat meine Freundin Nele bestimmt auch so schnell einen Ehemann bekommen. Sie ist Meisterin ihres Faches. Wenn sie zu ihrem Per Hansen, dem frischgebackenen Polizeidirektor, hochblickt, dann spricht aus ihren Augen grenzenlose Bewunderung. Dann fühlt er sich bestimmt wie ein junger Gott. Dabei ist er ein unangenehmer Zeitgenosse. Er hat nicht die Spur Humor und mag nicht, wenn sie Zeit mit ihren Freundinnen verbringt. Mich kann er am wenigsten von allen leiden. Das lässt er mich jedes Mal spüren, wenn ich zu Besuch bin. Wahrscheinlich seit ich ihm auf den Kopf zugesagt habe, dass Nele sehr wohl in der Lage ist, auf einem Pferd zu galoppieren. Schließlich haben wir oft genug gemeinsame Ausritte gemacht. Er aber hat es ihr verboten, weil sich das für eine Dame nicht gehöre, und da ist mir der Kragen geplatzt.
Das Traurige daran ist, Nele tut alles, was er sagt. Und sie behauptet, diesen Blick einer Frau von unten nach oben mit züchtig niedergeschlagenen Lidern mögen die Männer. Ich weiß nicht, ob das stimmt, und werde das wohl auch nie erfahren. All die kleinen Junggesellen der Stadt gucken mich genauso wenig an, wie ich sie. Aber ich will auch gar keinen von ihnen. Mutter ermahnt mich stets, mich nicht so burschikos zu benehmen.