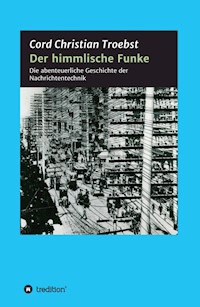
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
"Der himmlische Funke - die abenteuerliche Geschichte der Nachrichtentechnik" schildert spannend und allgemeinverständlich die Entwicklung der Kommunikation, von der Buschtrommel, den "Bryffjongen" des Mittelalters, dem Pony Express des Wilden Westens und der Verlegung des ersten Transatlantik-Kabels bis zur aktuellen Suche nach intelligenten Wesen im Weltraum. Eingewoben sind diese technischen Fortschritte in Leben und Schicksal von Persönlichkeiten wie Chappe und Morse, Marconi, Field und Bell, Siemens und Lee DeForest und vielen anderen Erfindern und wagemutigen Unternehmern.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 739
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Cord Christian Troebst
Der himmlische Funke
Die abenteuerliche Geschichte der Nachrichtentechnik
© 2020 Cord Christian Troebst
Verlag und Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN
Paperback:
978-3-347-10828-8
Hardcover:
978-3-347-10829-5
e-Book:
978-3-347-10830-1
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Für meine Tochter Yvonne, aufgewachsen in South Wellfleet auf Cape Cod, einem ersten Standort von Marconis Transatlantik-Funkbrücke.
PROLOG
William Henry Gates III aus Seattle im US-Staat Washington war 14 Jahre alt, als er 1969 die Welt der Computer für sich entdeckte. Der Sohn eines Rechtsanwalts schrieb die ersten Programme. Zunächst tat er das für seine Schule, doch schon nach kurzer Zeit auch für städtische und bundesstaatliche Auftraggeber. Dass das in der elterlichen Garage geschah ist allerdings eine Legende. 1976, da war „Bill“ gerade 21 Jahre alt, ließ er die von ihm und seinem Freund Paul Allen gegründete Firma Microsoft ins Handelsregister des Staates New Mexico eintragen. In den folgenden Jahren stieg er dank seiner Erfolge zum reichsten Mann der USA auf. Im Juni 2017, also 48 Jahre nach seinen ersten Programmierversuchen galt er zum dritten Mal in Folge als reichster Mann der Welt. Sein geschätztes Netto-Privatvermögen: unglaubliche 80 Milliarden US-Dollar.
In diesen 48 Jahren hat es auf dem Gebiet der Nachrichtentechnik und Informatik gewaltigere Fortschritte gegeben als in den letzten 2000 Jahren der Menschheitsgeschichte. Mit Hilfe von PC’s, Laptops, Handys, i-phones, i-pads und immer raffinierteren und kleineren Geräten können wir inzwischen fast weltweit kommunizieren. Rund 200 Milliarden Mal pro Tag (!) wird allein das @-Zeichen des E-Mail Erfinders Ray Tommlinson für den Austausch von Nachrichten genutzt. Wir können innerhalb von Sekunden schriftlich Informationen über Kontinente und Meere hinweg übermitteln, miteinander sprechen und uns dabei sogar sehen. Wir mailen, wir simsen, twittern, chatten, posten, skypen, snapchatten, lesen digitale Bücher, hören Musik, streamen Filme, können einkaufen, Spiele spielen oder unsere Elektrogeräte aus der Ferne steuern und unser Haus im Urlaub aus der Ferne überwachen. Per Mausklick können wir virtuelle Wanderungen durch Galerien und Museen oder durch historische Stätten unternehmen, die Hunderte oder auch Tausende Kilometer entfernt liegen. Sportereignisse, Konzerte und andere Großveranstaltungen können zeitgleich weltweit gesehen und gehört werden. Und Raumsonden schicken uns Informationen und Fotos von fernen Planeten und Asteroiden, zu denen sie oft viele Jahre und Millionen Kilometer unterwegs waren.
Aber wie war es früher? Wie fing das alles an? Davon handelt dieses Buch. Es ist die abenteuerliche Geschichte der Nachrichtentechnik und ihrer Sternstunden. Und es ist auch eine Geschichte ihrer teils in Vergessenheit geratenen Pioniere, eine Geschichte von Erfolgen und Niederlagen, von Intrigen und angeblichen Patentdiebstählen und Streitfragen darüber, wer mit einer bedeutenden Erfindung wirklich „der Erste“ war.
********
CLAUDE CHAPPE SETZT SEINE ZEICHEN
„Wenn Du Erfolg hast, wirst Du im Ruhm baden“.
Angeblich die erste, mit einem optischen Telegrafen übermittelte Nachricht
Jahrhunderte lang hatte sich an der Übermittlungstechnik kaum etwas geändert. Es blieb bei Boten-Männern und -Frauen, bei Läufern, Brieftauben, Leuchtfeuern, Reitern und Kutschen. Dann, am 25. Dezember 1763 kommt im französischen Brûlon-le-Maine, einem Ort unweit der Stadt Le Mans, ein Junge zur Welt, als zweites von sieben Kindern des königlichen Gutsverwalters Claude Chappe und dessen Ehefrau Marie geborene Devernay. Der Neuankömmling wird auf den Namen Claude getauft. Mit dem Erstgeborenen Ignace Urbain Jean (1762-1829) und dem zehn Jahre jüngeren Abraham (1773-1849) wird er die Welt der Nachrichtentechnik entscheidend verändern.
Es ist eine Zeit der sozialen und politischen Unruhen, in der die Gebrüder aufwachsen. Die Welt steht am Vorabend des Industriezeitalters – und Frankreich vor einer bluttriefenden Revolution. In England arbeiten seit 1712 die ersten Dampfmaschinen eines gewissen Thomas Newcomen, um Wasser aus Bergwerken heraus zu pumpen. In Schottland schnauben und brodeln die ersten leistungsfähigen Hochöfen. Henry Cavendish hat im Geburtsjahr Chappes das Wasserstoffgas entdeckt, und in Paris findet eine große Gewerbeausstellung statt. Frankreich hat das beste Straßennetz Europas, mit einer Gesamtlänge von 53.000 Kilometern. Ein Wegefrondienst der Anwohner sorgt für die laufende Instandhaltung. Allerdings lauern andere Gefahren als nur Schlaglöcher. Räuber, Wegelagerer und anderes Gelichter – meist sind es ehemalige Soldaten vieler Kriege – machen jede Reise zu einem unsicheren Abenteuer.
In den Städten gibt es andere Probleme. Frankreich ist damals das bevölkerungsreichste Land Europas, mit etwa 16 Millionen Einwohnern. Paris beherbergt fast eine Million Menschen. Nur London ist mit 1,5 Millionen größer. Verglichen damit ist Berlin ein „großes Dorf“, mit nur 150.000 Bewohnern. Noch bis Mitte der 1870er Jahre werden die deutschen Lande im Wesentlichen ein Agrarstaat bleiben. Gut leben im 18. Jahrhundert nur die höheren Stände und der Adel, vor allem in Frankreich. In Paris sind für diese „Elite“ z.B. 7.200 Perückenmacher tätig. Dazu kommen 12.000 Näherinnen, Maßnehmer und Zuschneider. Ein Fünftel der Bewohner von Paris sind damals Bedienstete. So stehen allein beim Adel 8.000 Lakaien in der Pflicht. Die haben wenigstens ein Dach über dem Kopf.
Die meisten Angestellten schuften für Hungerlöhne. Für 12 bis 14 Stunden Arbeit kann sich eine Familie gerade mal fünf Brote kaufen. Ein Pfund Salz kostet so viel wie ein Tagelöhner in 12 Stunden verdient. Hausherren behalten sich deshalb oft vor, jedem der am Tisch Sitzenden selber das Essen zu salzen. Doch nicht nur das: ein Gesetz schreibt vor, dass jedermann pro Jahr mindestens sieben Pfund Salz verbrauchen muss!! Mit Hilfe der Salzsteuer, eine der ältesten der Welt, (in Deutschland wird sie erst am 1. Januar 1993 abgeschafft!!), und vielen anderen Auflagen, wie der Verzehr- und der Fenstersteuer muss das Geld für den verschwenderisch lebenden und daher völlig verschuldeten Hof Ludwig XVI beschafft werden.
„Im Frühjahr 1776“, Claude Chappe ist gerade 12 Jahre alt geworden, „gibt es in Paris ungefähr 91.000 Personen ohne festen Wohnsitz“, heißt es in einem Bericht. Die einfachen Bürger hausen zwischen Schmutz und Abfällen in Hinterhöfen, umgeben vom Gestank von Kloaken und den Misthaufen von Kleintieren. Dazu herrscht ein unheimliches Gedränge. Denn in der Hoffnung auf eine Anstellung ziehen Tausende von Bauern ohne eigenen Hof und Tausende von Tagelöhnern auf der Suche nach Arbeit von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt. Und meist nach Paris.
Entsprechend groß ist die Arbeitslosigkeit. „Sie leben in armseligen Quartieren. Es gibt zwar Suppenküchen. Dennoch sterben viele Menschen in Stadt und Land an Hunger. Tausende von Mädchen versuchen, als Prostituierte ein Paar Sous zu verdienen, wenn sie nicht das Glück haben, eine Anstellung in einer der neuen Manufakturen zu finden.“ Und immer wieder gibt es Teuerungen. Der Volkswirt und Gelehrte Graf Victor Riquetti de Mirabeau (1715 - 1789), der „politische und ökonomische Menschenfreund“, beschreibt diese Gestalten in einem Brief als „schreckliche, wilde Tiere, bekleidet mit Kitteln aus gröbster Wolle… die Gesichter hager und mit langen, schmierigen Haaren bedeckt, der obere Teil des Gesichts wachsblass, der untere zu einem Versuch grausamen Lächelns und einer Art Ungeduld verzerrt.“ Wer auch nur ein wenig Geld verdient, nutzt die Lage dieser Elenden schamlos aus. Einfache Familien, sofern sie nicht in einem einzigen Zimmer wohnen, können sich ein Dienstmädchen leisten. Bauern, sofern sie noch einen Hof haben, verfügen über Knechte, Ladeninhaber über Laufburschen – und viele gebärden sich als kleine Sklavenhalter.
Auch in der Provinz stöhnt das Volk unter der Teuerung und den Steuerlasten. Im kleinen Lyon gibt es 30.000 Arbeitslose. Bis zu 80 Prozent der Landbevölkerung sind Bauern. Sie leiden mit am schlimmsten. Über die Hälfte ihres Verdienstes müssen sie an den Staat abgeben. Gutsherr und Kirche kassieren weitere 14 Prozent. Zeitweilig sind im Land bis zu 200.000 Steuereintreiber unterwegs. Rund 40.000 Prozesse gegen „Steuerhinterzieher“ stehen ständig als „laufende Verfahren“ an. Wer nicht zahlen kann, erhält die Prügelstrafe. Kurz, der Unterschied zwischen „gewöhnlich“ und „vornehm“, zwischen „arm und reich“ ist gewaltig. Es ist der ideale Nährboden für eine Revolution.
Die Sensation von Parcé-sur-Sarte
Es sind die Lebensumstände, die viele junge Männer dazu nötigen, den Priesterberuf zu erwählen. Im Schoß der Kirche erhoffen sie sich zumindest eine gewisse Versorgung und Sicherheit. Auch Claude Chappe entschließt sich dazu. Aber bei ihm ist es nicht nur die allgemeine Not. Wahrscheinlich wird er auch durch seinen Onkel Jean Chappe d‘Auteroche dazu angeregt. Denn der ist ebenfalls Geistlicher, und dazu ein recht berühmter und weitgereister Astronom. Schon früh hat er in seinem jungen Neffen die Liebe zu den Naturwissenschaften geweckt. So hat sich Claude bereits als Kind intensiv mit physikalischen und technischen Experimenten beschäftigt. Anfang des Jahres 1783 erregt der 20jährige einiges Aufsehen mit einer Abhandlung über das Phänomen der Blitze. Sie erscheint im Journal de Physique. Doch sie wird angesichts anderer technischer Errungenschaften bald wieder vergessen. Denn im gleichen Jahr konstruiert der Marquis de Jouffroy mit Hilfe der von Newcomen erfundenen und James Watt verbesserten Dampfmaschine einen maschinell betriebenen Raddampfer. Am 15. Juli fährt dieser auf der Seine in Richtung Lyon ein Stück flussaufwärts! Das ist eine Sensation, denn damals mussten größere Wasserfahrzeuge bei ungünstigem Wind noch getreidelt, also von Menschen oder Zugtieren an Seilen flussaufwärts gezogen werden.
Nur wenige Monate später gibt es die nächste, technische Sensation, diesmal auf dem tapis vert, dem „grünen Teppich“ vor dem Schloss von Versailles. Vor den Augen von König und Hofstaat steigt ein kunstvoll verzierter Heißluftballon der Gebrüder Montgolfier in die Luft. Passagiere sind ein Hahn, eine Ente und ein Schaf – die alle sicher in 2,5 km Entfernung wieder landen.
1788 erleben Frankreichs Bauern erneut eine Missernte. Im Winter müssen sie teilweise ihr Saatgut verzehren, um nicht zu verhungern. Weitere Unruhen werden befürchtet. Die Regierung wittert Verschwörungen. Steuerreformen, weil zu zaghaft, bleiben ohne Wirkung. Verdächtige werden verhaftet, ein Arbeiteraufstand wird von Soldaten des Königs blutig niedergeschlagen. Am 14. Juli 1789 stürmt eine wütende Menschenmenge in Paris die Bastille, das verhasste Staatsgefängnis, Symbol für Unterdrückung und Tyrannei. Der Bastille-Kommandant wird erschlagen, sein Kopf auf einer Pike durch die Straßen getragen. Unter der neuen Gesetzgebenden Versammlung verlieren Adel und Kirche ihre Privilegien. Dadurch verlieren am 2. November 1789 auch Claude Chappe, sein Bruder Abraham und viele andere Seminaristen ihren sicher geglaubten Kirchenhort. Deprimiert kehren die beiden Brüder zurück ins Elternhaus.
Was Claude Chappe dazu veranlasste, eine neuartige Kommunikationstechnik zu entwickeln, ist nicht ganz klar. Versuche dazu gab es damals auch bei anderen Tüftlern und Bastlern. Einigen Quellen zufolge war es Claudes Wunsch, mit Freunden in der Nachbarschaft zu kommunizieren, ohne sie persönlich aufsuchen zu müssen. Glaubhafter scheint, dass auch er, wie andere Bastler und Tüftler seiner Zeit, an Verfahren zur schnelleren Nachrichtenübermittlung arbeiten. Jedenfalls beginnen er und seine Brüder Abraham, René und Ignace im Winter 1790/91 mit ersten Transmissions-Versuchen hinter ihrem Elternhaus in Brulôn.
Angesichts der Unruhen im Lande ist dies nicht ohne Risiko. Man könnte die jungen Männer leicht für Spione halten, die einander Geheimbotschaften schicken. Denn um sich Informationen zu senden benutzen die Brüder zwei selbstgebaute Apparate in Form großer, gleich schnell laufender Standuhren. Statt eines Stunden- und Minutenzeigers verfügt jede nur über einen einzigen, durch Fallgewichte schnell rotierenden Zeiger. Und statt der 12 Ziffern auf dem Zifferblatt gibt es nur die Ziffern Null bis 9. Die eine Uhr steht bei Claude, die andere anfangs etwa 400 m entfernt bei René. Als Anrufsignal dient ein großer Kupferkessel. Schlägt man mit einem Knüppel drauf, so ertönt ein weit hallender Gongschlag. Nach dem „Eröffnungsruf“ werden die Uhren zunächst synchronisiert: Claude setzt sein Laufwerk in Gang. Sobald der Zeiger seiner Uhr die Mittelposition (theoretisch die Ziffer zwölf) erreicht, schlägt er erneut auf den „Gong“, woraufhin sein Bruder den Zeiger seiner Uhr ebenfalls auf die 12 stellt. Beim nächsten Gongschlag setzen die Brüder ihre Zeiger gleichzeitig „in Marsch“. Jedesmal, wenn der Zeiger auf Claudes Uhr eine von ihm gewünschte Ziffer erreicht, schlägt er erneut auf den Gong. Und René, auf der Empfängerseite, schreibt die Ziffer ab, die sein Zeiger gerade erreicht hat. Auf diese Weise lassen sich mit Hilfe der Ziffern Zahlencodes übermitteln, deren Bedeutung die Chappes in einem eigenen Codebuch nachschlagen. Die Codes können Worte oder auch ganze Sätze beinhalten.
Das Ganze ist ein geniales - allerdings auch sehr lautstarkes Verfahren. Schon bald gibt es Beschwerden der Anwohner. Claude muss sich eine lautlose oder zumindest leisere Verständigungsmethode einfallen lassen. Er denkt an elektrische Signale, doch gibt es keine isolierten Drähte. Auch Rauchzeichen scheiden aus. Dank seiner früheren physikalischen Experimente entscheidet er sich schließlich für einen optischen Signalgeber. Das ist anfangs ein in seiner Senkrechten drehbares, etwa 1,66 m hohes und 1,33 m breites Brett, befestigt an einer vier m hohen Stange. Auf der einen Seite ist es schwarz, auf der anderen weiß gestrichen. Es ersetzt den Gong, indem es jedes Mal, wenn der Zeiger die gewünschte Ziffer erreicht, von Hand gewendet wird.
16 km in vier Minuten
Nun wird es auch möglich, die Übertragungsstrecke zu erhöhen - durch den Einsatz von Fernrohren. Ende Februar ist Claude so weit, seine Erfindung öffentlich zu machen. Am 2. März versammeln sich einige prominente Gäste, darunter ein Notar und ein Lokalpolitiker, im Haus eines gewissen Ambroise Perrotin in der Stadt Parcé-sur-Sarte. Claude Chappe führt sie in einen Raum „in dem wir eine Standuhr und ein Fernrohr sahen, dessen Objektiv in Richtung des etwa 16 km weit entfernten Brulôn zeigte.“ Obwohl es etwas regnerisch sei, so sagt Claude, werde ihm sein Bruder René von Brulôn aus eine Botschaft übermitteln, diktiert von einem Mitglied der dortigen Gemeindedeputation. Es ist elf Uhr, …und während er [Claude] durch das Fernrohr schaut, notiert er die nächsten vier Minuten uns unbekannte Ziffer-Kombinationen.“ Es sind neun Worte bzw. insgesamt 55 Zeichen. Die übersetzt Claude dann wie folgt: „Si vous réussissez, vous serez bientôt couvert de gloire“. („Wenn Du Erfolg hast, wirst Du im Ruhm baden“).
Eine fast ähnliche Beschreibung des Versuchsablaufs um 11 Uhr am 2. März 1791 gibt es über den Vorgang in Brulôn. Die dort Anwesenden, unter ihnen der Vikar Avenant, der Arzt Jean Audruger und andere Honoratioren sind Zeugen wie René Chappe diese Botschaft an seinen Bruder Claude übermittelt. Ausgesucht hatte sie der Arzt Dr. Chenou.
Um 3 Uhr sendet Claude aus Parcé nach Brulôn, diesmal adressiert an seinen Bruder Pierre Francois, eine weitere Nachricht: „Die Nationalversammlung wird Experimente, die der Öffentlichkeit nutzen, belohnen.“ (L’Assembleé Nationale récompensera les experiences utiles au public). Um 10:30 Uhr am nächsten Tag wird das Experiment vor den gleichen Zeugen mit einer anderen, diesmal 25 Worte umfassenden Nachricht wiederholt. Es verläuft ebenfalls erfolgreich. Ein Schwindel scheint also ausgeschlossen. Die Sensation ist perfekt - denn ein Bote hätte zur Überbringung der verschiedenen Nachrichten nicht vier Minuten sondern etwa drei Stunden benötigt. Eine Weile noch werden an diesem Tag in Gegenwart von Zeugen weitere Nachrichten schnell und ergfolgreich übermittelt. Und Chappe erkennt seine Chance: Frankreich ist von einem Haufen von Feinden umgeben. Im Hafen von Toulon sitzen bereits die verhassten Engländer; die gegen Frankreich gerichtete Allianz von Großbritannien, Holland, Preußen, Österreich und Spanien stellt eine unberechenbare Gefahr dar. Denn diese Länder fürchten, dass der Funke der Revolution auch auf ihr eigenes Territorium überspringen könnte. Fast der einzige „Verbündete“, den Paris in dieser Situation besitzt, ist die schleppende Kommunikation seiner Gegner untereinander. Das kommt Chappe zu Gute: In einer Bittschrift an den Konvent beschreibt er seinen Tachygraph, seinen Schnellschreiber und beantragt eine finanzielle Unterstützung für den Bau einer Versuchslinie. Doch Behörden arbeiten langsam, Die Wartezeit bis zu einer Antwort nutzt Claude, um seine Apparatur weiter zu verbessern. Nach weiteren Experimenten gelangt er zu der Überzeugung, dass aus größerer Entfernung die Stellung von Stangen oder Stäben besser zu lesen sei als die Zahlen auf einem großen Zifferblatt. Bei guten Wetterbedingungen können er und seine beiden Brüder bis zu drei Zeichen pro Minute vom Sender zum Beobachter übermitteln.
Währenddessen hat sich die Lage in Paris und den Provinzen weiter zugespitzt. Es gibt die ersten Hinrichtungen. Ein Arzt und Politiker namens Joseph Ignace Guillotin (1773-1814) teilt dem Konvent am 30. April 1791 mit, er habe eine „humane Köpfmaschine“ zum „schmerzlosen Töten“ erfunden. Der Kongress beauftragt den königlichen Leibarzt Antoine Louis, eine solche Tötungsmaschine zu entwerfen. Er präsentiert sie, gebaut nach dem Vorbild einer in Schottland benutzen Apparatur. Den „Erfinderruhm“ heimst jedoch Dr. Guillotin ein. Ironie des Schicksals: Später wird er selbst eines der 17.000 Opfer der Guillotine werden.
Im Juni 1791 zieht Claude Chappe trotz der zunehmenden Unruhen nach Paris. Dort darf er seinen Tachyraphen auf der Étoile aufstellen, dem Platz, von dem sternförmig die wichtigsten Pariser Hauptstraßen auslaufen. Doch alle Tachygraphenteile werden über Nacht gestohlen, noch ehe die ersten Versuche beginnen.





























