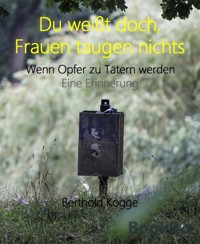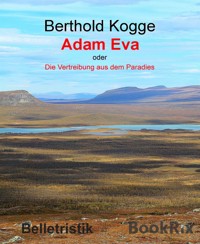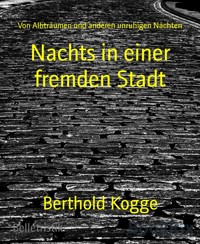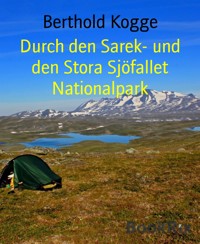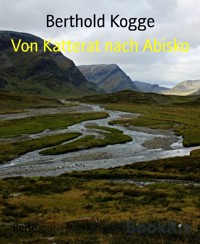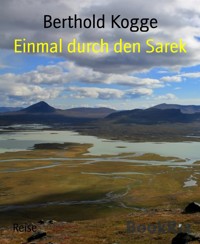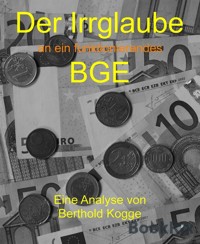
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In diesem Buch dreht sich um eine Analyse über die Aussagen aus den Büchern:
„Einkommen für alle“ von Götz W. Werner
und
„1000 € für jeden“ von Götz W. Werner und Adrienne Goehler.
Beide Bücher predigen das BGE. Allerdings gibt es, obwohl zumindest Herr Werner in beiden Büchern als Autor tätig war, jeweils extreme Unterschiede in der Auslegung, in welchem Umfang ein BGE gezahlt werden soll.
In dem Buch „Einkommen für alle“ pocht Herr Werner darauf, dass jeder, wirklich jeder, ein echtes BGE, ganz praktisch in die Hand bzw. auf das Konto gedrückt bekommt.
In dem Buch „1000 € für jeden“ sollen nur noch die ein BGE erhalten, die nicht selbst Geld verdienen. Die, die arbeiten oder sonst wie Einnahmen haben, sollen nur einen Steuerfreibetrag bekommen, also auf ihre Einnahmen keine Steuern bezahlen müssen.
Das ist ein erheblicher Unterschied, der miteinander nicht kompatibel ist und bei der Bewertung, welche Probleme ein BGE heraufbeschwört, total verschiedene Ansätze bringt.
Letztendlich kann ich nur vermuten, dass das Buch „1000 € für jeden“ die gültige Variante ist, da dieses Buch drei Jahre nach dem Buch „Einkommen für alle“ veröffentlicht wurde. Allerdings kann das nur eine Vermutung sein. Explizite darauf hingewiesen, dass die Auffassung aus dem Buch „Einkommen für alle“ überholt ist, wurde nicht abgegeben.
Vieles, was Herr Werner und Frau Goehler als Argumentation für ein BGE gebracht haben, ist reiner Etikettenschwindel. Egal ob an Beispielen, in denen angeblich Vorläufer eines BGEs in der Vergangenheit funktioniert haben sollen, oder bei Beispielen von angeblichen Protagonisten für ein BGE.
Wer bei seiner Argumentation so extrem Etikettenschwindel betreiben muss, zeigt eigentlich nur auf, wie unglaubwürdig die „Religion“ BGE ist. Denn das BGE scheint eher eine Religion zu sein, in der man auch die skurrilsten Beispiele und Begründungen heranzieht, um eine angebliche Funktionalität und Sinnhaftigkeit des BGEs nachzuweisen, als ein politisches Programm.
Außerdem ist es schon reiner Hohn, wenn man nach den Sternen eines BGEs greifen will, während man unter einem Apfelbaum steht, aber nicht einmal in der Lage ist, die Äpfel Vollbeschäftigung und radikale Steuervereinfachung vom Ast, der gleich über einem hängt, zu pflücken.
Dass Vollbeschäftigung keine Utopie ist, zeige ich in diesem Buch auf. Zumindest ist Vollbeschäftigung nicht so eine große Utopie, wie ein BGE. Es ist in Deutschland genug Arbeit vorhanden, um eine Vollbeschäftigung zu gewährleisten, und es wird schon heute ausreichend Arbeit ausgeführt, um fast eine Vollbeschäftigung zu bieten, oft eben nur am Arbeitsmarkt vorbei (Schwarzarbeit).
Dass unser Steuersystem und auch das Sozialtransfersystem in diesem Land viel zu kompliziert und teilweise überflüssig ist, streite ich nicht ab. Aber in anderen Ländern, die auch kein BGE haben und unsere komplexe Gesellschaftsstruktur, geht es auch anders.
Und wer die Verfassung des antiken Spartas, die Ansichten eines Thomas Morus, Charles Montesquieu, Thomas Paine, Paul Lafargue und anderen Politikern und Gesellschaftskritikern für seine Thesen einspannt, sollte sich vielleicht auch mit der Geschichte und den Texten der genannten Personen beschäftigt haben, sie vielleicht sogar gelesen, bevor man versucht, diese für die eigenen Ideen zu missbrauchen.
Ein wesentliches Problem unserer Zeit habe ich auch in dem Abschnitt „Ungleichheit der Welt“ erläutert. Das dort Genannte einfach zu leugnen und zu hoffen, wir könnten uns dem Problem durch ein BGE entziehen, würde unseren jetzigen Wohlstand vernichten, weil wir ihn verbrauchen würden. Grundsätzlich muss jede Leistung, die wir selbst empfangen wollen, von irgendjemand geschaffen werden. Wie auch immer das geschehen mag, aber ein BGE kann diese Leistung nicht erschaffen. Haben wir irgendwann wirklich einmal zu wenig Arbeit in diesem Land und haben wir das Problem, das ich in dem Abschnitt „Ungleichheit der Welt“ erläutert habe, endlich in den Griff bekommen, können wir immer noch die vorhandene Arbeit gerechter verteilen.
Aber ein BGE wäre auch dabei nicht die Lösung, die wir benötigen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Der Irrglaube BGE
Der Irrglaube an ein funktionierendes BGE
BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenEinleitung
In diesem Buch dreht sich im Wesentlichen um eine Analyse über die Aussagen aus den Büchern:
„Einkommen für alle“ von Götz W. Werner
und
„1000 € für jeden“ von Götz W. Werner und Adrienne Goehler.
Beide Bücher predigen das BGE. Allerdings gibt es, obwohl zumindest Herr Werner in beiden Büchern als Autor tätig war, jeweils extreme Unterschiede in der Auslegung, in welchem Umfang ein BGE gezahlt werden soll.
In dem Buch „Einkommen für alle“ pocht Herr Werner darauf, dass jeder, wirklich jeder, ein echtes BGE, ganz praktisch in die Hand bzw. auf das Konto gedrückt bekommt.
In dem Buch „1000 € für jeden“ sollen nur noch die ein BGE erhalten, die nicht selbst Geld verdienen. Die, die arbeiten oder sonst wie Einnahmen haben, sollen nur einen Steuerfreibetrag bekommen, also auf ihre Einnahmen keine Steuern bezahlen müssen.
Das ist ein erheblicher Unterschied, der miteinander nicht kompatibel ist und bei der Bewertung, welche Probleme ein BGE heraufbeschwört, total verschiedene Ansätze bringt.
Letztendlich kann ich nur vermuten, dass das Buch „1000 € für jeden“ die gültige Variante ist, da dieses Buch drei Jahre nach dem Buch „Einkommen für alle“ veröffentlicht wurde. Allerdings kann das nur eine Vermutung sein. Explizite darauf hingewiesen, dass die Auffassung aus dem Buch „Einkommen für alle“ überholt ist, wurde nicht abgegeben.
Vieles, was Herr Werner und Frau Goehler als Argumentation für ein BGE gebracht haben, ist reiner Etikettenschwindel. Egal ob an Beispielen, in denen angeblich Vorläufer eines BGEs in der Vergangenheit funktioniert haben sollen, oder bei Beispielen von angeblichen Protagonisten für ein BGE.
Wer bei seiner Argumentation so extrem Etikettenschwindel betreiben muss, zeigt eigentlich nur auf, wie unglaubwürdig die Religion „BGE“ ist. Denn das BGE scheint eher eine Religion zu sein, in der man auch die skurrilsten Beispiele und Begründungen heranzieht, um eine angebliche Funktionalität und Sinnhaftigkeit des BGEs nachzuweisen, als ein politisches Programm.
Außerdem ist es schon reiner Hohn, wenn man nach den Sternen eines BGEs greifen will, während man unter einem Apfelbaum steht, aber nicht einmal in der Lage ist, die Äpfel Vollbeschäftigung und radikale Steuervereinfachung vom Ast, der gleich über einem hängt, zu pflücken.
Dass Vollbeschäftigung keine Utopie ist, zeige ich in diesem Buch auf. Zumindest ist Vollbeschäftigung nicht so eine große Utopie, wie ein BGE. Es ist in Deutschland genug Arbeit vorhanden, um eine Vollbeschäftigung zu gewährleisten, und es wird schon heute ausreichend Arbeit ausgeführt, um fast eine Vollbeschäftigung zu bieten.
Das Einzige, was da einen zur Verzweiflung bringen kann, ist die Tatsache, dass man sich kaum Mühe gibt, dieses auch umzusetzen, sondern den jetzigen Zustand im Grunde, und zwar nicht nur in der Politik, sondern auch in großen Teilen der Bevölkerung, duldet. Und in der Bevölkerung geht es sogar weitflächig über eine einfache Duldung hinaus. Denn in großen Teilen der Gesellschaft sieht man es durchaus als sein Recht an, aus Schwarzarbeit seine eigenen Vorteile zu ziehen.
Dass unser Steuersystem und auch das Sozialtransfersystem in diesem Land viel zu kompliziert und teilweise überflüssig ist, streite ich nicht ab. Aber in anderen Ländern, die auch kein BGE haben und unsere komplexe Gesellschaftsstruktur, geht es auch anders.
„Wenn ich vom Liegen nicht zum Gehen aufstehen kann, muss ich halt vom Fliegen träumen und versuchen das zu realisieren.“
Wer so denkt, sollte Fantasiegeschichten schreiben, aber nicht versuchen, politische und gesellschaftliche Grundsätze zu entwickeln.
Und wer die Verfassung des antiken Spartas, die Ansichten eines Thomas Morus, Charles Montesquieu, Thomas Paine, Paul Lafargue und anderen Politikern und Gesellschaftskritikern für seine Thesen einspannt, sollte sich vielleicht auch mit der Geschichte und den Texten der genannten Personen beschäftigt haben, sie vielleicht sogar gelesen, bevor man versucht diese für die eigenen Ideen zu missbrauchen.
Ein wesentliches Problem unserer Zeit habe ich auch in dem Abschnitt „Ungleichheit der Welt“ erläutert. Das dort Genannte einfach zu leugnen und zu hoffen, wir könnten uns dem Problem durch ein BGE entziehen, würde unseren jetzigen Wohlstand vernichten, weil wir ihn verbrauchen würden. Grundsätzlich muss jede Leistung, die wir selbst empfangen wollen, von irgendjemand geschaffen werden. Wie auch immer das geschehen mag, aber ein BGE kann diese Leistung nicht erschaffen. Haben wir irgendwann wirklich einmal zu wenig Arbeit in diesem Land und haben wir das Problem, das ich in dem Abschnitt „Ungleichheit der Welt“ erläutert habe, endlich in den Griff bekommen, können wir immer noch die vorhandene Arbeit gerechter verteilen.
Aber ein BGE wäre auch dann nicht die Lösung, die wir benötigen.
Die Irrungen von Götz W. Werner in seinem Buch: „Einkommen für alle.“
Über das Kapitel: Die marmorne „Sockelarbeitslosigkeit
Herr Werner behauptet in seinem Buch „Einkommen für alle“, dass eine Vollbeschäftigung in Deutschland gar nicht möglich ist, da es, nach seiner Auffassung, an entsprechender Arbeit fehlt.
Das ist falsch.
Arbeit ist in Deutschland genug vorhanden. Wer das leugnet, mogelt sich an dieser bitteren Wahrheit vorbei.
Die durchschnittliche Zahl der Arbeitslosen lag in Deutschland im Jahr 2013 bei ungefähr drei Millionen, was einer Arbeitslosenquote von ungefähr 7% entspricht. Die Arbeit für diese Arbeitslosen ist aber vorhanden. Wir haben einen Investitionsstau in der Infrastruktur von jährlich fünfzig Milliarden Euro. In Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen haben wir einen Pflegenotstand. Und man kann noch einige andere Bereiche aufzählen, in denen Arbeit vorhanden ist, aber leider keine Arbeitsstellen dafür bestehen.
Außerdem werden in Deutschland, laut Bundesregierung, für ca. dreihundertvierzig Milliarden Euro Schwarzarbeit im Jahr geleistet. Das ist ein Arbeitsvolumen für ca. 5,4 Millionen Arbeitsstellen.
Arbeit scheint also ausreichend vorhanden zu sein, es fehlen also entweder nur die finanziellen Mittel für die Durchführung oder der Wille, sie legal auszuführen.
Wenn Herr Werner der These, „Wachstum schafft Arbeit“, widerspricht, mag er ja nicht unbedingt falsch liegen, aber wir brauchen kein Wachstum, um die drei Millionen Arbeitslosen, gehen wir einmal davon aus, sie sind oder können entsprechend ausgebildet werden, in Lohn und Brot zu bringen.
Das BIP (Bruttoinlandsprodukt) betrug im Jahr 2012 in Deutschland ungefähr 2.600 Milliarden Euro.
Man geht in Deutschland von einer Schwarzarbeiterquote von 13% aus, die zwar auch, zusätzlich zu dem offiziellen BIP, erwirtschaftet wird, aber in der BIP-Statistik nicht mit enthalten ist. Diese zusätzliche Leistung würde eine Erhöhung des BIPs um ungefähr dreihundertvierzig Milliarden Euro bedeuten, wenn diese Leistung nicht am Fiskus vorbei, sondern ganz offiziell erstellt worden wäre.
Die Beschäftigungszahl in Deutschland, die im Jahr 2012 die 2.600 Milliarden Euro offizielles BIP erwirtschaftete, lag bei ca. 41,5 Millionen Menschen. Würden die dreihundertvierzig Milliarden Euro Schwarz-BIP, die außerhalb der offiziellen BIP-Wertung und, zu einem beträchtlichen Teil, außerhalb legaler Arbeitsplätze geschaffen wurden, nicht von Arbeitslosen, Arbeitnehmern, Selbstständigen und Unternehmen nebenbei erwirtschaftet, sondern in legale Arbeit umgewandelt, dürften es somit, zumindest rein rechnerisch, ungefähr 13% mehr Beschäftigte in diesem Land geben. Es würden also in Deutschland ungefähr 5,4 Millionen vollwertige, steuerpflichtige Arbeitsstellen mehr vorhanden sein.
Praktisch könnte wohl nur ungefähr die Hälfte davon in neue legale Arbeitsplätze umgewandelt werden, da ein Teil der heutigen Schwarzarbeit während der normalen Geschäfts- und Arbeitszeit abgewickelt wird und es dafür keine neuen Arbeitsplätze geben würde, wenn diese Arbeit nicht mehr schwarz, sondern legal geleistet wird. Aber trotzdem wären es immer noch über zwei Millionen Arbeitsplätze mehr, die zusätzlich vorhanden wären, wenn die jetzige Schwarzarbeit legal geleistet werden würde. Und mehr als eine weitere Million Arbeitsstellen könnten geschaffen werden, wenn die zusätzlich eingenommenen Steuern und Sozialabgaben investiert werden würden. Die Vollbeschäftigung wäre erreicht.
Die Regierung beziffert den Schaden für die öffentlichen Kassen durch die Schwarzarbeit, durch ausbleibende Steuereinnahmen und Schaden an den Sozialkassen, bei einhundert Milliarden Euro pro Jahr. Mit diesem Geld könnte man viele, längst überfällige Infrastrukturmaßnahmen endlich anpacken, den Pflegenotstand beseitigen und noch einiges andere auf den Weg bringen.
Ich hoffe doch, Herr Werner hält das totale Ausschalten der Schwarzarbeit nicht für eine größere Utopie, als ein BGE für alle. Oder etwa doch?
Und man kann wohl davon ausgehen, auch wenn es in legaler Form etwas teurer wäre, dass der Großteil der bisher schwarz erbrachten Leistungen auch legal ausgeführt werden würde. Grundsätzlich bezahlt werden die Leistungen ja schon heutzutage. Und sollte jemand das große Jammern bekommen, weil sein Geld nicht ausreicht, um eine Auffahrt auch legal pflastern zu lassen, wird er wohl kaum, aus Verzweiflung, das vorhandene Geld verbrennen, sondern es anderweitig ausgeben.
Und sollte jemand die Schwarzarbeit für unausrottbar halten und deshalb für ein BGE plädieren, sollte er bedenken, dass gerade ein BGE, zumindest gemäß dem Buch „1000 € für jeden“, in dem nur die ein BGE erhalten sollen, die nicht offiziell arbeiten oder auf andere Art offiziell Geld verdienen, der Schwarzarbeit Vorschub leisten würde, da man bei einer legalen Arbeit, mit jedem Euro, der offiziell zuverdient wird, an seinem BGE erst einmal entsprechend verlieren würde.
Vollbeschäftigung ist nun wirklich keine Utopie. Zumindest ist sie nicht so utopisch wie das BGE.
Über das Kapitel: Produktivität frisst Arbeit auf
Im Grunde hat hier Herr Werner zwar recht, aber auch das ist nur eine Seite der Medaille.
Selbstverständlich frisst Produktivität Arbeit auf. Aber schon bei der Frage der Sockelarbeitslosigkeit habe ich belegt, dass trotzdem in diesem Land immer noch genügend Arbeit vorhanden ist und auch schon zum großen Teil ausgeführt wird. Dass alleine fünfzig Milliarden Euro für notwendige Infrastrukturmaßnahmen jedes Jahr fehlen, und diese daher nicht ausgeführt werden können, heißt nicht, dass diese Arbeit nicht da ist. Dass das notwendige Geld für ausreichendes Pflegepersonal in Krankenhäusern und Pflegeheimen fehlt, heißt nicht, dass diese Arbeit nicht vorhanden ist.
In den letzten einhundertfünfzig Jahren ist die Produktivität enorm gestiegen. Wer aber glaubt, dass Produktivitätssteigerung automatisch zur Vernichtung entsprechender Arbeitsplätze führt, irrt. Denn im Vergleich zu vor einhundertfünfzig Jahren dürften wir dann wohl heutzutage nicht einmal mehr eine Stunde am Tag arbeiten, um alles geschafft zu haben, was zu leisten notwendig ist. Das ist aber nicht so. Ganz einfach aus dem Grund, weil wir auch nicht mehr so (einfach) leben, wie vor einhundertfünfzig Jahren. Wir leben nicht mehr in einer Mangelgesellschaft. Wir haben einen höheren Lebensstandard, mehr Komfort und nutzen mehr Dienstleistungen. Alles Dinge, die im Vergleich zu vor einhundertfünfzig Jahren zusätzlich erschaffen und geleistet werden müssen.
Die Produktivität hat sich immerhin alleine von 1970 bis heute (2013) ungefähr verdreifacht.
Nach der Theorie von Herrn Werner hätten wir also nur noch 1/3 der Arbeit, wie vor dreiundvierzig Jahren. Aber das stimmt nicht. Wir haben viel mehr Autos, unsere Wohnungen sind komfortabler, Fernseher, Telefon, und, und, und.
Diesen gleichen Gedankenfehler hatte schon Paul Lafargue vor ungefähr einhundertdreißig Jahren. Aber zu Lafargue kommen wir noch später intensiver.
Über das Kapitel: Gesättigte Märkte
Auch wenn bei vielen Märkten eine Sättigung eingetreten ist (z.B. bei Pkws in Europa), gibt es immer wieder Neues auf dem Markt, wie z.B. das mobile Telefon, das sich in Deutschland eigentlich erst nach der Wiedervereinigung wirklich zu einer Massenware entwickelt hat. Und wenn auch bei den Handys inzwischen eine Sättigung eingetreten ist, da heutzutage jeder mindestens ein Handy hat, verändert sich doch die Technik rasant. Man schaue sich nur sein jetziges Handy an und denke an das Handy zurück, mit dem man zur Jahrtausendwende, um null Uhr, versucht hat, Verwandte oder Freunde zu erreichen. Was ist alleine mit der Entwicklung beim Internet in den letzten Jahren?! Und hatte vor zehn Jahren schon jemand einen Plasmabildschirm?! Es muss ja nicht immer heißen: „immer mehr“, sondern es reicht ja auch: „immer besser.“
Übrigens: Herr Werner schrieb (2006/2007) von einem gesättigten Automarkt. Nun. Von 2009 bis 2012 ist die weltweite Autoproduktion von 58 Mio. Stück pro Jahr, auf 81 Mio. gestiegen. Für 2013 werden 87 Mio. produzierte Autos geschätzt.
Herr Werner lässt sich in seinem Buch darüber aus, dass man heutzutage zu Hause selbstverständlich warmes Wasser hat, Gasboiler, Toiletten in der Wohnung, statt im Treppenhaus, usw.. Herr Werner kommt daher zu dem Schluss, dass man heutzutage schon alles hat und eine Sättigung somit erreicht ist. Die Wohnungen sind auf dem modernsten Stand, besser geht es sowieso nicht mehr. Damit macht Herr Werner aber den gleichen Fehler, den vielleicht Zukunftsforscher bereits 1939 dachten. Nämlich, dass die Häuser alle renoviert sind oder nach dem neusten Stand der Technik neu gebaut wurden, und besser geht es nun einmal nicht mehr. Aus damaliger Sicht stimmte das auch.
Oder im Grunde macht Herr Werner den gleichen Fehler, den eventuell jemand vor einhundertfünfzig Jahren von sich gegeben hat, als derjenige vielleicht meinte, dass es genügend Postkutschen geben würde, und damit der Markt für Postkutschen gesättigt ist. Was sogar nicht einmal falsch gewesen wäre, denn Postkutschen werden heutzutage wirklich kaum noch benötigt.
Herr Werner kann nicht in die Zukunft sehen, er geht von dem heutigen Stand aus. Vielleicht gibt es in zwanzig Jahren keine Pkws mehr, sondern wir fliegen alle, mit technischen Hilfsmitteln, durch die Luft. Wer will das heute wirklich schon vorhersagen können. Vor zweihundert Jahren kannten unsere Vorfahren auch keine Pkws oder die Eisenbahn, geschweige dann ein Flugzeug. Aber sie kannten vor zweihundert Jahren Postkutschen, und hätte ihnen damals jemand etwas von Flugzeugen als Massenverkehrsmittel erzählt, oder etwas von Smartphones, hätten sie den Erzähler wohl für verrückt gehalten.
Genauso wenig wie die Leute vor zweihundert Jahren sich unsere heutige Welt hätten vorstellen können, genauso wenig kann Herr Werner sich die Zukunft vorstellen. Herr Werner sollte einmal ehrlich sein. Hätte er sich vor dreißig Jahren vorstellen können, mit einem Smartphone überall erreichbar zu sein und die Welt quasi in der Tasche zu haben? Der Markt der Telekommunikation war vor dreißig Jahren total gesättigt. Eigentlich jeder Haushalt in Deutschland (West) hatte ein Telefon. Das Nonplusultra war vor dreißig Jahren in dem Bereich Telekommunikation erreicht. Mehr ging nicht mehr. Somit hätte die Aussage von Herrn Werner also schon vor dreißig Jahren, für die Branche Telekommunikation, lauten können, „Rien ne va plus“, da der Markt gesättigt war.
Genauso wenig wie Herr Werner sich vor dreißig Jahren unsere heutige Technik hätte vorstellen können, so wenig kann Herr Werner dreißig Jahre in die Zukunft schauen. Er tut es aber, das Schauen in die Zukunft. Aber er tut es nur bei der Produktivität, die Arbeit auffrisst. Dass dabei aber auch ganz neue Märkte geschaffen werden, von denen wir heutzutage nicht einmal zu träumen wagen, davon erwähnt Herr Werner nichts.
Wie schon erwähnt, dass wir immer noch genügend Arbeit hätten, wenn wir sie nicht teilweise schwarz erledigen würden, trotz unserer ständigen Produktivitätssteigerung, habe ich bereits belegt. Alles, was Herr Werner also noch über angeblich mangelnde Arbeit in seinem Buch von sich gibt, entspricht somit nicht der Realität.
Und wer jetzt aufschreit und stöhnt: „Oh man, schon wieder so ein Wirtschaftswachstumsfanatiker“, dem sei gesagt, wir brauchen kein Wachstum. Wir brauchen nicht mehr, nicht alles größer. Momentan würde die Leistung der Schwarzarbeit in legale Form umgegossen, die notwendigen und überfälligen Arbeiten in der Infrastruktur und die Bereitstellung der notwendigen Gelder in anderen Bereichen, wie z.B. in der Pflege, absolut ausreichen, um eine Vollbeschäftigung zu gewährleisten. Es gibt keinen Anlass anzunehmen, dass die Produktivitätssteigerung, die in den letzten Jahrzehnten nichts daran geändert hat, dass ausreichend Arbeit vorhanden ist, in den nächsten Jahrzehnten dieses auf einmal ändert.
Über das Kapitel: Wahre, falsche und neue Bedürfnisse
Der Hinweis von Herrn Werner, dass die Menschen schlichtweg kein Bildtelefon haben möchten, ist ein Irrtum. Herr Werner hat das Buch 2007 geschrieben bzw. herausgebracht. Heute, sechs Jahre später, mit besserer Technik, ist Bildtelefon zwar auch noch nicht selbstverständlich, aber es wird, bei Telefon über das Internet, immer häufiger genutzt. Auch das Internet selbst brauchte mehrere Jahrzehnte, um sich wirklich weitflächig durchzusetzen.
Auch der Versuch von Herrn Werner, die Erfindung eines gesunden Speiseeises, dessen Markteinführung wohl gescheitert wäre, sollte man so etwas versuchen, als technischen Innovationsfehler hinzustellen, ist nun wirklich weit am Thema vorbei. Speiseeis hatte und hat immer noch, nur eine einzige ganz spezielle Funktion. „Es soll schmecken.“ Wenn jemand den Versuch starten würde, ein gesundes Speiseeis zu schaffen und die wesentlichen Elemente, die ein Eis in seiner Funktion als etwas Leckeres auszumachen haben, streicht, wäre der ganze Sinn und Zweck des Speiseeises dahin. Das in einen Vergleich mit einem Bildtelefon und dessen technischer Entwicklung zu setzen, ist nun wirklich weit daneben geschossen.
Im Grunde wird in diesem Kapitel ein wesentlicher Fehler von Herrn Werner offensichtlich. Er weist darauf hin, dass technische Innovationen mit falschen Prognosen gepflastert sind. Gleichzeitig tut Herr Werner so, als ob er, mit dem Wissen von heute, in die Zukunft sehen kann. Auch in der Zukunft wird es, wie bereits in der Vergangenheit, so sein, dass Erfindungen, die die Menschheit für schwachsinnig hält, durchfallen werden, und Erfindungen, die der Mensch für sinnvoll hält, sich durchsetzen. Auch das Fliegen in einem Flugzeug, in Form eines Massenverkehrsmittels, hat sich erst in den letzten Jahrzehnten durchgesetzt. Und wer Lust hat, kann ja einmal im Internet nachschauen, wann die Gebrüder Wright das erste Mal mit einem Motorflugzeug gestartet sind. Das ist schon ein Weilchen her.
Über das Kapitel: Denken wie Onkel Dagobert
In diesem Kapitel verdreht Herr Werner so einiges. Er spricht zum Beispiel sein Vermögen an, vom Manager Magazin auf ca. eine Milliarde Euro geschätzt (2007), und behauptet, es existiere gar nicht und seine DM-Handelskette sei für Investoren, die den Betrieb eventuell kaufen und weiter fortführen möchten, nicht interessant.
Das Unternehmen von Herrn Werner hat einen Jahresumsatz von knapp sieben Milliarden Euro. Bei einer Umsatzrendite von 2% würde das einen Gewinn von einhundertvierzig Millionen Euro im Jahr bedeuten. Bei 1,5% Umsatzrendite wären es rund einhundert Millionen Euro Gewinn. Bei 1% Umsatzrendite wären es immer noch siebzig Millionen Euro Gewinn im Jahr und damit eine Kapitalverzinsung von 7%, bei einem Eigenkapital (Firmenwert laut Bilanz) von einer Milliarde Euro. Ist der Firmenwert, wie Herr Werner behauptet, wesentlich niedriger als eine Milliarde Euro, wäre die Kapitalverzinsung, bei siebzig Millionen Euro Gewinn, sogar wesentlich höher als 7%. Jeder potenzielle Investor würde bei dieser Vorstellung vor Gier anfangen zu sabbern.
Selbstverständlich hat Herr Werner recht, wenn er behauptet, eventuelle Investoren interessieren sich nicht für das Toilettenpapier in seinen Läden. Aber sie könnten sich für die Umsatzrendite, die die DM-Handelskette mit diesem Toilettenpapier erzielt, interessieren. Und sicher sind die Mitarbeiter der DM-Handelskette keine Sklaven, und nicht als Eigentum des Unternehmens mit einem Wert in der Inventurliste und der Bilanz vermerkt, wie Herr Werner zurecht festgestellt hat. Aber auch bei einem Verkauf der DM-Handelskette würden diese Mitarbeiter dort weiterarbeiten und damit für einen Investor die Umsatzrendite erwirtschaften. Denn auch wenn die Mitarbeiter keine Sklaven sind, würden die Angestelltenverträge ja weiter bestehen, und es wäre naiv zu glauben, die Mitarbeiter würden kündigen, nur weil der Besitzer des Unternehmens gewechselt hat.
Und auch Herr Werner würde den Gewinn seines Unternehmens nicht zum größten Teil in den Betrieb reinvestieren, wenn der Gewinn sich damit ins Nirwana auflösen würde. Und würden seine Reinvestitionen sich doch in Nichts auflösen, hätte er schon längst nicht mehr die Kredite, die er angibt, dass er sie hat. Denn die Banken hätten dann schon längst den Geldhahn zugedreht, so wie sie es ja bereits vor Kurzem bei einem ehemaligen Wettbewerbsunternehmen getan haben.
Letztendlich schweigt Herr Werner sich über die tatsächliche Umsatzrendite und über das Eigenkapital seines Unternehmens aus. Das ist zwar kein Verbrechen, aber wenn er hier schon mit seinem Unternehmen Zahlenspiele bringt, sollte er auch diese Zahlen offenlegen. Denn diese Zahlen sind wichtige Kriterien, um festzulegen, ob sein Unternehmen einen Kaufpreis von einer Milliarde Euro wert wäre oder nicht. Was er ja bestreitet.
Wenn Herr Werner in seinem Buch „Einkommen für alle“ herumjammert, er würde gar nicht verstehen, wieso das Manager Magazin behauptet, er hätte ein Vermögen von einer Milliarde Euro und er den Anschein zu erwecken versucht, dass er nicht einmal in die Nähe dieser Summe kommt, dann macht er sich, wenn man die Begründungen seiner Zweifel liest, wie keine Sklaven zu beschäftigen und Toilettenpapier sei doch nicht interessant, lächerlich.
Ob eine Aussage glaubwürdig ist oder nicht, hängt auch von der Glaubwürdigkeit der Begründungen ab. Und die Begründungen von Herrn Werner (Toilettenpapier, Sklaven) sind nicht glaubwürdig.
Und auch Investoren würden das Geld für einen Kauf, entgegen den Behauptungen von Herrn Werner, durchaus auch in einem Koffer mitbringen können, sprich, sie müssen nicht unbedingt einen Kredit aufnehmen. Es gibt genügend Lebensversicherungsgesellschaften, Versicherungskassen für Ruheständler, Gebäudeschutzversicherungen, Feuerversicherungen oder sonstige Kapitalanlagegesellschaften, die die Beiträge ihrer Mitglieder irgendwo unterbringen müssen, damit diese Beiträge nicht im Tresor langsam aber sicher vor sich hingammeln. Und nicht jeder Investor möchte sein eingesetztes Kapital in einem überschaubaren Zeitraum zurückerhalten, sondern nur, wie die DM-Handelskette wohl auch jetzt schon, eine angemessene Verzinsung für sein eingesetztes Kapital erreichen.
Kommen wir überhaupt einmal zu dem Thema Geld.
Herr Werner behauptet, dass die Geldknappheit heutzutage noch vorhanden ist, während es die Güterknappheit, zumindest bei uns, im Grunde nicht mehr gibt. Gleichzeitig kommt Herr Werner aber auch zu der Erkenntnis, dass jedes Gut und jede Leistung im Prinzip mit Geld hinterlegt ist und die Geldknappheit eigentlich nur besteht, da das Geld nicht gleichmäßig verteilt ist.
Nun – dieses Problem könnten wir lösen, in dem wir das vorhandene Geld und Vermögen gleichmäßig verteilen. Den Reichen nehmen, den Armen geben. Wir könnten z.B. Herrn Werner enteignen und sein Unternehmen den Mitarbeitern übergeben. Da, laut Aussage von Herrn Werner, seine Läden sowieso kaum etwas wert sind, dürfte ihn das nicht einmal sehr schmerzen. Mit solchen Maßnahmen würden wir das Problem, das Herr Werner hier anführt, die ungleichmäßige Geldverteilung, oder sprechen wir lieber von einer ungleichmäßigen Vermögensverteilung, lösen. – Was das für die wirtschaftliche Entwicklung seines Unternehmens, und sollten wir solche Verfahren flächendeckend durchziehen, für die wirtschaftliche Entwicklung des ganzen Landes bedeuten würde, steht auf einem anderen Blatt.
Aber ein BGE würde das Problem nicht lösen. Herr Werner hat es nämlich im Grunde erkannt. Geld und produziertes Gut und Leistung müssen im Einklang stehen. Gibt es mehr Geld als Leistung/Güter, gibt es Inflation, gibt es weniger Geld als Leistung/Güter, Deflation. Nicht immer gleich kurzfristig, aber auf lange Sicht gesehen.
Und hier haben wir ein Grundproblem bei dem BGE. Geld, aus sich selbst heraus, hat keinen Wert (zumindest seit dem das Geld nicht mehr aus Edelmetall hergestellt wird oder durch Goldreserven gedeckt ist). Hinter Geld muss aber grundsätzlich immer eine Leistung oder ein Wert stehen. Haben wir Arbeitslose, aus welchem Grund auch immer, müssen die, die arbeiten, die Leistung, für das Geld, was ohne Leistung ausgegeben wird (Arbeitslosengeld), zusätzlich mit leisten.
Wenn durch die Einführung von einem BGE, der Zwang selbst Leistung zu erbringen, um Geld zu bekommen, ausgesetzt wird, werden ganze Berufszweige, die für die Gesellschaft wichtig sind, aussterben. Das hat zwei Folgen.
Mehr Menschen bekommen eine Geldleistung, ohne dass eine Güter- oder Dienstleistung dahintersteht, und somit müssen weniger Menschen dann mehr leisten, um das auszugleichen.
Für die Gesellschaft wichtige Berufe würden nicht mehr bedient werden. Es gibt zwar eine Umfrage, in der es heißt, dass die meisten Berufstätigen auch mit einem BGE weiter arbeiten würden, aber eben nicht unbedingt in ihrem jetzigen Beruf. Die BGE-Befürworter weisen ja selbst ständig darauf hin, dass man mit einem BGE nicht mehr jeden Job unbedingt annehmen muss, sondern man sich etwas Kreatives als Beschäftigung suchen kann. Sicher werden wir auch weiterhin Architekten, Schneider und Beschäftigte in anderen interessanten Berufen haben. Aber was machen wir, wenn die eine Million professionelle Reinigungskräfte in diesem Land, die heutzutage öffentliche Toiletten, Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser, Ärztepraxen, Alten- und Pflegeheime, Geschäftshäuser und Verwaltungsgebäude reinigen, zu der Auffassung kommen, dass ihr Job nun wirklich nicht das Gelbe vom Ei ist, und sie lieber sich im Stadtpark mit einer Staffelei hinstellen möchten, um Landschaftsbilder zu malen. Was bis heute automatisiert werden konnte, wurde auch automatisiert. Zu glauben, wir können solche Jobs einfach mal durch Roboter ersetzen, wäre naiv.
So bitter es klingt, aber letztendlich ist es Herr Werner, der den Fehler macht, wie Onkel Dagobert zu denken.
Nicht das Geld hat einen Wert, sondern nur die Leistung, die wir dadurch erhalten können. Und diese Leistung muss erschaffen werden. Was nicht erschaffen wurde, können wir, auch mit einem BGE, nicht bekommen.
Vor einhunderttausend Jahren ging der Neandertaler mit seinem Speer auf die Jagd, um ein Tier zu erlegen, damit er und seine Sippe satt wurden. Dazu brauchte er, wie erwähnt, einen Speer. Heute gehen wir nicht mehr auf die Jagd, sondern in den Supermarkt. Dazu brauchen wir keinen Speer, sondern nur Geld. Aber trotzdem muss das Tier, das wir uns jetzt im Supermarkt aus der Tiefkühltruhe holen, von irgendjemand gejagt und erlegt worden sein, bzw. heute eher gezüchtet, aufgezogen, geschlachtet und zum Supermarkt transportiert werden. Unsere Welt ist zu klein, um selbst auf die Jagd zu gehen, ja selbst, damit jeder seine eigenen Tiere züchten kann, reicht der Platz nicht aus. Die Leistung, die wir selbst für andere erbringen (egal jetzt, ob es sich um das Reinigen von öffentlichen Toiletten oder um das Planen von Häusern als Architekt handelt), sowie die Leistungen, die von anderen für uns erbracht werden (als Bauer das Schwein züchten; der Schlachter, der das Schwein schlachtet; die Spedition, die das Fleisch in den Supermarkt bringt), verbinden wir nicht mehr mit dem Begriff „Sattwerden“, so wie es der Neandertaler mit dem Jagen verbunden hat. Durch die Steppe hetzen, Mammut jagen, Mammut töten, Mammut nach Hause tragen, Mammut aufs Feuer legen, Mammut essen und satt sein. Punkt aus. So einfach war damals die Welt.