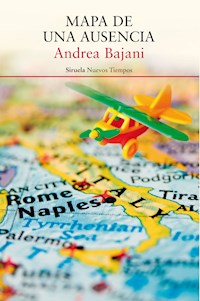19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Nagel & Kimche
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ausgezeichnet mit dem Premio Strega 2025 und dem Premio Strega Giovani 2025.
Zehn Jahre ist es her, dass der Sohn seine Eltern zum letzten Mal gesehen hat. Seither hat er seine Telefonnummer gewechselt, die Stadt verlassen, eine unüberwindbare Mauer errichtet, um der schmerzhaften Familiengeschichte zu entkommen. Es waren die zehn besten Jahre seines Lebens.Mit unerbittlicher Präzision erzählt er von seinen Eltern, zeichnet das ergreifende Porträt seiner Mutter, die ihr eigenes Leben aufgegeben hat, um den Ansprüchen des tyrannischen Vaters gerecht zu werden. Stückweise nähert sich der Sohn der Frau an, deren Persönlichkeit hinter ihren Rollen als Ehefrau, Hausfrau und sorgender Mutter verschwindet. Wer war seine Mutter vor diesem Leben, der Ehe mit dem dominanten Vater, von dessen beherrschendem Bild sie sich nur schwer lösen lässt?
»Der Jahrestag« ist ein radikaler Befreiungsroman und eine eindringliche Ergründung der wahrscheinlich prägendsten Verbindung im Leben: der Beziehung zu den eigenen Eltern.
»Ein erschütterndes, wichtiges Buch. Eine scharfsinnige Analyse und zugleich ein tragischer Abschied von der eigenen Familie.« Jenny Erpenbeck
»Einer der besten zeitgenössischen italienischen Autoren.« Jhumpa Lahiri
»Kannst du dich von deinen Eltern befreien? Von dem Leid, das sie dir angetan haben? Das ist eine skandalöse Frage. Andrea Bajani stellt sich dieser Frage schreibend, in einem Buch, das skandalös ruhig ist.« Emmanuel Carrère
»Bajani ist ein außergewöhnlicher und kompromissloser Künstler. Jede Seite ist mit Klarheit, Tiefe, Aufrichtigkeit und sezierender Intelligenz geschrieben.« Katie Kitamura
»Mit einer ebenso unerbittlichen wie raffinierten Stimme legt Andrea Bajani eine Mine unter das Bild einer Familie. Und er lässt sie explodieren in seinem wahrhaftigsten Buch.« Donatella Di Pietrantonio
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 170
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Zum Buch
Zehn Jahre nachdem sich ein Sohn vom patriarchalischen Elternhaus losgesagt hat, kann er endlich zurückblicken. Seitdem hat er seine Telefonnummer gewechselt, die Stadt verlassen, eine unüberwindbare Mauer errichtet, um der schmerzhaften Familiengeschichte zu entkommen. Mit unerbittlicher Präzision erzählt er von seinen Eltern, zeichnet das ergreifende Porträt seiner Mutter, die ihr eigenes Leben aufgegeben hat, um den Ansprüchen des tyrannischen Vaters gerecht zu werden. Stückweise nähert sich der Sohn der Frau an, deren Persönlichkeit hinter ihren Rollen als Ehefrau, Hausfrau und sorgender Mutter verschwindet. Was für eine Frau war seine Mutter vor diesem Leben, der Ehe mit dem dominanten Vater, von dessen beherrschendem Bild sie sich nur schwer ablösen lässt?
»Der Jahrestag« ist ein radikaler Befreiungsroman und eine eindringliche Ergründung der wahrscheinlich prägendsten Verbindung im Leben: der Beziehung zu den eigenen Eltern.
Zum Autor
Andrea Bajani, 1975 in Rom geboren, wuchs im Piemont auf. Bis heute schreibt der Schriftsteller und Journalist regelmäßig Essays und Artikel, u.a. für La Stampa und La Repubblica. Bereits seine dritte Veröffentlichung, der Roman Mit herzlichen Grüßen, 2010 auf Deutsch erschienen, war ein enormer Erfolg. Für Lorenzos Reise wurde Bajani mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, u.a. mit dem Premio Mondello. Zuletzt erhielt er für Der Jahrestag (2025) den wichtigsten italienischen Literaturpreis, den Premio Strega. Seit 2018 ist er Lektor im Turiner Verlag Bollati Boringhieri, außerdem gibt er regelmäßig Kurse in Creative Writing – augenblicklich an der Rice University in Houston, Texas, wo er auch lebt.
Andrea Bajani
Der Jahrestag
Roman
Aus dem Italienischen von Maja Pflug
NAGEL UND KIMCHE
Die Originalausgabe erschien 2025 unter dem Titel L’anniversario bei Feltrinelli Editore, Mailand.
Questo libro è stato tradotto grazie a un contributo per la traduzione assegnato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano.
Die Übersetzung dieses Buches erfolgte mit finanzieller Unterstützung des italienischen Ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten und Internationale Zusammenarbeit.
© 2025 Andrea Bajani
Deutsche Erstausgabe
© 2025 für die deutschsprachige Ausgabe
NAGEL UND KIMCHE
in der Verlagsgruppe HarperCollins Deutschland GmbH
Valentinskamp 24 · 20354 Hamburg
Covergestaltung von wilhelm typo grafisch, Zollikon
Coverabbildung von Gianni Berengo Gardin/contrasto/laif
E-Book-Produktion von GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 9783312014248
www.nagel-kimche.ch
Jegliche nicht autorisierte Verwendung dieser Publikation zum Training generativer Technologien der künstlichen Intelligenz (KI) ist ausdrücklich verboten. Die Rechte der Urheber, Urheberinnen und des Verlags bleiben davon unberührt.
If you are not the free person you wantto be you must find a place to tell the truthabout that. To tell how things go for you.
Anne Carson, Candor
That’s why I’m not to be trusted.Because a wound to the heartis also a wound to the mind.
Louise Glück, The Untrustworthy Speaker
1.
Zum letzten Mal habe ich meine Mutter gesehen, als sie mich zum Abschied an die Wohnungstür begleitete. Danach hat sie gewartet, bis sie mich die Treppe hinunter verschwinden sah, bevor sie die Türe schloss. Abschiedsgesten lagen meiner Mutter nicht, vor allem, weil sie dabei von einer Form von Schüchternheit übermannt wurde, die an Selbstverleugnung grenzte. Was ihr konkret jede Rhetorik unmöglich machte: Nie hätte sie das, was sie selbst für so nebensächlich hielt, auch nur vorübergehend vorspielen können. Deshalb, glaube ich, gestand sie sich nicht das Recht zu, Beginn oder Ende von irgendetwas festzulegen. Sie stand hinter meinem Vater, wenn die Tür sich öffnete, und sie stand hinter meinem Vater, wenn die Tür die beiden am Ende jedes meiner Besuche wieder in der Wohnung verschluckte.
Dennoch war sie es, die sich an jenem Tag als Letzte von mir verabschiedete; sie war über die Schwelle getreten, stand allein im Treppenhaus oben an den Stufen. Eher als mich zu verabschieden, folgte sie mir irgendwie. Aus dem Blickwinkel der Jahre, die seitdem vergangen sind, würde ich sagen, sie konnte mich nicht gehen lassen. Tatsache ist, dass meine Mutter, während ich rückwärts zum Ausgang strebte und jeden Schritt in nebulöse Worte hüllte, im gleichen Schritt vorwärts ging. Durch die Brille des Schreibens gesehen, gleicht die Szene einem Tanz, ein Männerfuß nach hinten, ein Frauenfuß, der nachzieht, ein weiterer Schritt des Sohnes, noch einer der Mutter, bis zum Ausgang.
Die letzten Worte, die ich meine Mutter sagen hörte, waren keine Bestätigung, sondern eine Frage. Was ebenfalls in deutlichem Gegensatz zu einer Haltung stand, die eher zur Akzeptanz als zur Forderung neigte, eher zur Unterwerfung als zu Ansprüchen, eher dazu, Rechenschaft abzulegen, als sie von anderen zu verlangen.
»Wirst du uns wieder besuchen kommen?«, fragte sie, indem sie auf mich zuging, während ich mich aus der Wohnung stahl. Ich glaube, sie hat mir in die Augen gesehen, es ist aber eher eine Vermutung als eine verblasste Erinnerung, weil ich sie nicht anschaute.
Ihre Frage war völlig unpassend, es gab keinerlei Grund, sie zu stellen. Regelmäßig fuhr ich ungefähr alle zwei Wochen siebzig Kilometer, um ein paar Stunden mit meinen Eltern zu verbringen, gewöhnlich über Mittag. Am Ende des Essens, nach dem Kaffee, stieg ich wieder ins Auto und kehrte nach Turin zurück. Lange Zeit hatte ich das getan, nachdem ich mit zwanzig unter dem üblichen Vorwand des Studiums von zu Hause ausgezogen war. Als sie die Frage stellte, war ich einundvierzig. Das bedeutet, dass ich dieses Ritual, sie zu besuchen, seit einundzwanzig Jahren in einem Rhythmus wiederholte, der zwangsläufig als Routine gelten musste. Es gab also wirklich keinen Grund, daran zu zweifeln, dass es sich nach jenem Tag noch weiterhin und bis in alle Ewigkeit wiederholen würde. Außerdem war ich ihr Sohn, und sie waren diejenigen, die mir das Leben geschenkt hatten, ein Grund mehr, keinerlei Zweifel zu hegen.
Ich könnte noch hinzufügen, dass die Frage nicht nur eindeutig nicht zum Anlass passte, sondern dass auch ich selbst sie mir nie gestellt oder je irgendwie darüber nachgedacht hatte. »Wirst du uns wieder besuchen kommen?«, fragte sie mich. Auf diese Frage hat es nie eine Antwort gegeben. Das »Aber sicher«, das ich auf dem Treppenabsatz fallen ließ, wurde nur ausgesprochen, damit etwas geschah, damit meine Mutter den Zugriff lockerte und ich die Treppe hinunterlaufen konnte. Es war keine Antwort, einfach weil eine Mutter ihrem Sohn diese Frage nicht stellen konnte.
Doch meine Mutter stellte sie, und zwar instinktiv. Nach all den Jahren, in denen sie sich entzogen, weder für sich selbst noch für die Kinder dagewesen war, nur geputzt, bedient, im Haushalt und im Bett ihrem Mann gehorcht und das Wenige oder das Nichts ausgeführt hatte, das mein Vater von ihr erwartete oder forderte, machte sie am Ende die Geste einer Mutter. Sie fühlte, was in ihrem Sohn geschehen war, bevor er selbst es wusste.
An jenem Tag vor zehn Jahren habe ich meine Eltern zum letzten Mal gesehen. Seitdem habe ich die Telefonnummer, die Wohnung, den Erdteil gewechselt und eine unüberwindliche Mauer errichtet, habe einen Ozean zwischen uns gelegt. Es waren die zehn besten Jahre meines Lebens.
2.
Ich habe nie über meine Mutter geschrieben. Ich habe nie gedacht, es könne sich lohnen, über sie zu sprechen, und im Grunde habe ich es auch nie getan, mit niemandem. Selbst in den intimsten Gesprächen kam sie höchstens als Aufblitzen eines vom Satz umrahmten Wortes vor. Das Stück Welt, das sie einnahm, war so nebensächlich, dass es keine Aufmerksamkeit forderte. Mein Vater beanspruchte in der Familie den ganzen Raum, er hatte sich ins Zentrum der Szene gerückt und sozusagen die einzige Version des Familienromans geschrieben. Die eines Mannes, dem es zustand, alles vom Leben abzukassieren, was bedeutete, dass wir alle zahlten und mit ihm zusammen im Feuer schmorten. Anders gesagt, ich habe an ihn geglaubt und nie gedacht, dass es die Mühe wert sei, über meine Mutter zu reden, weil es nichts zu sagen gab. Ihr Leben bestand darin, dass sie zur Welt gekommen war. Ihr Auf-der Welt-Sein selbst war keiner Notiz würdig.
Bis heute kann ich sie nur schemenhaft in den Wohnungen lokalisieren, in denen wir gelebt haben. Selbst wenn ich in den Ordnern der visuellen Erinnerungen blättere, gibt das Gedächtnis wenig her. Da ist kein Raum, der ihr zusteht, kein Winkel in der Wohnung, kein Zimmer, Stuhl, Fenster, in dem es mir gelingt, ihr Bild ganz scharf zu stellen. Und doch hat sie gesessen, Türen geöffnet und geschlossen, schmutzige Wäsche in die Waschmaschine gestopft und sie dann aufgehängt, hat sich an- und ausgezogen, ist schlafen gegangen. Ich weiß das, weil es nicht anders sein kann, es muss zwangsläufig so sein. Aber in mir finde ich keine Spur davon.
Nicht einmal die Küche, der Raum, der ihr gesellschaftlich zugewiesen war, gehörte ihr wirklich. Ich weiß, dass sie diejenige war, die kochte, den Tisch deckte, abspülte, kann sie aber bei diesen Tätigkeiten nicht visualisieren, ihre Gestalt nicht sehen, wie sie am Herd steht, die Kühlschranktür öffnet. Die Abwesenheit meines Vaters am Spülbecken kann ich mir dagegen ganz leicht vorstellen, ich weiß, dass er nicht abgespült und nicht gekocht hat. Oder falls er es getan hat, war es so außergewöhnlich, dass sich die Erinnerung daran angesichts der allgemeinen Tendenz in Luft aufgelöst hat. Sicher ist, dass ich meine Mutter, die es jeden Tag an seiner Stelle tat, nicht sehe.
Ich weiß, dass es bestimmte Hausarbeiten gab, die sie täglich erledigte, aber nichts hat sich je zu einer Gewohnheit verdichtet. Damit etwas zu einer Gewohnheit wird, braucht man einen Körper, der sie einfordert, und meine Mutter hatte keinen, oder besser, keinen eigenen Körper. Auch als Körper war sie ein Anhängsel meines Vaters. Die Hausarbeiten (Einkaufen, Kochen, Putzen, uns von der Schule abholen) waren die Fäden, an denen sich ihre Figur – dem Willen unseres Vaters gehorchend – durch die Wohnung bewegte, oder durch den Raum, der die Wohnung vom Rest trennte.
Von ihrem Körper bleiben mir nur noch verbale Indizien und ein Bein, das infolge einer Kinderlähmung zwischen Knie und Fußknöchel ein klein wenig schmaler war. Dadurch hinkte sie ganz leicht, was, glaube ich, für fremde Blicke nicht wirklich sichtbar war. Jedes Mal, wenn ich ihre Wade sah, empfand ich eine Art schmerzliche Zärtlichkeit, das ist sicher. Sie ertrug ihr Hinken mit einer gewissen Unbekümmertheit, zwischen Unschuld und Nachlässigkeit. Ich habe sie nie darüber sprechen hören, ihr Körper war kein Gesprächsthema. Er war unsichtbar, das Bollwerk ihrer Unsichtbarkeit. Obgleich kaum wahrnehmbar, war ihr von der Kinderlähmung geschädigtes Bein – wenn man es so nennen kann – das Einzige, was diese Unsichtbarkeit durchbrach, was sie dazu verurteilte, gesehen zu werden. Ich glaube, das war es, was mich schmerzte.
Ein weiterer Hinweis auf den Körper meiner Mutter ist der unpassende Geruch eines Damenparfums in der Wohnung, der am Samstagnachmittag noch im Raum hing, wenn sie mit meinem Vater ausgegangen war. Ich müsste sagen, dass sie zu einem Spaziergang aufbrachen, aber in meinem Gedächtnis ist diese Aktion unter dem Ausdruck archiviert, dass mein Vater sie »ausführte«. Auf diese Weise sprach er von der Zeit, die sie gemeinsam außer Haus verbrachten, so als würde er seinen Hund ausführen.
Was sonstige körperliche Hinweise betrifft, gab es eine Phase mit nächtlichen Koliken, mit Wimmern, wenn nicht sogar richtigem Weinen, das aus dem Schlafzimmer meiner Eltern drang. Ich habe keinerlei Erinnerung daran, dass sie doch auch tagsüber zuckendes Stechen in der Seite spüren musste. Aus irgendeinem Grund wurden diese Krämpfe, Ausdruck eines unerträglichen Schmerzes, weder tagsüber thematisiert, noch flossen sie je in den Familiendiskurs ein. Die sogenannte offizielle Version beeinflussten sie jedenfalls nicht. Sie blieben in den Bereich des Traums verbannt. Man konnte sie nur zur Kenntnis nehmen, wenn sie in einer oberflächlicheren Kurve des Schlafzyklus stattfanden, während ich meinen Kopf auf dem Kissen zur anderen Seite drehte, bevor ich erneut in Tiefschlaf fiel.
Das Ganze endete schließlich mit einem operativen Eingriff, herausgenommenen Nierensteinen und einem Aufenthalt im Krankenhaus, der keine Spuren in mir hinterlassen hat. Nur eine Art Frieden – jetzt, da ich darüber schreibe, gewinnt er Raum, breitet sich auf dem Blatt aus – und ein stilles Licht in dem Zimmer im dritten oder vierten Stock jenes Gebäudes. Diesmal, könnte man sagen, steht meine Mutter im Mittelpunkt der Szene, umringt von Ärzten und Schwestern. Sie versorgen sie so, wie es ihrer Lage zukommt, die übliche Praxis der Krankenpflege. Fieber messen. Wunde säubern, Essen ans Bett servieren, Tablett wieder abholen, Eintritt in die Nacht.
An diesem Bild fällt hauptsächlich eines auf: dass sie – ihr Körper, ihre Person – der Macht meines Vaters entzogen und einer anderen Gerichtsbarkeit überantwortet ist, der des Staates. Sie muss die Papiere selbst unterschreiben, mit ihrem eigenen Namen die Akzeptanz besiegeln, bestätigen, dass sie weiß, welche Gefahr für ihr Leben sie eingeht. Niemand anders – vor allem nicht ihr Ehemann – kann das an ihrer Stelle bescheinigen, niemand anders kann sich dem Skalpell aussetzen, das in sie hineinschneiden wird, um ihr Erleichterung zu verschaffen.
Und sich danach dieser Eingeschlossenheit zu überlassen, sich nicht um Mittag- oder Abendessen kümmern zu müssen, um das Wechseln der Bettwäsche. Eine Haft gewissermaßen, aber auch eine Festung. Sogar, dass sie in dieser Szene allein ist, scheint mir bedeutend, nicht Zweite, in keiner Weise marginal. Also kann man von dieser Szene ausgehen, in der meine Mutter daliegt, den Kopf aufs Kissen gestützt, und von dem Pflegepersonal, das vom Staat bezahlt wird, damit es ihr besser geht.
Ob es geschehen ist oder nicht, spielt jetzt keine Rolle, es ist der Beginn des Romans.
3.
Es gibt nicht viele Spuren eines früheren Lebens meiner Mutter. Unter früher verstehe ich das, was vor ihrem Eheleben geschah, dessen Zeuge ich ja zumindest teilweise gewesen bin.
Sie hat es nicht für nötig gehalten, ein Fotoalbum anzulegen, falls sie überhaupt je eines besessen hat. Während das Leben meines Vaters ausführlich dokumentiert und darauf ausgerichtet ist, ein Opferschicksal zu erzählen, ist das meiner Mutter nicht überliefert. Entweder hat es keinen Platz gefunden, oder es wurde uns einfach nie etwas darüber mitgeteilt. Oder es gab ein Album – jetzt, da ich darüber schreibe, sehe ich den Rücken des Bandes, hineingeschoben neben dem meines Vaters –, aber es gab keinen mit ihrem Leben verbundenen Mythos, an den die fotografischen Zeugnisse hätten anknüpfen können. Deshalb stand es einfach dort, regloses, in einem Regal gelagertes Leben.
Ich weiß ganz sicher, dass meine Mutter eine Kindheit hatte. Das ist bezeugt: als jüngere von zwei Töchtern einer Sekretärin und eines Bauarbeiters, Sozialwohnung gleich außerhalb von Rom. Aber wieder ist es eine mündliche Kindheit, die stattgefunden hat und über die zu sprechen sich nicht lohnte, weil es darüber nichts zu sagen gab. Das passt perfekt zu den wenigen Begebenheiten, in denen man das Leben zusammenfassen kann, bei dem ich dabei war.
Sie taucht in den Alben meines Vaters auf, wieder als direktes Anhängsel, das sein Bild vervollständigt. Auf dem Rücksitz eines Mopeds, am Meer. Das Foto ist nicht lange vor der Geburt meiner Schwester aufgenommen und lässt nichts ahnen. Im Doppelsinn, weder lässt es ein Familienschicksal erahnen noch den Zerfall, dem diese Familie entgegengehen würde. An ihrem Gesicht kann man nichts ablesen, weder Lust noch Vergnügen, weder Schwindel noch Angst. Und es gibt keine Verführung. Da ist eine Art Abstand, als vergesse sie, wirklich da und präsent zu sein.
Direkte Zeugnisse gibt es kaum. Nicht dass im Gespräch mit ihr oder ihren Verwandten irgendetwas verschwiegen oder vergessen wurde. Es gab einfach nicht so viel zu erinnern. Nur, dass sie die jüngere von zwei Schwestern war, und das genügte.
Auch auf Nachfrage hatte niemand viel zu erklären. »Sie hat nie Probleme gemacht«, lautete die Zusammenfassung des Wenigen, was sie über sie zu sagen hatten. Es gab sie und Schluss, sie steckte in einer Art Stillstand, in dem die Zeit keine Variable war, keine bemerkenswerten Veränderungen hervorbrachte. Es wurde nie über die Kinderlähmung gesprochen, jedenfalls nicht so, dass es Eindruck gemacht hätte. Was mich angeht, steckte der Muskelschwund in der Hose. Am Meer wurde er sichtbar, im Badeanzug, doch niemand bemerkte ihn wirklich, dann kam der September, und er verschwand wieder.
Direkte Zeugnisse ihres Lebens vor der Ehe gibt es wenige. Eines stammt von meinem Vater und dient noch einmal der Ausschmückung des Bildes, das er von sich vermitteln wollte. Es betrifft die Art, wie er die Freundin abservierte, mit der er zu jener Zeit zusammen war und die ihn in flagranti mit meiner Mutter erwischte. Der Satz, den er damals sagte und mir dann stolz als guten Rat für seinen Sohn berichtete, erlaubte ihm, vor meiner Mutter sein Gesicht zu wahren und sich bei der unglückseligen anderen nicht entschuldigen zu müssen.
Den Satz zu wiederholen, lohnt sich nicht, doch einzig in diesem Zusammenhang taucht meine Mutter einmal als Mädchen auf. Es gibt nichts, was mir sonst noch berichtet worden wäre, weder die Reaktion der Betrogenen noch die meiner Mutter, als er ihr mitteilte, sie sei die Erwählte. Ich könnte nicht sagen, ob meine Mutter auf die gleiche Weise von der anderen wusste, wie diese nichts von ihr ahnte.
Ein weiteres Zeugnis stammt von der Mutter meiner Mutter, die bei jeder Familienkrise Bruchstücke der Erinnerung von sich gab. Es betrifft wiederum die Anfänge der Beziehung zu meinem Vater. Meine Mutter verlässt das Haus, um zur Bushaltestelle zu gehen und ihm von dort aus entgegenzufahren. Sie hat einen großen runden Wecker in der Hand, den man nachts in der ganzen Wohnung ticken hört. So jedenfalls stellte meine Großmutter es dar, wobei sie ihre Worte mit Gesten begleitete, um zu zeigen, wie übertrieben die Sache war. Oder so stelle ich es mir vor.
Der Grund für ein derartiges, ästhetisch auffälliges und insgesamt lächerliches Verhalten war, dass sie offenbar ihre Armbanduhr nicht fand und fürchtete, zu spät zur Verabredung zu kommen. Das heißt, sie fürchtete die heftige Reaktion meines Vaters, falls sie nicht pünktlich erschien.
Meine siebzehn- oder achtzehnjährige Mutter, die mit einem großen Wecker in der Hand im Autobus quer durch Rom fährt, ist die letzte Spur, die ich von ihr habe, bevor ich sie wenige Jahre später treffe, als ich um drei Uhr morgens an einem Frühlingstag in einem römischen Krankenhaus zur Welt komme. Dieses Bild ist sehr symbolisch. Aber wofür? Die Interpretation ihrer Mutter, als sie es mir schilderte, lautete, es handele sich um eine von Angst diktierte Unterwerfung. Sie fokussierte sich mehr auf die Einstellung des Mädchens als auf das visuelle Element der Szene.
Sie zog den Gegenstand nicht in Betracht, den Wecker, den ihre Tochter dabeihatte. Das heißt, sie zog bei ihrer Analyse nicht in Betracht, dass meine Mutter gar keine Angst vor meinem Vater haben könnte. Dass sie gar nichts empfinden könnte, oder nichts, was von Furcht ausgelöst war, und dass mein Vater im Gegenteil als derjenige fungierte, der die Zeit in Bewegung setzte und sie damit aus dem Stillstand herausriss, in dem sie lebte, in dem es nichts zu erklären und nichts zu erinnern gab. Dass die Zeit spürbar wurde.
Dass also die Inszenierung der Bedrohung und der Reaktion eine soziale Funktion hatte, konkretes Leben war, zumindest etwas mehr als nichts.
4.
Wenn ich nie über meine Mutter geschrieben noch je über sie nachgedacht habe, dann deshalb, weil man sie dafür von meinem Vater abtrennen muss. Was eine heikle Operation bedeutet, eine spezielle chirurgische Begabung erfordert, eine kalte, ruhige Hand. Man braucht Langsamkeit und Präzision, ein grammatikalisches Skalpell. Das heißt, man muss bei den Wörtern an den noch nicht befallenen Stellen ansetzen. Sie erkennen, vom Rest absondern und dann aufschneiden, entschieden Schmerz zufügen.
Meine Mutter von meinem Vater abzutrennen, heißt buchstäblich, sie der Übermacht zu entziehen, mit der die Figur meines Vaters sich systematisch unserer Vorstellung bemächtigt hat, indem er unserer Netzhaut gnadenlos ein selbstmitleidiges Bild von sich einbrannte und so unsere Sehfähigkeit unheilbar verdarb. Womit er alles im Dunkeln ließ, was nicht er war. An erster Stelle sie, die sowieso zum Verschwinden neigte. Wenn ich kindliches Mitgefühl in mir habe, drückt es sich in der Erbarmungslosigkeit dieses Versuchs aus, sie dem Dunkel zu entreißen, in der grausamen Tat, sie ins volle Licht zu heben.
Meine Mutter von meinem Vater abzutrennen, bedeutet also, sie aus dieser Finsternis hervorzuholen, um sie in jeder Hinsicht zu einer Romanfigur zu machen. Auch deshalb, könnte ich sagen, habe ich bisher noch nie einen Roman geschrieben. Also etwas, das einem Universum Gestalt verleiht, dessen Zeuge ich nicht unmittelbar oder nur teilweise gewesen bin. Etwas, das Fakten, Gedanken und sogar eine vollkommen andere, alternative Erinnerung schafft, die im Schreiben erzeugt wird. Also mehr ein Produkt der Erfindung als des Erinnerns. In dem meine Mutter sogar von ihr selbst unabhängig existiert.