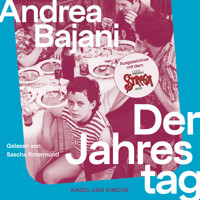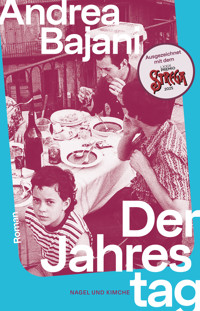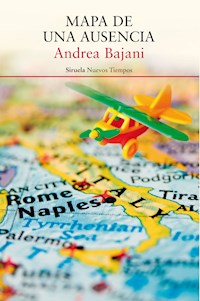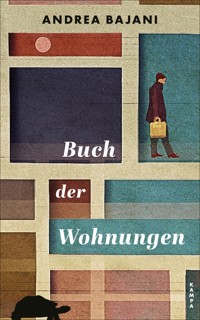
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wovon sprechen wir eigentlich, wenn wir »Ich« sagen? Sind wir ein Leben lang dieselben? Lassen wir nicht immer etwas zurück, wenn unser Leben eine Wendung nimmt? Und wo bleibt all das? In den Wohnungen, in denen wir gelebt haben? Bewahren sie die Erinnerung an uns und an die, die vor uns darin lebten, an gedachte Gedanken, ungedachte, nicht zu Ende gedachte? Andrea Bajani erzählt in seinem virtuos gebauten Roman aus dem Leben eines Mannes - anhand der Wohnungen, in denen er lebte: von seinen Freundschaften, von einer Ehe, in die er sich geflüchtet hat, von vielen Verletzungen, der Entdeckung von Sex und Poesie und davon, wie er sich befreit hat, von einer Familie, die sich selbst zu zerstören drohte. Von Wohnung zu Wohnung geht es, hin und her in der Zeit: Der Mann ist der junge Liebhaber einer verheirateten Frau in einer Provinzstadt, er ist das Kleinkind, das in einer römischen Wohnung einer Schildköte nachkrabbelt, er ist Ehemann in einer Wohnung in Turin, Bohemien in einer Mansarde in Paris und erfolgreicher Geschäftsmann in einem Londoner Hotel, er ist der Junge, der in einer Ferienwohnung vom Vater verprügelt wird, und der Student, der auf einer Matratze übernachtet. Und manchmal jemand, der einfach die Tür einer leeren Wohnung hinter sich zuzieht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 285
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Andrea Bajani
Buch der Wohnungen
Roman
Aus dem Italienischen von Maja Pflug
Kampa
In Memoriam
A.A.F.
Xaver antwortete, dass das Zuhause weder ein Wäscheschrank noch ein Vogel im Käfig sei, sondern die Gegenwart des Menschen, den man liebe. Und dann sagte er zu ihr, dass er selbst kein Zuhause habe, oder anders gesagt, dass er es in seinen Schritten, seinem Gang, seinen Reisen habe. Dass sein Zuhause dort sei, wo unbekannte Horizonte sich öffneten. Dass er nur leben könne, wenn er von einem Traum in den anderen, von einer Landschaft in die andere schreite.
Milan Kundera, Das Leben ist anderswo
1.Souterrainwohnung, 1976
Die erste Wohnung hat drei Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, eine Küche und ein Bad. Der Raum, in dem das Kind schläft, das wir der Einfachheit halber Ich nennen werden, ist in Wirklichkeit eine Abstellkammer mit einer Liege. Sie ist ein wenig feucht, wie übrigens die ganze Wohnung. Sie hat kein Fenster, ist aber gemütlich und nah an der Küche. Das Geschirrklappern, das regelmäßige Tock-Tock des Messers auf dem Schneidebrett, das laufende Wasser im Spülbecken gehören wahrscheinlich zu Ichs frühesten Erinnerungen, auch wenn er sich nicht daran erinnert. So, wie er sich auch nicht an das dumpfe Geräusch beim Schließen des Kühlschranks erinnert oder an den ruckartigen Widerstand, wenn man ihn aufmacht. Es ist die kleine Polyphonie der Küche: ein Schlagzeug aus Metall mit Kontrapunkten von Keramik, Wasserstrahl, Kühlschrankbrummen und Rattern der Abzugshaube überm Herd.
Die Wohnung liegt unter Straßenniveau. Um sie zu betreten, muss man eine Wendeltreppe ins erste Untergeschoss hinuntersteigen oder den Lift nehmen. Im Eingang, in dem ein roter Läufer zur Treppe hinführt, riecht es ganz anders als im Untergeschoss, wo sich durch die Feuchtigkeit ein Kellergeruch in den Räumen ausgebreitet hat. Im Übrigen befinden sich die Keller auf der gleichen Ebene wie Ichs Wohnung und außerdem noch zwei massive Holztüren, hinter denen nicht näher bekannte Familien leben.
Aber nicht die ganze Wohnung liegt unter Straßenniveau. Das Esszimmer, die Küche, das Bad und die Schlafzimmer gehen nämlich auf zwei Innenhöfe hinaus. Esszimmer, Küche und Bad zur einen Seite, Schlafzimmer zur anderen. Diese Innenhöfe oder Betongärten befinden sich in der Mitte einer Anlage von fünf- oder sechsstöckigen Mehrfamilienhäusern, die in den fünfziger und sechziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts gebaut wurden.
Tritt man in den Hof hinaus, hebt man unwillkürlich den Kopf. Ichs Großmutter – ab hier Oma – vollzieht jeden Morgen dasselbe Ritual: Sie geht hinaus, reckt den Hals und schaut senkrecht zum Himmel, um zu sehen, wie das Wetter ist. Dann geht sie wieder hinein.
Drinnen in der Souterrainwohnung hat man den Eindruck, draußen sei es immer bewölkt. Die Fenster zu den beiden Betongärten lassen kaum Tageslicht in die Zimmer. Deshalb knipst man beim Betreten der Wohnung im Flur eine Lampe an.
In dieser Dunkelheit macht Ich seine ersten Bewegungen. Gegenstände und Möbel werfen Schatten auf den Fußboden, die ausufern und die Wohnung überschwemmen; sie erklimmen Tische, Fensterbänke, die Obstschale aus Keramik, die immer mitten auf dem Tisch steht. Ich lernt, sich zwischen diesen Schatten zu bewegen, danach zu treten, von ihnen überwältigt zu werden. Wenn er durch die Wohnung krabbelt, verschwindet er manchmal in einem Schatten oder lässt nur eine Hand oder einen Fuß draußen, die einsam im Hellen bleiben: Ich wird von der Dunkelheit in Stücke gehackt, lässt Teile von sich auf dem Teppich liegen.
In der Souterrainwohnung werden die Lichter nur zum Schlafen gelöscht oder wenn man ausgeht: Der Raum wird der Dunkelheit, seinem natürlichen Element, zurückgegeben. Vier Schlüsselumdrehungen, Stimmen auf der Treppe und dann Stille. An dem Punkt lösen sich die Schatten gänzlich von den Gegenständen, lassen sich zu Boden fallen, unterwerfen jeden Zentimeter, erobern die Wohnung.
In dem Hof, auf den Küche, Bad und Esszimmer hinausgehen, lebt Schildkröte. Sie lebt vorwiegend hinter den Blumentöpfen oder in ihrem Panzer zurückgezogen. Selten sieht man sie ins Offene kommen. Nur wenn Oma hinaustritt, läuft sie ihr plump quer durch den Hof entgegen; sie klopft mit ihrem Bauchpanzer mehrmals auf den Boden, die immer gleiche Rhythmik ihrer Fröhlichkeit. Oma hebt sie hoch und spricht mit ihr; sie zappelt mit den vier runzeligen Beinchen in der Luft und probt so mit Omas Hilfe den Flug zwischen den hohen Häusern, die den Himmel in ein Viereck zwingen. Dann kehrt sie hinter die Blumentöpfe zurück, das Salatblatt mitschleifend, das Oma ihr gebracht hat und das sie nach und nach vertilgen wird, indem sie es mit ihrem Hornschnabel zerpflückt, bis nichts mehr übrig ist.
Schildkröte ist das erste Tier, dem Ich sich in der Souterrainwohnung gegenübersah. Und außerdem ist Ich der einzige Mensch – abgesehen von Oma –, dem Schildkröte ihren Kopf zeigt und aus dem Panzer entgegenstreckt.
Ich besucht sie im Hof, er weiß, wo sie zu finden ist: Im Eiltempo krabbelt er quer durch den Betongarten zu ihr hin, mit der jeden Tag rascheren Kadenz seiner Knie. Die Begegnung findet immer hinter den Blumentöpfen statt. Ich schlägt mit flachen Händen auf den Panzer von Schildkröte, ein aufgeregtes, festliches Getrommel. Dieses Stammesgetrommel – Ich thront auf dem Boden auf seiner weichen Windel – ist vermutlich das erste Ritual, das Ich vollzieht. Ich schlägt rhythmisch auf den Panzer, und Schildkröte streckt den Kopf heraus.
Schildkröte ist auch das erste Lebewesen, das Ich sich zum Vorbild nimmt: Im Gegensatz zu fast allen anderen Kindern, die jede Art von Grünzeug verabscheuen, verlangt Ich unweigerlich Kopfsalat zum Essen. Auch die Fortbewegungsart ist bei Schildkröte abgeschaut: lange Augenblicke der Unbeweglichkeit in den versteckten Ecken der Wohnung, gefolgt von unvermittelten Beschleunigungen im Flur.
Wenn die beiden sich von Angesicht zu Angesicht auf dem Boden treffen, lacht Ich immer laut. Dann nähert er sein nacktes Füßchen dem Maul von Schildkröte und stupst mit dem großen Zeh an ihren Kopf. Ichs großer Zeh und Schildkrötes Kopf haben die gleiche Form, und deshalb ist Ich überzeugt, dass sein Kopf im Fuß sitzt. In der Vorstellung seiner ersten Lebensjahre ist Ich also eine Schildkröte mit zwei Köpfen. Ich und Schildkröte begrüßen sich durch die Füße des Kindes.
Die Souterrainwohnung befindet sich auf einem der sieben Hügel Roms.
Auf dem Gipfel des Hügels schieben jeden Tag zwei Soldaten der italienischen Armee eine Kanone aus den Befestigungen heraus. Schlag Mittag feuern sie eine Salve auf Rom ab. Die Anwesenden klatschen dieser Inszenierung Beifall – die italienische Armee, die auf ihre Hauptstadt schießt. Häufig bringt das Getöse die Kinder zum Weinen, während die Eltern ihnen vergeblich die Bedeutung dieser Fiktion zu erklären versuchen und den Unterschied zwischen dieser und der Wirklichkeit. Die Explosion hört man kilometerweit, ihre Druckwelle überrollt das Panorama, dasselbe, auf das es auch die Fotoapparate der dort anwesenden Personen hartnäckig abgesehen haben.
In der Souterrainwohnung leben Vater, Mutter, Schwester, Oma. Und Ich.
2.Ofenwohnung, 1998
Die Grundsteinlegung war der Erwerb des Fernsehapparats, der nun auf einem Kachelboden in Cotto-Optik steht. Es ist ein Elektrogerät kleinen Formats – 14 Zoll steht auf der Verpackung –, hat aber die Macht, die Menschen zu sich herunterzuziehen: Ich legt sich auf den Boden, zur Seite gedreht wie ein Etrusker auf dem Sarkophag, und betrachtet den hellen Bildschirm.
Gekauft hatte er das Gerät aus purem Instinkt, Jahrmillionen der Evolution der Spezies, zusammen mit den Genen erworbenes Wissen. Da er sich in Turin immer noch kaum auskennt, ist er in das einzige Geschäft für Elektrogeräte gegangen, das ihm einfiel, weil er zehn Monate lang jeden Tag mit der Straßenbahn daran vorbeigefahren ist: Es ist in der Peripherie, an der Auffahrt zur Stadtautobahn, und verkauft Fernseher, Mixer, Waschmaschinen und vieles mehr, alles im Schaufenster ausgestellt wie eine Landschaft der Effizienz.
Ichs Busfahrt zu seinem ersten Zuhause als junger Mann mit Examen war also ein erhebendes Ritual. Er ist mit dem Panasonic-Karton in den 55er eingestiegen, hat sich bei allen für die Ausmaße entschuldigt und auf die sperrige Verpackung verwiesen. Sobald ein Platz frei wurde, hat er den Karton auf den Sitz gestellt und blieb daneben stehen, um ihn zu bewachen. An der zwölften Haltestelle, gezählt nach dem schnaufenden Geräusch beim Öffnen der Türen, ist er ausgestiegen, mit dem Karton unter dem Arm dreihundert Meter zu Fuß gegangen und dann vier Stockwerke hinaufgelaufen.
Aus dem Blick seines Mitbewohners – Eigentümer der Wohnung, ein Mann um die sechzig, unzweifelhaft das Abbild eines persönlichen Schiffbruchs – sprach heimlicher Jubel und überzeugter Tadel: Er will die Gebühr nicht zahlen, will keinen Ärger, weiß aber, dass er von der Anschaffung profitieren wird. An die Tür gelehnt hat er zugesehen, wie Ich den Fernseher aus dem Styropor genommen, ihn auf den Boden gestellt und den Knopf gedrückt hat. Im ersten Sender, den er hereinbekam, erschien eine gut gekleidete Sprecherin und war die einzige weibliche Präsenz in jenem Zimmer.
Dass es ein vorübergehendes Zuhause ist, erkennt man eindeutig am Fehlen eines Schranks in Ichs Zimmer, obwohl seit seinem Einzug schon eineinhalb Monate vergangen sind. Der offene Koffer neben dem schmalen Bett dient ihm als Kommode für seine Kleider. Außerdem gibt es weder eine klare Abmachung noch einen gültigen Vertrag zwischen ihm und dem Mitbewohner. Das Geld wird formlos an jedem Monatsende übergeben, und ansonsten ist die einzige Bedingung die, dass er Dienstagnachmittags bis zum Abendessen wegbleibt, um dem Besitzer seinen wöchentlichen Homosex zu gestatten.
Was Ichs sexuelle Betätigung angeht – so die unausgesprochene Vereinbarung –, hat er das ganze Wochenende zur Verfügung, wenn der Mitbewohner verschwindet und aufs Land fährt.
Dieses Zusammenleben wird nicht lange dauern, das ist beiden klar, genau wie beiden klar ist, dass das Zurückdenken daran schöner sein wird, als es jeden Tag zu leben. Es gibt nämlich zwischen ihnen keine andere Beziehung als das Teilen der Fächer im Kühlschrank und eine diskrete, sterile Höflichkeit. Was sich an Leben abspielt, ist vor allem das Leben in den Zimmern. Der Rest der Wohnung zählt nicht: eine enge, fensterlose Küche – sie hat nur eine vergitterte Luke zum Treppenhaus – mit einem Tisch, an dem nur einer essen kann. Und ein Flur, fast ganz verstellt von einem Ölofen, der einzigen Wärmequelle. Das Badezimmer gleich daneben ist der wärmste Ort der Wohnung.
Wegen des Ölofens findet das Leben in den Zimmern bei offenen Türen statt. Die Alternative ist eine Privatsphäre bei Raumtemperatur; aber es ist Januar, draußen fällt der erste Schnee, der zuerst für Weihnachten und dann für Neujahr versprochen worden war. Die Dächer von Turin sind weiß, auch der Bahnhof, zwei Blocks von der Wohnung entfernt, ist mit Schnee bedeckt, was die Pfiffe der ein- und ausfahrenden Züge dämpft. Kurz, die Privatsphäre besteht aus zwei Pullovern und Zähneklappern.
Deshalb hat Ich an den Fingern seiner Handschuhe die Spitzen abgeschnitten. Im eisigen Zimmer wärmt er seine Fingerkuppen, indem er auf die Tastatur des Computers hämmert, den er von einem Freund geerbt und im letzten Moment vor dem Abfallcontainer gerettet hat. Es ist ein alter 286, eine ausgestorbene Gattung, die nicht mehr produziert wird, er ist schwerfällig, lahm, visualisiert sehr wenig und sehr langsam. Aber es ist sein erster PC, und deshalb kann keine Kälte die Tragweite dessen schmälern, was Ich die Revolution nennt, den Putsch, der den Fernseher, auf dem Fußboden an den Pranger gestellt, zum Tode verurteilt hat.
Daher haben die Fenster auf der Straßenseite gegenüber jeden Abend – und später zur Nachtzeit – diese Szene vor sich: einen unter Pullovern begrabenen jungen Mann, manchmal mit Mütze über den Ohren, der hektisch auf den Tasten eines Computers herumhämmert, installiert auf einer aufgebockten Spanplatte, die für den Stuhl zu hoch ist. Das Ganze mitten im Schneegestöber, das den Anblick von Weitem verwischt, falls denn wirklich jemand hinschaut.
Was man ganz sicher nicht sehen kann, ist die Diskrepanz zwischen Ichs Vehemenz und dem Hinterherhinken der Technologie; zwischen seinem Tippen eiliger Wörter und der Trägheit des Bildschirms, der lange weiß bleibt, verblüfft und überanstrengt, bis er sie alle zugleich zeitversetzt wiedergibt, wenn Ich schon aus dem Satz heraus ist und die Hände in einer Denkpause innehalten. Die Finger über den Tasten erhoben, sieht er die Wörter in einer Reihe auf der weißen Fläche erscheinen, geordnet in gerader Linie voranschreiten, um dann zur nächsten Zeile zu springen und erst anzuhalten, wenn es ein Punkt vorschreibt. Hiernach liest Ich – nun verblüfft und gerührt –, was sie alle zusammen da vorn in Habachtstellung ihm in der Eiseskälte zu sagen gekommen sind.
3.Familienwohnung, 2009
Die Familienwohnung besteht aus drei Zimmern und Küche. Der Flur ist halbdunkel. Ein Tischchen rechts von der Eingangstür lädt dazu ein, automatisch die Schlüssel abzulegen. Die Kacheln aus gelb-grau gesprenkelter Graniglia am Boden reichen hinten bis in die Küche hinein.
Zwei Zimmer gehen vom Flur ab, das Esszimmer und das Schlafzimmer von Ich und Ehefrau, beide mit Parkett. Im Esszimmer steht ein schlichtes Bettsofa mit sandfarbenem Bezug. Seine Linie ist so unauffällig, so gewöhnlich, dass man es sofort vergisst, nachdem man es gesehen hat, als wäre es gar nicht da. Gegenüber der Fernseher. Sonst gibt es über diesen Raum wenig zu sagen: ein Tisch, Platte kirschrot lackiert, vier Stühle, auf zwei Seiten angeordnet, potenziell für sechs Leute zum Essen erweiterbar.
Hinten ein Fenster mit Aussicht auf eine Terrasse auf der Straßenseite gegenüber, wo sich im Sommer ein altes Ehepaar zum Mittag- und zum Abendessen einfindet; im Winter dient sie als Abstellraum. Hinter der Terrasse der Alpenbogen. Bei der ersten Wärme öffnet Ich das Fenster und verbringt dort viel Zeit, die Ellbogen auf das Fensterbrett gestützt. Ab und zu kommt der Kopf von Töchterchen hinzu. Manchmal nur ganz kurz, manchmal bleibt sie neben ihm stehen. Sobald jemand auf der Terrasse erscheint, winkt Töchterchen zum Gruß mit der Hand, ohne etwas zu sagen; eine Hand, auch sie stumm, aber liebenswürdig, winkt zurück. Es ist nun schon eine lange Gewohnheit, die sich nie in eine Beziehung verwandelt und nie zu einem verbalen Gruß geführt hat, aber immer freundlich geblieben ist. Eine Angelegenheit, für die allein die Hände zuständig waren.
Rundherum Wohnhäuser aus dem frühen zwanzigsten Jahrhundert, über die Straßen verteilt solides Bürgertum, Konditoreien, am Sonntag Süßigkeiten, Restaurants mit gut, aber unauffällig gekleideten Familien. Zweihundert Meter vom Turiner Hauptbahnhof entfernt.
Das Zimmer von Ich und Ehefrau ist das größte der Wohnung – etwa dreißig Quadratmeter –, aufgeteilt in einen Schlaf- und einen Wohnbereich. Ein Ehebett mit hellem Holzrahmen steht im hinteren Teil neben einem Fenster mit französischem Balkon. An den Bettseiten je ein hölzerner Würfel, das Design erinnert an Obstkisten, aber für eine zahlungskräftige, postrurale Klientel neu gestylt. Ichs Nachttisch erkennt man an den unordentlich gestapelten Büchern, ein wackeliger Turm. Mehrere aufgeschlagene Bände liegen umgedreht auf dem Boden, wie Libellen in Wartestellung. Weitere Libellen sind über die Wohnung verteilt, auf den Sofalehnen, auf dem Küchentisch.
Der sogenannte Wohnbereich des Schlafzimmers besteht faktisch aus dem Schreibtisch von Ehefrau: darauf farbige Textmarker, ein Korb mit Scheren und Büroklammern, Hefte, Laptop und Drucker. Auf der Platte rosa und gelbe Klebezettel.
Das letzte Zimmer ist das von Töchterchen.
Die Mattglastür ist immer geschlossen. Durch die Scheibe würde man, auch wenn man näher träte, wenig sehen, nur vier Streifen Tesafilm an den Ecken eines Plakats, das fast die gesamte Fläche bedeckt. Es ist ein Poster, das Töchterchen vom Bett aus betrachten kann; von draußen sieht man nur die Rückseite. Ihr Zimmer ist nur als ein Innen gedacht: Das Draußen ist ein umgekehrtes Innen, die Welt von der Seite der Nähte.
Wenn die Kleine in die Schule geht, bleibt das Zimmer offen. Ehefrau geht hinein und räumt auf, Ich hält gewöhnlich an der Schwelle inne, kann aber schwerlich vermeiden hineinzuschauen. Am Fußboden die gewohnten gelb-grauen Graniglia-Kacheln. Das Bett steht an der Wand. Davor ein weißer Schrank mit zwei Türen, die, wie moosbewachsen, von oben bis unten mit Aufklebern und ein paar Fotos bedeckt sind. Eins mit zwei Freundinnen, eins mit Vater von Töchterchen. Auf einem Bord daneben Stöße von Schulbüchern und ein Foto zusammen mit Ich, Arm in Arm, das höchstwahrscheinlich Ehefrau geknipst hat. Insgesamt ist es schon ein richtiges Zimmer, kein Kinderzimmer mehr.
Gegenüber die Küche, wenige Quadratmeter Graniglia. Drei Einbaumodule, Farbe Kirschrot, oben und unten, eindeutig an diesen Raum angepasst. Die Arbeitsfläche endet unvermittelt, die Schnittkante offenbart die Spanplatte. Dazwischen steht der Herd mit dem Umluft-Backofen. Auf der Seite gegenüber ein Tischchen mit drei Stühlen. An der Wand hängt eine kleine Tafel mit Töchterchens Wochenplan, unterteilt in Spalten für die Tage und Zeilen für die Stunden.
Draußen der Blick auf die Garagen und Wohnungen, die zu den umlaufenden Balkonen der anderen Häuser hinausgehen. Dahinter die Hügel. Ein Küchenmodul ist wegen Platzmangel auf den Balkon verbannt worden und dient als Abstellkammer.
Allgemeiner gesagt: Aus der Möblierung der Familienwohnung kann man leicht schließen, dass hier zwei Einrichtungen zu einer dritten verschmolzen wurden. Leicht lassen sich die Stücke zuordnen – was Ich gehört, was Ehefrau und Töchterchen –, leicht kann man rückschauend die zwei ursprünglichen Wohnungen rekonstruieren, die zwei in einem Experiment zusammengefügten Leben.
Deshalb verbringt Ich viel Zeit am Tisch sitzend oder auf dem Sofa. Vor allem, wenn er schlecht gelaunt ist oder sie gestritten haben, was übrigens nicht oft passiert: Seine alten Möbel sind sein Botschaftsgebäude, dorthin zieht er sich zurück. Auf dem Sofa kauert er sich zusammen, zieht die Fersen hoch, nicht einmal die Füße sollen den Boden berühren. So verharrt er, bis er sich besser fühlt, dann steht er auf und bewegt sich wieder durch die Wohnung. Sehr oft kommt allerdings Ehefrau zuerst auf ihn zu, um Frieden zu schließen, und dann öffnet Ich die Botschaftstür. Er rückt beiseite, erlaubt, dass sie sich aufs Sofa setzt, heißt sie mit dem Blick willkommen. Wenn sie nach erfolgter Versöhnung wieder aufsteht, kehrt er mit den Füßen auf den Boden zurück.
Der Anblick der Kleinen, die fast jeden Nachmittag auf dem Sofa einschläft, mit einem Mathematik- oder einem Physikbuch auf dem Kissen und dem auf den Boden gerutschten Bleistift, ist ein Panorama, an das sich sein Auge noch nicht gewohnt hat.
4.Souterrainwohnung, 1978
Zu Ichs ersten Erinnerungen gehört Vater, tagelang in sein Zimmer eingeschlossen; vielleicht wochenlang.
Es ist Frühlingsanfang, in die zwei von den Häusern eingefassten Betongärten fällt endlich etwas Sonne. Nicht viel und nicht lange. Eine Erscheinung, die sich im Lauf des Tages zweimal wiederholt. Zum ersten Mal, wenn die Sonne senkrecht steht, um diese Jahreszeit gegen 12.40 Uhr: Da ergießt sich die Sonne in den Garten, doch es ist kaum mehr als ein Eimer voll.
Beim zweiten Mal kommt sie von Osten, am frühen Abend gegen 18.30 Uhr. Es ist nur ein Sonnenstrahl, der sich zwischen zwei Gebäuden durchzwängt. Danach jedoch, abwärts, breitet er sich aus; er nimmt, ihn beleuchtend, eineinhalb Meter Boden ein. An diesem Punkt hört man ein regelmäßiges Klopfen: Schildkröte erscheint, mit dem Panzer auf den Boden stoßend kriecht sie eilig hinter dem Blumentopf hervor. Wie ein Tennisspieler fängt sie den Strahl blitzschnell auf. Dann hält sie inne, den Kopf draußen im Flutlicht.
Wenn sie Glück hat, kann sie still sitzen bleiben, solange die Sonne scheint, bis der Strahl verglüht, und kehrt dann langsam um. Wenn sie Pech hat, kommt Ich angelaufen – normalerweise mit einem Schrei – und verwandelt Schildkröte in eine Trommel.
Vater schließt sich immer im Zimmer ein; er kommt nur heraus, um auf die Toilette zu gehen, und danach verschwindet er wieder. Er isst nicht häufig und nur selten mit Ich, Schwester, Mutter und Oma zusammen.
Wenn Vater nicht da ist, hört man fast immerzu Omas Stimme. Während der Mahlzeiten spricht der Fernseher, der hingegen schweigt, wenn Vater da ist. Es geht um einen entführten Politiker, der in eine Wohnung eingesperrt und zum Tode verurteilt ist. Man sieht ein Foto des Mannes mit einer Zeitung in den Händen; sie dient als Beweis, dass der Mann – an diesem Tag – noch lebendig ist.
An dem Foto kann man nicht erkennen, wo er sich aufhält. Hinter ihm ist nur eine Fahne.
Niemand schaut wirklich hin oder hört wirklich zu. Aber der Fernseher wirft ein Licht auf sie, ein Lichtbündel, das sich von innen aus dem Rechteck des Apparats dann auf dem Tisch ausbreitet. Nur Ich bleibt ab und zu außerhalb; er läuft durch die Wohnung, fällt hin, weint aber nicht. Vor der geschlossenen Tür von Vaters Zimmer hält er immer inne.
Dann dreht er hastig wieder um, und wenn er ins Esszimmer kommt, sieht er Mutter, Oma und Schwester im Licht des Fernsehers: Danach schlüpft auch er hinein, wie Schildkröte es am Nachmittag mit der Sonne macht. Der Fernseher wirft weiterhin den Mann mit der Zeitung über ihre Köpfe.
Der Bildschirm ist der Eingang zu einem Tunnel, der die Souterrainwohnung mit der Wohnung verbindet, in der der Mann gefangen gehalten wird. Ich könnte hineinkriechen, auf allen vieren.
Schwester ist zu groß.
Für Mutter und Oma wär es unelegant.
Ich könnte bequem in das Rechteck aus Licht hineinschlüpfen: Er müsste nur eine Weile krabbeln – wie lange, kann man nicht wissen – und dann auf der anderen Seite, wo der Gefangene mit der Zeitung sitzt, herauskommen.
Doch weder Ich noch die anderen erwägen wirklich diese Möglichkeit: Still sitzen sie da, und der Fernseher kippt seinen gesamten Inhalt über ihren Köpfen aus. Übrigens will Ich, seit er die aufrechte Haltung erst geprobt und dann übernommen hat, nicht mehr auf allen vieren krabbeln. Das macht er nur für Schildkröte, mit ihr verbindet ihn eine uralte Beziehung.
Nach dem Mittagessen geht Mutter mit einem Teller in Vaters Zimmer. Ich läuft hinter ihr her, bleibt aber draußen; sie zeigt ihm etwas, und dann ist die Tür zu.
Nach einer Weile kommt Mutter heraus und spricht mit Oma, während sie das Geschirr abwäscht.
Es geschieht auch, wenn Ich ihr nicht auf den Fersen ist, dass Mutter die Tür zum Elternzimmer angelehnt lässt; und so kommt es, dass Ich einmal den Kopf durch den Spalt streckt und sieht, dass die zwei auf dem Sofa sitzen, Vater mit dem Kopf zwischen den Händen und Mutter neben ihm, etwas abgerückt, die Knie aneinandergelehnt, ohne zu sprechen.
Am Telefon sagt Oma, dass ihr Sohn – Vater – erschrocken sei.
»Er verlässt das Haus nicht, weil er Angst hat, dass sie ihm was antun.«
»Er hat einen verprügelt, den er lieber nicht hätte verprügeln sollen.«
Sie sagt, man müsste sicher sein, bevor man so tut, als sei man stark.
Das Telefon steht in der Küche neben einem Stuhl und einem Tischchen. Darauf liegt eine kleine Tafel, auf der Oma alles notiert, was sie nicht vergessen will.
Spricht Oma am Hörer über Vater, lehnt sie die Türe an, doch Ich stößt sie auf, weil man hier durch muss, um Schildkröte im Betongarten zu besuchen.
Wenn er vorbeigeht, fallen Omas Worte auf seinen Kopf; sie verfangen sich in seinen Haaren, bis – unter endlosem Geschrei und Widerstand – Mutter sie ihm wäscht.
5.Wörterwohnung, 2010
Sie ist knapp einen Kilometer von der Familienwohnung entfernt, jenseits des Hauptbahnhofs von Turin.
Jeden Morgen verlässt Ich das Haus, durchquert die Bahnhofshalle und begibt sich in die Wörterwohnung.
Zu Fuß sind es sieben Minuten, acht, wenn er stehenbleibt, um den Fahrplan zu studieren. An manchen Tagen hebt er den Kopf nicht. An anderen lässt er den Blick über die Zielorte wandern. Er malt sich aus, er sei in einigen der Städte, die da geschrieben stehen. Dann läuft er weiter, durchschneidet den Menschenstrom; geht hinaus in diesen anderen Teil der Stadt.
Hier gab es früher Schießereien, und die Leute schlossen sich zu Hause ein. Schlafen konnte man nur mit Ohrstöpseln oder mit Kissen über dem Kopf. Oder wenn man überlegte wegzuziehen, bis man schließlich doch einschlief und dann blieb.
Schießereien gibt es jetzt keine mehr. Gedealt wird nur noch an zwei Straßenecken nahe der Überführung. Der Rest sind Lokale, wo getrunken wird, die jungen Leute lachen die ganze Nacht. Mit jedem Glas werden die Stimmen lauter. Zum Schlafen Ohrstöpsel oder Kissen über den Kopf. Oder das Fenster öffnen und vergeblich hinausbrüllen. Oder überlegen wegzuziehen, mit diesem nagenden Gedanken wach liegen, um dann zu bleiben.
Die Wörterwohnung ist im ersten Stock eines Gebäudes aus den dreißiger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts.
Im Erdgeschoss befindet sich seit jeher das Schaufenster eines Lebensmittelgeschäfts; der Inhaber hat ein Gitter angebracht, um die Leute zu entmutigen, sich mit ihren Gläsern davor zu setzen. Ichs Zimmer liegt genau über dem Warenlager: Der Kühlschrank lässt seine Füße zittern, vor allem sonntags, wenn alles still ist. Unter der Woche fällt es ihm nicht auf, dafür hört er das Ding Dong jedes Kunden, der den Laden betritt.
Ich kommt täglich kurz nach dem Morgengrauen und geht bei Sonnenuntergang. Im Winter früher, im Sommer um die Abendessenszeit, er folgt dem Rhythmus der Sonne. Ich will nicht sehen, wie das Licht abnimmt und dann stirbt.
Mittags verlässt er kurz das Haus, um etwas zu essen; ein Brötchen in der Bar oder einen Teller Pasta in der Trattoria. Er spricht mit niemandem; wenn ein Fernseher läuft, ist es ihm lieber; er schaut gern in das Rechteck aus Licht.
Die Wörterwohnung besteht aus einem zwei mal vier Meter großen Raum. Es gibt ein Fenster zur Straße hin und eine Tür, die direkt ins Treppenhaus führt. Ichs Name steht nicht an der Klingel und nicht an der Sprechanlage. Niemand läutet, weil niemand weiß, dass es ihn gibt. Wenn es doch einmal klingelt, werden andere gesucht, und so öffnet Ich nie.
In der Wörterwohnung stehen ein Tisch, ein Stuhl und ein Sessel. Hinter dem Schreibtisch eine kleine Tafel, ein Geschenk von Ehefrau. Mit Kreide hat sie darauf geschrieben: »Für deine Wörter«. Die Wörter und die klare, freundliche Schrift von Ehefrau bilden seine Rückendeckung.
Die Wände sind weiß, nirgends hängt etwas; man sieht die Löcher von früheren Nägeln und das Rechteck der Abwesenheit dessen, was dort war. Es stammt aus dem vorigen Leben der Wohnung.
Ich hat nichts getan, um diese Spuren zu tilgen. Aus den Rahmen, die das Licht an der Wand hinterlassen hat, sieht die Vergangenheit Ich an, und Ich kann sie ansehen.
In den größeren Löchern war höchstwahrscheinlich ein Wandbord verankert. Oder zwei, parallel montiert. Ich hat weder ein Bord aufgehängt noch Bücher mitgebracht. Die wenigen, die er hier hat, sind auf dem Tisch gestapelt und wechseln ständig.
Dafür hat er viele Hefte; Modell kleinformatiges Notizbuch, ungefähr achtzig Seiten, kariert oder liniert, das ist gleichgültig. Zwischen den Seiten und auf dem Tisch, der schwarz ist, finden sich weiße Gummiflöckchen. Es sind begrenzte, minimale Schneeschauer von ausradierten Wörtern.
Der Stuhl am Tisch ist ein Drehstuhl wie in einem Büro.
Ich sitzt oft zum Fenster gedreht da, den Blick starr auf das Gebäude auf der anderen Straßenseite gerichtet. Wenn dort jemand auftaucht und in seine Richtung schaut, wendet Ich sich ab und senkt die Augen auf den Computer.
Beim Betreten der Wörterwohnung zieht er seine Schuhe aus und lässt sie neben der Türe stehen, parallel. Im Sommer zieht er auch die Socken aus; er faltet sie zusammen und schiebt sie in den Raum, der vorher von seinen Füßen besetzt war.
Wenn Ich die Schuhe abstreift und der Bildschirm aufleuchtet, begibt er sich an einen Ort, an dem Ehefrau nicht existiert.
Tag für Tag packt er das Ende des Wörterseils, das er auf dem Bildschirm sieht, klammert sich daran fest und taucht ab, stemmt die nackten Füße gegen die weiße Mauer seines Monitors, bis er unten im Licht verschwindet.
Von dem, was er sieht, wenn das Licht ihn überwältigt, sagt er weder Ehefrau noch Töchterchen etwas; im Übrigen wüsste er nicht, was er sagen sollte.
Er weiß nur, dass er bei Sonnenuntergang zurückkehrt: Er klammert sich an das Seil aus Wörtern, stemmt die Füße erneut gegen die Wand und zieht sich Meter für Meter wieder hoch. Bis er die Oberfläche erreicht und diesseits des flimmernden Computerrechtecks wieder im Zimmer auftaucht.
Von dem, was Ich in diesen Stunden sieht, sieben Minuten von dem Haus entfernt, wo er mit Familie lebt, bleibt vielleicht nur in seinem Blick noch eine Spur zurück.
Abends, wenn er sich mit Ehefrau und Töchterchen zu Tisch setzt, fragt ihn niemand, was während des Tags passiert ist. Ehefrau fragt nur: Wie war’s?, und er antwortet nur: Gut; dann sprechen sie über anderes.
Ehefrau würde gern mehr erfahren, doch sie weiß, dass genau da die größte Gefahr lauert. Sie weiß, das Einzige, was sie tun kann, ist warten; und dann eines Tages, wenn alles vorbei sein wird und Ich ihr erlauben wird zu lesen, wird Ehefrau verstehen und in der Erinnerung alles neu ordnen, unterteilt nach Abendessen.
Doch vorerst kann sie nur Tag für Tag versuchen, den Blick zu deuten, den Ich zu Tisch mitbringt. Um so herauszufinden, ob das Irreparable schon geschehen ist, ob irgendwo noch etwas Raum für sie geblieben ist. Oder ob Ich schon woandershin umgezogen ist und nur zum Schlafen heimkommt.
6.Wohnung unter dem Berg, 1983
Obgleich eine Festung, befindet sie sich im dritten Stock eines erst kürzlich gebauten Mehrparteienhauses. An der Klingel steht Ichs Nachname, in derselben Schrift wie alle anderen Namen auf dem Schild. Es ist der dritte Knopf rechts, drückt man mit dem Finger darauf, betritt man die Wohnung mit einem Surren: Drinnen ist eine Familie, die Vater dort eingesperrt hat und die sich ab und zu am Fenster zeigt.
Ich ist acht Jahre alt, und wenn er könnte, würde er immerzu hinausschauen.
Das Wo ist ein Ort, an dem tausend Menschen am Fuß der Alpen leben. Von der Souterrainwohnung bis hierher sind es fast achthundert Kilometer, die größtmögliche Entfernung, wenn man innerhalb der nationalen Grenzen bleiben will.
Das Mehrparteienhaus ist Teil eines Wohnkomplexes, dessen Bau jahrelang angekündigt wurde. Es geht um drei senffarbene Gebäude, die drei Seiten eines Beets begrenzen, wo drei Schilder verkünden: »Das Betreten der Beete ist strengstens verboten.« Auf der vierten Seite ist ein mäßig großer Parkplatz, erreichbar über ein Netz von Kieswegen, die zu den Hauseingängen führen.
Die Wohnung unter dem Berg hat eine Küche und zwei Zimmer. Die Zimmer zweigen rechts und links von einem mittleren Flur ab. Hinten, immer geschlossen, die geriffelte Glastür zum Badezimmer.
Die Küche ist beim Hereinkommen der erste Raum rechts. Geht man weiter, folgt auf derselben Seite das Esszimmer. Das Mobiliar beider Räume stammt aus einem lokalen Einrichtungshaus, das auf alpine Möbel spezialisiert ist. Der Küchentisch, die Anrichte – und sogar das Sofa –, die zwei Sessel und der Schrank sind Massiv Holz und mit einem Blumenmuster verziert.
Die Küche hat einen kleinen Balkon. Von dort blickt man auf ein bestelltes Feld. Jenseits des Felds die Straße, deren Asphalt man nicht sieht. Rechts erkennt man vage den Friedhof, von niedrigen, festen Mauern umgeben, und die von Zypressen gesäumte Zugangsallee.
Links blasen die Schlote der Papierfabrik Wolken in den Himmel. Wenngleich nebensächlich in der Topographie des Orts, ist die Papierfabrik die Lunge der Gegend, denn sie garantiert Beschäftigung. Mit den Ausschussexemplaren der Porno-Illustrierten, die neben den Abfallcontainern deponiert werden, nährt sie auch das Testosteron der Jugendlichen. Ich wird dort, ohne die geringste Anstrengung der Phantasie, seine erste bewusste Ejakulation erleben, einen Ausbruch, eine plötzliche, heftige Regung im Unterleib, ohne sich mit den Händen überhaupt zu berühren.
Aber das geschieht nicht jetzt, man wird noch einige Jahre warten müssen. Vorerst ist die Papierfabrik nur Rauch, Andeutung, Verbrennung, und Ich ist ein Kind, das zuschaut, wie sie sich im Hintergrund einhüllt. Und oft beobachtet er auch die Jungen auf dem Fahrrad, die in Dreier- oder Vierergruppen schreiend oder erregt auf der Staatsstraße die Füße von den Pedalen streckend ihr Ziel erreichen, mit dem Versprechen auf Fotos von Brüsten und Sexualorganen, oft fleckig von einer Mischung aus Regen, Matsch und Sperma. Er schaut auch zu, wie sie – Stunden später – langsam wieder zurückfahren, die Räder surren lassen, die Kette still.
Ichs Zimmer liegt dem Esszimmer gegenüber. Es ist ein großer Raum mit einem einfachen dreitürigen Schrank. Das Stockbett, wenn man hereinkommt, links, prunkt gut sichtbar mit dem Blumenmuster.
Ich schläft im oberen Bett, geschützt von einem massiv hölzernen Gitter. Jeden Abend klettert er die Leiter hoch und steigt darüber weg. Schwester schläft unten.
Das Fenster geht auf einen Balkon hinaus, der auf das Gemeinschaftsbeet schaut. Gegenüber, nicht weit weg, droht der Berg.
Das Esszimmer ist das Zimmer von Vater, so wie die Küche Mutters Reich ist, was schon eine klare soziale Hierarchie und eindeutige Spezialisierungen aufzeigt. Vater betritt die Küche nur zum Essen. Mutter das Esszimmer nur, um das Bett zu machen.
Nach dem Abendessen verwandelt sich das Esszimmer nämlich in ein privates Schlafzimmer. Das Sofa spuckt das Ehebett aus. Die Sessel werden unter das Fenster geschoben und der Fernseher eingeschaltet, Vater und Mutter verfolgen das Programm vom Bett aus. Was man sieht, wenn man nach dem Abendessen hereinkommt, ist ein normales Schlafzimmer.
So lernt Ich die Metamorphose kennen; das Universum kann in jedem Augenblick revolutioniert werden. Ich akzeptiert, dass seine Welt auf den Kopf gestellt oder vernichtet wird, wenn Vater es entscheidet. Er akzeptiert das Verschwinden der Dinge als naturgegeben.
Ich genügt es, sich in sein Zimmer zurückzuziehen, über das Gitter zu steigen und an die Decke zu starren, so wie eine Schildkröte ihren Panzer von innen betrachtet.
In der Wohnung unter dem Berg gibt es kein Telefon, weil Vater Ruhe braucht. Deshalb ist es in der Wohnung immer still, während rundherum ständig irgendwo ein Telefon läutet.
Einmal in der Woche geht Mutter mit einer Handvoll Münzen zur dreihundert Meter entfernten öffentlichen Telefonkabine. An den übrigen Tagen sammelt sie die Münzen zum Telefonieren in einem Aschenbecher neben den Schlüsseln. Wenn Mutter vom Anruf zurückkehrt, sagt sie, dass die Verwandten alle grüßen.
An dieser Hürde, dass kein Telefon da ist, scheitern die Anrufe von Oma und Verwandten. Damit hat Vater Ichs Familie eingemauert.
Lebendig eingemauert, ist die Familie in Sicherheit. Vater kann sich unbesorgt ausruhen, wann er will.
Mutter legt das Restgeld des Einkaufs beiseite, damit sie anrufen kann.
7.Schildkrötenwohnung, 1968
Viel Platz ist nicht, dennoch wirkt es nicht sehr eng. Es ist für einen einzigen Bewohner gedacht, eine Art Einzimmerapartment mit dem Allernötigsten.
Es gibt nur einen Eingang an der Vorderseite.
Von dort betrachtet Schildkröte die Welt; von dort zieht sie sich zurück.
An der Rückseite gibt es zwei stets geöffnete Fenster, durch die Licht hereinfällt und die Beine herauskommen. Weitere Öffnungen an den beiden Seitenwänden und eine bescheidenere hinten in der Mitte für den Schwanz.
Die Decke ist gewölbt, beeindruckend trotz der geringen Größe der Wohnung. Die Öffnungen vorn, hinten und seitlich projizieren was außen ist an das Gewölbe. Die Welt ist, was an die Decke projiziert wird. Bewegt sich Schildkröte, verändert sich die Ansicht: Das Gewölbe wird zum Bildschirm, die Wohnung ist ein Wanderkino.
Der Boden besteht wie alle anderen Teile aus Knochenmaterial. Es sind etwa zehn Platten, auch wenn man meinen könnte, er sei aus einem Guss.
Er ist streng in der Form, aber nicht kalt, elegant mit kleinen Fehlern.