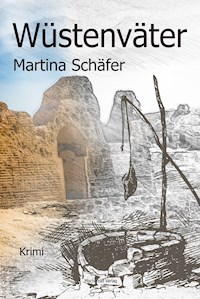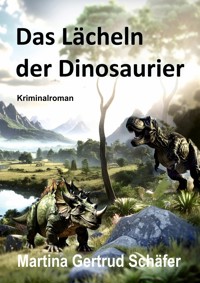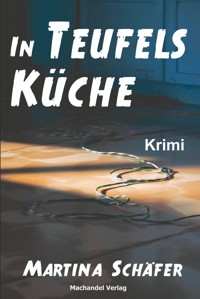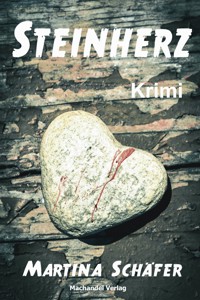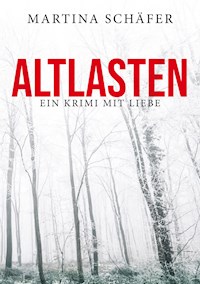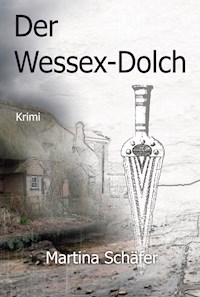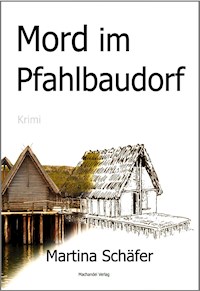Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Machandel Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Ausgeraubte Zeitungs-Kioske sind nichts, was Kommissar Kerkbaum als besonders schwierige Fälle betrachten würde. Jedenfalls so lange nicht, bis die Besitzerin eines der Kioske ermordet wird. Schnell merkt Kerkbaum, dass mehr hinter diesem Mord steckt. Und in diesem Mehr scheint die lokalen Frauenszene eine Rolle zu spielen. Wer könnte da besser ermitteln als Polizeifotografin Rosi Kramer und ihre Liebste, die Wen-Do-Trainerin Jana Müller? Was diese beiden allerdings herausfinden, ist erschreckend – und reicht Jahrzehnte zurück, zu Ereignissen, die viele Leute lieber vergessen würden, nahe jener stillgelegten Fabrik, deren Kamin wie eine Mahnwache oben auf dem Berg steht. Die Lösung des Falles eilt, denn es gibt weitere Tote. Und niemand weiß, wer noch auf der Liste des Täters steht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 342
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Kamin
Martina Schäfer
In memoriam Ernst Klee (1942-2013)
©Martina Schäfer 2017
Machandel Verlag Haselünne
Charlotte Erpenbeck
Cover-Bild:Elena Münscher, Bildquelle PD, pixabay.comHintergrund: Filter ForgeIllustration: Stefanie Szabo
1. Auflage 2021
ISBN 978-3-95959-303-8
1. Kapitel
„Jetzt hat er ihn aber mal richtig zusammengeschissen!“ Befriedigt ließ Rosi ihren Rucksack von der Schulter und vorsichtig auf den Boden gleiten, denn kein normaler Mensch feuert einen Rucksack, der Kameras im Wert von mehreren Tausend Euros enthält, so in die Ecke, als enthielte er abgegriffene Taschenkrimis, ausgeleierte Trainingshosen und abgegessene Bananenschalen. Das ist eher meine Art der Rucksackbehandlung.
„Wer hat wen angeschissen?“ Wenn es mir danach zumute ist, kann ich gleichzeitig reden und zur Begrüßung küssen.
Rosi allerdings auch: „Na, von Kerkbaum den Schmidtken!“
„Immer noch wegen der vermurksten Geschichte in dem Anthroposophenheim?“1
„Ja, auch. Von Kerkbaum sagte ihm, er habe mehr Vorurteile in seinem Kopf als zwanzig fundamental-katholische Lateinlehrerinnen und wenn er nur halb so viel Verstand hätte wie arrogante Ansichten, könnte er in Nullkommanichts einen Nobelpreis in Kriminologie erwerben!“
Sie warf sich auf ihr Sofa und ich sauste los, um zwei Gläser Saft aus ihrer Küche zu holen. Ich war anlässlich eines Vortrages über Gewaltprävention, den das örtliche Haus für geschlagene Frauen, der Kinderschutzbund und die Kripo organisiert hatten, in Rosis hübscher Kleinstadt zwischen Bergischem- und Sauerland zu Besuch. Der Ort mit seinen fachwerkreichen Häusern und den in unendlichen Grautönen gedeckten Schieferdächern wirkte heimelig. Eigentlich stamme ich ja aus Westeuropa, also aus der linksrheinischen Eifel, aber ein etwas mörderischer Selbstverteidigungskurs in einem gewerkschaftsnahen Tagungshaus Mitteleuropas, genauer gesagt in den unendlichen Wäldern des sauerländischen Mittelgebirges, hatte mich verschiedenster Mordanschläge auf meine werte Person ausgesetzt sowie andere, sehr sympathische Personen, wie zum Beispiel die Polizeifotografin Rosi Kramer, in Lebensgefahr gebracht. Letztendlich gelang mir die Lösung meines ersten Falles, und wie das Leben so spielt, fand ich mich, gewissermaßen als Lohn für alle meine dortigen guten Taten, anschließend in den Armen dieser wunderlieben, lockigen Fotografin wieder, in denen ich, metaphorisch gesprochen natürlich, bis heute zu liegen die Freude habe.2
„Danke -“ Sie nahm das Glas entgegen und zog mich auf das Sofa herunter. „Aber dieser Schmidtken sollte uns eigentlich egal sein. Erzähl, was hast du heute gemacht?“
„Nichts von Bedeutung, nur den gestrigen Vortrags- und Diskussionsabend ausgeschlafen.“
„Die drei Weizenbier?“
„Ja, die auch! Also, er ist degradiert, die Schulterklappen abgetrennt, die feine Lederjacke in Fetzen gerissen und Schmidtken damit das arrogante Lächeln vom Gesicht gewischt?“
„Nicht ganz – aber fast! Von Kerkbaum ist ein gütiger Vater in allen Lebenslagen, selbst solchen Kreaturen wie Schmidtken gegenüber.“
Vater – okay, über das gütig mochte man sich streiten, denn wir hatten ihn durchaus auch schon als etwas hinterhältig erlebt. Als Folge unseres ersten Falles im Sauerland hatte von Kerkbaum, Rosis und Schmidtkens gemeinsamer Vorgesetzter, eine seltsame Intrige eingefädelt, die uns alle drei – er nannte uns seitdem übrigens das Sauerland-Trio! – in eine anthroposophische Institution für Erwachsene mit geistiger Behinderung führte. Ein alter Freund von ihm war dort mächtig in Schwierigkeiten geraten. Schmidtken hatte sich vor Ort allerdings wahrlich nicht als der geniale Aufklärer erwiesen. Ohne das schnelle und mutige Eingreifen der so genannten `Behinderten` selbst läge ich nun wohl in der Familiengruft und ein irrer Schlächter liefe immer noch weiter frei in der Landschaft herum!
„Schmidtken in die Produktion?“ Ich fuhr mit allen meinen Fingern durch Rosis stürmische Locken und vergaß den Orangensaft im Glas und den Eintopf im Ofen.
„So ungefähr. Von Kerkbaum hat ihm einen leichten Fall mit viel Lauferei zugeteilt. Diese Bande, die hier in der Gegend in letzter Zeit so viele Kioske überfallen und aufgebrochen hat, ist gestern Nacht weit über ihr sonstiges Maß hinausgeschossen: Die Kerle haben eine Kioskfrau erschlagen!“
„Oh!“
„Jana, wenn du dir überlegst, in welchem Alter Jugendliche heutzutage kriminell werden, Tankstellen ausrauben, Autos klauen und sogar Leute umbringen – es ist traurig!“
„Und wir Frauen halten derweil kluge Vorträge über Gewaltprävention!“
Es war eine ganze Vortragsserie zum Thema sexuelle Gewalt, die, auf Anregung verschiedener Frauen und durch Rosis berufliche Kontakte gefördert, in ihrem Ort stattfand. Vorige Woche hatte eine Juristin gesprochen, davor die Woche eine Psychologin zum Kindesmissbrauch, ich am gestrigen Abend über Deeskalationsmaßnahmen an Schulen, nächste Woche würde ich noch einmal vor einer Elterninitiative des hiesigen Gymnasiums sprechen. An dem Wochenende dazwischen gab ich einen Wen-Do-Grundkurs für zwölf Mädchen einer Hauptschule. Die Tage, an denen ich keine Pflichten hatte, verbrachte ich mit Spazieren gehen, für meine Liebste und mich russisch, chinesisch oder italienisch kochen, Schundromane lesen sowie allerlei gemeinsamen Aktivitäten.
„Als du heute früh deine Weißbiere ...“
„Na, nicht doch Rosi, die hochpolitischen Diskussionen!“
„Gut, gut! Also, als du das Alles noch ausgeschlafen hast, haben die Kollegen mich zum Fotografieren an den Kiosk geschickt. Schmidtken war bereits gestern Nacht vor Ort. Immerhin – pflichtbewusst ist er ja!“
„Wann ist denn der Überfall passiert?“
„Ach, irgendwann wohl zwischen zehn und zwölf Uhr – eher zwölf, gab der Pathologe kurz vor Feierabend noch durch. Die Frau hatte ihren Stand in der Nähe des Bahnhofes und hielt offen, bis der letzte Zug durch war.“
„Als wir bereits mit den Organisatorinnen in der Kneipe waren?“
„Ja. Das Schlimme ist...“, Rosi trank nachdenklich einen Schluck Saft und richtete ihre honigfarbenen Augen auf mich, „... ich kannte die Frau sogar ein wenig.“
Rosi stammt eigentlich vom Bodensee und hat einen sehr starken alemannischen Akzent, der immer dann besonders durchklingt, wenn sie betroffen ist oder sich sonst aufregt. „Und keiner hat etwas gesehen? Euer Bahnhof ist nach der Rushhour tatsächlich nicht mehr ein Abbild des brodelnden Lebens. Aber immerhin doch der Bahnhof einer mittleren Kleinstadt mit kulturellen Bedürfnissen in der nächsten Großstadt? Da kommen doch immer noch allerlei Nachtschwärmer und Theaterbesucher mit dem letzten Zug zurück?“
„Nein – kein Mensch!“ Sie schaute an mir vorbei in Richtung Fenster. „Bei all den anderen Überfällen hat fast immer irgendjemand irgendetwas gehört oder gesehen. Deshalb wissen wir ja auch, dass es sich sehr wahrscheinlich um eine Bande von Jugendlichen handelt.“
„Wenn du jemanden totgeschlagen hättest, würdest du auch nicht mehr lange dort herumstehen und allzu großen Lärm machen!“
„Eigentlich sind sie noch nie in dieser Weise tätlich geworden.“ Rosi runzelte die Stirn und legte sich den kühlen Glasrand an die Schläfe.
„Die anderen Kioskbesitzer waren doch immer schon zu Hause. Sie ist sicherlich die Einzige gewesen, die so spät abends noch geöffnet hatte. Damit haben die Kerle nicht gerechnet – Rums – Schlag...! Und ab klammheimlich, schnell und leise!“
„So ähnlich mag das wohl gelaufen sein. Wirklich übel! Sie war eine Nette. Liebäugelte übrigens auch mit der hiesigen Frauenszene. Ich habe sie hin und wieder auf Festen oder größeren Veranstaltungen gesehen. Sie hatte ein tolles Mundwerk, fast so wie du, mein Herz.“ Sie lächelte mich mit diesem Blick an, der mich auf der Stelle durch die Sofakissen hinschmelzen ließ.
„Aber bitte!“
„Betonte die Worte wie du: ‚Fisternöllschen’ zum Beispiel.“
Rosi ist hinreißend, insbesondere, wenn sie versucht, meinen flotten, mit allen Abwässern des Altvaters Rhein gewaschenen Tonfall nachzuahmen! Während wir Rheinländerinnen meistens unser Leben lang unfähig sind, das CH und das SCH auseinander zu halten – wir essen und betreten Kirschen gleichermaßen – sind die Bewohnerinnen der voralpinen Seen auch nicht im Entferntesten in der Lage, das SCH zu artikulieren, nicht einmal ein sauberes CH, welches andere Leuten unter die Zungenspitze legen. Alles bleibt ihnen regelmäßig im Halse stecken – und ‚Fisternöllschen’ auf jeden Fall.
Rosi Kramer, deren hoch privilegierte Geliebte ich zu meinem Glück bin, so dass sich anstrengende Aktivitäten wie Seitensprünge oder Zweitbeziehungen angenehmerweise erübrigen, runzelte nachdenklich die Stirn. Sie ließ den Saft in ihrem Glas schaukeln und rückte ein wenig aus meiner liebenden Umarmung heraus. Das macht sie immer so, wenn sie über etwas nachdenkt. Irgendwann hat es dann den Anschein, als stelle sie ihre Augen auf Fernsicht ein. Aber eine Fernsicht, die durch innere Landschaften streift, hunderte von Archivschubladen im Kopf aufreißt und tausende von Kontaktabzügen vor der Erinnerung vorbei ziehen lässt.
Rosi Kramer, die Polizeifotografin, hat mehr als ein visuelles Gedächtnis, denn so simpel als ‚Gedächtnis’ lässt sich ihre Fähigkeit nicht mehr beschreiben, die sämtliche, aber auch sämtliche je von ihr gemachten Fotografien eines fast fünfzigjährigen Fotografinnenlebens auf Abruf im Kopf bereit hält.
Ein Wunder, nicht nur für solch kuckfaule Personen wie mich!
Schauen, kucken, beobachten, betrachten und ähnliche Tätigkeiten finde ich ungeheuer anstrengend. In Museen, selbst in naturwissenschaftlichen, die eher meinen Interessen entsprechen, überfällt mich meist gleich bei der Eingangstüre ein unwiderstehlicher Gähnzwang.
Ich bin kaum weit- und ebenso wenig kurzsichtig, aber viele blaue Flecken und ein Fahrstundensoll von annähernd dreißig Stunden haben mich gelehrt, dass ich eigentlich die Welt eher flach wahrnehme, wie einen Kinofilm, weshalb ich auch gerne ins Kino gehe. Da zappelt diese flache Welt und ich kann ihre Tiefenschärfe bemerken, denn das ist ja der Sinn dieser bunten beweglichen Illusion.
Möglicherweise ist das alte Echsenstammhirn ein bisschen überproportional bei mir entwickelt: Stille Dinge entgleiten mir rasch: Statuen, Tapetenmuster und Keramikornamente. Ich liebe das, was sich bewegt: Im Wind wehende Bäume, das vor- und zurück schwappende Meer, tanzende Frauen und springende Hunde, und bewege mich deshalb selber auch sehr viel. Zum Leidwesen der Menschen in meiner Umgebung, die diese Zappelei eines stämmigen Kämpferinnenkörpers vor ihren Nasen erdulden müssen.
Die Art, wie ich als Kind mühseligst das Schreiben erlernte, muss meine Erziehungsberechtigten sehr erschrocken haben. Nur die Tatsache, dass ich in rasanten zwei Wochen oder gar Tagen lesen lernte, beruhigte sie einigermaßen in ihren Befürchtungen, etwas lern-, leistungs- oder gar geistig Behindertes in die Welt gesetzt zu haben. Aber Lesen hat eben etwas mit den Ohren zu tun: Natürlich kann jedes halbwegs aufgeweckte Kind einen Text, der schon dreimal von anderen MitschülerInnen vorgestottert wurde, dann auswendig herunterbeten! Da braucht`s echt keine Buchstaben mehr.
Was in einiger Entfernung platt ist und nur durch die Beweglichkeit der flitzenden und flatternden Kinobilder Tiefenschärfe aufweist, diese seltsame Welt, genannt Erde des ausgehenden 20. Jahrhunderts, erhält in der Nähe ihr Profil durch eine Wahrnehmung, die der anthroposophische Teil meiner Familie „Bewegungssinn“ nennt und die mir in meinem Beruf als Lehrerin für Selbstverteidigung und Selbstbehauptung sehr zustatten kommt: Ich spüre sehr gut, was sich wo in Bezug auf meinen Körper bewegt, parke Güllefässer oder Wohnmobile rein nach dem Gefühl für die Abstände ein und versuche Frauen, Mädchen und Menschen mit Behinderungen aller Art wenigstens eine Ahnung dieses Gefühls für Grenzen und grenzüberschreitende Körper, die meistens dem anderen Geschlecht gehören, zu vermitteln, oder Orientierungshilfen in dunklen Straßen und gefährlichen Wohnzimmern.
„Irgendetwas war anders als bei den Überfällen davor.“
„Wie – anders?“ Ich schrak aus meinen Selbstbetrachtungen hoch.
„Ich krieg es nicht zusammen.“
Rosi legte den Kopf schief und schaute zum Fenster hinüber, was aber, wie ich wusste, eine Illusion war, denn sie kramte eigentlich eher irgendwo schräg in ihrer Erinnerung herum.
„Der Eindruck, weißt du, der Gesamteindruck ...“
„Ja?“
Man sagt mir nach, dass ich sehr helle, blaue Augen habe und deshalb glaubt kein Mensch, dass es eigentlich meine Ohren sind, auf die man sein Misstrauen richten sollte. Aber Segelohren sind nun mal kein solch schönes Kompliment wie keltenblaue Augen, auch wenn sie das Niesen eines Regenwurmes an einem herbstlichen Nebeltag hören.
„Ich würde gerne die verschiedenen Fotoserien von den Überfällen noch einmal vergleichen.“
„Na, dann schaust du halt gleich morgen früh mal nach?“
„Weißt du, Jane, die Ermordete hat sich auch sonst für die Menschen interessiert: Häufig standen Leute stundenlang an ihrem Kiosk herum, ohne dass sie eine Zeitung kauften!“
„Mit anderen Worten, sie ist es dir wert, gleich jetzt noch einmal die Fotos im Labor anzuschauen?“
„Genau!“ Rosi holte ihren Blick in unsere Gegenwart zurück. „Woher weißt du das?“
„Für Leute, die dir nicht wichtig sind, bist du selten bereit, freiwillige Überstunden abzudienen.“
„Wir kucken nur schnell im Fotoarchiv nach. Wir wollten doch eh` noch einen Kleinen ziehen gehen, da kommen wir fast am Rathaus vorbei.“
„Einenziehengehen“ heißt auf Alemannisch ein Bier trinken.
„Außerdem“, Rosi war schon aufgestanden, „ist heute Abend Frauenbeiz!“
Auf Hochdeutsch: „Frauenkneipe“, eine nette Sitte, die viele alternative oder links angehauchte Kneipen in der deutschen Provinz eingeführt haben: Ein Abend, an dem nur Frauen in die Kneipe dürfen. Reine Frauenkneipen halten sich bei uns nur in den Millionenstädten und auch da nur mit Ach und Krach oder Hängen und Würgen.
„Was ist mit dem Abendessen?“
Als hätten die sich miteinander verbündet, fingen unsere Mägen nun unisono an zu protestieren, zu knurren wie ein Haufen Löwenbabies. Also gab es zuerst noch den Eintopf mit Weißbrot und Quarkhäufchen drauf. Solche Feinheiten gehören zu meinem unbewussten slawischen Erbe.
Dann machten wir uns Hand in Hand durch einen leichten bergischen Nieselregen auf in Richtung Rathaus, in dem die Institutionen der Kriminalpolizei untergebracht sind.
1siehe meinen Kriminalroman: „Herz aus Stein.“
2 siehe den Krimi unter dem Pseudonym Magliane Samasow: „In Teufels Küche.“ Elsdorf, 1999 kbv-Verlag
2. Kapitel
Unter der Türe mit der Aufschrift „Fotolabor und Archiv“ drang Licht hervor, als wir im Rückgebäude des von Fachwerk durchzogenen Rathauses den langen Gang des Kommissariats entlanggingen.
Rosi stieß, ohne anzuklopfen, die Türe ihrer Arbeitsräume auf. „Wer ist denn da? Um diese Zeit?“ Schmidtken schaute von einem großen Leuchttisch, der quer hinten im Raum unter einer Fensterfront stand, hoch.
Das Licht warf von unten merkwürdige Schatten über seine wohlgepflegte Gestalt und gab seinem Gesicht tatsächlich den Anschein eines zutiefst beleidigten Adlermännchens. Oder sollte von Kerkbaums Standpauke tatsächlich Wirkung gezeigt haben?
„Was machst du hier um diese Zeit?“ Rosi trat an den Leuchttisch. Dadurch wurde der Blick frei auf meine bescheiden hinter ihr drein stolpernde, füllige Gestalt.
„Oh! Nicht Sie auch schon wieder!“ Schmidtken ließ ein paar Bögen auf den Tisch gleiten und griff sich an die Stirne. Rosi lachte mir über die Schulter zurück zu.
„Dein Name fiel für seinen Geschmack ein bisschen zu häufig heute aus Kerkbaums wütendem Mund! Ja – sie auch!“, wandte sie sich wieder an ihren unglücklichen Kollegen. „Und was machst du hier in meinen Räumen?“ Sie trat energisch vor und fasste nach den Fotografien, die auf den hellen Tisch gefallen waren.
„Diese Zeitungsfraugeschichte ...“
„Du auch?“ Sie sah Schmidtken fragend an.
„Es ließ mir keine Ruhe! Irgendetwas stimmte nicht an diesen Bildern!“
„An dem, was sie abbilden!“, führte ich ihn vorsichtig auf die Pfade ordentlicher Formulierungen zurück und Rosi brummte zustimmend. Er aber verdrehte schon wieder ungeduldig die Augen.
„Ich weiß es auch nicht, was es ist, das Ganze wirkt irgendwie anders als die letzten Male!“
Rosi beugte sich über die Fotografien und legte sie nebeneinander auf den Tisch. Man konnte heraus gerissene Schubladen erkennen, abgestürzte Zigarettenstangen, zerfledderte Zeitungen.
„Hol` doch einmal ein paar Vergleichsfotos von den anderen Einbrüchen!“ Rosi wies auf einen der Karteischränke mit den großen Hängeschubladen und fügte hinzu: „Dritte Schublade, vierter, siebter und zehnter Hänger.“
Schmidtken bewegte sich gehorsam in den dunklen Hintergrund hinein, ich hörte ihn Schubladen herausziehen und die Hänger klapperten wie altjüngferliche Stricknadeln. Er brachte die Fotografien an den Tisch zurück.
Rosi ordnete die anderen Gruppen in drei parallelen Reihen darüber an und lehnte sich stirnrunzelnd über den Tisch.
„Lasst uns das einmal nach Themen geordnet von oben nach unten aufreihen: Alle Bilder mit aufgebrochener Kasse links, dann vielleicht die Zigarettenstangen oder was von ihnen übrig ist und dann...“ Sie stockte und Schmidtkens Finger blieben in der untersten Reihe links stehen. Auch ich sah, was es gar nicht zu sehen gab: Kein Foto mit aufgebrochener Kasse, statt dessen eine kaum vorgezogene Schublade, in der wir eine wohl verschlossene Stahlkassette erkennen konnten. Rosi schaute Schmidtken fragend an und der nickte bestätigend.
„Das Geld war unangetastet noch da. Die Tote ist ja über diese Schublade gebeugt vornüber gefallen. Anscheinend war es ihnen unheimlich, unter ihr nach der Kasse zu stöbern.“
„Sehr seltsame Rücksichtsnahme!“ Rosi schüttelte verwundert den Kopf. „Dann haben die ja kaum etwas erbeutet?“
Schmidtken nickte. „Die Zigarettenstangen und Zigarrenkisten waren auch alle noch da.“ Er deutete auf die Reihe mit den Zigarettenstangen aus den verschiedenen anderen Überfällen: „Kiosk Oberbergenbach: Zerfetztes Papier, fünf aufgerissene Kartons, zurück bleiben drei heraus gepurzelte Malboroughpäckchen und sieben Galloisstangen.“
„Die raucht hier oben auch kein Schwein!“, murmelte Rosi. „Wären gar nicht rasch an den Mann zu bringen.“
„Kiosk Familie Meier in der Weimarerstraße: Die führten gleich gar keine Gallois, aber eine Menge leichter Marken, da ist nämlich ein Gymnasium in der Nähe. Alle Stangen weg, die ausgepackten Päckchen nur teilweise aus den Regalen gerissen. Sah nach einer überstürzten Flucht aus, nicht mal richtig Zeit haben die sich gelassen, noch ein, zwei in die eigenen Hosentaschen für den Eigenverbrauch zu stopfen. Hier wurden die Ganoven übrigens das erste Mal auch beobachtet!“
Er atmete aus und ich wagte mich einzumischen: „Meinen Sie, Gymnasiasten stecken dahinter?“
Er zog seine Luft schnaufend wieder ein und warf mir einen Blick zu, als hätte ich ihn gefragt, ob grüngelbe Marsmännchen an den Überfällen beteiligt gewesen seien. „Gymnasiasten?“
Undenkbar anscheinend für Schmidtkens reine Waldorfschülermentalität! Wir etwas allgemeiner beschulten Frauen aus den Niederungen staatlicher Institutionen grinsten uns über die Fotos hinweg an.
„Die Zeitschriften!“ Rosis Finger deutete auf die dritte Vergleichsreihe und wieder neigten wir alle drei unsere Köpfe über den Tisch. Friedenspapa von Kerkbaum hätte die helle Freude an seinem „Sauerland Trio“ gehabt. Seit einer Viertelstunde wieder traut streitend vereint!
„Wieso sind die hier überhaupt herausgerissen? Die sind doch für einen Überfall gar nichts wert?“ Ich deutete auf die durcheinander geworfenen Magazine, Tageszeitungen und Fernsehzeitschriften des Bahnhofkiosks.
„Ist auch sonst nie der Fall. Hier, der Kiosk in der Neubausiedlung: Alle Zeitungen noch an ihrem Platz, Meiers auch, Oberbergenbach auch.“
„Und ich erinnere mich gut“, Rosi schaute in ihre imaginäre Ferne, “dass es bei den vier anderen Fällen ebenso war.“
„Dann hättet ihr also am Bahnhof ein ganz und gar untypisches Bild: Kein Geld geraubt, Zigaretten nur so pro forma herausgerissen, aber liegen gelassen, Zeitungen dagegen herumgefleddert?“
„Und die tote Frau nicht zu vergessen, Frau Mertens, die Pächterin des Kiosks.“
„Vera Mertens“, ergänzte Schmidtken und starrte nachdenklich weiter auf die Fotoreihen. „Vera Mertens, geboren am 15. Mai 1949 in Hamm.“
„Kinder?“ Ich schaute ihn fragend an und er schüttelte den Kopf.
“Nein, sie war ihr Leben lang ledig.“
Ein typischer Schmidtkens-Schluss, Männerlosigkeit mit Kinderlosigkeit gleichzusetzen.
„Das sollten wir trotzdem nachprüfen.“ Rosi schob die vier Fotografienreihen wieder zusammen. „Andere Verhältnisse?“
„Eine alte Mutter im hiesigen Altenstift, ein verheirateter Bruder, Elektrikermeister mit halb erwachsenen Zwillingen in Bochum sowie eine verheiratete Schwester, eine Frauenskatrunde und irgendwelche weniger wichtigen, flüchtigen Kontakte. Das brachte sicherlich auch ihr Beruf so mit sich. Aber wir haben das heute noch gar nicht weiter verfolgt, Rosi, der Fall schien ja auf den ersten Blick hin ziemlich klar!“ Schmidtken stopfte seine Fäuste ein wenig trotzig in die Taschen der feinen Wildlederjacke. „Bisher!“
„Immerhin ist dir das Gleiche aufgefallen wie mir!“ Rosi klopfte Schmidtken ermutigend auf den Rücken und grinste ihn an.
„Na gut, wenn dieser Überfall tatsächlich nicht auf das Konto der Jugendlichen geht ...“
Er drehte sich herum und verließ das Labor, Rosi räumte die Bilder wieder in ihre Hängevorrichtungen und schloss mit Schwung die Türen.
„Eigentlich im Zeitalter von Digitalkamera und Computervernetzung ein ziemlich altbackenes System, das ich da führe. Aber wenn ich zwanzig Bilder nebeneinander auf dem Monitor haben will, sehe ich außer Pünktchen und Flecken nicht mehr sehr viel. Außerdem geht das Gefühl fort! Frau muss ihre Fotos anfassen und hochheben können, sie ins Licht kippen ...“
„Daran riechen?“ Ich lächelte sie an und Rosi löschte die Lampe.
„Irgendwie, nenne es riechen, fühlen. ... wie du willst.“
„Wie hat man eigentlich die Frau getötet?“
Schmidtken hatte im Flur auf uns gewartet und ging jetzt mit uns heraus. Ich trottete hinter den beiden Kripobeamten den nächtlichen Gang herunter und wunderte mich wieder einmal darüber, wie weit gefasst doch die charakterliche Spannbreite der deutschen Polizei war, verkörpert in diesen beiden Gestalten da vor mir im nächtlichen Flurlicht.
Alle drei schlossen wir wieder zu einander auf, als es galt, die nächtens ungenutzten Büroräume der örtlichen Kripo von außen zu verschließen.
„Ziemlich gemein und hinterlistig: Die Täter sind von vorne an den Kiosk herangetreten, haben die Frau irgendwie vorgezerrt, ihr auf den Kopf geschlagen und sie wieder zurück auf ihren Stuhl gestoßen. Danach erst sind sie durch die Seitentüre in den Kiosk eingedrungen.“
„Also hat Vera Mertens sie gar nicht auf frischer Tat ertappt?“ Ich fragte geduldig die Rücken der beiden KollegInnen aus, während die grüßend an der schummerig beleuchteten Kabine des Nachtportiers vorbei wieder auf die Seitenstraße des Marktplatzes traten.
„Nein!“ Schmidtken blieb stehen und schaute in den nieseligen Nachthimmel hinauf. „Dieser Mord war ihre erste Gewalttat in der Tatsequenz, wirkt ja fast wie geplant und das war es auch, was mich zuerst stutzig gemacht hat. Das war geplant und gemein! Sie hätten einfach weiter gehen können, als sie sahen, dass der Kiosk noch besetzt war. Aber das geschah nicht, und das finde ich äußerst seltsam.“
Da wir im Dunkeln Schmidtkens Gesicht nicht sehen konnten und er auch eilig vor uns her lief, rang er sich doch glatt zu dieser Gefühlsäußerung durch. Das war ein untrügliches Zeichen dafür, wie sehr selbst diesen coolen, schnieken Beamten das Bild der erschlagenen Frau berührt hatte. Es musste wahrlich fürchterlich ausgesehen haben!
„Ja, das war gemein und brutal. Wenn ihr mich fragt, hat jemand den Verdacht ganz gezielt auf die Jugendbande gerichtet. Schließlich hat der Täter oder haben die Täter ein ziemliches Risiko auf sich genommen, gesehen zu werden.“ Schmidtken sah sich hin und wieder nach uns um, marschierte aber im Übrigen doch weiter sehr flott vor uns her.
„Was diese jungen Kerle machen ist nicht in Ordnung, sicher! Und wenn wir denen nicht irgendwann das Handwerk legen und sie vernünftigen Erziehungsmaßnahmen unterwerfen, solange da noch eine klitzekleine Chance auf Besserung besteht, wird vielleicht der eine oder andere von denen auch mal solch eine raubmörderische Kariere einschlagen. Doch vorerst sind es zwar verdammt leichtsinnige Bengel, aber sicherlich keine Mörder!“
„Meinst du, Frau Mertens hat ihren Mörder gekannt? Warum sonst hätte sie sich so vertrauensvoll weit vorbeugen oder ihm die Hände aus dem Kiosk herausreichen sollen?“
„Schon möglich, Rosi.“
Schmidtkens lange Rede hatte uns über den alten Marktplatz und die ungefähr achthundert Meter lange Fußgängerzone hinab in Richtung Bahnhofsvorplatz geführt.
„Bei achtzig Prozent aller Gewaltverbrechen kennen sich Opfer und Täter“, brachte ich mein Wissen ein und Schmidtken warf mir einen missbilligenden Blick zu.
Rosi hatte das Signal der Ampel gedrückt. Obwohl keinerlei Verkehr zu dieser etwas späteren Stunde zu hören oder gar zu sehen war, wartete ich geduldig mit den beiden Staatsbeamten zusammen auf das grüne Signal. Vermutlich war es hier vor ungefähr vierundzwanzig Stunden, als der Mord geschah, genauso friedlich und still gewesen.
Der Kiosk stand einsam mitten auf der größten der sieben Straßeninseln, die den regionalen Busbahnhof bildeten. So im nächtlichen Dunkel wirkte er geduckt und schimmerte breit wie ein getretenes Huhn durch die Stille herüber.
„Es sah sehr wüst aus, als wir an den Tatort kamen. Der Schichtarbeiter, der Vera Mertens um vier Uhr dreißig entdeckte, als er aus dem Bahnhof trat, war ziemlich bleich, als wir ihn vernahmen, und er ist sicherlich sonst ein eher harter Typ!“
„Trotzdem wirkte das Chaos auf den Bildern wie gewollt. Da wollte jemand, der keine Ahnung von Überfällen hat, bewusst den Anschein erwecken, als sei es einer gewesen.“
„Wäre Frau Mertens nicht über die Schublade mit der Kasse gefallen, vielleicht hätten die Täter ja dann das Geld zu Tarnungszwecken doch entwendet?“, wagte ich schüchtern anzufragen und Schmidtken nickte nur grimmig vor sich hin.
„Aber warum tötet jemand eine solch relativ harmlose und anscheinend bei vielen Leuten beliebte Frau?“ Ich schüttelte den Kopf.
Rosi fasste meine Hand, als wir Richtung Marktplatz zurückliefen: „Ich kannte Vera Mertens sogar ein bisschen, Schmidtken. Sie war wirklich sehr nett und ich könnte mir denken, auch bei den Menschen, die du zu den weniger wichtigen, flüchtigen Kontakten gerechnet hast, sicher ziemlich beliebt.“
„Du kanntest sie?“
Wir standen wieder unter den Arkaden des Rathause.
„Vera Mertens verkehrte am Rand der Szene, der Frauenszene, meine ich!“
„Eurer ...?“ Er machte große Augen.
„Unserer!“ Rosi fasste ihn am Arm. „Du wirst ein wenig über deinen Schatten springen müssen, aber wenn du willst, helfe ich dir auch ein bisschen. Das muss bestraft werden, diese Schweinerei!“
„Wenn du dich für mich umhörst, ist die doch auch wieder dabei!“ Er deutete auf meine Person wie auf eine verrostete Teertonne. Komisch eigentlich, wie viele Menschen gegenüber Lesbenpaaren in eine Art „La-Belle-et-la-Bete-Schema“ verfallen: Da gibt es meistens die Gute, Schöne und nach den herrschenden Maßstäben Angepasstere und die Latzhosige, Finstere mit Stoppelhaaren. Nun, in meinem Fall, da ich keine Stoppelhaare und auch kein wieder von den Toten auferstandenes Butch-Image pflege, war es wohl eher mein das staatliche Gewaltmonopol brechender Beruf, der mich in Schmidtkens Augen zur Unperson abstempelte, trage ich doch auch schon seit zwanzig Jahren keine Latzhosen mehr und die Haarmatte auf meinem slawischen Rundschädel ist ungefähr zehn Zentimeter lang, weich und, wie ich finde, durchaus von eher femininer, dunkelblonder Farbe.
„Natürlich ist die auch dabei!“ Rosi gluckste ob Schmidtkens Abscheu vor einer privaten, weiblichen Selbstverteidigungstrainerin. „Und du wirst noch dankbar dafür sein, nehme ich an. Denn wenn du Pech hast, werden sich deine Untersuchungen in einer reinen Frauenwelt abspielen, einer Welt aus allein erziehenden Müttern, karrieregeilen Ledigen, wilden, unterbezahlten Projektfrauen und“, sie lachte laut und hakte sich bei mir unter, „Lesben! Gute Nacht!“
Während wir Schmidtken leicht verdutzt am Eingang der Seitenstraße stehen ließen, rollten wir wie zwei Seebärinnen auf Landgang vergnügt dem verspäteten Besuch der heutigen, hiesigen Frauenkneipe entgegen.
3. Kapitel
In den Provinzhauptstädten Deutschlands, in denen nicht alle Tage irgendwo ein Frauenereignis in einem männerfreien Ambiente stattfindet, werden die wöchentlichen oder eventuell gar nur vierzehntägigen Frauenkneipen in der Regel gut besucht.
Da taucht dann nicht nur die einsame, meist ortsfremde Wen-Do-Trainerin auf der Durchreise auf, da zieht es die Landlesben von ihren unökonomisch geführten Kleinstbiobäuerinnenbetrieben und leicht verkommenen Pferdehöfen ins brodelnde Kleinstadtleben, die dreieinhalb festen Lehrerinnenpärchen als jeweilige Vertreterinnen der drei wichtigsten Schultypen unseres nordrhein-westfälischen Landes sitzen an ihrem Lehrerinnentisch und besprechen die Realien des Daseins zwischen Beamtinnentum und Comeoutbestrebungen. Und da hängen die obligaten Kajaldamen zwischen fünfzehn und achtzehn Jahren am Tresen herum. Schick behängt mit diesen nierenkranken, ausgebleichten Jäckchen, an den Füßen Plateausohlen. Sie können sich immer noch nicht entscheiden, ob sie nun Mädels wollen oder doch wieder lieber mit den Jungens weiter rumhängen – echt ätzig die, echt! Sie werden misstrauisch beäugt von den zwanzig- bis fünfundzwanzigjährigen Junglesben in Lederjacke und mit Stoppelkopf, die es geschafft haben, sowieso demnächst nach Köln oder Berlin emigrieren werden und verachtungsvoll auf alle Provinztussis hernieder blicken. Dazu gibt es eigentlich keinen Grund, denn das Häuflein übrig gebliebener, aufrechter Politfrauen aus grandioseren Jahren, grau geworden in den jahrzehntelangen Kämpfen zwischen Männerherrschaft und Beziehungskisten, debattiert ernst und so laut, dass bitte es alle hören mögen, die beklagenswerte Unpolitisiertheit der jungen Generation – zu der sowieso alle unter siebenunddreißig gehören! Meistens artet das aus in den üblichen Hickhack zwischen der Ober-Hetero-Politfrau des Ortes, die sich irgendwann mal für das Engagement bei den Grünen entschieden hat, und der Ober-Lesben-Politfrau, die heute die regionale Ansprechpartnerin der Feministischen Partei ist. Vor vielen Jahren waren sie die erbittert verfeindeten Queens of the Scene, leider auch einige Male miteinander im Bett, was sie besser hätten bleiben lassen sollen. Heute sieht das Ganze viel gelassener aus. Die hohen Sturmeswellen der Jugend sind verklungen, die wilden Gebirgszacken aller Dissenzen zu ruhigen Tälern glattgehobelt. Man kann wieder miteinander – zumindest einmal in der Woche oder im Monat einen Abend lang.
Rosi hat gewissermaßen eine biografische Lücke von zehn Jahren, was diese Szene betrifft.
„Manchmal muss man sich entscheiden“, erklärte sie mir einst an einem lieblichen Sommerabend bei mir zu Hause an der Steinbachtalsperre, als die anderen Eifellesben schon vom gemeinsamen Badewurzelstammstrand aufgebrochen waren und die Sonne eine späte Brücke über das dunkle Wasser legte.
„Du kannst nicht gleichzeitig deine Karriere bei der Polizei planen und illegal Frauen zur Abtreibung nach Holland fahren.“
„Du musstest ja nicht ausgerechnet zur Polizei gehen!“
„Nein, mein Schatz, das nicht. Aber ich wollte eben fotografieren und dort wurde die Stelle frei.“
„Presse wäre doch auch etwas gewesen?“
„Ich weiß es nicht. Ich mochte, als ich noch in der Lehre war und schon so kleinere Aufträge in Konstanz übernahm, diese Hektik nicht, die dort herrschte, diesen Stress. Jeder konkurrierte mit jedem. Das war nicht sehr fein! Abgesehen davon, glaubst du im Ernst, Jane, Fußballspiele oder Bankeröffnungen wären so viel politischer als Autounfälle oder Wasserleichen?“
„Immerhin tust du ja auch was Gutes – so vom Gesellschaftspolitischen her gesehen.“
„Irgendwie schon. Ich bin gerne auf der Rächerseite, wenn ich ehrlich sein soll. Aber als ich hier auf dem Kommissariat ein paar Jahre geschafft hatte und die Vereidigung zur Beamtin anstand ...“ Sie zuckte die Achseln und ich spürte an ihrem Blick, wie sehr sie das Ganze eigentlich bis heute noch berührte: Meine Geliebte sieht aus wie ein hungriger Vogel, wenn ihr die Seele wehtut, und so schaute sie mich auch nachdenklich von oben herab an, während ich in ihrem Schoß lag.
„Manche der Lesben fanden das so schlimm, als wolle ich heiraten!“
„Du hast die Bewegung verraten!“
„So ein Quatsch!“
Aus dieser Zeit hatte sie nur wenige Freundinnen behalten, danach höchstens mal ein Frauenfest besucht und sich ansonsten aus dem aktiven Politleben feministischer Beratungs- und Selbsterfahrungsgruppen zurückgezogen.
Stattdessen war sie Co-Trainerin in einem Aikido-Dojo geworden und genoss die wenigen freien Abende, die ihr die Kleinstadtkriminalistik zwischen Beruf- und Beziehungsstress ließ, mit Pfeife und einem guten Buch auf dem Sofa. Doch Polizeifotografinnen sind viel in der Nacht und ausgesprochen häufig am Wochenende unterwegs, wodurch sie wohl mehr Stress in den Beziehungen wie in ihrem Beruf erlebte. Glücklicherweise war ich ihr ja im Rahmen ihres Berufes begegnet, und aus einer dienstlichen Überwachungssituation war eine sehr wunderbare, wohl auch etwas altmodische Liebesbeziehung geworden.
Mein Beruf hatte es mit sich gebracht, dass ich mir kontinuierlich die Hörner an der bundesrepublikanischen Frauenbewegung und ihren Projekten wundstoßen musste, schon fast seit einem Vierteljahrhundert. Das hatte mich auch ziemlich geprägt.
Der Grund, warum wir nun also doch hin und wieder in die örtliche Frauenkneipe gingen, wenn ich auf Besuch weilte, ist wohl, dass Rosi und ich gerne miteinander angeben! Ja doch, wirklich! Anscheinend halten wir einander tatsächlich für die schönsten und liebsten Frauen der Welt, was ja noch anginge, wären wir nicht darüber hinaus auch noch beide der Meinung, dass alle anderen Frauen auch so über unsere Geliebte zu denken hätten.
Kurz gesagt, wir Beide liebten es sehr, jeweils mit der schönsten Frau der Welt öffentlich aufzutreten.
Da ich am Tag zuvor einen öffentlichen Vortrag gegeben hatte, erkannten mich einige Frauen wieder, hoben die Köpfe und lächelten uns zu, als wir die Türe zum „Grünen Schwan“, der örtlichen Alternativkneipe, die den wöchentlichen Frauenabend veranstaltete, aufstießen.
Ursprünglich hatte das Lokal „Goldener Schwan“ geheißen. Der Schwan hatte leider einen steilen Absturz erlebt. Nach gutbürgerlichem Restaurant, italienischer Pizzeria und sodann nur noch heruntergekommener Altstadtpinte hatten am Ende drei stellungslose Sozialarbeiter in Wollepullis und mit Bärten sowie zwei gleichermaßen stellungslose Sozialpädagoginnen mit gut situierten Elternhäusern in friedfertigen Vororten der umgebenden Großstädte im Hintergrund den unaufhaltsam scheinenden Abstieg des „Schwanes“ durch Ankauf der Räumlichkeiten im letzten Moment gebremst. Da wurden nicht nur die schmuddelig verrauchten Wände in leicht gelblichem Rauhputz a la Mexico neu geweißt und Bilder von rasenden Pferdeherden in staubiger Pampa aufgehängt, sondern von jenem stellungslosen Sozialarbeiter, der kein Mädel mit Geld ins Projekt eingebracht hatte, dafür aber eine Ofensetzerlehre, auch noch ein riesiger, runder Tonofen mit breit umlaufender Kachelbank an Stelle des alten Pizzaofens aufgemauert. Sodann benannte man das „Goldene“ als dezenter Hinweis auf eine etwas andere Ess- und Lebenskultur in „Grün“ um, wohl auch nach einem der Kollektivisten, wie Rosi mir mal erzählt hatte, der damit vermutlich einen ihrer Sponsoren ehren wollte.
Der ökologische Bezug hatte leider zur Folge, dass das Kollektiv nur noch an zwei Tagen in der Woche Fleischmahlzeiten servierte. Tage, die sich geheimnisvollerweise nie mit dem Frauenkneipentag deckten, so sehr in dieser Hinsicht auch schon die regionale Motorradlesbengruppe Einspruch erhoben hatte. Doch das merkwürdig moderne Medienbild der emanzipierten, schlank-sportiven, rundum erfolgreichen Karrierefrau mit drei Kindern und etwas angefaultem Hausmann deckt sich seltsamerweise über große Strecken mit der grün-alternativen Vorstellung der allzeit aktiven, politisch engagierten, aufstrebenden Konrektorin mit drei Kindern, etwas fülligerer Statur und trägem Hausmann, der Künstler zu sein vorgibt, was ihn oft vom Windelnwechseln, Einkaufengehen und Abspülen abhält. Beide essen keine Wurst und keine Schweineschnitzel, erbleichen im Anblick einer Salamitheke, selbst wenn sie in der Toskana steht, und halten Döner-Kebab entweder für eine Berliner Unanständigkeit oder für politisch unkorrekt. Die Karrierefrau beschränkt sich auf Salat, Tomaten mit Basilikum und Mozzarella das ganze Jahr über und Joghurt am Morgen, die Konrektorin isst Körneraufläufe, Pastenbrote in der Zehnuhr-Pause und Joghurt mit Müsli am Morgen. Nun ja – von irgendwoher müssen die verschiedenen Staturen herrühren. Beide halten die allgemeine Illusion aufrecht, dass Emanzen doch nicht so schlimm, staatstragend und im Tierschutzverein sind. Ein politisches Verdienst, denn ohne ihre vegetarische Harmlosigkeit hätten wir den zwanzigjährigen Schnelldurchmarsch durch diese patriarchale Gesellschaft nie geschafft!
Fakt ist, es gibt erstens Lesben, zweitens begeistert Fleisch essende Lesben, drittens kräftig gebaute Lesben, viertens ekelhaft unbescheidene Lesben, die jetzt auch noch heiraten, sprich an die Fleischtöpfe des geschützten Patriarchates heran wollen, fünftens solche Lesben, die meinen, die Frauenbewegung habe noch gar nichts erreicht, Karrierefrauen und Konrektorinnen hin oder her, solange Wen-Do nicht Pflichtfach an allen Schulen für alle Mädchen von acht bis achtzehn Jahren ist. Zur letzten Gruppe gehöre ich – ebenso wie zu den vier vorherigen auch.
Glücklicherweise – andererseits – herrschte striktes Rauchverbot im „Grünen Schwan“ zu allen Tages- und Nachtzeiten, die ganze Woche über und nicht nur an den Frauenkneipentagen, was ich andernorts nämlich auch schon erlebt hatte. Als ob Männer schöner rauchen als Frauen!
Von daher war der „Grüne Schwan“ auch im gemischtgeschlechtlichen Zustand für eine gewisse rot-grüne Bildungsbürgerschicht sowie weitere Leute, die guten Willens sind, ein sehr angenehmer Treffpunkt in Rosis Mittelalterstädtchen und berühmt für seine vegetarische Paellia de Verduras, angeblich nach dem Spezialrezept einer Mutter oder Großmutter des Kneipenkollektives.
Natürlich würden die fünf KneipenbetreiberInnen mit solch einem Geschäftsgebaren nie reich werden, aber das war wohl sowieso schon vorher nicht ihr Ziel gewesen. Oder ist jemals ein Sozialpädagoge in Ausübung seines Amtes Millionär geworden?
Der ohne Mädchen, also der Ofenfachmann, der auch am vorherigen Abend Kneipendienst gemacht hatte, nickte mir vom Tresen her freundlich zu, denn ich hatte auch den gestrigen Nachvortragsabend hier mit den Organisatorinnen der Anti-Gewalt-Reihe verbracht.
„Kommt, setzt euch zu uns!“ Eine kräftig gebaute Frau winkte Rosi und mich an einen großen, runden Tisch am Fenster, an welchem bereits drei andere Frauen saßen.
„Friedrich, ein Weizenbier und ein großes Klosterbräu!“, riefen wir dem Ofenbauer zu und folgten der Einladung.
„Katharina“, Rosi deutete auf die Frau, die uns her gewunken hatte. „Wir waren früher in der Beratungsgruppe zusammen. Katharina ist immer noch dabei.“
Diese nickte zufrieden vor sich hin. „Ja, ja – so`n alter Ackergaul, der zieht seinen Karren durch den Dreck bis ans bittere Ende. Glücklicherweise wird frau für diesen Job heutzutage von der Stadt bezahlt. Zu Rosis Zeiten haben wir das ehrenamtlich gemacht, neben unserer eigentlichen Arbeit.“
„Was warst du damals von Beruf?“ Ich zog mir einen Stuhl heran.
„Leiterin einer Kinderkrippe!“ Katharina lachte, was ihr etwas rundliches Gesicht absolut nach oben und unten in die Länge zog, sodass sie plötzlich ganz anders aussah.
„Ich habe mir buchstäblich mit meiner Politarbeit das berufliche Wasser abgegraben. Der Nachwuchs blieb nämlich aus und die Krippe wurde geschlossen! Jetzt berate ich weniger in Abtreibungsangelegenheiten, eher Scheidungsfrauen, und auch viele, die jahrelang ungesichert in sogenannt fester Partnerschaft lebten und jetzt ziemlich alt aussehen, wenn der edle Softie, in die Jahre und zu einem Konto gekommen, sich eine Jüngere an die gemeinsame Müslischüssel holt! Aber die Weiber werden wohl nie klug!“, seufzte sie mit einem Blick auf die hoffnungsvolle Tussi-Jugend am Tresen.
„Wir kennen uns ja!“ Heike Balden, die Leiterin des Frauenressorts der örtlichen Volkshochschule, nickte mir wohlwollend zu. Sie war in Bezug auf die Vortragsreihe sowie die anschließenden Wen-Do-Kurse meine Hauptansprechpartnerin am Telefon gewesen. „Dein Vortrag gestern Abend hat mir wirklich gut gefallen. Aber vieles, was du so forderst, ist doch noch ziemlich exotisch, findest Du nicht?“
„Solange Frauen sich bei Dunkelheit immer noch nicht getrauen, einen gemütlichen Stadtbummel zu machen oder für einen Fußweg von drei Minuten die Umwelt und die Ohren ihrer Mitmenschen mit dem Auto belästigen, weil sie sich ohne Blechhülle ungeschützt fühlen, scheint mir die volle Finanzierung von Selbstverteidigungskursen für Frauen durch die Öffentliche Hand oder durch die Krankenkassen vollauf gerechtfertigt.“
„Hier“, der Ofenbauer kam heran und schob Rosi und mir die gewünschten Getränke zu. „Sorry übrigens, dass die Frauen heute an eurem Tag nicht Dienst machen, sie sind zu fertig ...“ Er stockte und schaute uns unsicher an, ob er den Satz beenden dürfe. Katharina klopfte ihm auf den Arm: „Geht schon in Ordnung. Die meisten von uns wissen ja, dass Vera Maggis Tante war. Das ist schon in Ordnung. Wir sind auch alle ziemlich geschockt darüber.“
„Ausgerechnet genau zu dem Zeitpunkt, da wir uns alle deinen Vortrag über Selbstverteidigung und Gewaltprävention im Alltag anhörten.“
„Das ist die Dritte im Bunde der Frauenrunde. Wir haben so `ne Art Stammtisch hier.“ Katharina stellte mir Lilo vor, die ich bereits aus Rosis Erzählungen kannte. Am Abend zuvor war sie mir durch lebhafte Fragestellungen aus dem Publikum heraus aufgefallen und morgen sollte ich sie treffen, um den Ablauf des Kurses an der Hauptschule durchzusprechen.
Eigentlich war Lilo ihr Leben lang Hausfrau gewesen. Doch da sie fünf eigene Kinder aufgezogen hatte sowie zwei Pflegekinder, welche sie alle strategisch sehr geschickt über die verschiedenen Schulen des Städtchens verteilt hatte, gab es kaum eine Schulangelegenheit, kein Elternpflegschaftstreffen, kein öffentliches Hearing, keine Schulaktion an der sie nicht irgendwie federführend beteiligt war. Und wenn sich einmal die Schultermine, die sie pflichtschuldigst alle wahrnahm, überschnitten, so sprang ihr Gatte ein, ein schmaler, ziegenbärtiger, stadtbekannter Mann, dessen Beruf als Beratungslehrer für Kinder mit Körperbehinderung ihn in den Schulen des ganzen Landkreises herumbrachte, was ihn aber keinesfalls daran hinderte, ebenso wie seine Frau, Elternpflegschaftsvorsitzender an zwei Schulen seiner Kinder, Kassenwart im Förderverein der dritten Schule sowie Beratungsmitglied für Schulangelegenheiten im Schulausschuss der Stadtverwaltung zu sein. Die Göttin hatte ihn zu einem kritischen Linken und sie zu einer Radikalfeministin, soweit das für eine verheiratete Frau überhaupt möglich ist, gemacht, so dass sie beide der Schrecken aller altbackenen Lehrer, ungerechter Lehrerinnen und christlich-konservativer Schulleiter waren.
Lilo schüttelte betrübt den Kopf: „Vera war eine feine Frau! Ich kann eure Freundinnen gut verstehen!“
Der Ofensetzer nickte bekümmert. „Das Ganze ist eine große Sauerei. Als ob wir hier in der Stadt nicht genügend für die Jugendlichen täten: Disco in der alten Mälzerei an der Autobahnauffahrt, Beratungsstellen noch und nöcher ...“
„Förderunterricht ...“, unterbrach ihn Lilo.
„Und nicht zu vergessen die Kurse der JUZ-Initiative! Hoffentlich war`s keiner von den Jungens aus der Lehmbaugruppe!“
Ich wollte Luft holen, aber Rosi stieß mich unter dem Tisch an und zog warnend die Augenbrauen zusammen. „Ich wusste gar nicht, dass Maggi mit ihr verwandt war?“
„Doch, doch! Maggi war fast ihre einzige Verwandte, ihre Nichte. Vera hat – – hatte auch Geld als Starthilfe hier in unserem Projekt!“
„Ach!“ ‚Ach’ hatte bisher noch Nichts gesagt. Sie trug einen dunkelgrünen, fast nachtgrünen Rollkragenpullover, einen strengen Helm aus schwarz-grau melierten, knapp geschnittenen Haaren und hatte ihre sehr langen, schlanken Hände vor dem Gesicht gefaltet. Nun stützte sie ihr Kinn auf die nebeneinander liegenden Daumen und schaute den Kneipenkollektivisten ernsthaft aus großen, schwarzen Augen an. „Wie viel?“
„Die Leiterin von ‚Brot und Blüten’!“, flüsterte Rosi mir zu und fasste unter dem Tisch meine Hand. „Ein Drei-Frauen-Projekt. Sie beraten Frauenprojekte in der ganzen Bundesrepublik bei Existenzgründungen, machen deine Buchhaltung oder Steuererklärung, empfehlen dir passende Versicherungen und fördern deine Vermögensbildung, so du Selbiges hast! Das da ist ihre Juristin Emma Nolden! Wenn du mich fragst, ein eiserner Besen!“
Emma hatte mit Sicherheit die letzten Worte meiner Liebsten gehört und obwohl sie keine Sekunde lang den Sozialarbeiter aus ihrem Blick ließ, schnellte ihr rechter Zeigefinger für eine Millisekunde auf Rosi zu, als wolle sie meine schöne Polizistenfreundin durch standrechtliches Abschießen ohne langes Verfahren für solch unbotmäßige Bemerkungen bestrafen.
Ich lachte unwillkürlich leise auf und nun schnellten beide Zeigefinger in unsere Richtung, um dann, gelehnt an eine sehr scharfe, ausdrucksvolle Nasenspitze, wie ein Zeltdach über dem kritisch vorgewölbten, schmalen Mund stehen zu bleiben.
„Ich weiß nicht, ob ich das hier ohne die anderen sagen darf ...“ Er warf verlegene Blicke in die Runde, als würde gleich der kritische, weibliche Teil seines Kneipenprojektes hinter ihm auftauchen und ihn abführen.
„Das war auch nur rhetorisch gemeint!“ Emma Nolden runzelte ungeduldig ob so viel Unverständnis für die Feinheiten zwischenmenschlicher Kommunikation ihre Stirne. „Wir sind zwar ein Frauenprojekt, aber vielleicht sollten wir in eurem Fall mal eine Ausnahme machen?“ Emma Nolden stockte kurz und nachdenklich und ließ ihre Augen an uns anderen fünf Frauen entlang wandern, taxierend, ob wir wohl schweigen würden zu dem, was sie als Nächstes vorzuschlagen hatte. Dann fing sie wieder mit einem Blick den schüchternen Ofenbauer ein, der mittlerweile zum siebten Mal seine eh` schon trockenen Hände an der Schürze abwischte.
„Ihr seid ein gemischtes Projekt, solche beraten wir normalerweise nicht. Aber schick doch die beiden Mädels morgen mal bei uns vorbei. Ich habe das Gefühl, dass euch in dieser Lage ein wenig fachliche Hilfe nicht schaden kann.“