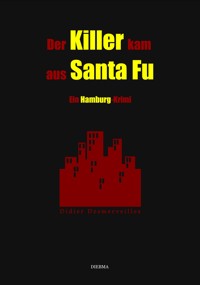
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Eigentlich möchte der Halbitaliener Fredo seinem Vater, einem einflussreichen Hamburger Mafia-Paten, nur eins auswischen. Der skrupellose Geschäftsmann will nämlich, dass sein Sohn die abgehalfterte Sängerin Lady M. (bekannt geworden durch die Schnulze "The Night Is Dark And Blue") zum Traualtar führt. Fredo aber hat nur Augen für die siebzehnjährige Luisa. Doch ausgerechnet dem eiskalten Killer aus Santa Fu einen Besuch abzustatten erweist sich ziemlich schnell als Bumerang, der Fredo und seinen Freund, den Hacker Latour, mit voller Wucht treffen wird. Fredo kann nicht ahnen, dass er eine mörderische Gewaltspirale in Gang gesetzt hat, an deren Ende nicht nur seine eigene Existenz in Trümmern liegen wird ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 224
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Didier Desmerveilles
Der Killer kam aus Santa Fu
Ein Hamburg-Krimi
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Prolog
Sonntag, 5. Mai
Montag, 6. Mai
Dienstag, 7. Mai
Mittwoch, 8. Mai
Donnerstag, 9. Mai
Freitag, 10. Mai
Sonnabend, 11. Mai
Sonntag, 12. Mai
Montag, 13. Mai
Sonntag, 12. Mai, 17.22 Uhr
Epilog
Statt eines Nachworts
Vom selben Autor
Leseprobe "K. - Begegnungen im Schattenreich"
Impressum neobooks
Prolog
Sonnabend, 4. Mai
»O.k., Digger, bin jetzt drin. Wie weiter?«
»Bist du schon im passwortgeschützten Bereich?«, vergewisserte sich die Stimme am anderen Ende.
»Alter!«, schimpfte Fredo. »Hab' ich das nicht gerade gesagt? Sprech' ich kein Deutsch, oder was?«
»Ist ja gut. Der Trojaner hat sich also bereits selbst installiert. Funktioniert ja geil, das Teil. Da blinkt unten rechts auf dem Monitor ein kleines Pferd, oder?«
»Alter, dass das Vieh ja keine Pferdekacke auf dem Rechner von meinem Alten hinterlässt, ey!«
Fredo befand sich in der Villa seines Vaters. Er schlief nur noch selten dort. Sein Vater hatte ihm zum Studienbeginn vor ein paar Jahren ein Apartment in Alsternähe geschenkt, das er zu einer WG umfunktioniert hatte. Martin war bereits der achte Mitbewohner. Die sieben Vorgänger hatten Fredos nächtliche Partys mit türkischen Freunden auf Dauer nicht ertragen. Auch heute hatte er seinen Vater nicht gesehen, obwohl er den halben Tag in Rissen verbracht hatte. Ganz nach Plan. Er wusste von dem Abendessen mit den wichtigsten Entscheidungsträgern von Lion-Air, dem kleinen Luftfahrtunternehmen, mit dem sein Vater fusionieren wollte. Er hatte sich in das Büro des großen Aksam geschlichen, das USB-Stäbchen, das ihm Martin gegeben hatte, in das Laufwerk geschoben und den passwortgeschützten Bereich tatsächlich in null Komma nichts erreicht. Dann hatte er sein Mobilfunktelefon Martin anrufen lassen. Und wie verabredet hatte sich das Computer-Genie auch gleich gemeldet.
»Wenn du alles genau so machst, wie ich dir gesagt habe, geht auch nichts schief. Die Dateien musst du natürlich selber finden.«
Fredo hatte sich die Plastikhandschuhe von seinem Haarfärbemittel übergestreift. Sie knisterten ein wenig, während er die Maus durch die Liste der Dateien klickte. »Da hab' ich jetzt kein' Nerv für, Digger. Ich kopier' einfach den ganzen Scheiß auf dein' USB.«
»O.k. Der dürfte groß genug sein. Aber pass auf, dass du copy und nicht ausschneiden wählst.«
»Ey, bin ich die Computer-Arschgeige, oder was?«, beschwerte sich Fredo. »Ich leg' jetzt auf. In 'ner halben Stunde bin ich bei dir.«
»Wie verabredet. Alles klar. Und schön alles wieder schließen. Und den USB-Stick abmelden, bevor du ihn rausziehst!«
»Alter, der hält mich für bescheuert!«, flüsterte Fredo sich selbst zu, nachdem er aufgelegt hatte. Online-Kontoauszüge und geschäftlicher Briefverkehr, viele sensible Daten, Informationen über Handelsbeziehungen und internationale Finanz-Transaktionen, die sein Vater lieber von hier statt vom Bürocomputer aus vorgenommen hatte, befanden sich nun als Kopie auf dem kleinen Datenträger mit dem Spähprogramm, den ihm Martin letzte Woche ausgehändigt hatte. Dass sein Mitbewohner und derzeit bester Freund ein Computer-Ass war, das musste man wohl als Wink des Schicksals bezeichnen.
Als Fredo in der Doppelgarage, die an die Villa anschloss, seinen Ferrari startete, war er bester Laune. Am Sonntag würde er Luisa sehen und falls sein Vater es wagen sollte, sich seiner großen Liebe, seiner Einzigen und Wahren, in den Weg zu stellen, weil er von Liebe einfach nichts verstand, so hatte er, Fredo Aksam, jetzt etwas in der Hand, das ihm den Weg frei machte.
Fredo blickte in die Lichter eines großen weißen Frachters, der sich unten auf der Elbe durch die Dämmerung Richtung Hafen schob. »Fiat lux!«, rief Fredo, schaltete ebenfalls das Licht ein, dann das Autoradio. Ozzy Osbourne, Dreamer. Fredo wippte im Takt auf dem Sitz hin und her. Gleichzeitig fuhr er an. Im Grunde ist das Leben auch nichts anderes als ein Musikstück im Radio, dachte er, es klingt langsam aus, als ob irgendein Idiot langsam den Ton leiser drehen würde, oder es endet mit einem Paukenschlag. Wenn man's drauf hat.
Sonntag, 5. Mai
1
»Uuuuh baby, I love your way, everyday!« Peter Framptons Allzeit-Liebeslied flog aus den Lautsprecherboxen in Fredos geöffnetem Ferrari-Cabrio hinauf zu den alten Linden der Allee, durch die er mit achtzig Sachen flitzte, verstärkt nicht nur durch seine 500-Watt-Hifi-Boxen, sondern auch durch ihn selbst. Fredos Stimme eignete sich zwar nicht für einen dieser Song-Contests, die jetzt überall in den Flimmerkisten liefen, aber ging es da nicht sowieso eher ums Aussehen? Dann hätte er, der nonchalant-charmante Deutschtürke vielleicht doch Chancen. »Wanna tell you I love your way, everyday! Wanna be with you night and day!« Allerdings gab es Schwierigkeiten mit der Textsicherheit: »Luisa appears to shine and light the sky«, begann bei ihm die zweite Strophe. Und als Peter Frampton wieder beim Refrain war, macht er aus baby Luisa. »Uuuuh Luisa, I love your way, everyday ...« Er bog von der Kieler Straße in die Wolffstraße ein und von der wieder rechts in den Fasanenweg, der seinem Namen alle Ehre machte. Die Gegend erinnerte mehr an einen Park mit Verweilpavillons als an ein Wohnviertel. Fasane, wenn sie sich denn noch hierher verirrten, hätten keinen Grund zur Klage. Man durfte hier eigentlich auch nur dreißig fahren. Fredo war das zu lahm. »Luisa, Luisa, Luisa!« Der schmale Weg führte auf einen von Linden beschatteten Platz, in dessen Mitte sich eine imposante, dreihundert Jahre alte Kirche mit ihrem schlanken Turm divenhaft in den blauen Himmel emporstreckte. »Uuuuh Luisa, I love your way, everyday!« Eine Treppe führte an Rasenflächen und einem Denkmal für die Gefallenen der Weltkriege vorbei zum Portal, das sich soeben, es war elf Uhr dreißig am Sonntagmorgen, öffnete. Im selben Moment tauchte ein kräftiges Glockengeläut den Platz in ein frappierendes Innuendo und erstickte den ausklingenden Peter Frampton. Während Fredo auf dem Parkplatz vor dem Kirchengebäude in seinem Ferrari ausharrte und sich nervös noch einmal im Innenspiegel das glatte, schwarze Haar mit den dunkelroten Strähnchen zurechtstrich, strömten die ersten Kirchgänger aus dem Gottesdienst. Und – sie hatte versprochen, sich zu beeilen – da war auch schon sie: die Engelsgleiche, gehüllt in ein luftiges blau-weißes Sommerkleid, das braune Haar züchtig zu einem Zopf geflochten, der ihr einen halben Meter lang über den Rücken hing. Ihr Antlitz: strahlend. Sie sah ihn, löste sich von einem älteren Herrn, der beim Herausgehen ein Gespräch mit ihr begonnen hatte, lächelte, da sie seinen Wagen erblickt hatte, ihm entgegen. Er stieg aus, öffnete ihr die Beifahrertür, als sie noch zehn Meter entfernt auf den Treppenstufen war, und konnte sein klopfendes Herz nicht zur Ruhe bringen.»Du solltest lieber selbst mal in einen Gottesdienst kommen anstatt mir hinterher aufzulauern«, lachte sie. »Würde dir gut tun.«
»Goldstück«, sagte er und ließ seine weißen Zähne blitzen, »du weißt doch, ich bin Moslem. Moslems gehören in Moschee, nicht in eure heiligen Kirchen.« Sie stand vor ihm, er nahm sie in den Arm. Seinem Kuss auf die Wange wich sie aus.
»Aber in die Moschee gehst du ja auch nicht«, erwiderte sie, während sie auf dem Beifahrersitz Platz nahm und er die Tür zuwarf.
»Ich und Gott, das ist besondere Beziehung. Hier!« Er klopfte sich auf die Brust. »Gott ist tief hier drin. Und du bist gleich nebenan, ungefähr« – er tastete sich mit den Fingern auf seiner Brust nach links – »hier!«
»Trotzdem – was der Herr Pfarrer heute gepredigt hat, geht alle an. Das wäre für dich auch interessant gewesen. Es ging darum, dass es im Leben jedes Menschen Dämonen gibt, die ihn jagen. In der Bibel gibt es eine Geschichte, wo ein Mann von ganz vielen Dämonen, einer Legion von Dämonen, besessen ist und Jesus treibt sie aus und sie fahren in eine Herde von Säuen.«
»Das ist ganz einfach zu verstehen, Goldstück«, sagte Fredo und fuhr so rasant an, dass ein paar Steine von dem sandigen Parkplatz von seinen Hinterreifen gegen die Mauer flogen, die den Rasen des Kirchgrundstücks einfasste. »Jesus wollte zeigen: Der Typ da, das war’ne ganz arme Sau war das!«
»Wow, unser Laientheologe hat gesprochen! Aber irgendwo ist jeder Mensch eine arme Sau. Weil sein Dämon ihn drangsaliert und ohne dass er sich dagegen wehren kann, stürzt er ihn am Ende ins Unglück. Für die einen ist es, dass sie zu geldgierig sind ...«
»Mein Vater...«
»... ein anderer ist ständig hinter Frauen her und kann nie treu sein...«
»Kenn’ ich! Das Problem hatte ich früher auch mal, aber seit ich dich kenne, Goldstück, ist Dämon verschwunden, spurlos!«
»Oder jemand leidet an Depressionen, weil er mit irgendwas nicht fertig wird. Und das wird ihm am Ende zum Verhängnis und vielleicht nicht nur ihm ... Wusstest du, Fredo, dass der Teufel eigentlich ein Engel ist?«
»Was? Teufel, der Sauhund will ein Engel sein?«
»Der Teufel ist ein gefallener Engel.«
»Wie das?«
»Als er mit Gott konkurrieren wollte, hat Gott ihn fallen lassen.«
»Du meinst, der Scheitan hat da oben bei Gott Scheiß gebaut und dann hat der ihn rausgeschmissen?
»So ungefähr.«
»Wow. Mit Gott ist nicht gut Kirschen essen.«
»Und jetzt ist er ein böser Engel und geht hier auf Erden umher wie ein brüllender Löwe auf der Suche nach Leuten, die er verschlingen kann. Das heißt, er benutzt seine Macht und seine Dämonen-Legionen, um Menschen dazu zu bringen, dass sie werden wie er. In einer Zigeunerlegende sind es sogar zwölf Teufel, die aus dem Himmel auf die Erde geschleudert wurden, weil sie es gewagt hatten, Gott herauszufordern. Aber auf dem Weg zur Erde sind sie in den dürren Zweigen von Bäumen hängen geblieben und aus eigener Kraft können sie sich nicht mehr befreien. Sie müssen deshalb warten, bis eine Menschenseele vorbeikommt, die auf dem Weg zum Himmel ist. Und die müssen sie dann überreden, dass sie sie mit nach oben nimmt. Aber nachdem die Menschenseele ihnen geholfen und sie aus dem Baum befreit hat, hält der Teufel sie weiter fest und lässt sie nie wieder los. Er kann dann mit ihr machen, was er will. Und die Seele muss dem Teufel dienen bis in alle Ewigkeit.«
»Harte Nummer.«
»Ich glaube aber, das sind in Wahrheit keine Teufel, das sind Dämonen. In der Bibel ist jedenfalls nur von einem Teufel die Rede.«
»Klar, das andere sind die Djinns. Aus der Wüste.«
»Was ich eigentlich versuche zu sagen, Fredo, ist ... Manchmal kommst du mir auch so vor wie ...«
»Wie ein Engel? Oder wie eine arme Seele? Bin ich, Goldstück, bin ich. Bin ganz arm dran, wenn du ein Mal nicht ...«
»Wie ein Engel, der mit seinem Dämon kämpft«, würgte sie ihn ab. »Du kannst ein Engel sein, Fredo, das weiß ich. Aber ich glaube, es gibt da auch einen Dämon. Und ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Aber wenn man ihn nicht kennt, ist das gefährlich, weil man ihn dann nicht besiegen kann.«
»Das wird mir jetzt alles zu ernst hier.«
»Ja, typisch! Bloß nicht über was Ernstes reden.«
»Weißt du was, Goldstück?«, begann Fredo nach minutenlangem Schweigen neu. »Ich kenn' mein' Dämon. Das ist ganz klar, Baby: Du bist mein Dämon! Mein großes Problem ist, dass ich viel zu verliebt in dich bin und kaum noch einen Schritt ohne dich machen kann. Und wenn ich dich drei Stunden nicht gesehen habe, dann habe ich sie auch, diese... diese Depressionen, klar! Aber dann ist da noch anderer Dämon in mir, der knurrt immer – unheimlich manchmal, sag ich dir. Da! Hast du gehört?« Fredo wies mit der freien Hand dezent auf seinen Magen.
»Ach, du nimmst mich nicht ernst, Fredo. Immer musst du alles ins Lächerliche ziehen.«
»Nee, ganz im Ernst, Goldstück, da drin ist Dämon, der knurrt wie verrückt. Aber Fredo weiß, wie man mit solchen Biestern fertig wird. Dem werd’ ich’s zeigen! Einverstanden?«
»Womit?«
»Knurrenden Dämon austreiben. In der Pizzeria del Angelo. Müssen wir nicht mal bezahlen. Mein Alter liebt die Pizzas dort, deswegen hat er den Laden gekauft.«
»Aber ich habe meinen Eltern versprochen, dass ich heute Mittag bei ihnen esse. Seit ich bei ihnen ausgezogen bin, sehen wir uns nur noch einmal die Woche.«
»Luisa, du bist gute Christin, ja?«
»Hm.« Luisa zog die Lippen schmal und zuckte mit den Achseln. »Ich versuch’s.«
»Ich frage dich: Kann gute Christin zusehen, wie jemand von knurrendem Dämon belästigt wird, obwohl es ganz leicht wäre, das Vieh loszuwerden? Das müssen deine Eltern doch verstehen, das ist Christenpflicht, da helfen!«
Fredo musste an einer Ampel halten. Er beugte sich zum Beifahrersitz hinüber, legte seine Hand in Luisas Nacken und holte den Kuss nach, den sie ihm vor der Kirche verweigert hatte. Es wurde ein langer Kuss, an dessen Ende er in der bekannten Intonation erneut zu bekennen hatte: »Uuuuh, Baby, I love your way!«
2
Seine Frau hatte soeben aufgelegt. »Sie kommt nicht«, sagte sie mit leicht brüchiger Stimme. »Isst mit Fredo.«
Der alte Müller schlug mit der flachen Hand auf den frisch für drei Personen gedeckten Küchentisch, dass es knallte und das Geschirr nebst Besteck aufgeregt schepperte. »Meine Tochter, eine Mafiabraut!«, schimpfte der alte Müller. »Ich glaub', ich geh am Stock! Heute trifft sie den Kerl schon wieder!«
»Mafiabraut! Dass du immer gleich übertreiben musst! Man muss den Dingen ihren Lauf lassen. Die Liebe ist eine Himmelsmacht!«
»Ich würde vielmehr sagen: Die Liebe bedeutet ewige Nacht, wenn sie sich mit diesem Kerl einlässt.«
Seit dreiundzwanzig Jahren war Elisabeth Müller, geborene Greilich, mit Berthold Müller verheiratet. Sie kannte seine Launen und seine Entschlossenheit. Es war eine Entschlossenheit, die zum Problem werden konnte, wenn sie zum Starrsinn ausartete. Waren Entschlossenheit und Starrsinn nicht im Grunde sowieso dieselbe Sache, nur aus unterschiedlichen Blickwinkeln beäugt? »Wir müssen uns da raushalten, Berthold«, sagte sie um einen gemäßigten Ton bemüht und wandte sich wieder dem Herd zu, wo die Soße für den Sonntagsbraten vor sich hin köchelte. »Mit dem Herrn Aksam muss man sich gut stellen. Das ist ein Mann von Einfluss. Und Mafia, so was haben wir hier in Hamburg doch gar nicht!«
»Hast du 'ne Ahnung! Das pfeifen doch längst die Spatzen von den Dächern, dass dieser so genannte Reiseunternehmer seine Finger in allen möglichen schmutzigen Geschäften mit drin hat.«
»Wer Geld hat, hat auch viele Neider!«
»Man muss sich doch nur anschauen, wie der damals die halbe Belegschaft von Pigeon hat über die Klinge springen lassen. Spielt sich erst als der große Retter auf und betätigt sich wenig später als Leichenfledderer. Und zwischendurch hat er fleißig Geld vom Staat eingesackt. Das sind Mafia-Methoden und nichts anderes.« Berthold Müller erhob sich von seinem Küchenstuhl und begab sich schwerfällig an den Herd, wo seine Frau stand und im Kochtopf rührte. Er strich ihr über den Rücken und sagte etwas ruhiger: »Ich bin auch selber schuld. Ich hätte sie mir mal vor die Brust nehmen sollen, als sie diesen Fredo das erste Mal erwähnt hat, hätte mal genauer nachfragen sollen. Fredo? Was ist das denn für ein merkwürdiger Name? Ein Ausländer kommt mir sowieso nicht in die Tüte. Moslem dazu noch! Diese Türkischstämmigen, das sind doch alles Moslems. Geht jeden Sonntag in die Kirche, dass man sich selbst fast wie'n alter Heide vorkommt und kommt mit'm Moslem an.« Er schlug sich mit der Faust auf die Stirn und wandte sich ab. »Gott bewahre!« Was unausgesprochen blieb, war noch ein ganz anderes Unbehagen, das Berthold beschlich, wenn er an seine Tochter dachte: das Unbehagen darüber, dass er aus ihrem Leben herauswuchs, dass sie ihm entglitt und dass er nicht mehr diese durch nichts zu ersetzende Rolle in ihrem Leben spielte. Und das hatte gar nicht in erster Linie mit Fredo Aksam zu tun. Luisa war nach dem Auslandsjahr auf einem Konservatorium in England, das ihr musikalisches Talent fördern sollte, nicht in die elterliche Villa im provinziellen Hasloh zurückgekehrt, sondern in eine Ein-Zimmer-Wohnung in der Nähe des Eppendorfer Baums gezogen. Vordergründig war das mit dem kürzeren Schulweg erklärt worden: Luisa hatte sich für die Oberstufe des Johanneums entschieden, eines Hamburger Elite-Gymnasiums mit Schwerpunkt in der Förderung musisch begabter Kinder. Aber war das die ganze Wahrheit? Hatte das Auslandsjahr nicht vielmehr einen Ablösungsprozess beschleunigt, der nach Bertholds Geschmack viel zu früh eingesetzt hatte?
»Aber schreiben kann er, der Fredo. Ich hab' ihr neulich heimlich über die Schulter geschaut, als er eine von seinen romantischen E-Mails geschickt hat.«
»Süßholzraspeln, das können sie, diese Südländer.«
»Er ist aber doch wohl in Deutschland geboren. Sonst könnt' er ja nicht so gut schreiben.«
»Auf welchem Stern lebst du, Lieschen? So was kopieren die doch heute alles aus diesem Internetz.«
»Immerhin eines muss man Fredo lassen. Er ist 'ne gute Partie – mit dem Vater!«
»Du bist wohl von allen guten Geistern verlassen! Dir scheint das gerade recht zu sein, unsere einzige Tochter mit so einem ... einem Türken-Mafioso zu verkuppeln! Eher wird fünf 'ne gerade Zahl, als dass ich auch nur einen Cent von diesem Billigflug-Hausierer anrühre.«
Ein Klingeln an der Haustür ließ den alten Müller innehalten. Die Eheleute sahen sich fragend an. »Na? Wer kann das denn sein?«
Der Mann, dem Elisabeth Müller die Tür ihres noblen Hasloher Eigenheims aufmachte, hatte etwas Finsteres an sich, etwas Finsteres und Kühles. Er trug einen silbrig glitzernden Anzug und silbrig glänzte im Sonnenlicht auch sein auffallend stark gegeltes schwarzes Haupthaar, in dessen Ansatz sich eine Ray-Ban verfangen hatte. »Guten Tag, mein Name ist Vermino, Alessandro Vermino.«
»Ja, womit...?«
»Sie erlauben, gnädige Frau, dass ich mich kurz vorstelle. Darf ich ...?«
»Bitte. Kommen Sie herein.«
»Es geht um Luisa.« Vermino sagte das in einem Tonfall, dass Elisabeth sofort an etwas Schlimmes denken musste. Sie erblasste leicht.
»Nichts Schlimmes, keine Sorge. Ich...«
Elisabeth hatte sich gefasst. »Mein Mann ist in der Küche. Moment...«
Sie geleitete den Fremden ins Wohnzimmer und ließ ihn auf einem der teuren Veloursledersessel Platz nehmen.. »Was darf ich Ihnen zu trinken ...?«
»Oh, bitte keine Umstände«, lächelte Vermino. »Wenn Sie ein Glas Mineralwasser hätten, das wäre vollauf genügend.«
Sie ließ Vermino allein zurück und war ganz froh in die Küche zurückkehren zu können. »Ein Vermino«, erklärte sie ihrem Mann, der gespannt wie ein Flitzbogen an der Tür lauerte. »Kennst du einen Vermino?«
»Kruzitürken! Noch so'n Ausländer! Was will er denn?«
»Wegen Luisa. Ich hab' da kein gutes Gefühl, Berthold. Rede du mal mit dem.«
Gemeinsam kehrten sie ins Wohnzimmer zurück, wo Vermino es sich sichtlich bequem gemacht hatte. Ein Bein übers andere geschlagen saß er mit dem Glas in der Hand auf dem edlen Sitzmöbel. Berthold Müller war kein Mann von Höflichkeiten, die Zeit verschlangen, die er nie zu haben vermeinte, und sagte: »Herr Vermino, was verschafft uns die Ehre dieses so unverhofften Besuchs zur Mittagszeit?«
»Oh, ich hoffe, nicht ungelegen zu kommen. Aber wenn es um die eigene Tochter geht, ich meine, um Ihre eigene Tochter, dann denke ich doch, dass es gar nicht ...«
»Luisa? Was ist mir ihr?«
»Ich weiß nicht, ob Sie es schon bemerkt haben, aber ihr hübsches Töchterlein ist in den falschen Mann – nun, nennen wir es mal: verschossen.«
Bertholds Züge entspannten sich. Sollte sich hier ein unverhoffter Verbündeter eingefunden haben? »Doch, ist mir schon aufgefallen.«
»Ich muss ein wenig weiter ausholen. Ich bin Geschäftsführer von Aksam-Tours. Das sagt Ihnen etwas? Ich darf annehmen, dass dieser Firmenname, der für Erfolg und Wachstum steht, Ihnen nicht gänzlich unbekannt ist.«
»Das Hamburger Touristikunternehmen, dessen Oberhaupt ein gewisser Herr Erol Aksam ist, der Vater von Fredo Aksam. Und Fredo Aksam ist der Freund meiner Tochter.«
»Ein Freund, der – so ist zu hören – Ihren Vorstellungen nicht so ganz entspricht.«
»Die Frage ist nur«, knurrte Berthold, »was Sie das Ganze angeht.«
»Nun, auf den ersten Blick ganz sicher nichts. Aber lassen Sie mich zunächst mal klarstellen, dass ich die Verbindung zwischen Ihrer Tochter und Herrn Fredo Aksam ebenfalls für eine ... sagen wir mal in bestem Hamburger Patrizierdeutsch: Mésalliance halte. Und nicht nur ich. Der von Ihnen schon passenderweise erwähnte Herr Aksam, Erol Aksam, ist derselben Meinung.«
»Und – nun, wir haben gewisse Möglichkeiten, die Verbindung zwischen Fredo und Ihrem Fräulein Töchterchen zu unterbinden. Ich muss da etwas weiter ausholen:Wie Sie wissen oder zumindest erahnen, ist Herr Erol Aksam ein ziemlich einflussreicher Mensch und sein Einfluss macht vor den Entscheidungen in Betreff seines Sohnes schlechterdings nicht halt.«
»Hört, hört!«
»Alles, was ich von Ihnen erwarte, lieber Herr Müller und liebe gnädige Frau Müller, ist ein gewisses Maß an Kooperation.«
Berthold Müller runzelte die Stirn und rieb sich die linke Schläfe. »Kooperation?«
»Nun, ich muss da etwas weiter ausholen.«
»Schon wieder.«
»Ganz recht. Auch mir persönlich ist Ihr wertes Fräulein Töchterchen nicht fremd. Wie sie vielleicht wissen, hat Fredo vor ein paar Wochen seinen siebenundzwanzigsten Geburtstag gefeiert.«
»So alt ist der Kerl schon, Lieschen!«
»In kleinem Kreise, dafür in umso eindrucksvollerer Umgebung.«
»Ja, im Metropol, das hat sie uns dann schon verraten.«
»Zu dem kleinen Kreise gehörte auch ich. Schließlich bin ich mit Fredo seit seiner Kindheit, nun, wenn nicht befreundet, so doch zumindest bestens bekannt. Ich gehörte gewissermaßen schon immer zur Familie.«
»Wie kommt das? Sie hören sich eher italienisch an.«
»In dem Einwanderermilieu, zu dem die Familie Aksam dereinst vor vielen Jahren, Jahrzehnten gehörte, wie auch meine Familie, da musste man zusammenhalten. Herr Aksam hat meinem Vater manches zu verdanken, was hier im Detail auszubreiten mir jetzt nicht angezeigt erscheint, aber – um es kurz zu machen: Es war ein wunderbares Fest.«
»Meine Tochter hat doch nicht getrunken?«, warf Elisabeth mit einem Anflug von Empörung ein.
»Da dürfen Sie unbesorgt sein. Luisa ist ... Sie ist ein Wesen von besonderer Reinheit und Zartheit. Und genau deswegen kann auch ich nicht umhin zu gestehen, dass sie auch auf mich einen gewissen Eindruck gemacht hat.«
»Sie erzählen mir jetzt hier gerade, dass Sie in meine Tochter verliebt sind?«, unterbrach Berthold seinen merkwürdigen Gast, der daraufhin andächtig nickte und erwiderte: »Ja, so profan es klingt, man muss es wohl so nennen. Und der Wunsch, der hier zu äußern wäre...« Gebannt hingen die Eheleute an Verminos Lippen. Dem Italiener schienen überraschend die Worte ausgegangen zu sein. »Der Wunsch also wäre – und ich darf sagen, dass ich mir an diesem Punkt der vollen Unterstützung von Herrn Erol Aksam gewiss sein kann –, dass auch Sie eine Verbindung Ihrer Tochter mit mir gewissermaßen ... unterstützen.«
Berthold erhob sich, wandte sich ab und rang die Hände. Mit zur Zimmerdecke gerichteten Augen sagte er: »Ja, sind wir denn jetzt hier bei Emilia Galotti, oder was? Das ist doch hier kein bürgerliches Trauerspiel!«
»Könnte aber eins werden!«, sagte Vermino, der seine spitze Zunge wiedergefunden zu haben schien, mit einem hintergründigen Lächeln.
»Wir leben in einer europäischen Großstadt des 21. Jahrhunderts. Da werden zwischenmenschliche Beziehungen nicht mehr ausgekungelt wie im Mittelalter! Ich verordne doch meiner Tochter nicht den Freund.« Elisabeth warf ihrem Mann einen spöttischen Seitenblick zu.
»Es geht hier um keine Verordnung«, sagte Vermino, »das überlassen wir der Stadtverwaltung. Es geht darum, dass Sie Ihrer Tochter gegenüber zum Ausdruck bringen, was Sie gutheißen können und was nicht. Ein väterlicher Rat vermag bei der Tochter viel, wie Schiller zu sagen pflegte.«
»Also, ein Türke kommt nicht in die Tüte, aber 'n Italiener ist o.k. Da treibe ich ja den Teufel mit dem Beelzebub aus.«
»Sollte ich das jetzt als eine ausländerfeindliche Bemerkung auffassen?«
»Das können Sie halten wie'n Dachdecker. Fakt ist: Über meine Tochter wird nicht verhandelt wie über die Kerosinpreise bei Aksam-Tours!«
»Außerdem«, wagte sich nun auch Elisabeth aus der Reserve, »ist das ist ja jetzt auch kein Fortschritt: Wenn wir den Sohn haben können, dann... dann... dann nehmen wir doch nicht den Untergebenen!«
»Unterschätzen Sie bitte nicht meine Position«, gab Vermino mit einem Anflug von Gekränktheit zurück. »Außerdem habe ich einen deutschen Pass und bin daher von Rechts wegen zu hundert Prozent deutscher Staatsbürger.«
»Ja, daran sieht man mal, wo die Sozis uns hingebracht haben mit ihrer Integrationspolitik. Und jetzt, lieber Herr Vermino, hören Sie mal genau zu, denn mehr gibt es heute zu dem Thema nicht von mir. Erstens: Ein Liebhaber, der bei den Eltern der Umschwärmten angekrochen kommt, damit er bei ihr landen kann, ist für mich eine taube Nuss! Umgekehrt wird ein Schuh draus: Wir Eltern sollten erst mal von nichts 'ne Ahnung haben und die beiden Verliebten heimlich unter einer Decke stecken.«
»Unter einer Decke?«, wiederholte Vermino ungläubig.
»Ja, jetzt nicht wörtlich zu verstehen natürlich. Ich meine: Das Kind sollte eher Vater und Mutter zum Teufel wünschen, als sich von ihrem Liebsten trennen zu lassen, oder sich ihnen vor die Füße werfen, damit sie ihren Widerstand aufgeben. Das ist Liebe! Entweder ein Mann macht was her, dann sollte er sich schämen, sich auf so altmodische Wege des Liebeswerbens zu begeben, oder er hat keinen Mumm und ist ein Hasenfuß. Und für so einen ist meine Luisa schlicht und ergreifend zu schade. Und deswegen – nehmen Sie's nicht persönlich, Herr Geschäftsführer von Aksam-Tours – kann ich meiner Tochter zu vielem raten, aber zu Ihnen ganz bestimmt nicht.«
»Unsere Tochter hat was Besseres verdient!«, fügte Elisabeth hinzu.
Vermino war stark erblasst, seine Wangen wirkten hohl, als er sich erhob, zur Tür wandte, dort noch einmal umdrehte und sich mit den Worten: »Empfehle mich, Herr Müller – Frau Müller!« verabschiedete.
»Ich glaube kaum, dass es da noch was zu empfehlen gibt«, warf der alte Müller ihm nach.
Als der geckenhafte Gast schon lange aus dem Haus war, hatte er sich immer noch nicht beruhigt und wetterte: »Was für'n Lackaffe!«
Seine Frau pflichtete ihm bei: »Der Gaul wär' geschenkt noch zu teuer!«
3
»Goldstück«, sagte Fredo und griff über den Tisch nach ihrer Hand, um sie in die seine zu nehmen, »du bist heute irgendwie abwesend. Welche Laus ist dir über Leber gelaufen?« Sie werkelte mit dem Messer an ihrem letzten Stück Pizza herum, als wäre es ein ungebratenes Stück Steak und blickte nicht auf. »Luisa? Bist du noch bei mir?«
»Natürlich, Fredo, ich sitze doch hier vor dir!«
»Das mein' ich nicht, Goldstück, und das weißt du auch ganz genau. Du weißt, ich liebe dich, du bist mein ein und alles. Ich schwör's dir, ja?« Sie nickte wie abwesend. »Und du?«
»Ja?«
»Bist du noch die meine?«
Sehr leise, fast verzagt brachte sie hervor: »Ich liebe dich, Fredo.«
»Rede mir Wahrheit, Goldstück. Etwas stimmt nicht. Du weißt, du bist durchsichtig für mich wie geschliffener Diamant in Mittagssonne. Komm.« Er drückte ihre Hand. »Sag's mir. Was ist los? Was liegt wie eine Tonne Altmüll auf deiner Seele? Immer noch dieser verschissene anonyme Brief?«


















![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)










