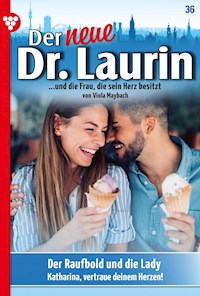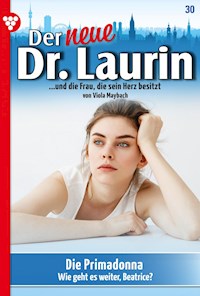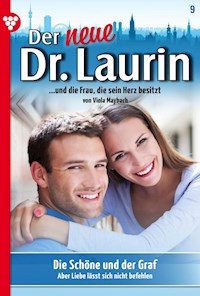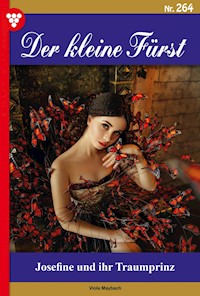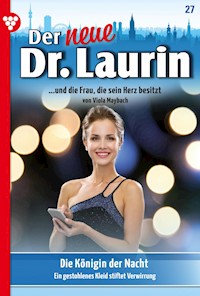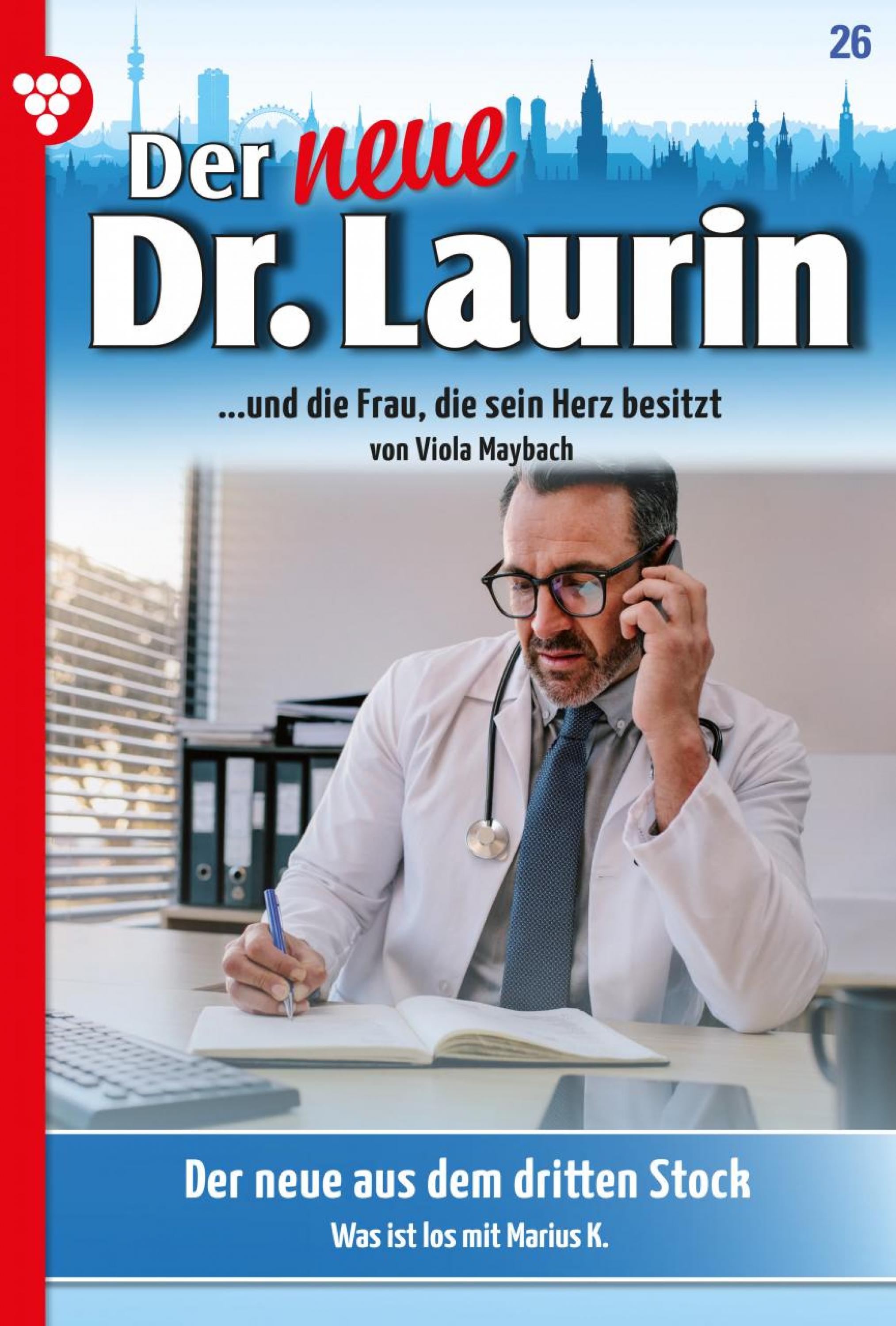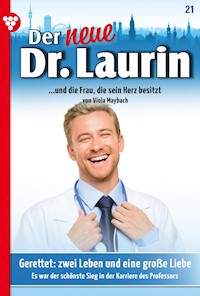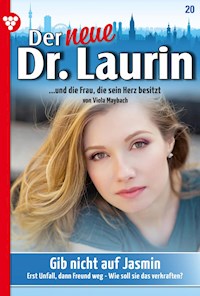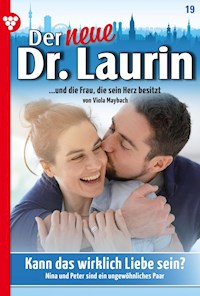Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Der kleine Fürst
- Sprache: Deutsch
Viola Maybach hat sich mit der reizvollen Serie "Der kleine Fürst" in die Herzen der Leserinnen und Leser geschrieben. Alles beginnt mit einem Schicksalsschlag: Das Fürstenpaar Leopold und Elisabeth von Sternberg kommt bei einem Hubschrauberunglück ums Leben. Ihr einziger Sohn, der 15jährige Christian von Sternberg, den jeder seit frühesten Kinderzeiten "Der kleine Fürst" nennt, wird mit Erreichen der Volljährigkeit die fürstlichen Geschicke übernehmen müssen. "Der kleine Fürst" ist vom heutigen Romanmarkt nicht mehr wegzudenken. »Da ist kein Fenster, Chris«, sagte Stephanie von Hohenbrunn enttäuscht. Wie lange kratzten sie jetzt schon mit den Glasscherben an der Wand, die sie voneinander trennte – dort, wo es beim Klopfen hohl geklungen hatte? Sie wusste es nicht, ihr war das Zeitgefühl abhanden gekommen, seit sie sich in diesem Gefängnis befand. Das Licht war dämmerig, ob früher Tag oder später Nachmittag. Nur in der Nacht wurde es richtig dunkel, sonst herrschte hier dieses seltsame Zwielicht, dem man keine Tageszeit zuordnen konnte. Nicht einmal das Wetter war zu erahnen, denn kein Sonnenstrahl verirrte sich durch die blinden Fenster der verlassenen Fabrikhalle – und schon gar nicht in diese engen kleinen Büros, die man an einer Schmalseite in die Halle eingepasst hatte. »Wir machen eine Pause«, erwiderte Christian von Sternberg, der kleine Fürst. »Mein Arm ist schon ganz lahm.« »Ich habe nur noch so wenig Wasser«, sagte sie. »Wenn ich nur wüsste, warum niemand kommt, um nach uns zu sehen! Die müssen doch wissen, dass wir mit einem Müsliriegel und einer Flasche Wasser nicht lange auskommen können, aber das scheint ihnen gleichgültig zu sein.« Christian ließ sich Zeit mit seiner Antwort. Endlich sagte er: »Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen.« »Dass sie nicht kommen?«, fragte sie ungläubig. »Was soll daran gut sein?« »Ich schätze, sie können nicht, weil die Polizei nach uns sucht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 114
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der kleine Fürst – 255 –Stephanies tapferer Beschützer
Viola Maybach
»Da ist kein Fenster, Chris«, sagte Stephanie von Hohenbrunn enttäuscht.
Wie lange kratzten sie jetzt schon mit den Glasscherben an der Wand, die sie voneinander trennte – dort, wo es beim Klopfen hohl geklungen hatte? Sie wusste es nicht, ihr war das Zeitgefühl abhanden gekommen, seit sie sich in diesem Gefängnis befand. Das Licht war dämmerig, ob früher Tag oder später Nachmittag. Nur in der Nacht wurde es richtig dunkel, sonst herrschte hier dieses seltsame Zwielicht, dem man keine Tageszeit zuordnen konnte. Nicht einmal das Wetter war zu erahnen, denn kein Sonnenstrahl verirrte sich durch die blinden Fenster der verlassenen Fabrikhalle – und schon gar nicht in diese engen kleinen Büros, die man an einer Schmalseite in die Halle eingepasst hatte.
»Wir machen eine Pause«, erwiderte Christian von Sternberg, der kleine Fürst. »Mein Arm ist schon ganz lahm.«
»Ich habe nur noch so wenig Wasser«, sagte sie. »Wenn ich nur wüsste, warum niemand kommt, um nach uns zu sehen! Die müssen doch wissen, dass wir mit einem Müsliriegel und einer Flasche Wasser nicht lange auskommen können, aber das scheint ihnen gleichgültig zu sein.«
Christian ließ sich Zeit mit seiner Antwort. Endlich sagte er: »Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen.«
»Dass sie nicht kommen?«, fragte sie ungläubig. »Was soll daran gut sein?«
»Ich schätze, sie können nicht, weil die Polizei nach uns sucht. Sie haben Angst, dabei beobachtet zu werden, wie sie in die Fabrik gehen.«
»Aber das ist doch nicht gut!« Stephanie hörte die Panik in ihrer Stimme, aber sie schaffte es nicht, sie zu unterdrücken. »Wenn die Polizei uns nämlich nicht findet, dann sitzen wir hier ohne Essen und Wasser!« Sie versuchte, sich zu beruhigen, vergeblich. Tränen liefen ihr über die Wangen, sie konnte sie nicht zurückhalten. Wenigstens sah Christian die Tränen nicht.
»Wir finden entweder einen Weg hier heraus«, hörte sie ihn sagen, so ruhig, als sei er nicht in der gleichen verzweifelten Lage wie sie, »oder sie sagen der Polizei, wo wir sind. Das machen sie spätestens, wenn sie das Lösegeld kassiert haben, weil sie nämlich bestimmt nicht wollen, dass wir in Lebensgefahr geraten. Oder, und das ist die dritte Möglichkeit: Wir werden vorher gefunden, weil entweder Anna und Konny eine Spur entdecken oder der Kriminalrat und sein Team. Beruhige dich, Steffi. Wir dürfen uns nicht selbst verrückt machen, wir brauchen unsere Kräfte für Wichtigeres.«
Obwohl sie noch immer weinte, wäre sie beinahe in hysterisches Gelächter ausgebrochen. Sie fand ihre Lage so aussichtslos, und er redete davon, dass sie sich vielleicht selbst befreien könnten? Wie sollte das gehen?
Aber trotz ihrer Zweifel verfehlten seine Worte ihre Wirkung nicht. Sie spürte, wie sie allmählich ruhiger wurde. Die Tränen versiegten, ihr Atem ging wieder regelmäßig. Nun schämte sie sich beinahe dafür, so die Fassung verloren zu haben. »Tut mir leid, Chris«, sagte sie. »Es war eine Panikattacke.«
»Die hatte ich auch schon. Das ist in unserer Situation ja auch kein Wunder. Wenn es dir wieder besser geht, sollen wir dann weitermachen?«
Sie glaubte nicht mehr an einen Erfolg ihrer Aktion, aber das Kratzen an der Wand vertrieb immerhin die Zeit. Alles war besser, als nur auf dem Boden zu sitzen und sich die schrecklichen Dinge auszumalen, die ihnen möglicherweise drohten.
»In Ordnung«, sagte sie. »Aber vorher beiße ich noch einmal von meinem Müsliriegel ab.«
»Gut, ich mache das auch. Und dann zwei Schlucke Wasser.«
Am liebsten hätte sie den ganzen Rest des Müsliriegels verschlungen und die Wasserflasche geleert, doch sie bezähmte sich.
»Fertig«, sagte sie. »Lass uns weiter kratzen.«
Sie hatte schon ziemlich viel von der alten, vergilbten Tapete abgekratzt, doch darunter war nichts zum Vorschein gekommen, das auf einen Hohlraum hingedeutet hätte. Auch Christian war nicht erfolgreicher gewesen. Doch kaum hatten sie die Arbeit wieder aufgenommen, als er aufgeregt rief: »Hier ist etwas, Steffi! Hier, wo ich klopfe. Das fühlt sich wie Holz an. Oder wie eine Spanplatte. Hör mal!«
Sie war ein ganzes Stück von der Stelle, an der sie ihn klopfen hörte, entfernt. Eilig bewegte sie sich dorthin, wo sie ihn vermutete und machte sich an die Arbeit. Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten: Sie stieß auf eine Fuge von mehreren Millimetern, die sie sofort mit ihrer Glasscherbe aufschlitzte. Als sie ihre Fingerspitzen über die Fuge gleiten ließ, spürte sie deutlich den Unterschied zwischen den beiden Materialien, die dort aufeinandertrafen.
Sie klopfte fest dagegen. »Hier ist etwas eingesetzt worden, Chris, ich kann das fühlen.«
»Ein richtiger Spalt ist da!«, rief er. »Wenn wir mit einer Glasscherbe dem Verlauf dieses Spalts folgen, wissen wir bald, wie groß die Öffnung war, die hier verschlossen wurde.«
Es dauerte nicht lange, bis sie das herausgefunden hatten: Die verschlossene Öffnung war vermutlich ein recht großes Fenster zwischen den beiden Räumen gewesen, das man irgendwann, aus welchen Gründen auch immer, verschlossen hatte. Christian hatte im Stillen auf eine Tür gehofft, aber diese Hoffnung erfüllte sich nicht.
»Vielleicht wollten die Leute nicht ständig von nebenan beobachtet werden«, sagte er. »Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wie wir das, was sie vor das Fenster gesetzt haben, entfernen können. Ich glaube, es ist eine Spanplatte.«
»Die haben sie bestimmt angenagelt, meinst du nicht?«
»Ja, wahrscheinlich. Aber alte Spanplatten halten nicht ewig, besonders nicht, wenn sie öfter feucht geworden sind. Die quellen auf und werden weich. Holz wäre schwieriger. Ich versuche, die Tapete abzukriegen, damit ich besser sehen kann, was sie gemacht haben.«
»Das mache ich auch«, sagte Stephanie.
Neue Hoffnung erfüllte sie. Sie waren schon fast vierundzwanzig Stunden hier eingesperrt, aber noch war nicht alles verloren.
*
Frieda Eckert saß noch immer wie festgewachsen vor dem Fernseher, ohne überhaupt zu bemerken, welches Programm gerade lief. Sie war erst zehn, aber normalerweise funktionierte ihr Verstand hervorragend. Sie wusste, was sie gehört hatte, nur konnte sie es noch immer nicht glauben, weil ihr Verstand ihr sagte, dass sie sich geirrt haben, dass sie etwas falsch verstanden haben musste. Es war doch unmöglich, dass ihr großer Bruder Marco Stephanie von Hohenbrunn entführt hatte – und vielleicht auch den kleinen Fürsten?! Ausgerechnet diese beiden, die Frieda bei der Verleihung des Musikpreises kennengelernt und bei der Gelegenheit ins Herz geschlossen hatte?
Es konnte nicht sein. Nur hatte sie ihn deutlich sagen hören, als er mit Lola telefoniert hatte, er werde die beiden frei lassen. Ihre Namen allerdings hatte er nicht genannt. Nur ›die beiden‹ hatte er gesagt, aber wenn sie eins und eins zusammenzählte, konnten nur Stephanie und Christian damit gemeint sein, schließlich war die Stadt voller Polizei, das musste ja Gründe haben. Und Frau Kabusch, ihre ehemalige Klavierlehrerin, hatte schließlich, wenn auch indirekt, bestätigt, dass der Polizeieinsatz mit Stephanie zu tun hatte.
Marco hatte außerdem noch mehr gesagt: ›Willst du die Polizei anrufen? Da kannst du dich auch gleich selbst stellen.‹ Ja, genau so hatte er es gesagt und auch, dass er später selbst irgendwohin fahren wolle, um die beiden frei zu lassen. Später, sobald es draußen dunkel war. Bis dahin würde noch einige Zeit vergehen, es war ja Sommer, da wurde es erst spät dunkel, und jetzt war erst Nachmittag.
Sie hatte seine Worte gehört, es gab keinen Zweifel. Nur hatte er vielleicht doch von etwas ganz anderem geredet? Frieda wusste schließlich ziemlich gut, was Missverständnisse waren, und sie wusste auch, wie schnell sie entstehen konnten, wenn man etwas, das man beobachtete oder zufällig hörte, falsch interpretierte. Es wäre also mit Sicherheit falsch gewesen, überstürzt zu handeln. Sie musste erst einmal nachdenken, in aller Ruhe. Das freilich war in diesem sehr komplizierten Fall nicht so einfach, auch wenn ihr noch etliche Stunden Zeit blieben.
Sie zwang sich zur Ruhe und ging die Geschichte noch einmal der Reihe nach durch: In der Stadt war überall Polizei, Autofahrer wurden kontrolliert, Ausfallstraßen waren gesperrt, aber über die Gründe dafür gab es bislang nur Gerüchte. Viele glaubten an einen terroristischen Anschlag, was Frieda nicht tat. Mittlerweile wurde allerdings auch über eine Entführung von Stephanie und Christian gemunkelt. Niemand wusste, wo diese Gerüchte ihren Ausgang genommen hatten.
Frieda war, um der Sache nachzugehen, bei Mona Kabusch gewesen, Stephanies Klavierlehrerin, bei der auch sie selbst früher Unterricht gehabt hatte, um diese ein wenig auszuhorchen, denn Frau Kabusch, das hatte sich herumgesprochen, war von der Polizei verhört worden. Frieda hatte ihrer ehemaligen Lehrerin ein paar gezielte Fragen gestellt, die ihr zwar nicht beantwortet worden waren, aber Frau Kabuschs Reaktion war in Friedas Augen eindeutig gewesen: Sie war erschrocken und abwechselnd blass und rot geworden, als Frieda ihre Überlegungen dargelegt hatte. Einiges sprach also dafür, dass Stephanie etwas zugestoßen war – vielleicht war das Gerücht über die Entführung richtig.
Was Frieda noch immer wie erstarrt auf dem Sofa sitzen bleiben ließ, war die Tatsache, dass sie eigentlich mit Marco über diese Sache hatte reden wollen. Auf dem Heimweg hatte sie darüber nachgedacht, wem sie ihre Überlegungen anvertrauen könnte. Ihre Mama wäre eigentlich erste Wahl gewesen, doch die musste an diesem Abend lange arbeiten. Bernd, Mamas neuer Freund, ebenso. Auch mit Bernd hätte sie vielleicht darüber reden können, aber auch er war noch in seiner Werkstatt, und zu Friedas Schwächen gehörte ihre Ungeduld. Da Marco kurz nach ihr nach Hause gekommen war, hatte sie beschlossen, mit ihm zu reden. Er war zwar immer noch nicht wieder der liebe und bewunderte große Bruder, der er früher einmal gewesen war, aber seit einiger Zeit war er wieder viel zugänglicher und auch freundlicher geworden.
Und dann hatte Lola angerufen, und sie hatte Marcos Gespräch mit ihr belauscht. Wenn er vielleicht selbst mit der Sache zu tun hatte, kam es natürlich nicht mehr in Frage, dass sie ihn ins Vertrauen zog.
Aber wieso hätte er Stephanie – und vielleicht den kleinen Fürsten – entführen sollen? Das war der Punkt, der ihr überhaupt nicht einleuchtete. Marco hatte keinen Grund, so etwas zu tun. Und wieso wusste Lola davon? Hatten sie es zusammen gemacht? Oder sogar mit den beiden anderen, mit Alina und David? Die vier waren ja eine richtige Clique, sie trafen sich dauernd, verbrachten viel Zeit miteinander.
Je länger Frieda darüber nachdachte, desto klarer wurde ihr, dass sie sich auf jeden Fall einem Erwachsenen anvertrauen musste. Einem klugen Erwachsenen, der wissen würde, was zu tun war. Ihre Mama schied aus. Nicht, weil sie nicht klug gewesen wäre, sondern weil allein die Vorstellung, dass Marco etwas Schreckliches getan haben könnte, sie unglücklich machen würde. Gerade jetzt, wo sie Bernd gefunden hatte! Das wollte Frieda auf keinen Fall. Außerdem war nicht auszuschließen, dass Bernd vielleicht nichts mehr mit ihnen zu tun haben wollte, wenn er hörte, was Marco getan hatte. Falls er es getan hatte …
Friedas Gedanken fingen erneut an, sich im Kreis zu drehen. Hatte sie wirklich gehört, dass Marco gesagt hatte, er wolle die beiden frei lassen? Oder bildete sie sich das ein?
Sie sprang auf, schaltete den Fernsehapparat aus und ging in ihr winziges Zimmer, um aufzuschreiben, was sie gehört hatte, bevor es in all den Gedanken, die ihr jetzt im Kopf herumschwirrten, unterging.
Sie hatte sich gerade hingesetzt und wollte anfangen zu schreiben, als die Tür ihres Zimmers aufgerissen wurde. Erschrocken drehte sie sich um.
»Ach, hier bist du. Ich dachte, du siehst noch fern«, sagte Marco. »Ich muss noch mal kurz weg und Lola etwas vorbeibringen. Dauert nicht lange. Zum Essen bin ich zurück.«
Weg war er.
Frieda sprang auf und ging zum Fenster. Unten auf der Straße sah sie Marco, der sich auf Daniels Fahrrad schwang und eilig davonfuhr. Ein eigenes Rad hatte er nicht, dafür fehlte ihnen das Geld – wie auch für ein neues Auto, nachdem jemand ihr altes zu Schrott gefahren hatte.
Sie verstand nicht, wieso er jetzt schon losfuhr. Er hatte doch davon gesprochen, die beiden – um wen auch immer es sich dabei handelte – erst frei zu lassen, wenn es dunkel war! Was wollte er dann jetzt da draußen?
Sie widerstand der Versuchung, ihre Mutter anzurufen und ihr alles zu erzählen, sondern zwang sich zur Ruhe. Keine Panik, befahl sie sich, und tatsächlich wurde sie ruhiger.
Sie setzte sich wieder hin, um aufzuschreiben, was sie gehört hatte. Danach würde sie weiter nachdenken und überlegen, an wen sie sich wenden sollte.
*
Marco strampelte Richtung Stadtausgang. Er hatte beschlossen, schon jetzt einen Versuch zu starten, ob er unbehelligt bis zur alten Fabrik vordringen konnte. Je eher er die beiden befreite, desto besser. Vielleicht hatten sie sich ja einfach verrückt machen lassen durch die vielen Polizisten, die überall in der Stadt Autofahrer und Fußgänger kontrollierten? Vielleicht war es gar nicht so schlimm, und er erreichte die Fabrik ohne Probleme.
Es war jedoch eher noch schlimmer, als er es sich vorgestellt hatte. Zwar hielt ihn zunächst niemand an, aber es war unübersehbar, dass in jeder Straße Polizei unterwegs war. Er sah zahlreiche Kontrollen von Autos und ihren Fahrern, und ihm dämmerte, dass sicherlich auch viele Beamte in Zivil im Einsatz waren.
Obwohl ihm das Herz bis zum Hals schlug, fuhr er weiter, Richtung Stadtausgang. Schon bald radelte er an stehenden Autos vorbei. Der nachmittägliche Berufsverkehr hatte begonnen, und im Verein mit den vielen Kontrollen hatten sich überall lange Staus gebildet. Eine Weile fuhr er noch weiter, dann wurde es ihm zu viel, und er beschloss, umzukehren, zumal mehrere Straßen gesperrt waren und er große Umwege hätte fahren müssen, um die Stadt zu verlassen.
Wenn sie seine Personalien jetzt schon aufnahmen und ihn am Abend noch einmal kontrollierten, zogen sie vielleicht ihre Schlüsse, das wollte er nicht riskieren. Er wendete also und fuhr zurück, allerdings nicht auf direktem Weg. Wenn er schon unterwegs war, konnte er sich auch umsehen. Vielleicht machte er eine Beobachtung, die ihm für sein späteres Vorhaben nützlich sein konnte.