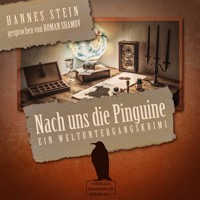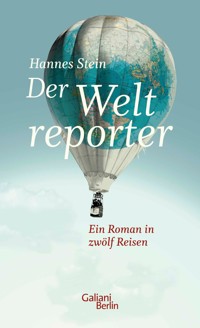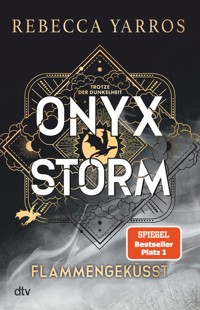8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Eine alternative Weltgeschichte voller Wiener Schmäh, Juden und Psychoanalytiker In Hannes Steins Roman Der Komet hat der Erste Weltkrieg nicht stattgefunden und Amerika ist ein Kontinent der Hinterwäldler. Es gibt keine Anglizismen, keine amerikanischen Erfindungen und keinen Krieg. Dafür ein Europa voller Juden, den Mond als deutsche Kolonie und Wien als Zentrum der Welt. »I bin doch ned deppat, i fohr wieder z'haus« lautet der Schlüsselsatz dieses Buches – denn damit fällt der Erste Weltkrieg aus. Gesprochen wird der Satz vom österreichischen Thronfolger am 28. Juni 1914 in Sarajewo, wo gerade jemand versucht hat, eine Bombe auf Franz Ferdinand zu werfen. Das hat natürlich Folgen: ohne Weltkriege keine Entkolonialisierung und keine Kollision mit dem Islam. Die europäischen Staaten versuchen ihre komplizierte Machtbalance zu erhalten – augusteischer Frieden herrscht auf der Welt. Vor allem: Das liebenswerte, etwas bräsige k.u.k.-Reich mit seiner Hauptstadt Wien ist und bleibt der Nabel der Welt. Hier, in dieser Stadt voller Juden, Psychoanalytiker und Wiener Schmäh, lässt Stein seinen jungen Protagonisten eine Liaison mit einer Gesellschaftsdame eingehen, deren Mann gerade auf dem Mond weilt. Doch die Nachrichten, die er von dort sendet, sind dramatisch: Ein Komet rast auf Kollisionskurs zur Erde und soll in wenigen Monaten dort einschlagen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 344
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Hannes Stein
Der Komet
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Hannes Stein
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Hannes Stein
Hannes Stein, geb. 1965 in München, aufgewachsen in Salzburg. Er ist Publizist. In Berlin schrieb er für die Frankfurter Allgemeine Zeitung, den Spiegel und Die Literarische Welt. Im Sommer 2007 ist er nach New York ausgewandert, wo er als Journalist und Autor lebt. Zuletzt erschien von ihm »Tschüss Deutschland. Aufzeichnungen eines Ausgewanderten«.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
»I bin doch ned deppat, i fohr wieder z’haus«, sagt der österreichische Thronfolger Franz Ferdinand am 28. Juni 1914 in Sarajewo, wo gerade jemand versucht hat, eine Bombe auf ihn zu werfen. Das hat natürlich Folgen: Der Erste Weltkrieg fällt aus! Amerika bleibt ein riesiges Land voller Cowboys, Goldgräber und Hinterwäldler, in Europa herrscht Frieden und Wien ist und bleibt der Nabel der Welt. Hier, in der Hauptstadt des Vielvölkerreichs, dieser Stadt voller Juden, Psychoanalytiker und Wiener Schmäh, lässt Hannes Stein seinen jungen Protagonisten Alexej eine Liaison mit einer Gesellschaftsdame eingehen, deren Mann sehr weit weg ist, aber beunruhigende Nachrichten schickt.
»Absurd und glaubhaft, skurril und irrwitzig, durchdacht und überraschend, herrlich und bizarr, höchstkomisch und tieftragisch, vollkommen unkonventionell: ein fabelhaftes Buch, das von einer fantastischen Welt handelt, in deren Schrägheit man sich sofort verliert.« (Vea Kaiser)
»Ein großartiger Roman!« (Denis Scheck)
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Motto
Hinweis
I. Die Liebeskatastrophe
II. Dudus Mondfahrt
III. Kummer und Geschichtslektionen
IV. Ein schwieriger Patient
V. Das Verhängnis
VI. Stelldichein
VII. Die drei Hofräte
VIII. Ecce homo
IX. Ein Brief aus Grusinien
X. Schwimmunterricht
XI. Die Rache der Fledermaus
XII. Es ist schade drum
Epilog. Austria Erit In Orbe Ultima
To Chanah
Glücklich ist, wer vergisst,
Was doch nicht zu ändern ist.
-- aus der »Fledermaus« --
Der Roman spielt in Wien und auf dem Mond. Alle Ähnlichkeiten der Romanfiguren mit lebenden oder toten kaiserlichen Hoheiten, Exzellenzen, Hofastronomen, Kunstgeschichtsstudenten oder schönen sefardischen Frauen wären reiner Zufall.
Wörter und Wendungen, die mit einem Stern[1]gekennzeichnet sind, werden am Ende in einem Glossar erläutert.
I.Die Liebeskatastrophe
Das Scherengitter rasselte in seiner Führungsschiene vorwärts und schnappte mit einem sanft - metallischen Klicken ins Schloss – trotzdem rührte sich der Aufzug nicht von der Stelle. Er brauchte einen verdutzten Augenblick, bevor er kapierte: Es handelte sich um einen jener altmodischen Aufzüge, wo es im Inneren der Kabine ein zweites Scherengitter gab, das man einrasten lassen musste. Leider blieb der Aufzug danach aber immer noch eisern stehen. Ihn kitzelten die Blicke der anderen Fahrgäste im Nackenhaar, er drehte sich um, und nun erst sah er ihn im Halbdunkel: einen kleinen alten Mann in einer nachtblauen Livree, dem die Schirmmütze schief im Haar hing. Neben dem Männlein wuchs etwas aus dem Boden des Aufzugs, das so aussah wie ein Maschinentelegraf. Ein Maschinentelegraf? Auf Schiffen hatten solche Geräte früher der Verständigung zwischen Brücke und Maschinenraum gedient: Wenn der nautische Offizier den Hebel umwuchtete, hatte es tief drunten im Schiffsbauch gebimmelt, dann wusste die Mannschaft gleich, ob die gewaltigen Schrauben sich hierhin oder dorthin drehen sollten. Volle Kraft zurück – so hatte manches Unglück (erinnern wir uns an die Jungfernfahrt des größten Passagierdampfers aller Zeiten, der »Titanic«) im letzten Moment noch abgewendet werden können. Dieser Maschinentelegraf hier drinnen hatte allerdings rein gar nichts mit Weltmeeren oder Wogengang zu tun; er zeigte keine Fahrgeschwindigkeiten an, sondern Stockwerke. Die hüfthohe Messingsäule kulminierte in einem Ziffernblatt, dem schwarz auf weiß diese Wörter eingestanzt waren: Souterrain, Parterre, Mezzanin; es folgten die römischen Ziffern von eins bis fünf. »G’schamster Diener«, sagte der kleine alte Mann in der Dienstuniform. (Er sagte es wirklich genau so – »g’schamster Diener«. Dabei näselte er auch noch.) »Bitte, wohin darf ich die Herrschaften führen?«
Offenbar handelte es sich bei diesem Aufzug um ein Relikt aus einer längst verwehten Epoche; dabei hatte man die Wende zum neuen Jahrtausend doch auch im I. Bezirk längst überschritten! Es war ein bisschen unglaublich, schließlich lebte man im Zeitalter des Mondflugs, auch der Mikrowellenherd war längst erfunden. Aber wenn die anderen Fahrgäste über solch altmodischen Luxus staunten, ließen sie sich das jedenfalls nicht anmerken. Ein junger Chassid im Kaftan, der als Letzter zugestiegen war, sagte nonchalant: »Dritter.« Und »Fünfter Stock« wünschte sich der Herr mit den melancholischen Kulleraugen, der dauernd mit dem Seidentaschentuch über seine Spiegelglatze fuhr. Dorthin, also in den Fünften, wollten er und sein Freund auch. Es schoss ihm durch den Kopf, dass er den Herrn mit der Glatze schon irgendwo einmal gesehen hatte, nur wollte ihm partout die Schublade seines Gedächtnisses nicht einfallen, in der er die verstaubte Fotografie mit seinem Gesicht aufbewahrte. Wenn dieser Aufzug nun gar kein Aufzug war, überlegte er eine Sekunde später, sondern eine Zeitmaschine – in welcher Richtung bewegten sie sich jetzt? Fuhren sie beschleunigt der Zukunft entgegen, weil die Reise nach oben ging? Sollte man also behaupten, sie bewegten sich zeitaufwärts? »Zeitabwärts« würde dann in Richtung Vergangenheit bedeuten. Aber vielleicht hatten solche der räumlichen Vorstellungswelt entlehnten Begriffe überhaupt keinen geraden Sinn, wenn man sie auf andere Dimensionen übertrug. Der Aufzug ächzte in den Seilen. Im dritten Obergeschoss blieb er mit einem Ruck stehen, der chassidische Jude stieg mit wippenden Schläfenlocken aus. Im fünften Stock äußerte das livrierte Männlein: »Endstation, Herrschaften, habe die Ehre.« Dass die Filmindustrie diesem Faktotum noch zu keiner Karriere verholfen hatte, war eine schreiende Ungerechtigkeit, dachte er.
Aber nun kam der Augenblick, vor dem er sich eigentlich schon seit dem Morgen gefürchtet hatte; jedenfalls fürchtete er ihn, seit er zusammen mit seinem Freund den Stephansplatz überquert, seit er den großen gotischen Dom im Vorübergehen kaum eines Blickes gewürdigt hatte, und die Furcht fuhr ihm noch gewaltiger in beide Knie, als sie in die Rotenturmstraße mit ihren hohen Wohnpalästen einbogen – mit einem Schock wurde ihm bewusst, welch vornehme Adresse die Einladung meinte, der sie an diesem drückend heißen Sonntagvormittag im August gefolgt waren. Das Schlimmste daran: Die Einladung galt im Grunde nur seinem Freund und gar nicht ihm. Sein Freund, der Thomas hieß, ein so schöner wie unauffälliger Name, kannte nämlich wichtige Leute. Überhaupt bewegte sich Thomas in Wien wie eine muntere Flussbarbe in der Donau. Thomas überragte ihn um Haupteslänge; Thomas war ein wenig breit in den Hüften und gemütlich. Goldenes Wallehaar fiel ihm in Locken über die Schultern. Im Übrigen war Thomas ein herzensguter Mensch; ganz ohne Ironie und ohne falsches Pathos gesprochen: von Herzen gut. Und wie war Thomas an diese Einladung gelangt? Er hatte einen Onkel, der bei einem berühmten Psychoanalytiker in Behandlung war; und jener Psychoanalytiker frequentierte jetzt schon seit Jahren die Matineen im Salon der Barbara Gottlieb. Der Psychoanalytiker hatte irgendwann kurzerhand den Onkel mitgenommen, der Onkel wiederum hatte seinen für kulturelle Dinge sehr aufgeschlossenen Neffen mitgeschleppt, und Frau Gottlieb hatte zumindest nicht gegen diesen sanften Überfall protestiert.
Als Thomas ihm vor ein paar Tagen erzählt hatte, er habe zusammen mit seinem Onkel den intellektuellen Salon besucht, der in der Stadt das höchste Ansehen genoss, und als er ihn dann in seiner niederösterreichischen Mundart fragte: »Kummst mit?«, da hatte er spontan geantwortet: »Wie kann man denn da Nein sagen?« Aber wie, um des lieben Himmels willen, hatte er nun wiederum das sagen können? Diese Frage rumorte in seinem Hinterstübchen, seit er heute Morgen seine käsweißen Beine aus dem Bett geschwungen hatte. Die Gottlieb gehörte zur feinen Gesellschaft, er hatte ihr Foto in Klatschmagazinen gesehen; er aber war ein kleiner, ganz unbedeutender Student, der etwas ungeheuer Brotloses studierte: Kunstgeschichte – ein Fremdling war er, ein krummer Ausländer, der in einer dumpfen Bude in Meidling hauste. Und was sollte er überhaupt anziehen? Er besaß nur ein gutes Jackett, aber das hatte leider Saucenflecken am Ärmel; keine seiner Krawatten taugte etwas.
Er hatte nichts in diesem Salon verloren, wo er keine Menschenseele kannte; wahrscheinlich würde er nach Art der Schüchternen über Stunden hinweg beharrlich - trotzig schweigen. Außerdem sollte es an diesem Sonntagvormittag um Lyrik gehen. Er verstand nichts von Lyrik. Und jetzt ließ der Augenblick sich nicht mehr länger wegschieben, auf den sich seine angesammelte Furcht konzentrierte wie auf den perspektivischen Fluchtpunkt in einem Gemälde: der Herr mit dem Taschentuch, sein herzensguter Freund Thomas und er selbst standen vor der Wohnungstür, und der Zeigefinger seines Freundes bewegte sich unerbittlich auf den perlmutternen Klingelknopf zu, und dann schellte es hinten in der Wohnung, und seine Beine, diese erbärmlichen Feiglinge, wollten unter ihm davon- und zurück zum Aufzug laufen – aber der war ja längst wieder in die Tiefe der unteren Stockwerke versunken –, und nun war es zu spät, denn die hohe Wohnungstür tat sich auf, und die Gastgeberin stand im Türrahmen und lächelte.
Zunächst einmal begrüßte Barbara Gottlieb den melancholischen Herrn: »Exzellenz«, sagte sie, während er sich zum Kuss über ihre Hand beugte. Mit einem Mal wurde ihm klar, in welche Schublade seines Gedächtnisses er dieses freundlich - dunkle Mondgesicht sortieren durfte: aber selbstverständlich doch, es handelte sich um den Gesandten des Osmanischen Reiches – hieß er nicht Kevork Bagradian? Seine eindringlichen Armenieraugen waren oft im Fernsehen zu bewundern, er saß in verschiedenen Gesprächsrunden unter lauter besorgt dreinblickenden Fachleuten, wenn es darum ging, die mitunter etwas erratische Politik der Hohen Pforte zu erläutern. (Und wer hätte sich wohl besser zu diesem Berufe geeignet als ein Angehöriger jenes uraltehrwürdigen christlichen Volkes, das seit bald dreitausend Jahren in Anatolien siedelte?) Als Nächstes war der goldene Jüngling an der Reihe, von Barbara Gottlieb in den erlesenen Kreis der Kulturmenschen aufgenommen zu werden: »Grüß dich, Thomas«, sagte sie; um ihn auf die Wangen zu küssen, musste sie sich ein wenig auf die Zehenspitzen stellen. »Wo ist denn dein Onkel geblieben?« Der habe eines geschäftlichen Projektes wegen verreisen müssen, meldete Thomas, so etwas komme bei Ingenieuren ja leider häufig vor; quasi zum Ausgleich habe er aber einen Studienfreund mitgebracht. Und nun wandte die Gastgeberin sich mit ihrem ganzen Wesen ihm zu.
Barbara Gottlieb war eine stadtbekannte Schönheit: Mittelmeeraugen, Olivenhaut, dunkle Locken, volle Lippen. Sie hätte vielleicht Italienerin – aber aus dem Süden, nicht aus dem Norden des Landes – oder eher noch Portugiesin sein können; in Wahrheit stammte sie aus einem sefardischen Geschlecht[2] , das schon seit Jahrhunderten in Wien lebte (ihr Geburtsname war d’Acosta gewesen). Barbara Gottlieb gehörte zu jener Art von Frauen, deren Schönheit nicht matt wird, sondern mit den Jahren eigentlich immer weiter aufblüht; als junge Studentin war sie nur hübsch gewesen, jetzt – im reiferen Alter von 36, nach sieben Ehejahren und nachdem sie zwei kleinen Töchtern das Leben geschenkt hatte – war sie unwiderstehlich. Allerdings führt der Begriff der Schönheit schnell in die Irre und auf gedankliche Abwege. Denn im Gehirn des Schüchternen verbindet dieses Attribut sich beinahe immer mit der Aura der Unnahbarkeit. Schön nennt der Schüchterne also Frauen, die als marmorkühle Statuen in einem Museum für erotische Kunst herumstehen, und auf jedem Sockel warnt eine Tafel in unsichtbarer Frakturschrift: Anfassen verboten. Welcher Reiz könnte davon je ausgehen? Aber Barbara Gottlieb war eben alles andere als reizlos. Belassen wir es für den Moment bei der züchtigen Andeutung, dass sie ein rotweißes Dirndl mit gewagtem Ausschnitt trug – und dieses Dirndl stand ihr ausgezeichnet. Gegen eine kalte Schönheit hätte unser Held sich mit einem Panzer aus Zynismus wappnen können; auf eine arrogante Gesellschaftsdame wäre er mit dem Speer der heimlichen Verachtung losgegangen. Aber den frechen Grübchen in ihren Wangen war er nun wehrlos ausgeliefert. Gegen die Freundlichkeit, die aus der Tiefe ihrer Mittelmeeraugen heraufleuchtete, war kein bitteres Kraut gewachsen. Nichts schirmte seine empfindliche Jungmännerseele vor dem Strahlen ihres Lächelns ab. Und dann roch sie auch noch so gut!
»Grüß Gott, Studienfreund«, sagte Barbara Gottlieb. »Haben Sie denn einen Namen?«
»Repin«, stieß er hervor. »Von Repin.« Und dann, nachdem er heftig geschluckt hatte: »Alexej von Repin.«
»Herzlich willkommen«, sagte die berühmte Gastgeberin. »Wie wunderbar, dass Sie da sind.« Dabei barg sie seine schweißnassen Finger zwischen ihren Mädchenfrauenhänden (Händen, die trotz ihrer Größe so grazil und schmal wirkten, als gehörten sie zu einer viel jüngeren Person, aber robust und erwachsen zugreifen konnten), es war ein betörender Augenblick. Und dann überschritt Alexej die Schwelle und fand sich unter lauter wildfremden Menschen wieder. Mehr Herren als Damen fielen ihm auf, mehr gesetzte Leute als junge, viele Anzüge in gedeckten Farben. Alexej kannte in dieser Menge nur seinen Freund Thomas; später erblickte er in einer Ecke einen Philosophen mit Stoppelbart, den man manchmal spätnachts in einer jener Fernsehsendungen bewundern konnte, wie sie für die Donaumonarchie mittlerweile ziemlich typisch waren: Da saßen Männer und Frauen auf durchgewetzten Sofas und redeten bis zum ersten Hahnenschrei allerlei Absonderliches, wobei sie Unmengen von Rotwein und Salzstangen konsumierten. Der Philosoph war dafür bekannt, dass er mit französischem Näseln immer wieder Thesen in die Kamera schleuderte, die ebenso ungekämmt waren wie seine graue Mähne. Übrigens war Alexej ihm schon in den verwinkelten Korridoren der Universität über den Weg gelaufen. Jetzt allerdings blickte der Philosoph (sein Name war André Malek) so finster, als wolle er um keinen Preis der Welt angesprochen werden.
Die Gäste der Barbara Gottlieb, etwa vierzig an der Zahl, standen unterdessen in dem geräumigen Salon und nippten am Frühstückschampagner. Ein stupsnasiges böhmisches Mädchen, das eindeutig von der Prager Kleinseite stammte, bahnte sich einen Weg zwischen den Gästen hindurch und erkundigte sich nett, ob denn auch Alexej von Repin an einem »Klaßerl Ssekt« interessiert sei.
Die Wohnung des Ehepaars Gottlieb war ohne Zweifel spektakulär. Es handelte sich um eine große Dachgeschosswohnung, aus der die Handwerker eine Zwischendecke herausgebrochen hatten; so waren überhohe Wände und eine gewaltige Fensterfront entstanden. Die zwei Seitenwände des Salons trugen Regale bis unter die schräge Decke; Alexej von Repin schätzte, dass diese Privatbibliothek wohl an die zehntausend Bände umfassen musste. Aber nicht dies war es, was ihn bis zur tiefen inneren Erschütterung beeindruckte; auch nicht der Blick auf den einzelnen Turm des Stephansdomes, obwohl er ihn noch nie aus diesem Blickwinkel gesehen hatte; auch nicht das Riesenfernrohr mit dem Stativ, das vor der Fensterfront auf einem kleinen Holzpodest stand wie ein dunkles exotisches Tier mit langem Hals (Barbara Gottliebs Gatte war k. u. k. Hofastronom); nicht die Biedermeiermöbel, nicht die hübschen stoffbespannten Stühle (in Wien nannte man sie »Sessel«), wie sie im Halbrund für die Lesung aufgereiht warteten; ganz gewiss nicht das golden gerahmte Porträt Seiner Majestät neben der Bücherwand – Bilder des Kaisers hingen in manch privatem Haushalt, vor allem in Wohnungen von Israeliten, herum. Nein, den tiefsten Eindruck in diesem Raum verschaffte Alexej von Repin, was er sah, wenn er Fensterfront und Dom den Rücken zukehrte. Es passierte einem ja nicht jeden Tag, dass man ein Bild des wahrscheinlich größten Malers zu Gesicht bekam, den das soeben abgelaufene 20. Jahrhundert hervorgebracht hatte. Ein Levinsohn! Es war mit klarem Verstand gar nicht zu fassen. Ein echter Levinsohn in einer privaten Wohnung!
Das Gemälde – es war ein großes Format, vielleicht zwei mal drei Meter – musste in der Periode kurz nach seinem Übertritt zur katholischen Kirche entstanden sein, also in den späten Dreißiger- oder frühen Vierzigerjahren. Auf den ersten dummen Blick glaubte man, es sei in Gold- und Silbertönen auf schwarzem Untergrund gehalten; auf den zweiten Blick (und etwas klüger geworden) sah man: Bei dem schwarzen Untergrund handelte es sich in Wahrheit um verschiedene Blautöne, die immer dunkler, immer finsterer wurden, ohne je die Absolutheit des Schwarzen zu erreichen. Und das Gold und das Silber erwiesen sich der genaueren Betrachtung als schmutzig helles Gelb und blendend reines Weiß. (Jizchak Levinsohn, das wusste jeder Anfänger auf dem Gebiet der Kunstgeschichte, hatte Licht so blendend zu malen verstanden wie vor ihm vielleicht nur William Turner; im Vergleich mit ihm nahmen sich die Herren Impressionisten – pardon, messieurs – wie Stümper aus.) Das Bild zeigte einen Höllensturz. Dieses Thema hatte er in jener Periode seines Schaffens in Dutzenden von Varianten auf die Leinwand geworfen, wie ein Getriebener war er mit dem Pinsel immer wieder der alten Legende von dem strahlenden Cherub nachgejagt, der sich gegen die himmlischen Autoritäten erhob und dafür mit dem Fall ins Bodenlose bestraft wurde. Auf diesem Ölgemälde hier fielen die Engel als pures Leuchten vom oberen Bildrand nach unten, im Sturz verdämmerten und verloschen sie allmählich in das tiefere Blau hinein; im unteren Drittel des Bildes aber, schreckverzerrt der Bodenlosigkeit zugewandt, hatte Levinsohn mit ein paar meisterhaft - kräftigen, zugleich dünnen weißen Strichen das Gesicht Luzifers festgehalten. Und nun das Verblüffende, auch Schockierende: das Antlitz des fallenden Engels leuchtete überirdisch herrlich. Edel, durchgeistigt und klar waren seine Züge, nur der Schrecken, wie gesagt, verzerrte sie ein wenig: Der Böse, wie Levinsohn ihn sah, war schön wie der Messias.
»Gefällt es Ihnen, unser Bild?«, fragte sie. Alexej hatte gar nicht bemerkt, wie sie sich neben ihn gestellt hatte, und seltsamerweise zuckte er nicht einmal zusammen, als Barbara Gottlieb ihn nun am Ärmel berührte.
»Es ist gewaltig«, antwortete er. Sie standen nebeneinander und schwiegen. Dann war auch dieser Augenblick vorüber und schlich auf Zehenspitzen davon.
Ein paar Minuten lang musste Alexej sich nun gefallen lassen, dass sein herzensguter Freund Thomas ihn charmant triezte (»sekkierte«), ehe Barbara Gottlieb ihn von dieser Qual erlöste, indem sie mit dem Löffelchen gegen ein Sektglas klingelte und die Gäste aufforderte, Platz zu nehmen; anschließend stellte sie die Lyrikerin vor, die nun gleich aus ihren Gedichten vortragen werde. Es handelte sich um ein großes flachbrüstiges Mädchen mit schiefen Zähnen und kurzem braunem Haar, eine Slowenin aus der Untersteiermark. Sie hörte auf den Namen Ana Dalmatin und mochte ein paar Jahre älter als Alexej und Thomas sein, das war schwer zu schätzen; jedenfalls hatte die Dichterin schon in verschiedenen Anthologien veröffentlicht, aber noch keinen Verlag gefunden, der ihre Verse zwischen zwei Pappdeckeln gebündelt oder als Elektrobuch auf den Markt geworfen hätte. Das sollte sich nach diesem Vormittag zum Glück ändern. Ana Dalmatin – sie trug trotz der Sommerhitze hohe Stiefel und war sehr eigenwillig farbenfroh gekleidet – stellte sich ohne Pose vor die Gäste, nahm ihre Blätter zur Hand und fing an zu lesen.
Las sie denn gut? Sie las sogar ausgezeichnet. Ihr leichter slawischer Akzent störte gar nicht, eher trug er – weil sie ihm bewusst entgegensteuerte – dazu bei, ihre Diktion noch deutlicher zu machen; die Dichterin verzichtete beim Lesen auf billiges pathetisches Donnergrollen, blieb andererseits aber auch nicht so unbewegt, als trüge sie aus dem Wiener Telefonbuch vor. Und war das gut, was sie da vorlas? Alexej von Repin glaubte, er könne sich kein Urteil erlauben. Zum Glück befand sich unter den Zuhörern aber ein kleiner dicklicher Kulturredakteur mit Brille und ergrauendem Bärtchen, auf dessen profunde Einsichten wir an dieser Stelle zurückgreifen dürfen. »Ein neues Talent ist anzuzeigen«, hieß es am übernächsten Tag im Feuilleton der Neuen Freien Presse. »Aber was heißt hier schon Talent? Das Wort ist ja beinahe eine Beleidigung bei einer Lyrikerin, die trotz ihres jugendlichen Alters offenbar fertig auf die Welt gekommen ist, die von Anfang an über sämtliche technischen Fertigkeiten verfügt, vor allem aber über das Wichtigste, das ein Dichter haben muss: eine eigene Stimme. Ana Dalmatin ist eine Slowenin aus der Untersteiermark, ihre Muttersprache beherrscht sie ebenso gut wie das Ungarische und Deutsche. Dass sie ihre Verse auf Deutsch vorlegt, ist eine bewusste Entscheidung, eine Liebeserklärung an die Sprache von Grillparzer, Rilke und Werfel. Eine Liebeserklärung aber auch an Egon Mautner, um einen Meister der neueren Moderne zu nennen, dessen Werk sich diese Dichterin in besonderer Weise verpflichtet fühlt; Anspielungen etwa auf Mautners ›Neue Wienerlieder‹, die der Schönberg-Schüler Max Deutsch kongenial vertont hat, können in ihren Versen gar nicht überhört werden. Ana Dalmatin ist eine Naturlyrikerin, als poetisches Material dient ihr vor allem ihre Kindheit auf dem Bauernhof. Offenbar verbindet sie mit dieser Kindheit ebenso gute wie schreckliche Erinnerungen. Ana Dalmatin verschmäht die traditionellen und komplizierten Gedichtformen nicht. Auch Sonette und Villanellen meistert sie mit so leichter Hand, als würden sie ihr nicht die geringste Mühe bereiten. Ihre Verse sind so zart wie genau, die Metaphern stimmen in sich, ihre Bilder sind klar: Ana Dalmatin ist eine Dichterin und hasst das Ungefähre. Und wenn sie auch um den Schmerz der Kreatur weiß – eines ihrer eindrucksvollsten Sonette handelt von jungen Katzen, die von unbarmherziger Hand in einen Sack gebunden und in einem Teich ersäuft werden –, so beharrt sie doch darauf, inmitten des Schreckens das Schöne zu suchen.«
Nun muss etwas Peinliches gebeichtet werden. Nach ungefähr zwanzig Minuten der Dichterlesung pochte mit einem Mal Alexej von Repins Blase auf ihr Recht. Champagner hatte immer diese Wirkung auf ihn, das hätte er bedenken sollen, ehe er sich von dem böhmischen Mädchen ein »Klaßerl Ssekt« und dann noch eines aufschwatzen ließ. Als die Dichterin aus der Untersteiermark in klassisch gefugten Versen die Heumahd beschwor, wurde ihm schon unbehaglich; wenig später las Ana Dalmatin ein Sonett über ihre Kindheit, das mit der Zeile »Eulen trugen die Nacht davon« begann – da ruckelte er längst ungeduldig auf seinem Stuhl herum, sein Inneres war zum Zerplatzen mit Flüssigkeit gefüllt, jede Sekunde dehnte sich und wurde zur Qual. So kam es, dass Alexej von Repin sich im Anschluss an die Lesung nicht am Applaus beteiligte, der höflich um ihn herum pritschelte. Stattdessen drückte er sich, nach allen Seiten um Entschuldigung bittend, zwischen den Sitzreihen ins Freie, stürzte mit hochrotem Kopf den nächsten Korridor hinunter und probierte eine Klinke nach der anderen, bis er endlich die richtige erwischte.
Nachdem er sein Wasser abgeschlagen hatte, verweilte er noch ein paar Minuten in jenem Badezimmer (muss extra erwähnt werden, dass es mit weißem Marmor und edlen römischen Fliesen ausgelegt war, dass die Wasserhähne golden schimmerten?); schwach und aufregend lag das Parfum der Hausherrin in der Luft. Prüfend betrachtete Alexej von Repin sich im Spiegel. Das hätte er allerdings lieber nicht tun sollen. Die Sache war nämlich so: Alexej war hässlich (»schiach« sagen die Österreicher). Sein Haar lockte sich dünn und rötlich über der Stirn, im Gesicht störte ihn empfindlich das Fehlen eines Kinns, sein Mund war viel zu schmal; er hatte eine Hühnerbrust und war ein wenig verwachsen. Und erblickte er dort auf der Wange unter den Koteletten, wo er sich heute morgen rasiert hatte, etwa ein gelbliches Nest von Mitessern (»Wimmerln«)? Alexej wandte den Blick schnell von seinem Spiegelbild ab, er schämte sich. – Aber war er denn wirklich hässlich? Das ist gar nicht so einfach zu entscheiden. Denn wir sehen uns alle nicht so, wie wir wirklich sind; kein Mensch hat je im Spiegel das eigene Gesicht erblickt. Klar ist nur, dass derjenige, der glaubt, er sei hässlich, sich meistens auch so benimmt, als sei er es; und eben dadurch wird er dann »wirklich« hässlich – was in diesem Fall heißt: in seiner Wirkung auf andere. Ob er hinter der Fassade, wenn man von seiner Wirkung absieht, ebenfalls »schiech« ist; ob sich in ihm latent ein attraktiver Mensch verbirgt, der nur leider nicht zur Erscheinung kommt – das ist eine spitzfindige philosophische Frage.
Als Alexej von Repin, der sich mittlerweile auch noch das Gesicht gewaschen hatte, aus dem Badezimmer in den Salon zurückkehrte, war der Skandal schon im allerschönsten Schwung. An die Lesung hatte sich, wie das zum Leidwesen der Dichter so üblich ist, eine Diskussionsrunde angeschlossen. Am Anfang waren wohl die üblichen Artigkeiten gesagt worden, aber dann hatte André Malek, der Philosoph mit der grauen Mähne, sich zu Wort gemeldet. »Madame«, sagte er, »Ihre Gedichte sind, mit Verlaub, merde.« Verteidiger der Dichterin waren ihm daraufhin empört über sein loses Maul gefahren (»impertinenter Lackel«, »Ungustl« usw.), aber Malek war von seinem Sitz aufgesprungen und hatte sie mit Stentorstimme alle niedergebrüllt. Die Verse der Ana Dalmatin seien überholt, nicht auf der Höhe der Zeit, kurz und schlecht: reaktionär! Eine Lyrik, die den Anschluss an die Moderne verpasst habe, verdiene im Grunde gar nicht, dass man sie Lyrik nenne. Diese Gedichte seien affirmativ (was immer das nun wieder bedeuten mochte)! Verse über »Frühling, Sommer, Herbst und Winter« – hier verzog der Philosoph die Miene, man sah ihm an, dass er am liebsten ausgespuckt hätte. Diese Dichterin sei mit den herrschenden Verhältnissen offenbar höchst einverstanden. Das sei ihr gutes Recht in ihrem stillen Kämmerlein, aber als Leser wünsche man, von diesem »affirmativen« (hier war die Vokabel schon wieder) Gewäsch verschont zu werden! Sie solle sich schämen, dass sie als Tochter eines unterdrückten Volkes in diesem verrotteten Kaiserreich nichts anderes zur Welt zu sagen wisse als: ja und amen.
Schwer atmend ließ sich der Philosoph auf seinen Stuhl plumpsen. Und nun entstand – nachdem Ana Dalmatin die Schimpfkanonade mit trotzig verschränkten Armen, aber gesenkten Hauptes hatte über sich ergehen lassen – eine jener Pausen, in denen still der Engel der Peinlichkeit durchs Zimmer geht. Und in diese Pause hinein ergriff Alexej von Repin das Wort. Oder das Wort ergriff ihn, so genau konnte das hinterher keiner mehr sagen. Von seiner Ecke an der Wand her, an der er mit überkreuzten Beinen lehnte, sagte der junge Mann eine winzige Spur zu laut und ohne irgendjemanden dabei anzuschauen: »Also, mir haben die Gedichte von dem Fräulein ganz gut gefallen.« Vielleicht lag es an dem altmodischen »Fräulein«: jedenfalls war es danach mit einem Mal so, als sei ein böser Bann gebrochen. Die Gäste der Barbara Gottlieb lachten; die Dichterin wehrte sich anfangs gegen den Lachreiz, fing dann aber auch an zu glucksen; sogar der finstere Philosoph André Malek brach in Gelächter aus. Am lautesten aber war das Lachen der schönen Gastgeberin in ihrem rot-weißen Dirndl, das ihr, wie schon angemerkt, ausgezeichnet stand. Dieses Lachen klang ganz hell, es lag nichts Finsteres, nichts Höhnisches darin. Als sie sich alle wieder beruhigt hatten, erklärte Barbara Gottlieb, das sei doch ein gutes Schlusswort, und sie wünsche den Gästen noch einen angenehmen Heimweg.
Bei der Verabschiedung geschah es dann, dass sie Alexej von Repin sehr fest an sich drückte. »Sie waren großartig, mein Freund«, sagte sie ihm ins Ohr, wobei sie das erste R fein auf der Zungenspitze rollte; er spürte, wie wunderbar weich ihre Brüste unter dem Stoff lagen; mit seinen Händen hielt er beinahe gegen seinen Willen ihre Taille umfasst, der Geruch ihrer Haut stieg ihm von ihrer Halsmulde her in die Nase; und als sie ihn, wie vorhin schon Thomas, auf die Wangen küsste, da wendete sie einen Augenblick zu früh ihren Kopf, und seine Lippen streiften kurz und sanft – niemand außer ihnen beiden hatte es bemerkt – ihren Mund. »Kommen Sie bald wieder, Alexej.« Die körperliche Empfindung dieses Beinahekusses begleitete ihn noch, als er benebelt in dem altertümlichen Aufzug nach unten fuhr (zeitaufwärts, zeitabwärts?). Sie begleitete ihn auch auf dem langen und einsamen Weg in seine Studentenbude, sie begleitete ihn noch bis in den unruhigen, von tollen Träumen zerrissenen Schlaf hinein. »Die Ehre, die Ehre«, sagte das Männlein in der Livree, als sie im Parterre angekommen waren, in Alexejs Ohren klang es wie Spott. Denn ihm war fürchterlich klar, dass er von nun an ehrlos war: Er hatte sich Hals über Kopf verliebt. Er, der Hässliche, der Schüchterne, in die schönste Frau von Wien; in eine Dame, die einen Levinsohn im Salon hängen hatte. Eine Ehefrau zudem, deren Gatte ganz gewiss bei Hof ein- und ausging. Eine Ehefrau mit zwei kleinen Töchtern. Es war eine Katastrophe. Es hätte nie geschehen dürfen; es war geschehen. Alexej wusste, was ihm blühte: schlaflose Nächte, zähneknirschender Selbsthass. Eine Katastrophe, eine Katastrophe. Die Liebe war eine Katastrophe.
Hätte er in diesem Augenblick gewusst, dass in ein paar Monaten die Welt untergehen sollte, es wäre Alexej im Vergleich wie das mindere Unglück vorgekommen.
II.Dudus Mondfahrt
David Gottlieb, den seine Freunde gern zärtlich »Dudu« riefen, platzte vor Vorfreude schier aus den Nähten und fühlte sich deswegen schuldig. Warum er sich schuldig fühlte? Weil seine Vorfreude wenigstens durch einen Tropfen der Trauer hätte getrübt sein müssen: noch war ja gar nicht abzusehen, ob er seine Gattin und ihre beiden Töchter binnen Wochen oder erst in Monaten wiedersehen würde. Dudu Gottlieb war aber überhaupt nicht traurig. Ihm fiel vielmehr ein Stein vom Herzen, als ihn das Telegramm mit der kryptischen Nachricht – seine Anwesenheit auf dem Mond sei »dringend stopp sehr dringend erforderlich« – aus dem Kreise seiner Lieben zu Hause fortriss. Nicht zu leugnen: Seine Ehe war im vergangenen Jahr mit sanft - bösem Knirschen auf eine Sandbank gelaufen. Man konnte nicht sagen, dass er häufig mit Barbara stritt; vielleicht stritten sie sogar zu wenig miteinander. Aber der Nebel der Gewöhnung hatte sich grau auf seinen Alltag und klamm um sein Herz gelegt. Womöglich war ja auch, so suchte er sich zu beruhigen, das Alter schuld: Er hatte die 50 gerade eben überschritten. Jedenfalls hatte er Barbara nun schon lange nicht mehr (im biblischen Sinn dieses Wortes) erkannt. Es lag nicht daran, dass Dudu ihre Schönheit nicht mehr wahrgenommen hätte; im Grunde fand er seine Gattin sogar attraktiver denn je. Aber ihre Schönheit reizte ihn eben leider überhaupt nicht mehr.
Nach den Vorschriften des Talmud war Dudu Gottlieb die Pflicht auferlegt, seine Frau entweder erotisch zufriedenzustellen oder ihr materiellen Ersatz zu leisten; so hatte er Barbara mit Halsketten und Ohrringen, mit Gold und Brillanten wortlos um Verzeihung gebeten … lieber hätte er seinen Ehekontrakt (einst hatte er ihn an einem sonnig - kalten Frühlingstag besiegelt, indem er ein Glas unter der Ferse zermalmte) auf die traditionelle Art erfüllt. Aber stand es denn in seiner Macht?
Nun musste Dudu Gottlieb also auf den Mond, und die Vorfreude wirkte auf ihn wie ein Gas, das sanfte Rauschzustände hervorruft. Barbara hatte ihm am Vorabend geholfen, seine Koffer zu packen; genauer gesagt war es so gewesen: sie hatte die Koffer systematisch mit allerhand Nützlichem gefüllt, er hatte immer mal wieder versucht, ein Buch unter die Kleidungsstücke zu schmuggeln, und Barbara hatte ihm die Bücher – »du kannst nicht deine halbe Bibliothek mitnehmen, Dudu« – einzeln wieder ausgeredet. Er hatte sich den Wecker auf halb sechs gestellt und war neben ihr tief in traumlosen Schlaf gefallen (Reisefieber kannte Dudu Gottlieb zum Glück nicht); morgens war er aus dem Bett gerollt, hatte seine Frau, die sich schlaftrunken räkelte, kurz auf den Mund geküsst, Gebetsriemen angelegt und eine halbe Stunde lang Schách’riss, das Morgengebet, verrichtet. Nach einer kräftigen Dusche (halb heiß, halb eiskalt) hatte er sich angekleidet wie jeden Tag – schwarz gestreifter Anzug, rote Seidenkrawatte, Samtkappe; an den Seiten seiner Hose hingen die Schaufäden des kleinen Gebetmantels herunter, den er als Unterhemd trug. Dudu Gottlieb musterte sich kritisch im Spiegel (demselben Spiegel, in den ein paar Tage zuvor Alexej von Repin geblickt hatte). Er sah sein blasses Gesicht, sah verschwiemelte Züge, seinen kurz geschorenen Bart, der an den Ecken schon grau wurde, hellbraune Augen.
Viele fragten sich, wie es einem Mann wie ihm wohl gelungen sein mochte, Barbaras Herz zu erobern. Als Antwort auf diese Frage hatte er seinem Spiegelbild kurz die Zungenspitze gezeigt, das ihm die kleine Ungezogenheit umgehend heimzahlte; anschließend hatte er allein in der Küche gefrühstückt (tiefschwarzen ungesüßten Kaffee, in den er ein trockenes Kipferl tauchte). Der Sekundenzeiger der alten Uhr auf der Bauernkredenz, in der sie die milchigen Teller verwahrten, hatte die Zeit mit »Tack« und »Tack« und wieder »Tack« in dünne Scheiben zersäbelt. Eine kleine Viertelstunde später klingelte es schon an der Tür, sein Taxi wartete unten. Seine Frau war gähnend und im Morgenmantel an der Tür erschienen; sie hatte ihn zum Abschied sanft in den Arm genommen, er hatte ihr ins Ohr geraunt, sie solle brav sein und die Kinder von ihm grüßen.
Dudu Gottliebs Taxifahrer war ein Rumäne aus Siebenbürgen, der einen gewaltigen Schnurrbart unter der Nase trug; noch gewaltiger war das R, das er gemütlich vor sich her rollte. Ob ihm Wien denn gefalle, wollte Dudu wissen, ob es hier besser sei als in seiner Heimatstadt. »Temeschoar – nicht schlecht. Bukarest – noch besser. Aber Wien ist grrrrreeeßte Stadt von Welt«, urteilte der Taxifahrer aus Siebenbürgen. Und nachdem er seinen Schmerbauch hinter dem Lenkrad verstaut hatte, fügte er im Brustton der Naivität hinzu: »Wien ist centru von Kosmos!« Als sie langsam am Prater vorbeifuhren, erkundigte der Rumäne sich, wohin die Reise denn gehe; ach so, auf den Mond, da schau her. »Geschäft oder Vergniegen?«, wollte er wissen – und Dudu, den die jubelnde Vorfreude längst unter den Haarwurzeln kitzelte, antwortete schnell und leise, es handle sich um eine Geschäftsreise, was im Grunde ja auch stimmte. »Ich spare für Mondflug«, informierte ihn sein Chauffeur. »Aber nie genug Geld auf Bank, la naiba!« Anschließend war er – während sie auf die Autobahn einbogen, die nach Transleithanien[3] hinüberführte – in das allgemeine Taxifahrerlamento ausgebrochen: hohe Steuern, korrupte Politiker, blöde Erzherzöge usw., und er hielt sein Lamento ungebremst durch, bis sie bei Schwechat die Abfahrt zum Flughafen nahmen. Eigentlich war Dudu der Mann am Ende ein wenig auf die Nerven gegangen; am liebsten hätte er das Trinkgeld gespart, aber es gab, weiß Gott, schon genug Antisemitismus, und er wollte nicht – wie seine Großmutter seligen Andenkens gesagt hätte – extra Risches[4] machen. Also streckte Dudu dem Rumänen mit mildem Seufzen ein goldenes Hundertkronenstück hin: »Vierzig, bitte«, sagte er, und der Taxifahrer gab ihm drei rote Zwanzigerscheine heraus.
Vor dem Flughafengebäude stand er dann allein mit seinen zwei Rollkoffern in der Hand, ein Herr mittleren Alters im teuren Anzug mit Samtkappe. Um Dudu herum brandete ein wildes Sprachengewirr: Er hörte das Ukrainische der Ruthenen, jiddische Brocken flogen an sein Ohr, eine tschechische Familie bahnte sich lautstark ihren Weg, sogar Englisch war hier und da zu vernehmen. Dudu Gottlieb aber steuerte mit seinem schweren Gepäck quer durch die geräumige Abflughalle schnurstracks dem Schild entgegen, das den Weg zum Mondflieger wies. Die erste Formalität des Tages bestand darin, dass er sich mitsamt seinen Koffern wiegen ließ. Dudu liebte diese Prozedur nicht, leider war sie unumgänglich: Touristen zum Mond lösen alle denselben Grundpreis von circa 6000 Kronen – eine erschwingliche Summe auch für Angehörige der Mittelschicht. Auf diesen Grundpreis ist dann aber jeweils ein Aufschlag zu entrichten, der sich nach dem Körpergewicht und der Schwere des mitgebrachten Gepäcks bemisst; denn jedes Kilo, das von der Erde zum Mond geschossen wird, macht zusätzlichen Raketentreibstoff erforderlich, und dafür haben die Passagiere aufzukommen.
Die finanzielle Seite der Angelegenheit bekümmerte Dudu wenig, schließlich wurden die Kosten vom Hofe getragen. Allerdings empfand er es als unangenehm, beinahe schon entwürdigend, dass er vor aller Augen mitsamt seinen Koffern auf einer riesigen Waage Aufstellung nehmen musste. Wenn man ihm den Ausdruck aushändigte, auf dem die Gewichtsdifferenz exakt in Krone und Heller umgerechnet stand, wurmte ihn das jedes Mal tief in den Eingeweiden. Er liebte Mehlspeisen nun einmal, neigte daher zur Dicklichkeit, und diese Rechnung kam ihm wie eine öffentliche Rüge vor. Zu begleichen war die Differenz an Bord (die Kunststoffkarte der k. k. Creditanstalt[5] ruhte sicher in der Dunkelheit seines Portemonnaies).
Noch eine zweite Hürde war auf dem Weg zum Mond zu bewältigen – die Grenzkontrolle. Ja, es war ein wenig verrückt. Dudu Gottlieb konnte nach Triest reisen, nach Budapest, nach Prag, nach Czernowitz, nach Sarajevo oder in sein heimatliches Lemberg, ohne dass er unterwegs je hätte seinen Reisepass vorweisen müssen; aber der Mond war nun einmal deutsch, da war nichts zu machen. Unsichtbar erstreckte sich eine politische Grenze durchs stille kalte All, eine seltsame Vorstellung. Auf ganz unerwartete Weise, dachte Dudu, während er sich in die nächste Menschenschlange einreihte, war eine Prophezeiung von Heinrich Heine aus dem 19. Jahrhundert wahr geworden. Heine, der die Deutschen mit ingrimmigem Spott geliebt hatte, dichtete in seinem Poem »Deutschland. Ein Wintermärchen«:
Franzosen und Russen gehört das Land,
Das Meer gehört den Briten.
Wir aber besitzen im Luftreich des Traums
Die Herrschaft unbestritten.
Diese Verse hatten sich also erfüllt – viel weniger metaphorisch, viel buchstäblicher, als Heine es hatte wissen können. Ganz ohne alle Ironie! Seit dem Jahr 1940 hatten die Deutschen mit überlegener Ingenieurskunst – das musste der österreichisch - ungarische Neid ihnen lassen – die Herrschaft im Luftreiche der Utopie erstritten. Der Rüstungswettlauf mit den Briten war da schon endgültig verloren gewesen: Auch der letzte Trottel hatte begriffen, wie sinnlos es war, immer neue Kriegsschiffe vom Stapel laufen zu lassen, die dann doch wieder nutzlos im Kieler Hafen herumdümpelten – in der Raketentechnik lag die Zukunft! Die Deutschen hatten also einen alten Menschheitstraum wahr gemacht, waren als Pioniere zum Mond geflogen und hatten ihn danach mit preußischer Gründlichkeit in Beschlag genommen und kolonisiert (in einem Anflug von jüdischem Nationalstolz erinnerte Dudu Gottlieb sich kurz daran, welch hervorragende Rolle Juden bei dieser waghalsigen Unternehmung gespielt hatten). Er mochte sie nicht besonders, die Preußen; aber das hatten sie gut gemacht. Doch nun war die Reihe schon an ihm, seine Papiere aus der Brusttasche zu fingern – dabei musste er aufpassen, dass ihm die Flugkarte nicht zu Boden fiel, gleichzeitig hatte er seine Koffer vorwärtszurollen. Schon stand er vor der Glaskabine, die einen Angehörigen der Grenzgendarmerie behauste. Da Dudu Gottlieb öfters zum Mond flog, kannte er mittlerweile viele Grenzgendarmen mit Namen. Dieser blutjunge Diener Seiner Majestät hieß Stanisław Paszkiewicz; er trug einen bleistiftstrichdünnen Schnurrbart unter der Nase und stammte wie Dudu aus Ost-Galizien.
»Guten Morgen, Exzellenz«, sagte der Grenzgendarm in seiner blauen Uniform.
»Dzień Dobry, Panie Paszkiewicz«, sagte Dudu Gottlieb und legte seine Dokumente vor, »jak siȩ pan miewa dzisiaj?«
»Caćkiem dobrze ale musi pan dobrze zadbał o swoje zdrowie, Herr Geheimrat. Zgodnie z naszym wczorajszym raportem bȩdzie padać śnieg o pòłnocy.«
»Mam spakowane futro«, versetzte Dudu, ohne die Miene zu verziehen.
»Mam nadziejȩ że Paǹskie walizki są wypełnione po brzegi sliwowica«, sagte Stanisław Paszkiewcz. »Będzie Pan musiał przekupić wiȩcej Prusaków.«
»Oczywiście, oczywiście. Zechciałby Pan sprawdzić?«
»Póki co z przyjemnościa zyczyłbym sobie sprawdzić, Herr Geheimrat. Żegnam Proszȩ tylko nieszaleć i nienarobić żadnych szkód przed Ksiȩżycem.« Mit diesen Worten[6] gab er Dudu den Pass zurück – und da es zum Spiel gehörte, dass keiner von ihnen lächelte, vermieden es die beiden, einander in die Augen zu sehen.
Nach den Grenzformalitäten und nachdem Dudu Gottlieb sein Gepäck aufgegeben hatte, blieb ihm gerade noch genug Zeit, sich in einer Trafik die jüngste Ausgabe der Neuen Freien Presse zu kaufen; außerdem erwarb er eines jener Bücher, wie man sie als Dutzendware auf allen Flughäfen der Welt herumliegen sieht. Dieses Exemplar hier hatte einen grellen Einband, stammte von einem gewissen Richard Turteltaub, trug den Titel Hannibal Barkas – Herrscher über Italien und kostete nur 16 Kronen und 95 Heller. Dudu kaufte das Buch, ohne dass er es auch nur angeblättert hätte; er kaufte es vor allem deshalb, weil Hannibal in seiner persönlichen Heldengalerie einen Ehrenplatz einnahm, aber auch, weil auf dem Umschlag des Buches ein trompetender Elefant abgebildet war – er mochte Elefanten. Dudu hatte das Buch kaum in die Tasche gesteckt, da kam schon der Bus, der ihn und die anderen Mondtouristen abholte und zur Startbahn des Mondfliegers fuhr, einem hellen Band aus Beton, das sich an der Donau entlangzog; sein Ende verlor sich irgendwo da hinten in der flirrenden Ferne. Diese Startbahn war eine eigene Attraktion – übertroffen wurde sie eigentlich nur noch von dem Weltraumgefährt, das dort in der Sommerhitze stand und wartete.
Der Mondflieger war wunderschön. Er war von oben bis unten, von vorn bis hinten in einem matten Dunkelblau lackiert und mit goldenen Sternen übersprenkelt; auf seiner Heckflosse sah Dudu groß und stolz das kaiserlich - königliche Wappen prangen. Der Mondflieger war aber nicht nur schön, er war auch riesig – so hoch wie ein dreistöckiges Haus. Wer neben ihm stand, der mochte sich vielleicht wundern, warum dieses Vehikel nur Platz für fünfzig Passagiere bot – aber den meisten Raum nahm hier naturgemäß der Treibstoff ein. Außerdem transportierte der Mondflieger nicht nur Passagiere, sondern nahm auch Lasten mit, denn beinahe alles Lebensnotwendige musste in die Mondstadt eingeführt werden (außer Wasser, das auf dem Mond in Form von Eis unter dem Staub lagerte, und Atemluft, die von den Kolonisten mithilfe von riesigen Algentanks längst selbst hergestellt wurde). Der Mondflieger sah im Grunde wie ein fantastisch überdimensioniertes Flugzeug aus – allerdings kulminierte er am hinteren Ende in den vier gigantischen Düsen seiner Raketentriebwerke; und während die Passagiere ein normales Flugzeug von der Seite her bestiegen, war hier am hinteren Ende eine Treppe herangefahren worden, sodass die Passagiere den Mondflieger nun betraten, indem sie (dies rief bei Dudu einen kurzen Moment des Unbehagens hervor: was, wenn die Raketenmotoren jetzt plötzlich feurig fauchend ansprangen?) zwischen den hausgroßen Düsen hindurch an Bord stiegen.
Drinnen gab es keine Abstufungen des Luxus, sondern nur eine einzige (und sehr komfortable) Klasse. Die fünfzig Sitze waren alle gleich breit und weich, boten genug Beinfreiheit und konnten im Handumdrehen in Liegen umgewandelt werden; alles andere wäre freilich auch unvertretbar gewesen, denn wenn das Sonnenlicht, das vom Mond gespiegelt wurde, auch nur eine Sekunde brauchte, ehe es die Erde erreichte, dauerte ein Mondflug doch immer noch seine 38 Stunden.