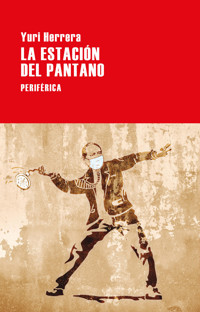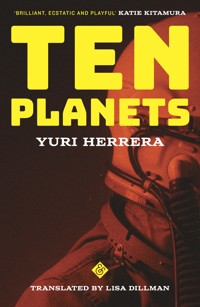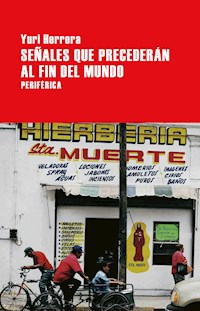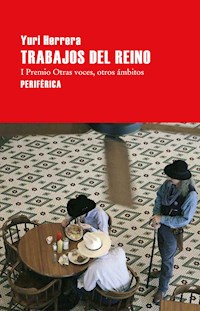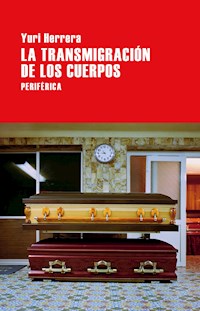9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Ein Meisterwerk … Unter den Schriftstellern meiner Generation ist Herrera der, den ich am meisten bewundere.« Daniel Alarcón, Autor von ›Lost City Radio‹ ›Der König, die Sonne, der Tod‹ versammelt drei Romane des Mexikaners Yuri Herrera, die ihn zu einem der eigenwilligsten lateinamerikanischen Erzähler der letzten Jahre machen. Die mexikanische Wirklichkeit, die wir aus den Nachrichten kennen – die Welt der Drogenkartelle, der sinnlosen Gewalt, der illegalen Einwanderer in den USA –, ist der Bodensatz, auf dem Herrera seine Geschichten ansiedelt. Auf berückende Weise gelingt es ihm, von Figuren zu erzählen, die sich in dieser Wirklichkeit bewegen und zugleich über ihr zu schweben scheinen – wie El Lobo, der die Tochter des Drogenbosses liebt; wie Makina, die auszieht, die Grenze zu queren; wie Alfaki, der nicht anders kann, als den Dreck wegzumachen. Es sind Erzählungen aus dem Inneren eines Landes, die sich weiten zur großen Erzählung über das Innerste unserer Welt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 304
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Yuri Herrera
Der König, die Sonne, der Tod
Mexikanische Trilogie
Aus dem Spanischen von Susanne Lange
FISCHER E-Books
Inhalt
Abgesang des Königs
Für Florencia
Er wusste Bescheid über das Blut und sah gleich, seines war anders. Allein wie der Mann den Raum ausfüllte, so seelenruhig, als wüsste er alles, als wäre er aus feinerem Garn gewebt. Von anderem Blut. Der Mann setzte sich an einen Tisch, und seine Begleiter bildeten hinter ihm einen Halbkreis.
Er bewunderte ihn im schalen Rest Tageslicht, der durch eine Lüftungsluke in der Wand sickerte. Noch nie war er in die Nähe dieser Leute gekommen, aber Lobo wusste, ihr Auftritt war ihm vertraut. Irgendwo stand die Ehrfurcht festgeschrieben, die der Mann und sein Tross ihm einflößten, das plötzliche Gefühl, in seiner Nähe wichtig zu werden. Er kannte diese Art, sich zu setzen, den Blick über alles hinweg, diesen Glanz. Er sah, wie er dort mit all seinem Schmuck thronte, und da wusste er: ein König.
Nur einmal war Lobo im Kino gewesen, und in dem Film hatte er so einen Mann gesehen: stark, prächtig, mit Macht über den Lauf der Welt. Er war ein König, und alles um ihn herum bekam einen Sinn. Die Männer kämpften für ihn, die Frauen gebaren Kinder für ihn, er beschützte und beschenkte, und kraft seiner Gnade hatte jeder im Reich seinen Platz. Aber die Begleiter dieses Königs hier waren nicht bloße Vasallen. Sie waren der Hofstaat.
Lobo empfand zuerst nagenden, dann beflügelnden Neid, denn auf einmal begriff er, dass dies der wichtigste Tag in seinem Leben war. Noch nie war er einem von denen nahe gewesen, die das Leben selbst ins Lot bringen. Hatte es nicht einmal gehofft. Seit ihn seine Eltern von wer weiß wo hergebracht und dann seinem Schicksal überlassen hatten, war das Dasein eine Strichliste von Tagen voll Staub und Sonne gewesen.
Eine verschleimte Stimme riss ihn aus der Betrachtung des Königs. Ein Saufbruder befahl ihm, zu singen. Lobo gehorchte, abwesend zunächst, denn noch immer hielt ihn die Erregung gepackt, doch auf einmal sang er sie sich aus dem Leib, wie er es selbst nicht für möglich gehalten hätte, schleuderte die Worte hervor, als kämen sie zum ersten Mal aus seinem Mund, überwältigt von der Freude, sie gefunden zu haben. Er spürte, wie der König hinter ihm aufmerksam lauschte, merkte, dass es still wurde in der Kneipe, die Leute die Dominosteine verdeckt auf die Blechtische legten und zuhörten. Er sang, und der Besoffene forderte: noch eins, und dann noch eins, noch eins, noch eins, und Lobo immer inspirierter, der Besoffene immer besoffener. Mal lallte er die Melodien nach, mal spuckte er ins Sägemehl oder lachte wiehernd im Chor mit seinem Saufkumpan. Schließlich sagte er: Genug, und Lobo hielt die Hand auf. Der Saufbruder zahlte, Lobo sah, es war zu wenig. Hielt wieder die Hand hin.
»Mehr gibt’s nicht, Singvogel, der Rest ist für ’n nächsten Rachenputzer. Kannst von Glück sagen, dass du so viel geschnappt hast.«
Daran war Lobo gewöhnt. Das kam vor. Er wandte sich schon mit einer Was-soll’s-Geste ab, als er hinter sich hörte:
»Bezahlen Sie den Künstler.«
Lobo drehte sich um und sah, dass die Augen des Königs den Saufbruder festnagelten. Er hatte es ganz ruhig gesagt. Ein simpler Befehl, aber der andere wusste nicht, wann Schluss war.
»Ein Künstler? Wo?«, sagte er. »Das Würstchen hier? Das hab ich schon bezahlt.«
»Kommen Sie mir nicht auf die witzige Tour, Freundchen«, die Stimme des Königs wurde härter, »bezahlen und Mund halten.«
Der Saufbruder stand auf und wankte zum Tisch des Königs. Der Tross ging in Angriffsstellung, doch der König blieb gelassen. Der Besoffene bemühte sich, ihn scharf ins Bild zu bekommen, und sagte dann:
»Sie kenne ich. Ich hab gehört, was man sich erzählt.«
»Ach ja? Was erzählt man sich denn?«
Der Saufbruder lachte. Fahrig kratzte er sich an der Wange.
»Nein, Ihre Geschäfte meine ich nicht, das weiß doch jeder … Ich meine das andere.«
Und er lachte wieder.
Das Gesicht des Königs verfinsterte sich. Er hob den Kopf, stand auf, hielt mit einem Wink seine Leibwache zurück, trat auf den Besoffenen zu und packte ihn am Kinn. Der versuchte sich loszureißen, ohne Erfolg. Der König flüsterte ihm ins Ohr:
»Nein, ich glaube nicht, dass du irgendwas gehört hast. Weißt du, warum? Leichen sind furchtbar schwerhörig.«
Er drückte ihm die Pistole auf den Wanst, als tastete er ihm nach den Därmen, und schoss. Ein simpler Knall, ohne Belang. Der Besoffene riss die Augen auf, griff nach einem Tisch, strauchelte, fiel zu Boden. Eine Blutlache wuchs unter seinem Körper hervor. Der König wandte sich an den Saufkumpan:
»Und Sie? Auch was zu sagen?«
Der Betrunkene nahm seinen Hut und floh, Nichts-gesehen sagten seine wedelnden Hände. Der König beugte sich über den Leichnam, fuhr ihm in die Tasche, zog ein Bündel Geldscheine hervor. Er nahm ein paar, gab sie Lobo und steckte den Rest zurück.
»Kassieren Sie, Künstler«, sagte er.
Lobo nahm die Scheine, ohne sie anzuschauen. Er fixierte den König, sog ihn in sich auf. Ließ ihn nicht aus dem Blick, als dieser seiner Leibwache ein Zeichen gab und ohne Eile die Kneipe verließ, wandte die Augen auch nicht von den schwingenden Türen. Von nun an, dachte Lobo, gab es einen neuen Grund für die Sinnlosigkeit der Kalender: Kein anderes Datum bedeutete mehr etwas, nur noch dieses, denn endlich hatte er seinen Platz in der Welt gefunden, hatte von einem Geheimnis gehört und hatte, verdammt nochmal, eine unbändige Lust, es für sich zu behalten.
Staub und Sonne. Allseits Schweigen. Ein verwahrlostes Haus, in dem keine Worte gewechselt wurden. Seine Eltern waren zwei Menschen, die im selben Winkel gestrandet waren und sich nichts zu sagen hatten. Deshalb stauten sich Lobo die Worte auf den Lippen, später in der Hand. Bei seinem Blitzbesuch in der Schule erahnte er die Harmonie der Buchstaben, den Rhythmus, der sie zusammen- und auseinandertrieb. Es war eine stille Heldentat, denn die Schrift an der Tafel verschwamm ihm vor den Augen, der Lehrer hielt ihn für einen Esel, und so verschloss er sich in der Einsamkeit des Schulhefts. Nur aus eigenem Antrieb konnte er noch erlernen, welche Gewohnheiten die Silben und Akzente regierten, bevor man ihn auf die Straße schickte, damit er seinen Unterhalt verdiente, Reime gegen Mitleid und Münzen feilbot.
Die Straße war ein feindliches Terrain, ein blindes Ringen, dessen Regeln er nicht verstand; er ertrug es, indem er tröstliche Liedzeilen in seinem Kopf wiederholte und die Welt mit Hilfe der Wörter um ihn herum bewohnte. Die Plakate, die Zeitungen an der Ecke, die Schilder waren sein Heilmittel gegen das Chaos. Er blieb auf dem Gehsteig stehen, ging ein ums andere Mal eine beliebige Ladung Wörter durch und vergaß so die wüste Umgebung.
Eines Tages drückte sein Vater ihm das Akkordeon in die Hand. Leidenschaftslos, als erklärte er ein Türschloss, brachte er ihm bei, wie man die rechten Knöpfe mit den Bässen auf der Linken kombinierte und wie die Luft im Balg durch Ziehen und Drücken den Klängen Farbe gab.
»Halt es gut fest, Mann«, sagte er ihm, »das ist dein Brot.«
Am nächsten Tag verschwand er nach drüben. Sie warteten vergeblich. Die Mutter folgte und versprach nicht einmal, zurückzukommen. Sie hinterließen ihm das Akkordeon, damit er in den Kneipen spielen konnte, und dort lernte er, dass der Bolero eine gefühlvolle Miene zulässt, man sich bei der Ballade, dem Corrido, jedoch in die Brust werfen und die Geschichte beim Singen darstellen muss. Ebenso lernte er folgende Wahrheiten: Das Dasein ist Zeit und Unglück, mehr nicht. Es gibt einen Gott, der sagt: So ist’s nun mal, ertrag es. Und vielleicht die wichtigste: Bloß weg von dem, der als Nächster kotzen wird.
Nie hatte er diese absurde Erfindung, den Kalender, beachtet, denn ein Tag glich dem anderen: von Tisch zu Tisch gehen, Lieder anbieten, die Hand aufhalten, Münzen in die Tasche stecken. Ein Tag verdiente nur einen Namen, wenn sich jemand seiner selbst oder der anderen erbarmte, den Revolver zog und die Warterei verkürzte. Oder als Lobo entdeckte, wie Haare und willkürliche Schwellungen an seinem Körper zum Vorschein kamen. Oder wenn sich Schmerzen den Weg durch seinen Kopf hieben und ihn für Stunden niederstreckten. Schlussstriche und Willkürlichkeiten dieser Art waren die einzigen Marksteine der Zeit. Darüber verging sie ihm.
Und über dem Erkunden des Bluts. Er konnte unterscheiden, wie das Blut bei dem Pack gerann, das ihn mit Komm-Kleiner-komm in dunkle Ecken locken wollte, wie zäh es in den Adern der Feiglinge stockte, die ohne Grund lächelten, wie es bei denen zu Wasser wurde, die mit der Jukebox immer wieder dieselbe Wunde aufrissen, und zu Bruchstein bei den finsteren Gestalten, die selbst Blut sehen wollten.
Nacht für Nacht kehrte Lobo in seinen Winkel zurück, wo er die Wände aus Pappe anstarrte und spürte, wie die Wörter in ihm wuchsen.
Er begann, Lieder über das zu schreiben, was anderen passierte. Von der Liebe wusste er nichts, war jedoch auf dem Laufenden, packte sie in Redensarten und Allerweltsweisheiten, unterlegte sie mit Noten und verkaufte sie. Aber was er bot, war eine Nachahmung, ein Spiegelbild des Lebens, das man ihm erzählte. Obwohl er ahnte, dass die Lieder mehr hergaben, fand er nicht die Triebfeder, es war doch alles gesagt, wozu also? Es blieb kaum mehr als warten, weitermachen, warten. Worauf? Auf ein Wunder.
So hatte er sich einen Palast immer vorgestellt. Mit Säulen, Statuen und Gemälden in jedem Raum, mit fellbedeckten Sofas, goldenen Klinken, einer Decke, die nicht zu erreichen war. Und überall Menschen. Was da alles im Laufschritt durch die Gänge eilte. Hin und her, mit Aufträgen oder um sich zur Schau zu stellen. Menschen von überallher, von jedem Ort der bekannten Welt, Menschen von jenseits der Wüste. Manche hatten, heiliges Ehrenwort, sogar das Meer gesehen. Frauen glitten wie Leoparden dahin, hünenhafte Krieger trugen ihre Narben wie Orden im Gesicht, es gab Indios und Schwarze, selbst einen Zwerg sah er. Er trat zu den Grüppchen, spitzte die Ohren, hungrig nach Wissen. Von Kordilleren, Urwäldern, Golfen und Bergen hörte er in einem Singsang, der ihm noch nie zu Ohren gekommen war: das Ypsilon wurden zu Sch, das S verschwand aus den Wörtern, mal hob und senkte sich die Melodie, als reiste jeder Satz über Berg und Tal, man merkte gleich, die stammten nicht vom flachen Land.
Früher einmal war er in diese Gegend gekommen, mit seinen Eltern noch. Aber damals war es eine Müllkippe gewesen, ein Morast aus Krankheit und Dreck. Wie hätte er ahnen können, dass ein Leuchtturm daraus werden würde? Genau das bewies die Hoheit eines Königs: Der Mann hatte sich unter dem einfachen Volk niedergelassen und den Schmutz in Pracht verwandelt. Wer näher kam, sah einen Wüstenausläufer, den der Palast in einer Herrlichkeit aus Mauern, Gittern und weitläufigen Gärten aufbrechen ließ. Eine glorreiche Stadt am Rande jener anderen, die bloß Straße für Straße ihr eigenes Unglück zu wiederholen schien. Hier aber drückte, wer kam und ging, die Schultern durch, gepackt von der Würde, einer blühenden Macht anzugehören.
Der Künstler musste einfach bleiben.
Er hatte erfahren, dass abends ein Fest stattfand, sich zum Palast aufgemacht und seinen einzigen Trumpf gezogen:
»Ich will für euren Chef singen.«
Die Wächter musterten ihn wie einen streunenden Hund, machten nicht mal den Mund auf. Der Künstler erkannte einen, der in der Kneipe dabei gewesen war, und merkte, dass auch der ihn erkannte.
»Sie haben gesehen, meine Lieder gefallen ihm. Lassen Sie mich für ihn singen, er wird’s Ihnen danken.«
Der Wächter runzelte kurz die Stirn, als malte er sich Reichtümer aus. Dann ging er zum Künstler, stieß ihn gegen die Wand und tastete ihn ab, überzeugte sich, dass er harmlos war und sagte:
»Sieh bloß zu, dass es ihm gefällt.« Er zog ihn ins Innere, und als der Künstler schon weiterging, warnte er ihn noch: »Wer’s hier vermasselt, ist verratzt.«
Als das Fest begann, wusste er nicht, wohin mit sich, und ging einfach unter den Gästen umher. Dann fing die Musik zu spielen an, ein Horizont von Hüten tat sich auf, die ins Gerangel auf der Tanzfläche stürmten. Die Paare schmiegten sich aneinander, und der Künstler wurde zum Spielball ihrer Arme und Hüften. Ein heißes Getümmel, das spürte er. Er schlug sich in die eine Richtung, ein Pärchen machte drei Schritte in dieselbe, er schlug sich in die andere, das nächste rempelte beim Drehen in ihn hinein. Endlich erwischte er einen Winkel, wo er zuschauen konnte, ohne ein Hindernis zu sein: all die imponierenden Hüte, die sanfte Gewalt, mit der sich die Schenkel schoben, all der Goldschmuck, der überall glänzte.
So, mit offenem Mund, traf ihn die Frage:
»Gefällt der Anblick, Meister?«
Der Künstler sah hinter sich einen aufgedunsenen, eleganten Mann, fast blond, der von seinem Platz aus eine Na-was?-Geste vollführte. Er nickte. Der andere deutete auf einen Stuhl neben sich und streckte ihm die Hand hin. Er nannte einen Namen und fügte hinzu:
»Juwelier. Was hier an Gold zu sehen ist, das habe ich gemacht. Und Sie?«
»Ich mache Lieder«, sagte der Künstler. Und kaum hatte er’s gesagt, da war ihm, als sollte er von nun an seinem Namen anhängen: Künstler, ich mache Lieder.
»Heben Sie einen, Meister, hier gibt’s genug, um Feuer zu tanken.«
Ja, das war ein Bankett. Auf jedem Tisch stand Whisky, Rum, Brandy, Tequila, Bier zuhauf und jede Menge Sotol, an Großzügigkeit sollte es nicht hapern. Junge Mädchen im schwarzen Minirock füllten das Glas bis zum Überlaufen, sobald man’s nur hob, und wer wollte, konnte zu einem Tisch gehen und sich nach Herzenslust selbst bedienen. Außerdem roch es verheißungsvoll nach Gegrilltem und Zicklein. Eine Kellnerin drückte ihm ein Glas Bier in die Hand, aber er trank nicht davon.
»Glauben Sie nicht, hier geht’s immer so rund«, sagte der Juwelier, »der Herr feiert gern beim Volk, in schäbigen Sälen, bloß heut ist ein besonderer Tag.«
Er schaute sich nach allen Seiten um, bevor er dem Künstler die große Neuigkeit eröffnete, die doch jeder schon wusste:
»Zwei Capos kommen, sollen ein Bündnis schnüren, und die muss man hätscheln, ohne zu knausern.«
Der Juwelier lehnte sich befriedigt zurück, und der Künstler nickte und schaute wieder. Er beneidete die Gäste nicht um die ziselierten Gürtelschnallen, nicht um die Stiefel aus Schlangenleder, sosehr sie ihm ins Auge sprangen, dafür aber die Musiker auf der Bühne um ihre Galatracht, um die Hemden mit den Lederfransen und dem Muster aus schwarzweißen Sporen. Unweit der Band, von wo sich bequem die Lieder bestellen ließen, entdeckte er den König, die Majestät in seinen gemeißelten Wangenknochen. Lauthals lachte er mit zwei Herren, die ebenfalls Macht ausstrahlten, aber nein, nicht mit der Kraft, nicht mit der Autorität des Königs. An seinem Tisch saß noch jemand, der damals auch in der Kneipe dabei gewesen war: unauffälliger gekleidet als die hohen Herren oder wie ein Auswärtiger, ohne Hut, ohne Gürtelschnalle.
»Das ist der Vize«, sagte der Juwelier, der sah, wohin er sah, »rechte Hand vom Herrn. Unerschrocken, der Kerl, hat Mumm im Sack, trägt aber die Nase ziemlich hoch.«
Muss er, dachte der Künstler, wenn er der Erbe ist.
»Erzählen Sie nicht, dass Sie’s von mir haben, Meister«, fuhr der Juwelier fort, »bloß keinen Klatsch verbreiten. Hier stellt man sich gut mit allen, dann fährt man auch gut. Wie jetzt grad, schon sind wir beide Freunde, was?«
Etwas im Ton des Juweliers warnte den Künstler, der nicht mehr nickte. Der Juwelier schien es zu merken, denn er wechselte das Thema. Er fertige Schmuck bloß auf Bestellung an, was immer der Kunde verlange. Als Künstler sollten Sie es auch so machen. Alle müssten gut bei ihm wegkommen. Gerade wollte der Künstler antworten, als derselbe Wächter kam, der ihn hereingelassen hatte.
»Los, Sie sind dran«, sagte er, »rauf mit Ihnen, die Jungs begleiten Sie.«
Der Künstler stand erschrocken auf und ging zur Bühne. Seinen Weg streiften flüchtig Gestalt und Duft einer Frau, anders als die anderen; umblicken wollte er sich nicht, doch ihm blieb ein heißes Gefühl. Er stellte sich zwischen die Musiker, bat sie: Spielt mir einfach nach, und legte los. Die Geschichte war nicht neu, aber noch keiner hatte sie besungen. Durch Fragen über Fragen war er zu ihr gelangt, nur, um sie niederzuschreiben und dem König zu schenken. Er besang seinen Schneid und sein Herz, beide im Kugelhagel auf die Probe gestellt, mit glücklichem Ausgang nicht nur für den König, sondern auch für die armen Teufel, für die er immer Sorge trug. Unter der gewaltigen Kuppel schwoll seine Stimme an wie nie zuvor in den Kneipen. Er sang die Geschichte hingebungsvoll wie eine Hymne und energisch wie ein Ausrufer, aber vor allem machte er sie anschmiegsam, damit die Leute sie mit Beinen und Hüften lernten und später wiederholen konnten.
Am Ende überhäufte ihn die Menge mit Gejohle und Beifall, die eleganten Musiker klopften ihm auf die Schulter, und die Herren, die dem König Gesellschaft leisteten, nickten bereitwillig und verzogen dabei (wie der Künstler sich einbildete) die Lippen voll Neid. Er verließ die Bühne, um seine Reverenz zu erweisen. Der König schaute ihm in die Augen, und der Künstler senkte den Kopf.
»Ein Blick, und ich wusste, Sie haben Talent«, sagte der König, der bekanntlich nie ein Gesicht vergaß. »Gelingen Ihnen alle so gut, Künstler?«
»Man bemüht sich«, stammelte der.
»Kopf hoch, schreiben Sie, halten Sie sich an die Guten hier. Werden gut damit fahren.« Er winkte einen Mann in der Nähe heran und sagte: »Kümmere dich um ihn.«
Der Künstler verbeugte sich noch einmal, folgte dem Mann und hätte am liebsten losgeweint, blind vor Lichtern und Zukunft. Dann atmete er tief durch, sagte sich, ja, das passiert wirklich, und fand auf die Erde zurück. Da fiel ihm die Gestalt wieder ein, die ihn gelockt hatte. Er hielt nach ihr Ausschau. Währenddessen redete der Mann:
»Ich bin der Geschäftsführer. Für die Rechnungen zuständig. Vom Herrn verlang niemals Geld, nur von mir. Morgen bringe ich dich zum Tonmeister, dem gibst du nach und nach, was du so schreibst«, der Geschäftsführer hielt inne, als er merkte, dass der Künstler die Augen schweifen ließ. »Und Finger weg, von dem, was dich nichts angeht, such dir keines andern Frau.«
»Und die da, wem gehört die?« Der Künstler zeigte auf ein aufgemachtes junges Ding, nur zur Ablenkung.
»Die«, sagte der Geschäftsführer leicht zerstreut, als hätte er anderes im Sinn, »die gehört dem, der sie braucht.«
Er drehte sich zum Künstler um, maß ihn von oben bis unten, rief dann die Kleine und sagte:
»Der Herr ist mit dem Künstler hier zufrieden, sieh zu, dass du ihn gut behandelst.«
Von einer absurden Panik gepackt, voll Angst vor dem, was er sogleich erahnte, aber noch mehr davor, dass jener andere Duft sehen könnte, wie er sich da hingab, nahm der Künstler die zarte Hand der Kleinen und ließ sich aus dem Saal führen.
Was hieß nur, dass man schon mal hier gewesen war, in einem anderen Leben? Dass Gott jedem seine Bürde für Jahrhunderte auferlegt hatte? Der Gedanke hatte dem Künstler eine Zeitlang schlaflose Nächte bereitet, bis er im Palast auf ein Sinnbild gestoßen war, das ihn frei davon machte: ein Schmuckstück von Plattenspieler mit Diamantnadel, der dem Juwelier gehörte und den dieser an einem Wochenende versehentlich hatte laufen lassen. Zwei Tage später, als er es merkte, war das Gerät kaputt.
So ist es, dachte der Künstler, so sind wir. Ein Apparat, den man vergisst. Vielleicht hatte Gott die Nadel aufgesetzt, war dann aber fortgegangen, um seinen Kater auszuschlafen. Der Künstler wusste bereits, dass es niemanden oben im Himmel oder unten in der Erde gab, der ihn beschützte, jeder war sein eigener Schutzpatron, aber hier am Hof wurde ihm klar, dass man auf seine Kosten kommen konnte, bevor der Diamant zu Staub zerfiel. Nicht bloß warten.
Das Geschenk des Königs ein paar Tage zuvor war der Wink gewesen, dass die Warterei vorüber war.
Das Blut der Kleinen war ein Rinnsal zwischen Kieselsteinen, doch ihr Körper entfaltete eine so verblüffende Gewandtheit, dass der Künstler zwei ganze Tage lang nicht mehr zu Atem kam. Du lernst es allmählich, sagte sie, und nach jedem Taumel wollte er sterben oder heiraten und weinte. Wie viel Welt verhieß ihm die Kleine selbst in ihrer Art zu reden, die nicht von hier war, und sie lachte: Dir musste man erst auf die Hühneraugen treten, damit du in die Gänge kommst, Sänger. Auch sie hatte der König gerettet, hatte sie aus einem Dreckloch bei der Brücke geholt, wo sie anschaffte, und in den Palast mitgenommen. Die Kleine machte ihrer Begeisterung mit einem Haufen frisch gelernter Wörter Luft:
»Hier zu sein ist cool, Sänger, ist spitze, genial, famos, der Wahnsinn, Sänger, einfach geil, von überall kommen sie her, und allen gefällt es.«
Wie sehr sie auch das Glück heraufbeschwor, sie hatte doch, das sah der Künstler in ihren Augen, ebenso Hunger auf andere Zärtlichkeiten, die nicht im Palast zu haben waren.
Anfangs konzentrierte sich der Künstler fast ausschließlich aufs Essen. Vom ersten Tag an erschien er pünktlich im Speisesaal zur Mittagspause der Wächter und aß mit ihnen. Aber sein Hunger hatte so lange gelauert, dass er davon nur angestachelt wurde. Die Kleine empfahl ihm, es wie sie zu machen, als sie ebenfalls nach Jahren chronischer Magenleere hergekommen war: nach dem Mittagessen des Königs in den Speisesaal zu gehen, wo dieser ebenfalls aß, manchmal sogar gemeinsam mit den anderen, und die Gerichte aufzuessen, die er nicht angerührt hatte. Davon gab es immer mehrere, und der Koch ließ zu, dass man sich darüber hermachte, sofern man sie nicht in andere Palastflügel entführte.
Während all der Stunden im Speisesaal lauschte der Künstler immer aufmerksamer den Geschichten, mit denen man die Zeit nach Tisch ausdehnte, und konnte seine Lieder mit immer mehr Stoff unterfüttern.
»Wenn man mich reinlegen will, werd ich wild«, sagte ihm einer, »drum hab ich letzte Woche einem Packesel, der mich billig abspeisen wollte, mit einer Zange die Daumen abgezwackt, war nicht nötig, ihn kaltzumachen, aber so einfach sollten ihm die Scheine nicht mehr durch die Finger flutschen, dem Schweinehund, was?«
»Mann«, sagte ein anderer, »was bin ich für ein sentimentaler Kerl. Damit ich mich an all die lieben Leichen erinnere, die auf mein Konto gehen, stecke ich mir von jeder einen Zahn ein und klebe ihn ans Armaturenbrett meines Pick-ups, mal sehen, wie viele Lachmünder ich zusammenkriege.«
Sie liebten sich wie Brüder, zwickten sich in den Bauch, gaben sich Spitznamen. Einen Wächter, den sie dabei überrascht hatten, wie er an ein Lämmchen ankoppelte, nannten sie den Heiligen, weil ihn die Tiere liebten.
»Heiliger, Heiliger«, neckten sie ihn, »du bist mir ein Gauner, ich merk grad, dass das Grillfleisch nach dir schmeckt.«
Ein armer Dickwanst, dem man aus Rache die Arme abgequetscht hatte, machte nun Botengänge mit einem Rucksack, in den Nachrichten gesteckt wurden, die er im ganzen Palast verteilte. Ihn nannten sie den Gefährlichen. Sobald ein Wächter ihn kommen sah, rief er, Gefahr!, Gefahr! Und der Gefährliche lachte.
Der Künstler merkte, dass sie auf ihn bloß achteten, wenn er sang oder wenn sie loswerden wollten, was für tolle Scheißkerle sie waren, und das war gut so, denn dadurch lernte er den Hofbetrieb kennen. Wie eine Katze im fremden Haus wagte er sich nach und nach über den Speisesaal und das Zimmer der Kleinen hinaus. Ständig verlief er sich. Der Palast war ein einfaches Geviert mit Innenhof, besaß jedoch so viele bizarre Gänge, dass er sich zu einem Ort aufmachte, doch am anderen Ende des Gebäudes herauskam. Damit ihn die Pracht im Palast nicht einschüchterte, hatte es sich der Künstler angewöhnt, einen Taschenspiegel der Kleinen mitzunehmen und sich darin all die Einzelheiten hinter seinem Rücken anzusehen: die gedrechselten Möbel, die schmiedeeisernen Türen, die Kandelaber. So konnte er auch unbemerkt die Besucher beobachten, die mit Anzug und Aktentasche aus den Städten kamen, Polizisten, die sich ihr Handgeld abholten, das Geschäft, das niemals ruhte. Wie unsichtbar sein war das.
Er fand heraus, dass dort außer dem König, seiner Leibwache, den Mädchen und Dienstboten noch andere Höflinge lebten. Auf Schritt und Tritt traf er den Geschäftsführer, immer besorgt, dass alles reibungslos lief. Der brachte ihn auch mit der Band zusammen, die seine Texte einspielte, damit er überprüfen konnte, ob sie auch so klangen, wie er sie in seinem Kopf gehört hatte; ja, er nahm sogar selbst ein Lied auf.
»Der Journalist kennt welche beim Radio, der bringt die Musik unter die Leute«, sagte ihm der Geschäftsführer.
Ein einziges Mal kehrte der Künstler zu seiner Bleibe zurück, um die Papphütte nicht den Hunden zu überlassen, aber da man ihn im Palast nicht zu bemerken schien oder sich an ihn gewöhnt hatte, holte er seine paar Habseligkeiten, ein Heft mit seinen Texten, eine Ausgehweste, und blieb.
Keinem am Hof versagte er seine Künste. Er komponierte einen Corrido auf den Gringo vom Dienst, der ein Händchen dafür hatte, Transportwege für die Ware zu finden. Er hatte sich an eine Clique Jungs gehängt, die auf der Suche nach einem guten Trip jeden Freitag rüberkamen, um sich diesseits der Mauer zuzudröhnen. Ich passe schön auf euch auf, mein Wort, sagte er, und aufs Wort glaubten sie ihm. Am meisten über die Stränge schlug der sommersprossige Sohn eines Konsuls, den der Gringo mit wahrer Vaterliebe nach Hause zurückschickte, die Wagensitze vollgestopft mit gutem Gras. Das Geschäft lief wie geschmiert, bis der Sommerspross in einer üblen Absteige verschüttging. Ein klasse Lied. Er komponierte auch eines auf den Doktor, den Hofarzt, der für den König einen Killer behandeln sollte, dessen Bauch von Gewehrkugeln durchsiebt worden war. Der Kerl war ein Verräter, wusste aber nicht, dass man Bescheid wusste. Der Doktor versorgte ihn und gab ihm noch ein Geschenk für die mit auf den Weg, die ihn gekauft hatten. Als der falsche Hund zu seinen Bossen ging, explodierte im genau berechneten Moment das vergiftete Geschenk im Magen, und alle verreckten. Er komponierte auch dem Nordlicht eins, der ständig wiederholte, als wär’s sein Zuname: Ich habe nicht die Grenze überquert, die Grenze verläuft quer durch mich. Das Nordlicht war drüben Polizist gewesen, bis er bei einem Hinterhalt von der Gerechtigkeit erleuchtet wurde: Drei seiner bisherigen Kumpane hatten den König umzingelt, der sich schon auf einen ehrenvollen Tod vorbereitete, bevor man ihn zu fassen bekam, da fuhr dem Nordlicht eine Stimme ins Ohr, die sagte: Weshalb musst du auf dieser Seite stehen? Also leerte er sein Magazin auf die Häscher in Uniform und stand von da an auf der Seite der Guten.
Keinem am Hof versagte der Künstler seine Künste, erzählte jedoch die Heldentat eines jeden, ohne zu vergessen, wer sie ermöglicht hatte. Ja, du bist ein toller Hecht, weil der König es dir erlaubt. Ja, du bist ein mutiger Held, weil der König dich anspornt. Er erwähnte ihn bloß in den Liebesliedchen nicht, die manch Höfling flüsternd bei ihm bestellte. Danach klopften sie ihm auf die Schulter oder packten ihn am Nacken und sagten: Wenn ich mal behilflich sein kann, Künstler. Natürlich musste der König ebenso wenig erwähnt werden, wenn es um ein paar Auftragszeilen ging. Etwa: Keine Angst wegen der Polizeikontrolle, da haben wir unseren Kommissar – Kommissar mit Doppel-m und Doppel-s; oder: Tragen Sie Ihre persönlichen Angaben in den falschen Pass ein. Der Künstler wusste sich nützlich zu machen. Und er wusste sich zu behaupten. Wenn er sagte: Jetzt nicht, ich schreibe ein Lied, dann respektierte der Höfling das.
Nur zwei am Hof baten ihn nicht um einen Corrido. Und hatten weiß Gott einen verdient. Er sah die beiden auf einem Palastbalkon beim Whiskytrinken. Als er dem Erben sagte, dass er seine Geschichte fast fertig habe, erwiderte der: »Später«, biss die Zähne zusammen, als wollte er weitere Worte zurückdrängen, und wiederholte bloß, »später.«
Es lief einem kalt den Rücken runter beim Erben, denn so makellos seine einfarbigen Hemden stets waren, in seinen Augen lauerte eine Explosion. Er hielt sich gewaltsam im Zaum wie jemand, der ganz allein auf sich gestellt ist.
Und der andere, der nicht wollte, der Hüter des königlichen Namens, der Journalist, sagte ihm:
»Lieber nicht, wenn Sie mein Konterfei liefern, bin ich zu nichts mehr nutze. Denken Sie nur, wenn man draußen herausfindet, wo ich stecke, wer glaubt mir da noch, dass ich nichts weiß?«
Der Künstler verstand. Der Journalist hatte eine Aufgabe, da durfte er nicht stören. Um die Einfältigen mit sauberen Lügen zu zerstreuen, musste er sie als Wahrheiten erscheinen lassen. Sein eigenes Terrain waren dagegen die wahren Nachrichten, der Stoff der Corridos, und es gab so viele zu besingen, dass es um die nicht schade war, die dem König nichts nutzten.
»Seien Sie nicht böse«, sagte der Journalist, »hat nichts mit Ihnen zu tun. Ja, ich möchte Ihnen, wo Sie so gern schreiben, ein paar Bücher geben.«
Dem Künstler wurde es flau im Magen vor Aufregung, aber er war gewöhnt, es zu verbergen, und keiner merkte es.
»Die werden Ihnen gefallen«, sagte der Journalist, »wem die Wörter schmecken, der kann sich da genüsslich mit den Ohren besaufen.«
Da wandten die drei den Kopf, denn der König kam den Gang entlang, mit eiligem Zorn und Ringen unter den Augen. Ihm folgte eine Frau mit langem Kleid und langem Haar voll grauer Strähnen, derb und boshaft wirkte sie. Der König blieb kurz stehen, drehte sich zu ihnen um, wie überrascht, sie drei dort anzutreffen, ging dann weiter und verschwand im Zimmer am Ende des Gangs. Es ist alles bereit, sagte die Frau und trat ebenfalls ein. Sie schlugen die Tür hinter sich zu.
Seit dem Fest hatte der Künstler den König nicht mehr gesehen. Aber sein Anblick hatte ihm nicht gefehlt, denn er war allgegenwärtig: in der Ehrfurcht, mit der man von ihm sprach, in seinen Befehlen, die erfüllt wurden, im Glanz, den der Ort verbreitete.
»Die sind wieder zur andern Seite raus«, sagte der Journalist, nahm einen Schluck. »Geht’s um den Verräter, oder ist’s die alte Geschichte?«
Der Erbe umklammerte das Glas, nickte und gab damit keinerlei Antwort.
»Diese Hexe«, murmelte er schließlich. Und als er schon nichts mehr sagen zu wollen schien: »Aber das wird sich ändern.«
Der Künstler, der den Mund halten konnte, schaute starr Richtung Wüste, bis die anderen sich im Palast verloren hatten. Dann beobachtete er mit der Geduld einer Raubkatze die Tür, durch die der König und die Hexe verschwunden waren. Nichts war zu hören. Er trat näher, suchte im Licht, das unten durch die Ritze fiel, nach Schatten, legte sein Ohr an. Nichts. Er wusste, dass er dort nichts zu suchen hatte, doch der Drang war stärker als die Furcht, und er wollte schon mit hämmerndem Herzen öffnen, doch seine Hand hielt inne, bevor sie die Klinke berührte, und schnell zog er sie zurück, als könnte er sich verbrennen.
Er machte sich auf zur Kleinen. Auf dem Weg zu ihrem Zimmer bemerkte er wieder den Duft von damals, und hinter der nächsten Ecke nahm der Duft für ein paar Sekunden Gestalt an. Zunächst als ein Windstoß aus Hochmut, als ein Augenpaar, das ihn verschlang und wieder ausspie, dann als harmonisches Spiel von langem Pferdeschwanz und einem Rücken, der sich wie die Spitze einer Locke bog, und schließlich als eisiger Hauch, der ihm die Eingeweide gefrieren ließ. Instinktiv setzte er seinen Weg fort, ohne zu denken, in Trance, wie mechanisch, und als er zur Kleinen gelangt war, fragte er sie nach der Intrige, auch wenn er schon nicht mehr an sie dachte. Sie erzählte:
»Es heißt, einem seiner Stellvertreter gefällt die neue Abmachung nicht, weiß nicht genau, der soll Koks in Umlauf bringen, ohne Erlaubnis des Herrn, stell dir vor. Unverantwortlich ist so was, herkommen und den Frieden stören … Und mit dir, was ist mit dir los?«
Der Künstler atmete tief durch und stellte nun doch die Frage, die ihn bedrängte:
»Wer ist sie?«
Die Kleine brauchte keine Erklärung. Nach einem Moment wütenden Schweigens sagte sie:
»Eine x-Beliebige.«
Sie sind. All die Buchstaben. Die seinen. Dort hingesetzt zum alleinigen Zweck, den Kopf zu befruchten. Sie sind. Sie zermahlen das Blatt zwischen Walzen aus Schlaflosigkeit, sie mahnen, sie zerwühlen das brachliegende Weiß des Papiers und des Blicks. Was war das Blatt früher anderes als ein Werkzeug, wie die Säge, wenn er sich an Tischen, wie das Schießeisen, wenn er sich am Leben zu schaffen gemacht hätte? Aber niemals dieser Abgrund im Sand, so voller Kraft und Wissenswertem. All die Buchstaben da. Sie sind. Sind ein Blitzstrahl. Wie sie einander anrempeln und aufsaugen und das Auge in einen Wirbel von Gründen stürzen. So vollkommen sie sein mögen, sie sind ebenso stur, klagen einander an, voll Furcht vor dem Chaos: Wörter. So viele Wörter. Die seinen. Ein Gerangel von Zeichen, die sich verbinden. Sie sind ein beständiges Licht. Sie sind. (Er wusste von den Büchern zwar, doch hatten sie ihn abgewiesen wie ein sprödes Vaterland. Und nun ließ er sich an der Hand zur Vorratskammer der Geheimnisse führen. Ein beständiges Licht.) Jedes hat einen anderen Glanz, jedes nennt den wahren Namen auf seine Weise. Selbst die lügnerischsten, selbst die launischsten. Jawohl. Nein. Sie sind nicht nur da, um den Kopf zu befruchten. Sie sind ein beständiges Licht. Der Weg zu anderen Papphütten, weit weg von hier. Der Abstieg in verborgene Gehörgänge, hier. (Wie die Viecher in seinem Innern.) Nein. Sie sind nicht bloß da, um das Auge zu füttern oder das Ohr zu füllen. Sie sind ein beständiges Licht. Ergießen sich wie das eines Leuchtturms über die Steine, ganz zu seiner Verfügung, sie sind ein Leuchtfeuer, das wandert, innehält, die Erde streichelt und ihm enthüllt, wie die Aufgabe vollenden, die ihm auferlegt wurde.
An dem Tag, als man dem Nordlicht den Schädel durchbohrte, meldeten sich beim Künstler, wie als Vorzeichen, die Schmerzen zurück, die den seinen spalteten, seit er ein Knirps gewesen war. Wie ein Schlägerhieb, der ihn niederstreckte. Dann dröhnte ihm selbst Grillenzirpen wie ein Donner in den Ohren, und keine Mixtur verschaffte Linderung. So erschrocken war die Kleine, dass der Doktor kam und eine Diagnose in den Pupillen des Künstlers suchte, der sagte: Lassen Sie mich, Doc, lassen Sie mich, gleich ist’s vorbei, er fragte ihn, seit wann, wie oft, wodurch, verschrieb ihm Beruhigungspillen, sagte aber:
»Da sind Untersuchungen nötig, ich spreche mit dem Geschäftsführer, der regelt das mit dem Krankenhaus, bis dahin nehmen Sie die Arznei.«
Von wegen Arznei, von wegen nehmen. Nicht mal lauwarmes Wasser ließ der Künstler sich einflößen, denn er begriff: aushalten, es ist, wie’s ist. Wenn andere Balsam für Seele oder Körper fanden, ihre Sache; er regierte seine Eingeweide lieber selbst. Heilmittelchen hatte er schon probiert. Ein paar dieser vermögenden Saufbrüder, die nach einer Flasche und drei Liedern ewige Freundschaft schwören, hatten ihm Stoff gegeben. Dem Künstler waren die Wände in die Ferne gerückt, und die Musik, seine Musik, hatte ihm wie ein Stöhnen geklungen. So sehr schockierte es ihn, seinen Körper nicht zu spüren, dass er beschloss, niemals mehr Gift zu nehmen, so gut man ihm auch zureden mochte. Ja, ja, wedelten seine Hände dem Doktor zu, damit der ihn in Ruhe ließ, dann schlief er ein.
Ein paar Stunden später erwachte er mit einer entsetzlichen Klarheit im Kopf, die ihm schon bei den ersten Schreien sagte, dass ein Unglück geschehen war.