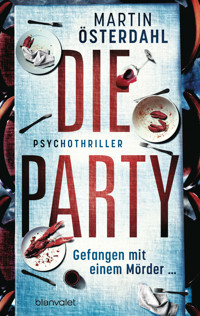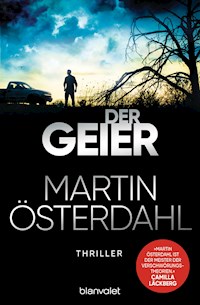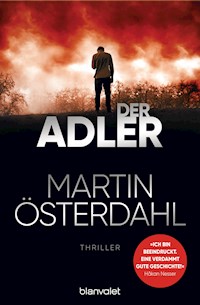9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Max Anger
- Sprache: Deutsch
Sankt Petersburg: Eine junge Frau verschwindet spurlos. Stockholm: Ein Hackerangriff legt das Mobilfunknetz lahm. Russlandexperte Max Anger ermittelt!
Paschie, Mitarbeiterin einer schwedischen Denkfabrik, verschwindet in Sankt Petersburg spurlos. Zeitgleich legt ein Hackerangriff das schwedische Mobilfunknetz lahm. Max Anger, Paschies Freund und Kollege, unterbricht die Nachforschungen zu seiner Familiengeschichte, um sie zu suchen. Ihm bleibt nicht viel Zeit, will er die Frau, die er liebt, lebend wiedersehen. Denn Paschie ist einem gefährlichen Mann in die Quere gekommen. Als Max entdeckt, dass es eine Verbindung zwischen Paschies Verschwinden, dem Hackerangriff und seiner eigenen Vergangenheit gibt, ist es fast zu spät …
Die »Max Anger«-Trilogie:
Band 1: Der Kormoran
Band 2: Der Adler
Band 3: Der Geier
Alle Bände sind eigenständige Fälle und können unabhängig voneinander gelesen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 582
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Buch
Paschie, Mitarbeiterin einer schwedischen Denkfabrik, verschwindet in Sankt Petersburg spurlos. Zeitgleich legt ein Hackerangriff das Mobilfunknetz in Stockholm lahm. Max Anger, Paschies Freund und Kollege, unterbricht die Nachforschungen zu seiner Familiengeschichte, um sie zu suchen. Ihm bleibt nicht viel Zeit, will er die Frau, die er liebt, lebend wiedersehen. Denn Paschie ist einem gefährlichen Mann in die Quere gekommen. Als Max entdeckt, dass es eine Verbindung zwischen Paschies Verschwinden, dem Hackerangriff und seiner eigenen Vergangenheit gibt, ist es schon fast zu spät …
Autor
Martin Österdahl, aufgewachsen in Stockholm und London, hat BWL, Zentral- und Osteuropäische Geschichte und Russisch (Master of Science) studiert. Er arbeitete über zwanzig Jahre für TV-Produktionen und war gleichzeitig Programmdirektor eines schwedischen Fernsehsenders. Mit seiner deutschstämmigen Frau und den drei gemeinsamen Kindern lebt er außerhalb Stockholms. Der Kormoran ist sein Debütroman rund um den charismatischen schwedischen Agenten Max Anger.
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag.
MARTIN ÖSTERDAHL
DER KORMORAN
Thriller
Deutsch von Leena Flegler
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen. Die Originalausgabe erschien 2016 unter dem Titel »Be inte om nåd« bei Bokförlaget Forum, Stockholm.
Copyright der Originalausgabe © 2016 Martin Österdahl
First published by Bokförlaget Forum, Schweden
Published by arrangement with Nordin Agency AB, Schweden
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2018 by Blanvalet in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Nike Müller
Umschlaggestaltung: © www.buerosued.de
Umschlagmotiv: © plainpicture/Goto-Foto/ Neville Mountford-Hoare
JaB · Herstellung: sam
Satz: Vornehm Mediengestaltung GmbH, München ISBN 978-3-641-20695-6 V002 www.blanvalet.de
Für Ellina
Prolog
Den ganzen Weg von der Uni bis zur Straße am Gribojedow-Kanal fuhr ihr ein schwarzer Mercedes nach. Er blieb hinter ihr und verfolgte sie, als sie auf den Newski-Prospekt einbog. Max hatte ihr immer eingeschärft, sie müsse vorsichtig sein, wenn sie in der Dunkelheit allein unterwegs sei, aber wie sollte sie sich ständig umschauen, ohne sofort aufzufallen?
Sie ging schon, so schnell sie konnte, ohne in den Laufschritt zu verfallen. Ihr Verfolger sollte nicht merken, dass er ihr aufgefallen war. Den Umschlag mit dem Buch presste sie unter ihrem Mantel fest an sich. Er durfte unter keinen Umständen in falsche Hände geraten.
Als sie den U-Bahnhof am Gostiny Dwor erreichte, eilte sie in Richtung Gleis und versuchte dort, zwischen den anderen Reisenden unterzutauchen. An der Majakowskaja stieg sie um in die Rote Linie. Bis zum früheren Fernbahnhof nach Finnland spürte sie, wie ihr der Schweiß den Rücken hinabrann. Sie atmete erleichtert aus, als sie sah, dass der Zug, der sie aus der Stadt bringen sollte, noch am Gleis stand.
Kaum dass sie eingestiegen war, setzte der Zug sich in Bewegung. Doch erst als er die Innenstadt hinter sich ließ und in Richtung Vororte rollte, ging ihr Atem ruhiger. Von dem Bahnhof gingen jede Menge Züge ab, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Unwahrscheinlich, dass er sie trotz des Umsteigens und der Menschenmassen bis in ihren Zug verfolgt hatte.
Vielleicht hatte sie sich das alles auch nur eingebildet? Und sich von den Warnungen des Journalisten ins Bockshorn jagen lassen?
»Lass die Finger davon. Komm diesem Unternehmen nicht zu nahe.«
Aber sie hatte nicht die Finger davon lassen können.
Als sie vierzig Minuten später aus dem Zug stieg, stach ihr sofort der Mercedes ins Auge. Sie musste sich zusammenreißen, um nicht in Panik zu geraten, zog im Gehen den Umschlag hervor, kritzelte eilig eine Adresse darauf und warf ihn in einen der Bahnhofsbriefkästen. Für einen winzigen Moment schloss sie die Augen und dachte an Max.
Ich hätte dir lieber alles erklärt, aber ich hoffe, du verstehst es auch so.
Fünf Minuten später hatte sie das Haus fast erreicht und rannte los. Die dunkle Straße war verwaist und leer. Vielleicht war es ihr ja doch gelungen, den Verfolger abzuschütteln. Doch im nächsten Augenblick glitt der Mercedes um die Ecke, und Scheinwerferlicht blendete sie.
Sie konnte den Fahrer des Wagens schließlich nicht zu ihr nach Hause führen! Dort bewahrte sie viel zu viel Material auf, das mit ihren Recherchen zu tun hatte, und andere Dinge, die eine Spur zu ihren Kollegen legen konnten.
Aber wohin sollte sie stattdessen laufen?
Sie griff in die Tasche und nahm das Handy in die Hand. Mittlerweile hatte der Mercedes aufgeblendet, sodass sie kaum noch sehen konnte. Dann ein Geräusch, als eine Tür aufgeschoben wurde, gefolgt von harten Sohlen auf Asphalt. Im Gegenlicht konnte sie nur eine große dunkle Silhouette ausmachen, die auf sie zukam. Der Mann kam viel zu schnell näher.
Das Arretieren eines Pistolenhahns.
Ein langer Arm, der sich in ihre Richtung hob.
Mit einer einzigen Bewegung schleuderte sie das Handy ins Gebüsch und riss die Arme hoch. Wenn er das Telefon in die Hände bekäme, wäre alles umsonst gewesen.
Der Mann war ein paar Meter vor ihr stehen geblieben. Er war breit gebaut, hatte einen auffällig kleinen Kopf und einen ungewöhnlich langen Hals. Und er war elegant gekleidet, trug Mantel und Smoking. Das Gesicht war nicht deutlich zu erkennen, wirkte aber alt. Wie jemand aus einer anderen Zeit.
»Wer sind Sie?«, fragte sie. »Nicht schießen!«
»Rücken zu mir«, befahl der Mann. »Auf die Knie. Hände hinter den Kopf.«
Sie tat wie geheißen. Schloss die Augen.
Der Mann beugte sich zu ihr hinunter. Dann schloss sich sein eiserner Griff um ihren Körper, und auf Nase und Mund legte sich ein Lappen. Die Kraft in seiner Hand war schier unmenschlich.
Ein paarmal keuchte sie schwer durch den Stoff, dann setzte die Wirkung ein, und schlagartig erschlafften ihre Muskeln. In seinem Griff sackte sie zusammen. Der Mantel legte sich über sie. Sie war den Blicken der Welt entzogen.
Der Mann hob sie hoch wie ein schlafendes Kind. Das Letzte, was sie mitbekam, war ein Klicken, als er den Kofferraum des Wagens öffnete.
Samstag, 24. Februar 1996
1
Das Murmeln drang bis hinauf in Nestor Lasarews Privatloge. An sich gab es dort Platz für zwölf, doch heute wollte er allein sein. An diesem Abend wurde Eugen Onegin aufgeführt, und ein erwartungsvolles Publikum strömte in das Sankt Petersburger Mariinski-Theater.
Die Kleider der Damen schimmerten mit den frisch gestrichenen, sahneweiß-goldenen Wänden um die Wette. Allmählich füllten sich die Nachbarlogen, und Stoff raschelte, als die Besucher sich auf ihren Sitzen niederließen. Aus dem Parkett konnte man das Lachen eines jungen Mannes hören, der sich auf einen breiten Sitz neben eine bildhübsche Frau setzte.
Nestor Lasarew saß kerzengerade auf seinem Stuhl. Weder hatte das Alter seine Wirbelsäule gekrümmt, noch war sein Rücken durch Krankheiten geschwächt worden. Dank allmorgendlichem Systema-Training – einer ganzheitlichen waffenlosen Nahkampftechnik – war sein Körper immer noch gestählt.
Als der Vorhang aufging, schoss sein Puls in die Höhe, und die Härchen in seinem Nacken richteten sich auf, sowie das Orchester zu spielen begann.
Mit dem rechten Zeigefinger verfolgte Lasarew den ersten Akt in der Partitur. Tief versunken genoss er die Musik. Dieser Abend war für ihn etwas Besonderes; seine ganze Kindheit hatte er darauf verwendet, Tschaikowskys Stücke zu meistern. Und ausgerechnet diese Oper – die auf Puschkins Versepos basierte und nun von der Opernkompanie des Mariinski aufgeführt wurde – kam der perfekten Zurschaustellung russischer Überlegenheit gleich.
Ein leises Klopfen, dann ging vorsichtig die Tür zur Loge auf.
Der Moment war zunichte.
Lasarew drehte sich um. In der offenen Tür stand ein Mann. Stocksteif und wortlos ließ Marcel Rousseau den Blick über das Publikum im Parkett schweifen und nestelte an seinem Goldring. Er wich Lasarews Blick aus.
Wenn das hier nicht wichtig ist, schoss es Lasarew durch den Kopf, dann werf ich dich eigenhändig vom Balkon zu diesem neureichen Aas dort unten.
»Herr Vorsitzender«, hob Rousseau an, »wir müssen reden.«
»Warten Sie draußen. Wir können uns in der Pause unterhalten.«
Er schloss die Augen und versuchte, sich wieder von der Musik umspielen und verzücken zu lassen. Doch bis der Akt zu Ende war, kreisten seine Gedanken nun mehr um Rousseau, der draußen auf ihn wartete.
Warum war er hier? Ausgerechnet heute?
Als die Türen zu den Logen aufgingen, wurden auf der Stelle Stimmen laut. Rundherum lachten sie, die ausgelassenen, die begeisterten Operngänger, und gierten nach sowjetskoje schampanskoje.
Er marschierte auf Rousseau zu, der ebenfalls ein Glas in der Hand hielt.
Rousseau beugte sich zu Lasarew vor. »Erinnern Sie sich an den Journalisten, von dem ich Ihnen letzte Woche erzählt habe?«, flüsterte er ihm ins Ohr. »Der wissen wollte, woher die Technologie stammt?«
»Wie könnte ich das vergessen.«
»Mir ist am Nachmittag die gleiche Frage wieder gestellt worden.«
Lasarew runzelte die Stirn. Er hatte sein Geheimnis bereits sehr viel länger bewahrt, als ihm lieb war. All die langen, düsteren Jahre, ehe er das Unterfangen endlich in Angriff hatte nehmen können. Kein einziges Mal war ihm diese Frage gestellt worden – niemand hatte je darüber nachgedacht. Bis jetzt.
»Von wem?«
»Von einer jungen Frau«, antwortete Rousseau. »Eine Universitätsangestellte – vom Institut für Wirtschaftswissenschaften.«
Was Rousseau da sagte, konnte zweierlei bedeuten: Entweder hatten sie es mit einem mehr als verwunderlichen Zufall zu tun – oder mit einem Echo aus Lasarews Vergangenheit. Ersteres bräuchte sie nicht weiter zu beunruhigen. Doch wenn es sich um Zweiteres handelte, würde er sich auf der Stelle damit auseinandersetzen müssen, das war ihm klar.
»Sie wirken bekümmert, Marcel.« Lasarew legte Rousseau freundschaftlich eine Hand um den Nacken. »Ich kann Ihnen versichern, dass Sie sich um nichts Sorgen machen müssen.«
Dann zog er ihn an sich heran und gab ihm drei Küsse auf die Wangen.
»Fahren Sie heim und ruhen Sie sich aus. Sie machen sich zu viele Gedanken.«
Dann ließ er ihn stehen und kehrte in seine Loge zurück, glitt auf den weichen Polstersitz, wartete noch eine Minute, um sicherzugehen, dass Rousseau auch wirklich nicht wiederkommen würde. Zu seinen Füßen lag das Programmheft zur Vorstellung des Abends mit dem Porträt der Sopranistin, die die Hauptrolle sang. Unter dem Foto standen die berühmten Verse aus dem Libretto: »Ein jeder kennt die Lieb’ auf Erden, ein jeder muss ihr Sklave werden.«
Seine Gedanken wanderten weiter, zu einer anderen Premiere, in einem anderen Opernhaus. Zu Kriegszeiten.
Sie war von Menschen umringt gewesen. Überall an den Wänden im Foyer hatten vergoldete Spiegel gehangen, und in einem dieser Spiegel hatte er den Mann entdeckt – seine Nemesis. Die Art und Weise, wie der Mann sie angesehen hatte, würde er nie vergessen. Lasarew war nur kurz unaufmerksam gewesen, hatte für einen winzigen Moment die Deckung fallen lassen und hätte um ein Haar alles verloren.
In gewisser Hinsicht fühlte es sich an, als würden ihn jene Ketten, jene Schlösser immer noch nach unten ziehen.
Ein Trommelwirbel vom Orchester. Der zweite Akt hatte begonnen. Die Trommeln beschworen andere Bilder in ihm herauf – Flugzeuge, die sich vor dem Himmel abzeichneten. Die Rettung.
Das hier war kein Zufall. An den Zufall hatte Lasarew nie geglaubt. Es war an der Zeit, die finale Operation in Gang zu setzen.
Dass dies gleichzeitig bedeutete, einer anderen Sache ein für alle Mal ein Ende zu setzen – einer Sache, von der er eigentlich geglaubt hatte, sie wäre längst beendet –, würde das Ganze nur umso zufriedenstellender machen.
Diesmal würde es keinen Raum für Fehler geben.
Dienstag, 27. Februar
2
Unruhig wanderte Max Angers Blick zwischen seinem Handy und der Wand des Konferenzraums hin und her, an der auf mehreren Bildschirmen Nachrichtensender aus ganz Zentral- und Osteuropa liefen. Dann las er erneut Paschies SMS. Sie hatte ihm am Freitag geschrieben, dass sie versucht habe, ihn zu erreichen. Daraufhin hatte er es am Wochenende mehrmals auf ihrem Vektor-Handy probiert. Doch das Handy war ausgeschaltet gewesen. Was in aller Welt ging da vor?
Er blickte erneut zu den Bildschirmen. Der Ton war abgestellt, stumme Bilder blitzten ihm entgegen. Wie immer interessierte ihn der russische Kanal am meisten. Max rutschte auf seinem Stuhl herum, als Bilder des zugefrorenen Wassers rund um Archangelsk an einem sonnigen und klaren Spätwintermorgen gezeigt wurden.
Durch eine Rinne im Eis fuhr ein rostiger Fischkutter auf den Fähranleger zu. Als das Boot den Kai erreichte, stießen die Männer an Deck ihre Jagdstöcke gen Himmel und riefen den Demonstranten, die sich an Land versammelt hatten, trotzige Antworten entgegen.
Dann wurden Bilder eines offenen Lkws mit einer Ladefläche voller Robbenjungen eingeblendet. Wieder andere Bilder zeigten, wie die Jungtiere an einer Laderampe bei lebendigem Leib gehäutet wurden.
Das ist nicht korrekt – das müssen sie noch auf dem Eis machen!
Max rutschte wieder nervös auf seinem Stuhl hin und her. Die Fernsehbilder erweckten alte Erinnerungen zum Leben. Er sah aus dem Fenster auf den Valhallavägen hinunter, wo die Wipfel der großen Bäume im Wind hin- und herschaukelten wie schäumende Wellen, die einander nachjagten.
Er war zwölf Jahre alt gewesen, als er von Arholma aus – der Insel vor der schwedischen Ostküste, wo er aufgewachsen war – nach Osten übers Eis zur unbewohnten nächsten Insel lief. Die Strecke war deutlich länger, als er gedacht hatte, und er schwitzte aus allen Poren. Als er die Jacke aufknöpfte, hörte er plötzlich ein merkwürdiges Röcheln. Er drehte sich um – und bei dem unerwarteten Anblick des schlafenden Robbenjungen verschlug es ihm den Atem. Es war schneeweiß, im Schnee annähernd unsichtbar, lag flach auf dem Bauch und tankte Sonne. Es war allerhöchstens ein paar Tage alt. Max wusste, dass der Pelz maximal zwei Wochen so strahlend weiß blieb.
Das Robbenjunge schlug seine rabenschwarzen Augen auf und sah Max neugierig an.
Er wusste, was zu tun war, wenn er auf dem Eis auf so ein Jungtier traf. Er wusste, dass er ihm den Schlagstock einmal hart über die Schnauze ziehen musste. Wenn er richtig traf, setzte der Blinzelreflex aus, und das Junge starrte ihn mit leerem Blick an.
Diese Tat würde ihn zum Mann machen, der unter Beweis gestellt hatte, dass er dem altehrwürdigen Mannesideal gerecht wurde, das sein Vater immer noch in Ehren hielt. Die Freunde seines Vaters würden ihre Sachen packen, zu ihnen nach Hause kommen und mit ihnen Max’ erstes Robbenjunges feiern.
Doch Max vermochte sich nicht zu rühren.
Je mehr Zeit verstrich, desto unmöglicher fühlte es sich an. In diesem Moment und an dieser Stelle begriff Max, dass er anders war. So ein unschuldiges Wesen totzuschlagen war keine Großtat – nichts, was aus einem Jungen einen Mann machte. Er sollte nie auf der anderen Insel ankommen. Er machte kehrt und lief wieder nach Arholma, erzählte niemandem von dem weißen Robbenjungen und hängte auch kein Robbenfell vor dem Haus auf.
Irgendeines Tages würde es wieder eine Gelegenheit geben. Und da würde alles komplett zum Teufel gehen.
Mit einem Mal gingen die Bildschirme aus.
»Violet hat mir gesagt, dass ich dich hier finde.«
Sarah Hansen stand mit der Fernbedienung in der Hand hinter ihm und sah ihn an. Womöglich hatte sie dort schon eine ganze Weile gestanden.
»Du siehst echt schlimm aus, Rospigg«, sagte sie und fuhr sich mit den Fingern durch das strubbelige weißblonde Haar.
Sarah Hansen war Max’ Chefin und die einzige Person in seinem Leben, die ihn Rospigg nennen durfte – eine uralte Bezeichnung für jemanden, der aus der Region Roslagen stammte.
Sie hatten sich während der Ausbildung beim Militär im Russischunterricht kennengelernt. Max war Kampfschwimmer gewesen, Sarah hatte die Dolmetscherschule besucht. Aus Kameraden wurden Freunde, und auch wenn sie nach der Ausbildung getrennter Wege gingen, blieben die beiden in Kontakt. Max verfolgte ihre steile Karriere bei einer Investmentbank und war beeindruckt von ihrem Unternehmergeist, als sie später einen Thinktank namens Vektor gründete, der sich der Demokratisierung und Sicherheit schwedischer Nachbarstaaten widmete. Als er selbst einige Jahre später die Kürzungen beim schwedischen Militär leid war und sie ihn fragte, ob er sich vorstellen könne, als Analyst mit Schwerpunkt Russland für sie zu arbeiten, hatte er nicht lange gezögert. Es war an der Zeit gewesen, das Soldatenleben hinter sich zu lassen und neue Wege zu beschreiten.
»Was du in deiner Freizeit machst, ist wirklich deine Sache, aber dir ist schon klar, dass du hier auch arbeitest, oder?« Sarah bedeutete ihm, ihr ins Büro zu folgen. »Und dass ich diejenige bin, die dich dafür bezahlt?«
Sie setzte sich an ihren ausladenden Mahagonischreibtisch und musterte ihn durch Brillengläser, die so dick waren, dass sie mehrere Millimeter über das zierliche schwarze Metallgestell hinausragten. Max wich ihrem Blick aus und ließ sich in einen himmelblauen Sessel fallen, den Sarah bei Christie’s in London ersteigert hatte.
»Wie könnte ich das vergessen«, murmelte Max. »Immerhin hast du mich zum Rubelmillionär gemacht.«
Sarah grinste schief.
Er sah zu dem Foto hoch, das über ihr an der Wand hing – darauf schüttelte sie König Carl XVI. Gustaf die Hand. Max kannte niemanden, der auch nur annähernd so patriotisch war wie Sarah. Sie war in Polen zur Welt gekommen, hatte aber mit sechzehn die schwedische Staatsbürgerschaft angenommen. Inzwischen liebte sie Schweden mehr als alles andere auf der Welt, konnte im Schlaf die Namen sämtlicher Regierungschefs von De Geer bis Carlsson herunterrattern und selbst einem Vierjährigen aus dem Kindergarten ihrer Tochter die Besonderheiten des parlamentarischen Systems erklären.
Sarah sah ihn besorgt an.
»Ganz ehrlich, Max, du siehst aus, als hättest du seit einer Woche nicht geschlafen.«
Max antwortete nicht. Im Grunde gab es darauf auch nichts zu erwidern. Sarah hatte recht.
»Hast du Carl Borgenstierna erreicht?«
Max starrte auf seine Knie, auf die Schwielen an seinen Händen. Und nickte dann bedächtig.
»Ich hab ihn besucht, ja.«
»Hat er sich gefreut, dich zu sehen?«
»Schwer zu sagen. Er war nicht bei Bewusstsein … und er hatte so eine Maske auf dem Gesicht, die einem hilft zu atmen. Sie hatten ihm gerade zwei Nieren transplantiert.«
Max hatte immer noch vor Augen, wie jämmerlich der Alte an dem Dialysegerät ausgesehen hatte. Wie oft hatte er in seiner Kindheit und Jugend den Namen Carl Borgenstierna gehört, insbesondere immer dann, wenn Jakob – sein Vater – betrunken gewesen war. Es war ihm eher wie ein Traum vorgekommen, dem Mann nach all den Jahren leibhaftig gegenüberzutreten.
Am Bett auf seinem Nachttisch hatte ein Album mit der Prägung einer Lilie gelegen, daneben ein gerahmtes Bild, das sepiabraune Porträt einer jungen, wunderschönen Frau, die ausgesehen hatte wie ein Filmstar aus einem alten Hollywood-Streifen. Irgendetwas an ihrem Blick hatte sich in Max verhakt – da war eine Glut gewesen, eine Sehnsucht, die ihn an jemand anderen erinnert hatte. An Paschie.
Nach dem Tod seiner Mutter vor einem Monat hatte Max beschlossen, endlich die Wahrheit über die Namen herauszufinden, die sein Vater immer derart hasserfüllt ausgesprochen hatte.
Wallentin und Borgenstierna.
Max wusste immer noch nicht, wie alles zusammenhing. Aber bislang hatten seine Nachforschungen ergeben, dass sein Vater 1944 als Pflegekind auf Arholma gelandet war. Und dass Borgenstierna auf irgendeine Weise damit zu tun gehabt hatte. Wenn der alte Mann tatsächlich für das Unglück von Max’ Familie verantwortlich war, dann würde er auch dafür bezahlen.
Max hatte den Mann gerüttelt und versucht, ihn aufzuwecken. Er hatte sich zusammenreißen müssen, um nicht kurzerhand die Schläuche aus dem Dialysegerät zu ziehen.
»Was weißt du über Borgenstierna?«, fragte Max.
Sarah sah ihn überrascht an.
»Das habe ich dir doch erzählt. Ich weiß im Grunde nicht viel mehr, als dass er vor rund fünfzig Jahren die Ostseestiftung ins Leben gerufen hat, die wiederum seit ein paar Jahren Vektor finanziell unterstützt. Ich bringe diesem Mann größten Respekt entgegen und bin ihm wirklich dankbar, auch wenn ich ihn bisher noch nicht persönlich kennengelernt habe.«
Sie rekelte sich in ihrem Stuhl und legte dann die Hand auf eine dicke Akte vor ihr auf dem Schreibtisch.
»Du musst endlich einen Schlussstrich unter deine kleine Privatermittlung ziehen. Dein Urlaub ist hiermit vorbei.«
Dann schob sie Max die Akte über den Tisch.
»Das hier sind deine Hausaufgaben für heute Abend.«
Vergebens versuchte Max, enthusiastisch auszusehen, als er den Wälzer aufschlug.
»Nur Schulkinder haben Skiferien, Max. Du hattest letzte Woche frei. Hättest eigentlich schon gestern wieder da sein müssen.«
Sie zeigte auf die Akte.
»Fahr nach Hause und lies dir das durch. Und schlaf in Gottes Namen ein paar Stunden. Ich krieg heute Abend Besuch, wenn du also irgendwelche Fragen haben solltest, müssen die bis morgen früh warten.«
»Wie heißt denn die Süße?«
»Gabbi heißt sie«, antwortete Sarah.
»Herrlich. Na, da will ich mal nicht stören.«
Sarah nickte vielsagend. Nein, darfst du verdammt noch mal auch nicht.
Dann stand sie auf. Die Besprechung war zu Ende. Sie selbst würde gleich den nächsten von unzähligen Kandidaten treffen, die allesamt Beratung in Sachen Russland und Osteuropa brauchten. Doch auf halbem Weg zur Tür blieb sie stehen.
»Und sei so nett, ruf du deine Süße an. Ich hab seit einer knappen Woche nichts mehr von ihr gehört.«
Max hatte seine Beziehung mit Paschie Kowalenko zunächst geheim gehalten, weil er sich nicht sicher gewesen war, wie Sarah darauf reagieren würde, dass er und die Sankt Petersburger Vektor-Mitarbeiterin ein Paar waren. Aber genau wie Max vermutet und gehofft hatte, hatte sie für ihn mal wieder eine Ausnahme gemacht.
Und seine Süße anzurufen war genau das, was Max jetzt vorhatte.
3
Er drückte die Wohnungstür hinter sich zu, hängte seine Jacke auf und warf einen Blick in den Spiegel. Genau wie jedes Mal, seit ihm die Veränderung erstmals aufgefallen war. Seine braunen Augen waren heute noch dunkler als sonst. Ihm war klar, dass das eine Nebenwirkung der Benzodiazepine war und dass er sie vorübergehend würde absetzen müssen.
Seine Augen waren rot geädert, die umliegende Haut gefurcht und schlaff. Er war drauf und dran, sich in seinen Vater zu verwandeln – in denjenigen, der er kurz vor seinem Tod gewesen war.
Aber mit sechsundzwanzig?
Natürlich hatte Sarah recht. Er sah schlimm aus. Oder so, als wäre er dem Teufel begegnet.
Im Wohnzimmer zog er die Vorhänge zur Seite und riss die Fenster auf, um frische Luft hereinzulassen. Es war ein düsterer Tag gewesen, die Sonne über Stockholm hatte es nicht geschafft, die dichte dunkelgraue Wolkendecke zu durchbrechen, und es kam ihm so vor, als wäre der Frühling noch eine Ewigkeit entfernt.
Die einzigen Lichtquellen in seiner Wohnung waren die Lämpchen an den Elektrogeräten: das rote Blinklicht am Anrufbeantworter und die angsteinflößende Ziffer daneben, die besagte, dass acht Nachrichten auf ihn warteten. Das blaue Stand-by-Licht des Fernsehers. Das grüne am Videorekorder.
Seit er auf die Militärhochschule gegangen war, hatte sich sein Mobiliar nicht verändert. Sarahs Begeisterung für exklusive Einrichtungsgegenstände und Antiquitäten teilte er kein bisschen. In seinem Wohnzimmer standen ein braunes Ikea-Sofa und ein schwarzer Kunstledersessel. Auf dem Sofa lagen zwei Decken, die er aus seinem Elternhaus auf Arholma mitgebracht hatte: eine graue Mohairdecke, die seine Mutter mal von einem isländischen Gast geschenkt bekommen hatte, und eine Schottenkarodecke, die er sich selbst gekauft hatte, als er auf dem Marineschulschiff Gladan zu den Shetlands gesegelt war.
Über dem Sofa hing eine große Karte der Sowjetunion an der Wand.
Er drückte auf den Knopf am Anrufbeantworter, um die Nachrichten abzuspielen. Die erste war eine knappe Woche alt. Er war einfach nicht dazu gekommen, sich darum zu kümmern, hatte sich auf nichts anderes konzentrieren können als auf seine Nachforschungen zu Wallentin und Borgenstierna. Nachdem er so lange mit der Suche gewartet hatte, war es nun so, als würde er davon vollkommen absorbiert. Er hatte tatsächlich weder geschlafen noch etwas gegessen. Hatte sich nicht mal mehr bei Paschie gemeldet. Sie hätte ihm angemerkt, wie sehr ihm diese ganze Sache naheging. Und sie hätte ihn aufgefordert, die Sache ruhig angehen zu lassen.
Max übersprang eine Nachricht nach der anderen: die der Bibliothekarin, Nachrichten von Vektor-Kollegen, Sponsoren, Mitarbeitern aus dem Archiv von Sveriges Radio – Nachrichten von Personen, mit denen er im Zuge seiner Nachforschungen in den vergangenen Wochen in Kontakt getreten war.
Eine Nachricht war von Hein Espen, einem frühpensionierten Norweger, der im Amphibiengeschwader gedient hatte. Er meldete sich jedes Jahr um diese Zeit – immer zum Jahrestag des Vorfalls. Während einer Übung im Becken des Marinestützpunkts Haakonsvern hatte ein technischer Fehler in Hein Espens Ausrüstung dazu geführt, dass ihm mit einem Mal die Luft ausgegangen und er in Panik geraten war. Max hatte ihn aus den Unterwassertunneln gerettet, hatte seine Luft mit ihm geteilt und ihn festgehalten, während Hein Espen um sich getreten und geschlagen hatte. Am Ende war es ihm gelungen, den Kameraden an die Oberfläche zu bringen.
Max sollte ihn zurückrufen. Aber noch nicht jetzt.
Und dann, endlich: »Hej, du!«
Der Klang ihrer Stimme aus dem kleinen Lautsprecher des Anrufbeantworters wärmte ihm das Herz.
»Hier ist dein Mädchen. Ich glaub, ich hab da was für dich. Was Neues, womit du nicht gerechnet hast. Allerdings musst du dafür herkommen und es dir selbst holen. Wann kannst du hier sein, Baby?«
Max hatte Paschie Kowalenko vor gut einem Jahr bei einer Konferenz in Helsinki kennengelernt. Vor einer langsamen, dafür umso lauter gurgelnden Kaffeemaschine waren sie ins Gespräch gekommen, und als der Kaffee fertig war, waren sie nur widerwillig zu ihren jeweiligen Terminen zurückgekehrt. Beide hatte ein unverhofftes, starkes Verlangen gepackt.
Sie hatte einen abgetragenen, dunkelblauen Dufflecoat und Stonewashed-Jeans getragen, und die meisten hatten aufgrund ihrer dunklen Haut gemutmaßt, sie wäre Südamerikanerin. Doch die hohen Wangenknochen und die verhältnismäßig kleinen, strahlend grünen Augen hatten Max verraten, dass sie asiatische Wurzeln hatte. An dem gelockten schwarzen Haar, das ihr weich über die Schultern fiel, hatte Max sich gar nicht sattsehen können. Erst später hatte er bemerkt, dass das offene Haar eine seltene Ausnahme gewesen war: Sehr viel häufiger flocht sie sich einen Zopf oder band die Haare zu einem Knoten zusammen.
Sie hatten Visitenkarten ausgetauscht. Ihre Karte war handgemacht gewesen – eine silberfarbene Handschrift auf schwarzem Papier: nur ihr Name, eine russische Telefon- und Faxnummer und eine Hotmail-Adresse.
Max riss den Blick vom Anrufbeantworter los. Überall in seiner Wohnung konnte er Spuren von ihr entdecken. Die bunt gemusterten Holzkellen, die sie im Gostiny Dwor in Sankt Petersburg gekauft hatten. Das rotbraune Plaid, das zusammengefaltet am Fußende des Bettes lag. Ihre neuen weißen Gummistiefel von NK im Flur. Und dann natürlich die Schneiderpuppe, die sie unbedingt hatte haben wollen, weil sie wieder anfangen wollte, Kleider zu nähen, wie es ihre Mutter früher getan hatte. Paschie hatte zwar ein paar Versuche unternommen, dann aber bald eingesehen, dass sie weder genug Zeit noch Geduld aufbringen konnte. Inzwischen stand die Puppe nur noch herum – mit einem halben Kleid über den Schultern und einem ihrer Hüte auf dem Kopf, einem gelben Cowboyhut.
»Nachzudenken heißt, im Nachhinein zu denken, Max, nicht schon im Vorfeld.«
Genau wie er selbst war auch sie chaotisch. Sie waren permanent in unterschiedliche Himmelsrichtungen unterwegs, versuchten aber doch, sich zu sehen, so oft es eben ging.
Seit einem Jahr schon. Ihre Fernbeziehung fußte auf ausgedehnten Telefonaten und E-Mails, in denen sie alles Mögliche besprachen: von gewitzten Geschäftsideen, die sie unbedingt in die Tat umsetzen wollten, bis hin zu Plänen für den Sommer an all den Orten in den Stockholmer Schären, die Max ihr zeigen wollte.
Aber würden sie je ein gemeinsames Leben an einem Ort führen?
»Ich glaub, ich hab da was für dich.«
Was hatte sie herausgefunden? Mal abgesehen von Sarah war Paschie die Einzige, die über Max’ private Nachforschungen Bescheid wusste. Sie war an jenem strahlend schönen und gleichzeitig schrecklichen Nachmittag in der Kirche dabei gewesen. Sie hatte seine zitternde Hand genommen, als die Orgel »Schönster Herr Jesu« anstimmte, und während Max den Blick nicht von dem Sarg abwenden konnte, der ganz vorne stand, drückte sie behutsam seine Hand. In dem Sarg lag seine Mutter.
Paschie hatte Verständnis dafür gezeigt, dass er sich nicht länger seinem Versprechen verpflichtet fühlte, nicht zurückzublicken, nicht über all das nachzugrübeln, was geschehen war. Sie wusste, wie es sich anfühlte, der eigenen Familie beraubt zu werden und die eigenen Wurzeln vorenthalten zu bekommen. Und sie wusste, dass ihn jetzt nichts mehr davon abhalten konnte, in seiner Familiengeschichte zu stöbern. Niemals würde sie ihn dafür verurteilen, dass er endlich tat, was er tun musste. Und sie würde auch nie zulassen, dass ihre Beziehung ihm dabei im Wege war.
»Was Neues, womit du nicht gerechnet hast.«
Max nahm den Hörer ab und rief erneut Paschies Handynummer an. Das Handy war immer noch ausgeschaltet. Nach ein paar Minuten versuchte er es erneut. Diesmal hatte er plötzlich ein Störsignal im Ohr, und dann sagte eine Frauenstimme: »Ihr Anruf kann momentan nicht entgegengenommen werden. Versuchen Sie es später noch einmal.«
Max ließ den Blick über die wolkenverhangene Stadt schweifen. Dann rief er ihre letzten SMS noch einmal auf, um sicherzugehen, dass er auch wirklich keine frühere Nachricht überlesen hatte. Hatte er nicht.
Was treibst du eigentlich, Paschie?
Er legte das Handy aus der Hand und fuhr sich frustriert durchs Haar.
Dann warf er einen Blick in die schlichte, leere Küche. Erinnerte sich wieder daran, wie Paschie dort eine halbe Ewigkeit Orangen ausgepresst hatte – nur mit einem von Max’ ausgewaschenen weißen T-Shirts auf dem Leib. Sie hatte über das Misstrauen gesprochen, das der Westen gegenüber Russland hegte, über die anstehende Präsidentschaftswahl und darüber, dass sich Russland jetzt, nachdem es sich wirtschaftlich geöffnet hatte, nicht mehr würde abschotten können. Dass ein Bürgerkrieg ausbrechen würde, wenn der Staat sich all die Reichtümer zurückholte, die gerade erst neu verteilt worden waren. Wenn die Privatisierungsmaßnahmen erst abgeschlossen wären, würden die Lebensumstände für die breite russische Bevölkerung besser werden, und der Staat an sich würde als Wirtschaftssupermacht wiederauferstehen.
»Wartet nur, ihr werdet schon sehen.«
All die Unkenrufe – dass schon bald massenhaft Russen in die nordischen Länder einwandern könnten – entbehrten jeder Grundlage. Russen verließen ihr Heimatland nicht, und für die alte Angst vor Iwan gab es schon lange keinen Anlass mehr. Das Land und seine Einwohner wollten endlich weiterkommen, die überholte Abschottung vom restlichen Europa überwinden und in Sachen Handel, Tourismus und kulturellem Austausch ein ebenbürtiger Partner werden.
Sowohl Max als auch Paschie wussten sehr wohl, dass sie sich mit der anstehenden Präsidentschaftswahl einem Scheideweg näherten: Immerhin handelte es sich dabei um die erste wirklich freie Wahl seit dem Zerfall der Sowjetunion. Vor fünf Jahren, als Jelzin die Wahl für sich hatte entscheiden können, hatte das Land immer noch unter einer Art nationalen Schockstarre gestanden, in der weder politische Parteien noch Wahlberechtigte genügend Zeit gehabt hatten, sich vernünftig zu positionieren. Und wie sich der Rest der Welt über die 1991er Wahlen ausgelassen hatte!
Jetzt aber, nachdem der Staat wieder halbwegs auf die Beine gekommen war und ein heftigerer, kälterer Wind wehte, würde der Westen sich zusammentun müssen, wenn er die demokratische Entwicklung in Russland vorantreiben wollte. Ehe es zu spät dafür sein würde.
Um auf Dauer mit Informationen aus erster Hand beliefert zu werden, hatte Vektor jemanden gebraucht, auf dessen Urteil die Firma vertrauen konnte. Jemanden, der vor Ort war, in Sankt Petersburg, dem russischen Tor zum Westen. Diese Schlüsselrolle hatte Paschie eingenommen.
Wann hatte er zuletzt mit ihr gesprochen? Am Freitag? Dass sie schon so lang nicht mehr miteinander telefoniert hatten, war ungewöhnlich für die beiden. Er war mit seinen eigenen Angelegenheiten beschäftigt gewesen und hatte versucht, das Beste aus der Woche zu machen, die er freibekommen hatte. Diesbezüglich war Paschie genau wie er. Auch sie hatte sich in die Arbeit gestürzt. Bestimmt hatte sie in den vergangenen Tagen diverse Sankt Petersburger Geschäftsleute mit klugen Fragen gelöchert. Hatte sie deshalb das gesamte Wochenende ihr Handy ausgeschaltet?
Er setzte sich an seinen PC und schob die Maus ein paarmal hin und her, um den Bildschirm aufzuwecken. Dann checkte er die Inbox. Keine neue Nachricht von Paschie. Die letzte stammte von Freitag.
»Ist alles in Ordnung bei dir, Max? Am Telefon hast du so gehetzt geklungen, ich mache mir ein bisschen Sorgen. Wir müssen uns bald wiedersehen. Es bleibt doch bei deinem Besuch? Ich hab einen spannenden Hinweis bekommen, den ich mit dir besprechen muss. Ruf mich an!«
Er hatte die E-Mail am Wochenende zwar gelesen, aber nicht beantwortet.
»Klar bleibt es bei meinem Besuch«, schrieb er jetzt. »Ruf mich bitte an, sobald du das hier liest.«
Dass er nach Sankt Petersburg fliegen würde, war schon länger geplant. Er hatte erst eine Woche zu Hause bleiben, dann im Büro ein paar Dinge für die Reise vorbereiten, nach Sankt Petersburg fliegen und zum alljährlichen Vektor-Fest wieder zurückkommen wollen. Diesbezüglich hatte Sarah sich nicht beirren lassen: Das Fest dürfe er nicht schwänzen.
Max sah in dem Ordner mit den gesendeten Objekten nach, ob seine E-Mail an Paschie tatsächlich rausgegangen war.
»Du hast so gehetzt geklungen.« Der Kloß in seinem Hals wurde größer. Er las die E-Mail noch einmal. Im Großen und Ganzen entsprach der Inhalt der Nachricht auf seinem AB – mit einer Ausnahme. Der Hinweis. Über welchen Hinweis wollte sie so dringend mit ihm sprechen?
Max schlug die Akte auf, die Sarah ihm gegeben hatte. Genau genommen handelte es sich dabei nicht um eine Hausaufgabe, sondern um zwei. Sie hatte ihm eine Woche freigegeben, doch als er jetzt durch ihre Unterlagen blätterte, dämmerte ihm, dass sie seine Aufmerksamkeit schon sehr viel früher gebraucht hätte.
In der Akte lag eine Studie zum Thema Wahlbetrug aus der Feder zweier Mitarbeiter der IFES, der International Foundation of Electoral Systems. Er las die Studie – alle hundertzwanzig Seiten –, während er gleichzeitig mit jeder Seite, die er umblätterte, sein E-Mail-Postfach aktualisierte, um zu sehen, ob Paschie auf seine Nachricht geantwortet hatte. Es war eine zähe Lektüre. All das hatte er schon mal gehört. »Bei Weitem nicht alle Staatsbürger Russlands verfügen über einen amtlichen Lichtbildausweis. Insbesondere in weniger privilegierten Bevölkerungsgruppen, unter Gefängnisinsassen, Angehörigen ethnischer Minderheiten und Menschen, die in Armut leben, ist die Verbreitung gering.« Erfahrungsgemäß zehn, fünfzehn Prozent, schrieb Max in seinen Notizblock. »Desinformation und Drohungen. Gezielte Versuche, über Verbindungen zum organisierten Verbrechen in Sankt Petersburg auf die Stimmabgabe einzuwirken. Tägliche Großdemonstrationen auf den meistbefahrenen Straßen der Stadt, Stimmung gewaltbereit. Gelegentliche Messerattacken, wenn sich Widerstand äußert oder Wortwechsel entstehen.«
Messerattacken in Sankt Petersburg. Nichts Neues unter der Sonne.
»Stimmabgabe am Arbeitsplatz in Russland üblich. In den Vorstädten zeichnen sich Arbeitgeber verantwortlich für Informationen im Vorfeld der Wahl sowie für Stimmabgabe, inkl. Wählerverzeichnis und Auszählung. Schuhputzmethoden wahrscheinlich.« Max kannte sich mit derlei Tricks und Kniffen aus, die schon bei diversen Wahlen in der ehemaligen Sowjetunion beobachtet worden waren. Bei der Schuhputzmethode wurde auf den Hebel der Wahlmaschine Schuhcreme aufgetragen, sodass man an der Hand des Wählers erkennen konnte, für wen er seine Stimme abgegeben hatte. Üblicherweise ging dies mit Drohszenarien und körperlicher Gewaltanwendung einher.
Die IFES-Studie war alles andere als erbaulich; das nächste Dokument war allerdings noch schlimmer. Es handelte sich um die jüngsten Umfrageergebnisse. Max’ Aufgabe bestand nicht nur darin, die Daten zu studieren, sondern auch Auffälligkeiten aufzuspüren und zu prüfen, wo die Datengrundlage möglicherweise zu dünn war. Aus der Umfrage ging eine eindeutige Tendenz hervor, und die entsprach mitnichten ihren Hoffnungen. Die Präsidentschaftswahl war nur wenige Monate entfernt, und Schuganow mit seiner retrokommunistischen Partei lag in den Prognosen klar in Führung. Wenn die Erhebung stimmte, waren sie auf dem besten Weg, die alte Sowjetunion wieder zu errichten.
Das Telefon klingelte, und Max griff danach. Allerdings hatte er vergeblich gehofft – es war nicht Paschie, die ihn zurückrief.
»Max«, sagte Sarah, »du musst sofort kommen.«
»Brauchst du Hilfe mit Gabbi?«
»Mischin hat sich gemeldet. Paschie hätte heute an zwei Meetings an der Uni teilnehmen müssen, ist aber nicht erschienen. Sie haben den ganzen Tag nach ihr gesucht. Sie ist spurlos verschwunden.«
4
David Julins Hände zitterten immer noch leicht, als er am Rednerpult stand. Ehe er vor sein Publikum getreten war, hatte er mehrmals sein Mantra wiederholt. Wenn du nicht an dich glaubst, wer dann? Fast wäre es ihm gelungen, sich zu beruhigen.
David fuhr sich durch das schulterlange braune Haar und ließ den Blick durch die Aula der Handelshögskolan schweifen. Er kniff leicht die Augen zusammen, um nicht von den Scheinwerfern geblendet zu werden, die auf ihn gerichtet waren und die sich in seinen achteckigen Brillengläsern spiegelten. Die jungen Studenten sahen erwartungsvoll zu ihm hoch. Sie alle waren gekommen, um zu erfahren, wie sie seinen Erfolgen in der Telekommunikationsbranche nacheifern, wie auch sie – wie es der Titel der Vorlesung versprach – GSM gewinnbringend weiterentwickeln konnten.
Für die Studenten war er fast ein Promi. Er hatte sein Unternehmen SwitchCom aus eigener Kraft aufgebaut und dann teuer verkauft. Die rosafarbenen Dagens-Industri-Seiten, die so etwas wie die Bibel für sie waren, hatten den kometenhaften Aufstieg der Firma ausführlich geschildert: von den ersten Schritten vor dem heimischen PC zum erfolgreichen IT-Consult-Unternehmen, das mit Großkunden wie Ericsson und Telia aufgewartet hatte und schließlich mit gigantischem Gewinn an einen neureichen Player aus dem kalifornischen Silicon Valley verkauft worden war.
David Julin war die personifizierte Erfolgsgeschichte. Und er war einer von ihnen.
Zwei Jahre zuvor hatte er auf einer wesentlich größeren Bühne gestanden und die Auszeichnung zum Unternehmer des Jahres entgegengenommen, der von Ernst & Young ausgewählt wurde. Im vergangenen Jahr hatte er an deren alljährlicher Alumni-Konferenz in Doha in Katar teilgenommen. Dieses Jahr würde er nicht dabei sein. Er hatte sich eine Notlüge zurechtgelegt, und bis heute kannte niemand den wahren Grund für seine Absage.
Vor ihm stand sein Laptop, und daneben lag sein Handy, das er während seines Vortrags immer wieder in die Höhe hielt, um seinem Publikum zu zeigen, wovon genau er sprach. Das Bild auf der großen Projektionsleinwand war mit Fernsteuerung überschrieben – dann das Schaubild, wie sich das Ganze aufbaute.
»Der volldigitale Mobilfunk-Standard eröffnet uns eine riesige Bandbreite an Möglichkeiten«, erklärte David. »Es dauert nicht mehr lang, und wir können aus der Ferne die Heizung in unserem Sommerhaus anstellen, das Licht aus- und wieder einschalten, Informationen aus Mikrochips auslesen, die unter unserer Haut sitzen, und unsere Herzfrequenz, den Puls und noch vieles mehr aufzeichnen.«
Ein Surren ging durch die Lautsprecher im Saal. Das Handy, das er stumm geschaltet hatte, wanderte über das Pult. Erst befürchtete David, seine Frau würde ihn anrufen, womöglich war etwas mit den Kindern. Doch es war nicht sie, die ihn zu erreichen versuchte.
Ray.
David starrte auf den Namen auf dem Handydisplay. Beim Anblick der drei Buchstaben lief es ihm eiskalt den Rücken hinunter.
Aus einiger Distanz drang Gemurmel an sein Ohr, und schlagartig wurde ihm bewusst, dass er mitten im Satz aufgehört hatte zu sprechen. David drückte den Anruf weg, sah von seinem Pult auf und ließ den Blick über das Meer von Gesichtern schweifen, das ihm jetzt schier endlos vorkam. Er schluckte trocken und zwang sich zu einem Lächeln.
Du hast alles im Griff. Du bist ein reicher Mann.
»Die Kehrseite der modernen Technologie – dass man jederzeit erreichbar ist, sogar für diejenigen, mit denen man gar nicht sprechen will«, sagte er. »Schönen Gruß von meiner Frau.«
Schallendes Gelächter in der Aula.
Wo war ich? David klickte vor zur nächsten Seite der Präsentation.
»GSM bietet Raum für eine Menge personalisierter Daten«, fuhr er fort, »mit deren Hilfe User über ihre Mobiltelefone Anwendungen steuern können, die sogar mit einer Bezahlfunktion ausgestattet sein könnten.«
Wieder surrte es durch die Lautsprecher, diesmal allerdings nur kurz.
»Entschuldigung …«
David nahm das Handy und rief die Nachricht auf.
»Incubus landet heute Nacht. Antworte J für Ja.«
Er musste mehrmals schlucken, krallte sich regelrecht ans Rednerpult. Incubus. Der Dämon, der einem Albträume bescherte, die für alle Zeiten andauerten.
Was sollte er tun?
Ihm war klar, dass er im Grunde keine Wahl hatte. Aber wenn er machte, was Ray wollte, hätte er sich irgendwann aus dessen Griff befreit, und sein Leben würde wieder in die Normalität zurückkehren.
Er tippte ein J und drückte auf Senden.
5
Er solle aufs Tempolimit pfeifen, hatte Max dem Taxifahrer gesagt. Trotzdem kam es ihm so vor, als würden sie bloß in Zeitlupe vorankommen. Er starrte aus dem Fenster auf die Häuser an der Straße und auf die Menschen, die aus diversen Geschäften in Richtung U-Bahn schlenderten. All das in der grauen Februardämmerung.
Wieder rief er Paschies Nummer auf. Zum wievielten Mal, hätte er nicht sagen können. Wieder nur die Bandansage.
Was ist passiert, Paschie?
Mit einigem Glück hatte Sarah ein Strandgrundstück auf Tyresö ergattert, einer Halbinsel im Süden Stockholms. Ein Stück Sandstrand mitsamt Steg, an dem ein Segelboot anlegen konnte, plus Bootshaus. Die alte Hütte hatte sie abreißen und ein neues Haus errichten lassen, das ihre Liebe zu Schweden und zur schwedischen Architektur widerspiegelte: offene Räume, riesige, deckenhohe Fenster.
Eine junge Frau machte die Tür auf.
»Du bist bestimmt Max?«, fragte sie und lächelte ihn zaghaft an. »Sarah meinte, sie erwartet dich unten am Bootshaus.«
»Ich finde den Weg schon.«
Er lächelte ihr freundlich zu und kehrte ihr den Rücken. Sie hatte nicht zurückgelächelt.
Die Wiese war nass vom Schmelzwasser, und um nicht in den Schneematsch und die aufgeweichte Erde einzusinken, verlagerte er sein Gewicht, so wie er es als Kind auf Arholma gelernt hatte, wenn er durch den verschneiten Wald gelaufen war.
Eine beleuchtete Treppe führte nach unten an den Strand. Max zog die Tür zum Bootshaus auf und erspähte am Rand des Bootsstegs einen glimmenden Zigarillo. Die Glut wies ihm den Weg. Der Mond spiegelte sich auf der stillen Wasseroberfläche. Davon abgesehen war es stockfinster.
Sarah saß auf dem Steg und baumelte mit den Beinen. Max setzte sich neben sie. Vom Wasser zog es kalt herauf, doch Sarah schien sich nicht darum zu scheren. Würde sich die Eisdecke noch einmal schließen?
Sie zog an dem Zigarillo.
»Das hier war mir am allerwichtigsten, als wir das Haus gebaut haben«, sagte sie. »Der Platz für die Sauna. Ich hab gehört, dass die Sauna in Schweden schon diverse Ehen gerettet hat. Nur meine nicht, wie sich zeigen sollte.«
Das alles hatte Max schon mal gehört, deshalb entgegnete er nichts. Inzwischen hatten seine Augen sich an die Dunkelheit gewöhnt, und er konnte die Anspannung in ihren Gesichtszügen erahnen.
»Was hat Mischin eigentlich genau gesagt?«, wollte er wissen.
»Er hatte so ein Gefühl, dass irgendjemand in Paschies Büro gewesen ist und etwas gesucht hat.«
Mischin leitete die Wirtschaftswissenschaften an der Staatlichen Universität für Wirtschaft und Finanzen in Sankt Petersburg. Die Fakultät war mit der Unterstützung von Vektor aufgebaut worden.
Max war an der Planung der dortigen Vektor-Außenstelle beteiligt gewesen. Sich vor Ort an russische Militärakademien anzuschließen war tabu, und auch das Institut für Politikwissenschaften wäre ihnen zu heikel gewesen.
Am Ende war Charlie Knutsson, der Vektor-Vorstandsvorsitzende, auf die Idee gekommen, sich an eine wirtschaftswissenschaftliche Fakultät zu wenden. Immerhin konnte man in Russland endlich auch offen über marktwirtschaftliche Themen und Unternehmertum sprechen, und beides waren grundlegende Faktoren, die eine demokratische Entwicklung vorantreiben konnten.
»Was meinst du, könnte sie zu Verwandten gefahren sein?«, fragte Sarah.
Max schüttelte den Kopf.
»Nicht ohne Bescheid zu sagen.«
Sarah zog erneut an ihrem Zigarillo und warf dann den Stummel ins Wasser. Mit einem Zischen erlosch er. Dann drehte sie sich vom Wasser weg und sah Max an.
»Woran arbeitet Paschie im Moment?«
»Sie untersucht die Wechselbeziehungen zwischen jüngeren Privatunternehmen und den unterschiedlichen politischen Kampagnen. Wühlt sich durch die Firmenlisten, die sie von uns bekommen hat.«
»Um was herauszufinden?«
»Wer wen unterstützt. Welche Unternehmen von der Liste je nach Wahlausgang in der Versenkung verschwinden könnten. Wie sie in diesen unruhigen Zeiten ihre Geschäfte führen.«
»Weißt du, um welche Unternehmen es da geht?«, hakte Sarah nach.
Max hatte die Liste zur Stellungnahme an ihre Sponsoren und Investoren geschickt. Einige Unternehmen hatte er selbst, andere hatten ihre Geldgeber und ein Vorstandsmitglied hinzugefügt.
»Teilweise. Ich kenne nicht alle«, antwortete er.
In letzter Zeit war er mit anderen Dingen beschäftigt gewesen. Aber wie sollte er das Sarah verständlich machen?
Die Planken knarzten, als er sein Gewicht verlagerte.
Worüber schwiegen sie sich eigentlich gerade an? Über die Gefahren ihrer Arbeit – gerade in instabilen Zeiten, gerade wenn man bereit war, Risiken einzugehen? Dabei war Paschie weder naiv noch unvorsichtig. Mit dünnem Eis konnte sie umgehen. Und auch wenn es ihre Arbeit mit sich brachte, dass sie es gelegentlich mit gefährlichen und obendrein gewaltsamen Akteuren zu tun hatten, wurden Drohungen nur äußerst selten wahr gemacht.
Was hatte trotzdem dazu geführt, dass Paschie gleich zwei Meetings an ein und demselben Tag versäumt hatte? Sie war in vielerlei Hinsicht chaotisch und spontan, aber einen Geschäftstermin hatte sie noch nie verpasst. »Man verschwendet nicht anderer Leute Zeit, Max«, hatte sie immer wieder gesagt.
»Mischin hat darüber nachgedacht, zur Polizei zu gehen, war aber nicht gerade optimistisch«, fuhr Sarah fort.
Und das wäre wirklich Zeitverschwendung, das wussten sie beide.
»Von hier aus können wir nichts tun«, murmelte sie. »Wir können nicht einmal die Schwedische Botschaft kontaktieren, weil sie keine schwedische Staatsbürgerin ist.«
»Ich fahre morgen hin«, sagte Max. »Das sieht Paschie gar nicht ähnlich. Irgendetwas ist da passiert.«
Den Beschluss hatte er bereits im Taxi gefasst.
Sarah hatte ihm zwar das Gesicht zugewandt, trotzdem konnte er ihre Miene nicht deuten. Vermutlich war das auch der Grund, warum sie ihn hier draußen in der Dunkelheit hatte treffen wollen – so musste sie weder seinem Blick begegnen noch wegsehen. Sie hätte ihn weder dazu zwingen noch daran hindern können, nach Sankt Petersburg zu fliegen. Insofern war auch kein weiteres Wort zu diesem Thema nötig.
Die Vektor-Geldgeber erwarteten den letzten Lagebericht in der Woche vor der Wahl, die inzwischen so nah bevorstand, dass das Timing langsam, aber sicher kritisch wurde. Sie konnten sich keine Verzögerungen oder Reportlücken mehr leisten. Es standen große Investitionen auf dem Spiel.
Doch Max wollte sich nicht verrückt machen. Womöglich war Paschie wirklich einfach nur aufs Land gefahren, wo sie keinen Handyempfang hatte, vielleicht um dort auch noch die allerletzte Person aufzuspüren, die ihr helfen würde, die Wahlkampfmaßnahmen in der jeweiligen Gegend zu verstehen. Vielleicht würde er sie ja auch in ein Buch vertieft in irgendeiner traditionsreichen Bibliothek antreffen.
Trotz allem herrschten unsichere Zeiten in Sankt Petersburg. Das Risiko, dass etwas richtig Schlimmes passiert war, war einfach zu groß. Wenn er nur daran dachte, drehte sich ihm der Magen um.
Er selbst würde das Briefing für diesen Auftrag schreiben. Und er würde sich selbst darum kümmern müssen, bei der Suche nach Paschie Hilfe zu organisieren, ohne dabei seine eigene Sicherheit aufs Spiel zu setzen. Er mochte es nicht, zu solchen Reisen derart schlecht vorbereitet aufzubrechen, aber er hatte keine Wahl – und er war dafür ausgebildet worden zu improvisieren.
»Gibst du Mischin Bescheid, dass ich komme?«
Sarah nickte.
»In Polen sagen wir: Die Wahrheit ist eine Droge, die man genau dosieren muss«, meinte sie.
»Das gilt für alle Drogen, die ich nehme.«
6
Manchmal gab es einfach nichts Heilsameres als Stille. Wenn Stimmen und Geräusche ihm keine Ruhe ließen, sehnte er sich nach nichts mehr als nach Stille. Doch dann gab es da auch diese ganz bestimmte Art der Stille, die er nie hatte abschütteln können. Da waren selbst Schreie und Detonationen besser.
Von dieser ganz bestimmten Stille wachte Carl Borgenstierna auf. Sie katapultierte ihn um Jahrzehnte zurück: in den Februar 1944, zu jenem Abend, an dem mit einem Mal aller Motorenlärm verstummt war und nur noch lautlose Flugzeuge über Stockholm gekreist waren.
Das war jetzt zweiundfünfzig Jahre her.
Die Krankenschwester hatte dafür gesorgt, dass er es bequem hatte. Hatte ihm die Fernbedienung erklärt, mit der er das Kopfende seines Bettes hoch- und runterfahren konnte. Das Bett stand etwas zu nah am Fenster, aber damit hatte er sie nicht behelligen wollen. Nicht jetzt.
Zumindest war er endlich die Sauerstoffmaske los. Die Schwester hatte ihm mit einem Lächeln im Gesicht erklärt, dass sie die gleichen Masken auch für Frühchen verwendeten. Womöglich hatte sie ihn damit aufheitern wollen, nur hatte dies bei ihm den gegenteiligen Effekt gehabt.
Immer wieder fiel Borgenstierna in einen medikamentenbefeuerten Schlaf. Ihm gegenüber an der Wand hingen ein paar Kunstdrucke. Bruno Liljefors. Carl Larsson. In seinem Elternhaus in Gamla stan hing die Replik eines berühmten Kurbitsbildes. Darauf war das Leben als Treppe zu sehen, auf der man erst hinauf- und dann wieder hinunterstieg. Jede Stufe symbolisierte ein Jahrzehnt. Der höchste Punkt entsprach der fünfzig, und dahinter führte die Treppe hinab bis zur letzten Stufe, der neunzig.
Auf jeder Stufe standen ein Mann und eine Frau, die einander an den Händen hielten. Auf den ersten Stufen sahen sie noch jugendlich aus und standen kerzengerade da, während sie auf den letzten Stufen alt und krummgebeugt waren. Der Mann und die Frau verbrachten ihr ganzes Leben miteinander, Seite an Seite, bis ins Grab.
Unter der Treppe wuchs ein dicht belaubter Baum, und links davon hockte ein nacktes Kind auf der Erde. Zur Rechten des Stammes – direkt neben der letzten Treppenstufe – stand ein Skelett mit einer Sense in der Hand. Der Tod.
Der Lauf des menschlichen Lebens, von der Wiege bis zur Bahre.
Den Baum hatten sie in das Logo der Ostseestiftung integriert – jener Stiftung, der Carl Borgenstierna den Großteil seines Lebens gewidmet hatte. Er sah zum Nachttisch hinüber, zu den beiden Gegenständen, die in seinem Leben eine so wichtige Rolle spielten. Das Album, das er von Wallentin bekommen hatte. Mit der violetten Lilie auf der Vorderseite. Und dann ihr Foto. Sie hatte lediglich auf einer einzigen Stufe mit ihm auf der Alterstreppe gestanden. Anderthalb Jahre – mehr war ihnen nicht vergönnt gewesen. Das war mittlerweile über fünfzig Jahre her. Da hatten sie ihr ein Ende gesetzt – ihr und ihren gemeinsamen Träumen.
Vor einigen Tagen hatte ihn jemand besucht, während er dagelegen und geschlafen hatte. Ein junger, gut aussehender Mann, vielleicht fünfundzwanzig, dreißig Jahre alt. Die Krankenschwester hatte erst angenommen, er wäre ein Verwandter oder Freund. Doch dann erzählte sie, dass er von irgendeinem Institut in Stockholm gekommen sei, das mit Carl Kontakt aufnehmen müsse.
Institution, nicht Institut, dachte Carl. Und zwar Vektor. Ich selbst war an der Gründung beteiligt.
Der junge Mann, von dem die Krankenschwester erzählt hatte, hatte zuvor bereits mehrere Briefe geschrieben und an Carls Familiensitz in Gamla stan geschickt.
Ich weiß genau, wer du bist, Max Anger. Wenn ich deine Kontaktanfragen beantwortete, würde ich dich damit in den sicheren Tod schicken.
Und dein Überleben ist das Einzige, was ich noch habe.
Stockholm, im April 1943
Noch während Carl Borgenstierna durch das verspiegelte Foyer des Opernhauses hetzte, schälte er sich aus dem Mantel.
Wallentin lehnte an einem Tischchen und musterte ihn vom Kopf bis zu den Zehen.
»Na, in Eile?«
»Kein bisschen.« Carl sah auf seine Armbanduhr. »Neun Minuten. Wir haben noch Zeit.«
»Ja, ja. Hier, probier das.«
Wallentin drückte ihm eins von zwei Gläsern mit einem Rum-Cola-Getränk in die Hand, die auf dem Tisch gestanden hatten. Carl musste grinsen. Wallentin hatte wirklich jederzeit die neuesten Trends im Blick. Die Wahl des Getränks war genauso vorhersehbar gewesen wie die weiße Smokingjacke.
»Also, wo soll es hingehen, Wolfgang? In den Pazifik?«
»Die Insel heißt Costadero.« Wallentin warf einen Blick in das Programmheft, das auf dem Tischchen lag. »Dort lernen wir das Indiomädchen Zorina und den gut betuchten Don Pedro kennen.«
»Lass mich raten. Die kleine Zorina ist kreuzunglücklich, weil sie einen reichen Mann heiraten muss, obwohl sie einen anderen liebt?«
Wallentin nippte an seinem Drink und verzog leicht das Gesicht.
»Du suchst dir die Liebe nicht aus, Herr Borgenstierna. Die Liebe sucht sich dich aus.«
Carl schüttelte den Kopf. Er nahm noch einen letzten Schluck und stellte das Glas beiseite. Auf der anderen Seite des Foyers hatte eine soeben eingetroffene Gruppe seine Aufmerksamkeit erregt.
»Schau einer an«, sagte er. »Besuch aus Russland.«
Der Mann, der gerade das Foyer betreten hatte, fiel auf: groß gewachsen, stämmig und mit einem ungewöhnlich langen Hals. Er hielt eine junge Frau an der Hand. In ihrem schwarzen Kleid und mit ihren Locken sah sie eher aus wie ein italienischer Filmstar als wie ein armes Mädchen aus dem Sowjetimperium. Die ganze Operngesellschaft schien sie anzustarren.
»Warum ziehst immer du die Spannung an, Borgenstierna?«, fragte Wallentin, während das russische Pärchen geradewegs auf sie zuflanierte.
Das ungleiche Paar war fast bei ihnen angekommen, als die Frau sich plötzlich vorbeugte, um ihr Kleid freizuzupfen, das sich unter ihrem Absatz verfangen hatte.
Als sie sich wieder aufrichtete, trafen sich ihre Blicke.
»Kennt ihr euch?«, wollte der große Mann von ihr wissen.
Er hatte ihre Hand so fest gepackt, als hielte er einen Hund an der Leine. Dann bedachte er Carl mit einem eisigen Blick. Als die Frau den Kopf schüttelte, wandte er sich um und zog sie hinter sich her in Richtung Loge.
Sobald sie ihre Plätze eingenommen hatten, versuchte Carl, die Frau ausfindig zu machen. Sein Herz schlug schneller, als er sie in der Loge neben dem Mann mit dem ungewöhnlichen Aussehen entdeckte.
Sie drehte sich in seine Richtung, und ihre Blicke trafen sich erneut. Carl stockte der Atem. Sie schien regelrecht zu ihm zu sprechen.
Sieh mich nicht an … Bring mich hier weg!
Mittwoch, 28. Februar
7
Die Hündin zerrte derart an der Leine, dass Sergei Gatschow schon glaubte, sie würde ihn hinter sich her ins Meer ziehen. Was in aller Welt ist heute mit dir los, Scharik? Er sah sich um. Waren hier in der Dämmerung noch andere Hunde unterwegs? Doch alles, was er sehen konnte, war die verwaiste, baufällige Strandpromenade entlang des einstigen Marinestützpunktes am Stadtrand von Sankt Petersburg, in dem früher einmal jede Menge los gewesen war.
Scharik war Gatschows einzige Freundin im Leben. Sie folgte ihm überallhin, ob in den Hörsaal oder auf die Toilette, und verlieh seiner ansonsten recht eintönigen Existenz eine gewisse Lebendigkeit. Er wusste, dass er mit seiner Lebensweise – so ganz ohne jede physische Aktivität – eigentlich nicht zum Besitzer eines kraftstrotzenden Bluthundes taugte, aber ein Leben ohne Scharik konnte er sich nicht mehr vorstellen.
Der beißende Wind, der vom Meer herauffegte, schien die Hündin nicht zu schrecken. Sie hatte eine Fährte aufgenommen, und Gatschow fiel es zusehends schwer, sie zu halten. Er ging in die Hocke und beugte sich zu ihr hinunter.
»Du läufst mir jetzt nicht weg, verstanden? Du bleibst in meiner Nähe.«
Als er sich wieder aufrichtete, tat ihm der Lendenbereich weh.
Du wirst allmählich alt, Sergei.
Am Ende musste er dann doch zusehen, wie Scharik sich unter dem Zaun vor der Strandpromenade hindurchschob und auf die dünne silbrige Linie am Horizont zulief, die das tiefgraue Meer vom grauen Himmel trennte. Was war heute Morgen nur in sie gefahren?
Am Wasser blieb sie abrupt stehen. Von der Ostsee spülte die flache Morgenbrandung über den Strand. Rund um die Betonpfeiler und Uferkiesel schäumte das Wasser. Scharik warf den Kopf hin und her und fing an zu jaulen.
Gatschow blickte sich um, entdeckte eine Treppe, die hinab zum Strand führte, und schlenderte von dort aus vielleicht zwanzig Meter weiter. Schariks Jaulen wurde immer durchdringender.
»Still!«, rief er und stapfte durch den Sand. »Du siehst doch, dass ich komme. Andere liegen um diese Uhrzeit immer noch im Bett.«
Das traf sicherlich zu – nur dass in unmittelbarer Nachbarschaft der graffitibeschmierten, fensterlosen sowjetischen Marinebasis, die sich wie ein steinerner Riese in den Himmel reckte, weit und breit keine Menschenseele mehr wohnte. Stumm wachte die alte Anlage über die verrammelten Lagerhallen.
Wieder ging Gatschow neben Scharik in die Hocke, strich ihr über den zitternden Körper und massierte ihr die schmerzende Hüfte.
»Gutes Mädchen«, murmelte er. »Was hat dich denn so aufgeregt?«
Die Antwort fand Gatschow am Spülsaum. Ein paar Knochen. Na klar. Ein Hund bleibt nun mal ein Hund.
Doch dann runzelte er die Stirn. Was waren das für Knochen? Er zog einen aus dem seichten Wasser. Von einem einheimischen Vogel stammte der mit Sicherheit nicht. Er war bräunlich und für einen Vogelknochen viel zu dick.
Gatschow hielt sich den Knochen vors Gesicht, drehte ihn hin und her und ins Licht. Es hingen noch Fleischreste daran, obwohl sich jemand allem Anschein nach mit großem Appetit darüber hergemacht hatte.
Er sah hinunter ins Wasser. Dort lagen noch mehr Knochen und schaukelten in den Wellen, die über die Steine schwappten. Gatschows Magen krampfte sich zusammen, und Schariks dumpfes Winseln rückte in weite Ferne. Das sah doch aus wie ein Brustkorb?
Er drehte sich um. Beobachtete ihn jemand, oder war das bloß eine Erinnerung aus der Vergangenheit, die ihn gerade heimgesucht hatte? Die von dieser Entdeckung wieder wachgerufen worden war?
Als blutjunger Student hatte Gatschow im Rahmen eines Forschungsprojektes mehrere entlegene Gegenden in der Ukraine besucht, wo in den Dreißigern eine entsetzliche Hungersnot geherrscht hatte. Dort hatte er Gräber mit menschlichen Überresten gefunden – Überresten von Verhungernden, die anderen Verhungernden zum Opfer gefallen waren.
Die Bilder aus der Ukraine hatten sich für alle Zeiten in sein Gedächtnis eingebrannt. Die Menschen dort waren unfassbar verzweifelt gewesen.
Konnte das wirklich stimmen? Oder bildete er sich das gerade ein?
Der Knochen in seiner Hand und die im Wasser stammten ohne jeden Zweifel von einem Menschen.
Es war genau wie damals. Im ukrainischen Hinterland.
Holodomor.
Wieder krampfte sich sein Magen zusammen, und diesmal konnte er nicht mehr dagegen ankämpfen. Er ließ den Knochen fallen und beugte sich vor. Leerte seinen Magen.
Irgendwann ließen die Krämpfe nach, und er spürte, wie Scharik ihn anstupste. Leise winselte. Behutsam tätschelte er sie und wischte sich mit der anderen Hand den Mund ab.
Fünf Jahre nach dem Fall der Sowjetunion. War es wirklich wieder so schlimm geworden?
Gatschow griff nach Schariks Halsband und leinte sie wieder an. Ist ja gut, feines Mädchen. Ihm war klar, dass er die Polizei nicht rufen konnte. Das hier durfte er nur mit seinen alten Vertrauten teilen.
Gatschow warf einen letzten Blick aufs Meer.
»Komm, Scharik«, sagte er. »Zeit, wieder nach Hause zu gehen.«
8
Von seinem Fensterplatz aus hatte Max die Flugroute über die Ostseeinseln verfolgt. Er konnte sie fast alle benennen.
Die Stockholmer Schären hatten sie längst hinter sich gelassen. Trotzdem war Max in Gedanken immer noch dort. Er konnte sich noch gut erinnern, wie allgegenwärtig sich die Bedrohung aus dem Osten während seiner Kindheit angefühlt hatte.
Als er noch ein kleiner Junge gewesen war, war er oft den Schotterweg hinauf zur Norra gefahren, hatte sein Fahrrad hinter einem Baum versteckt und war dann über die Klippen und an den Warnschildern vorbeigestreift, um einen Blick auf die Batteri Arholma zu erhaschen – eine geheime Küstenverteidigungsanlage, von der alle auf der Insel wussten. Einmal hatte alles um ihn herum angefangen zu wackeln, noch während er auf den Klippen saß und übers Meer blickte. Es hatte so geklungen, als hätte sich ein gigantisches eisernes Zahnrad in Bewegung gesetzt. Max war aufgesprungen und weiter auf die Klippen hinausgelaufen. Im selben Moment hatte sich der Fels aufgetan, und ein riesenhafter Arm hatte aufs Meer gezeigt. Gen Osten.
Es war die größte Kanone, die Max jemals gesehen hatte. Ein unversehens erwachter Drache, der seinen Zorn über das weite, wogende Meer gerichtet hatte. Dann lösten sich mehrere Schüsse, und um ihn herum bebte die Erde. So schnell er konnte, rannte Max zurück zu seinem Fahrrad, und noch während er den Abhang hinabraste, kreisten die Fragen in seinem Kopf. Warum wohnt da eine Kanone im Berg?
Ein paar Jahre später war er wieder dort. Er und Papa standen nebeneinander vor dem Zaun, der um die Anlage herum verlief, und Papa unterhielt sich mit dem Mann auf der anderen Seite. Der Mann sah sich um und machte dann das Tor für sie auf. Max hatte ihn schon ein paarmal bei ihnen zu Hause in der Küche sitzen sehen: Papa und er hatten Poker gespielt und sich eine Flasche Whisky geteilt.
Der uniformierte Mann führte sie über einen Weg bis zur höchsten Erhebung. Jenseits des Ufers mit zwei großen Birken erstreckte sich der weite Horizont. Als sie sich der Kuppe näherten, streckte Papa die Hand nach Max aus und flüsterte ihm zu: »Du weißt, was ich zu dir gesagt habe. Kein Wort zu niemandem.«
Der Offizier hob ein tarnfleckiges Gumminetz hoch, das den Eingang zu einer Felskammer verdeckte. Der Durchgang erinnerte an eine Grotte. Als die schwere Tür hinter ihnen zufiel, war mit einem Mal alles pechschwarz. Max griff nach Papas Unterarm und presste sich an ihn.
Irgendwann erreichten sie eine zweite schwere Metalltür. Sowie der Mann sie aufgeschlossen und das Licht eingeschaltet hatte, drehte er sich zu Papa um.
»Fünfzehn Minuten, haben wir gesagt.«
Papa nickte und schob Max über die Schwelle. Von der Kammer aus wanderten sie schweigend weiter durch ein Labyrinth aus Gängen, kamen an einem Krankenzimmer vorbei, an einem OP, am Schlafsaal und am Speisesaal. An einer Wand entdeckte Max eine Tafel, auf der stand, dass hier während der kritischsten Tage im Kalten Krieg bis zu einhundertzehn Mann beschäftigt gewesen waren. Die gesamte Stellung war in den Fels gesprengt worden.
Papa deutete in einen angrenzenden Raum.
»Das da ist das Herzstück der Anlage. Die Kommandozentrale. Hier werden sämtliche Informationen aus den Radarstationen zusammengetragen, und hier wird auch der Feuerbefehl gegeben.«
Und wieder sah Max den großen Drachen vor sich, der ihn in seinen Träumen immer noch heimsuchte.
»Warum gibt man denn einen Feuerbefehl?«