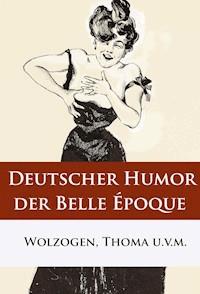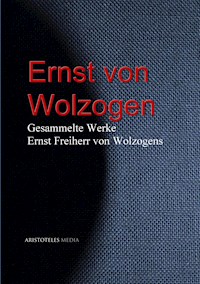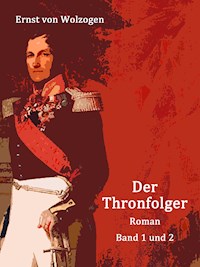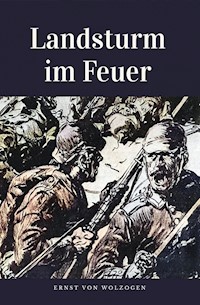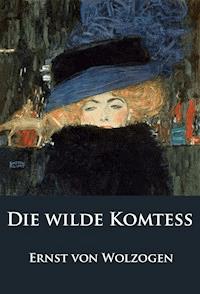Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein humoristischer Musikanten-Roman. Die Serie "Meisterwerke der Literatur" beinhaltet die Klassiker der deutschen und weltweiten Literatur in einer Sammlung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 520
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Kraft-Mayr
Ernst von Wolzogen
Inhalt:
Ernst von Wolzogen – Biografie und Bibliografie
Der Kraft-Mayr
Erstes Kapitel.
Zweites Kapitel.
Drittes Kapitel.
Viertes Kapitel.
Fünftes Kapitel.
Sechstes Kapitel.
Siebentes Kapitel.
Achtes Kapitel.
Neuntes Kapitel.
Zehntes Kapitel.
Elftes Kapitel.
Zwölftes Kapitel.
Dreizehntes Kapitel.
Vierzehntes Kapitel.
Fünfzehntes Kapitel.
Sechzehntes Kapitel.
Siebzehntes Kapitel.
Achtzehntes und letztes Kapitel.
Der Kraft-Mayr, E. von Wolzogen
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN:9783849639273
www.jazzybee-verlag.de
www.facebook.com/jazzybeeverlag
Ernst von Wolzogen – Biografie und Bibliografie
Ernst Freiherrvon Wolzogen, Schriftsteller, Stiefbruder des vorigen, geb. 23. April 1855 in Breslau, wurde bis zum Tode seiner Mutter (1863), einer Engländerin, ganz als Engländer erzogen, studierte 1876 bis 1879 in Straßburg und Leipzig deutsche Literatur, Philosophie und Kunstgeschichte und verlebte hierauf mehrere Jahre in Weimar. 1882 ließ er sich in Berlin, später in München nieder, jetzt hat er seinen Wohnsitz in Darmstadt. W. hat sich besonders als munterer, leichtflüssiger Erzähler, der in maßvoller Weise der modernen realistischen Richtung Rechnung trägt, und auch als Lustspieldichter vorteilhaft bekannt gemacht. Es erschienen von ihm die (teilweise oft ausgelegten) Erzählungen und Romane: »Um 13 Uhr in der Christnacht« (Leipz. 1879), »Immakulata« (das. 1881), »Der Mieter des Herrn Thaddäus« (das. 1886), »Heiteres und Weiteres« (Stuttg. 1886), »Basilla«, ein »Thüringer Roman« (das. 1887), »Die rote Franz« (Berl. 1888), »Er photographiert«, Humoreske (das. 1890), »Erlebtes, Erlauschtes und Erlogenes« (das. 1892), »Die Entgleisten« (das. 1894), »Das gute Krokodil und andre Geschichten« (das. 1893), »Fahnenflucht« (das. 1894), »Ecce Ego. Erst komme ich« (das. 1895), »Die Gloriahose« (das. 1897), »Geschichten von lieben süßen Mädeln« (das. 1897), »Vom Peperl und andern Raritäten« (Münch. 1897), »Das Wunderbare« (Berl. 1898), »Das dritte Geschlecht« (das. 1899, 150. Tausend 1903), »Was Onkel Oskar mit seiner Schwiegermutter in Amerika passierte« (das. 1904), »Seltsame Geschichten« (das. 1906), »Der Topf der Danaiden« (das. 1906), »Der Bibelhase« (Stuttg. 1908); ferner (seit 1888) in »Engelhorns Romanbibliothek«: »Die Kinder der Exzellenz«, »Die tolle Komtesse«, »Die kühle Blonde«, »Blau-Blut« (3 Bde.), »Die Erbschleicherinnen«, »Der Thronfolger«, »Der Kraft-Mayr«, ein humoristischer Musikantenroman, dem Andenken Franz Liszts gewidmet (1897, 2 Bde.; als Lustspiel bearbeitet mit E. Haller, Berl. 1906) und »Die arme Sünderin« (1901, 2 Bde.). Auf dramatischem Gebiete schrieb W. das Festspiel: »Das Gastgeschenk der Phantasie« (1882), die Lustspiele: »Der letzte Zopf« (1884), »Die Kinder der Exzellenz« (mit W. Schumann, 1890), »Das Lumpengesindel«, Tragikomödie (Berl. 1892, 2. Aufl. 1902), »Ein unbeschriebenes Blatt« (1896), »Unjamwewe« (1897), die Schauspiele: »Daniela Weert« (Berl. 1894), »Der Bastard« (1903); die Operntexte: »Feuersnot« (Berl. 1901, 9. Aufl. 1902; in Musik gesetzt von Richard Strauß), »Die bösen Buben von Sevilla« (1903) und »Die Bäder von Lucca« (1903, nach Heine). Seine Gedichte veröffentlichte W. u. d. T.: »Verse aus meinem Leben« (Berl. 1907); mit seiner Gattin Elsa, geborne Seemann (geb. 5. Aug. 1876 in Dresden), verfaßte er das »Eheliche Andichtbüchlein« (das. 1903). Außerdem veröffentlichte W. noch biographisch-kritische Studien: »George Eliot«, »Wilkie Collins« (beide Leipz. 1885), die Flugschrift: »Linksum kehrt schwenkt-Trab. Ein ernstes Mahnwort an die herrschenden Klassen« (1.–4. Aufl., Berl. 1895), »Ansichten und Aussichten. Gesammelte Studien über Musik, Literatur und Theater« (das. 1908) und gab die »Eigene Lebensbeschreibung des schlesischen Ritters Hans von Schweinichen« (Leipz. 1885; 2. Aufl., Berl. 1907) heraus. Ende der 1890er Jahre schuf W. das sogen. Überbrettl (s. d.) und veranstaltete Aufführungen in zahlreichen deutschen Städten; auch setzt er sie noch jetzt als musikalisch-deklamatorische Unterhaltungen fort, wobei ihn seine Gattin durch ihren eindrucksvollen Vortrag von Liedern zur Laute unterstützt.
Der Kraft-Mayr
Erstes Kapitel.
»Der weeiche Kinstler.«
In einem der ältesten Häuser am Luisenplatz in Berlin, drei Treppen hoch, bewohnte der Pianist Florian Mayr ein möbliertes Zimmer bei der Magistratssekretärswitwe Stoltenhagen. Das Zimmer war niedrig, die schmucklose weiße Decke verräuchert, die billige Tapete stark abgenutzt, der höchst unebene, ausgetretene Fußboden mit grauer Oelfarbe gestrichen; aber dafür war es so groß, wie man nur selten ein möbliertes Zimmer findet, und hell war es auch mit seinen zwei Fensterchen nach Westen und zwei Fensterchen nach Norden. Und groß mußte das Zimmer sein, in welchem Florian Mayr mit seinen gewaltigen, sehnigen Tatzen die Tasten schlug, sonst hätte die Tonfülle, die seinem Konzertflügel entströmte, wohl schier die Wände gesprengt, mindestens aber den empfindlichen Ohren des Klavierbändigers auf die Dauer ein Leid angethan.
Herr Florian Mayr war ein erstaunlicher Mensch. Ein junger Mann von dreiundzwanzig Jahren, weder schön, noch elegant, noch reich, pflegt einer Berliner Zimmervermieterin wohl schwerlich zu imponieren, noch dazu einer, der durch sein Klavierspiel das ganze Haus erbeben macht und sich obendrein seinen Thee und Kaffee selbst hält und zubereitet; aber Florian Mayr imponierte thatsächlich der Frau Stoltenhagen, sowie auch ihrer Nichte aus Pommern und ihrem Dienstmädchen aus Müncheberg ganz gewaltig. Der junge Pianist war nämlich ein Zielbewußter; das war ihm an der Nase anzusehen, die in dem hageren, bartlosen, etwas lebergelben Gesicht drinlag wie ein erratischer Block auf flachem Heideland. Einem jungen Herrn mit solcher Nase machte man kein X für ein U, und auch die gutmütigen, oft sogar lustigen, kleinen Braunaugen konnten geradezu schreckhaft funkeln, sobald Florian Mayr in Zorn geriet, was sehr leicht geschah, wenn die drei bedienenden Frauenzimmer seinen hohen Ansprüchen an Pünktlichkeit, Ordnung und Sauberkeit nicht genügten. Dem Dienstmädchen hatte er in aller Ruhe versprochen, ihr den gußeisernen Stiefelknecht um die Ohren zu schlagen, falls sie bei ihrer Gewohnheit beharren sollte, dies Gerät allabendlich thunlichst weit unter das Bett zu schieben. Sie hatte ihm diese Versicherung geglaubt und daraufhin ihr Urteil über ihn in den bedeutsamen Ausspruch zusammengefaßt: »Herr Mayr schmeißt so 'ne Jewalt von sich.«
Das war's, das Gewaltsame in seinem Wesen, was den Frauen achtungsvolle Scheu einflößte. Er war ein ganzer Mann, trotz seines langen Künstlerhaars, das ihm, aus der hohen, schmalen Stirn glatt zurückgestrichen, schlicht bis an den Nacken herunterhing. Und außerdem war er so unheimlich solide. Sein Leben war nach der Uhr geregelt, seine Rechnungen bezahlte er pünktlichst und nie brachte er einen Rausch oder sonst welche nächtliche Begleitung mit heim. Frau Stoltenhagen wußte auch, daß ihr Zimmerherr in den feinsten Häusern Unterricht gab und für die Stunde fünf bis zehn Mark bekam. Ihre Nichte aus Pommern, Fräulein Luischen, war ja auch für das Solide und ein ganz hübsches, gesundes Mädchen obendrein. Da konnte man nicht wissen – es wäre gar nicht so übel gewesen. Inzwischen hielt sich die gute Dame dafür, daß er sein Frühstück und Abendbrot nicht von ihr bezog, dadurch schadlos, daß sie an seinem Vorrat von Kolonialwaren, sowie an seiner Seife und selbst an seinem Zahnpulver harmlos partizipierte. Frau Stoltenhagen konnte sich übrigens doch nicht recht erklären, wie ein junger Mensch von so frühreifer Männlichkeit und unheimlicher Solidität zu erklären sei, wenn nicht irgend ein Geheimnis hinter ihm steckte. Und deshalb unterzog sie alle an Herrn Florian Mayr gerichteten Schriftstücke einer genauen Durchsicht, so oft sie durch Zufall oder mit Gewalt solcher habhaft werden konnte. Ihr Verdacht erstreckte sich nach zwei Richtungen hin: entweder war Florian Mayr schon ausgefüllt durch eine »große Liebe«, oder aber er war etwas andres, als wofür er sich ausgab. Wie oft hatte nicht Frau Stoltenhagen schon die lebensgroße Gipsbüste Franz Liszts, welche zwischen den beiden Fensterstöcken, links neben dem Flügel auf einer schwarzen Holzsäule stand, sinnend betrachtet, und sich so ihre Gedanken gemacht über die auffallende Aehnlichkeit ihres Mietsherrn mit dem großen Klaviertitanen. Dasselbe schmale, knochige Gesicht, dieselbe alles beherrschende Nase, dasselbe lange, schlichte Haar. Mund und Augen waren freilich verschieden, und statt der fünf Warzen des Altmeisters besaß Herr Florian nur eine, aber es war doch immerhin eine Warze. Sollte er nicht vielleicht ein Sohn von Franz Liszt mit irgend einer russischen Fürstin sein? Er behauptete zwar, von einem bescheidenen Organisten in Bayreuth abzustammen, aber was wollte das besagen! Die russische Fürstin konnte sich mit einer Handvoll Rubel den Bayreuther Orgelmann gekauft haben. Frau Stoltenhagen war eine Dame von lebhafter Einbildungskraft. Sie hielt die Sache für so gut wie erwiesen, und wenn sie trotzdem nicht müde ward, nach dokumentarischen Beweisstücken zu forschen, so war das wohl nur der Ausdruck eines gewissen amtlichen Uebereifers, der ihr im langjährigen Verkehr mit ihrem seligen Magistratssekretär so angeflogen war.
Es war am 11. November des Jahres 1879, halb zehn Uhr vormittags. Ein Tag wie jeder andre auch. Um acht Uhr wie immer war Florian Mayr aufgestanden, hatte seinen Kaffee gekocht und dann eine Stunde lang Tonleitern und Fingerübungen gespielt wie immer. Um zehn Uhr hatte er heute seine erste Stunde zu geben. Er war daher im Begriff, sich zum Ausgehen zu rüsten. Zuvor aber hatte er heute eine neue, eigenartige Vorkehrung zu treffen. Er nahm einen Bogen Schreibpapier, kniffte ihn dreifach zusammen und zerschnitt ihn mit dem Messer in acht Teile. Dann nahm er die Feder zur Hand und schrieb auf jeden der acht Zettel in großen, steilen Zügen ein inhaltschweres, wuchtiges Wort hin. Dann schnitt er von einem zweiten Bogen einige ganz schmale Streifen ab und bestrich sie mit Gummi arabicum.
So weit war er mit seinen Vorbereitungen gekommen, als einigermaßen schüchtern an seine Stubenthür gepocht wurde.
»Halt! Werda?« schrie Florian Mayr und sprang mit zwei großen Sätzen nach der Thür. Er schob den Riegel zurück, öffnete sie ein wenig und guckte durch den schmalen Spalt hinaus. »Ach Sie sind's, Prczewalsky? Na Prost! treten Sie ein!« rief er nicht eben froh gelaunt und ließ einen mittelgroßen Herrn hereintreten, welchen der lange Havelock, der Riesenschlapphut und das langlockige, weiche Haar sofort als einen Künstler zu erkennen gaben.
Der Herr mit dem schwierigen Namen nahm seinen Hut ab, fuhr sich mit den fünf Fingern der Linken durch die weiche, dunkle Mähne, zog dann den melancholisch über die Mundwinkel herabhängenden Schnurrbart durch die Finger, um den geschmolzenen Rauhreif daraus zu entfernen, und bequemte sich dann erst, mit müdem Augenaufschlag und müdem Nasalton, guten Tag zu wünschen.
»Womit kann ich Ihnen dienen? Wollen Sie nicht Platz nehmen?« sagte Mayr, ungeduldig auf das alte Kanapee deutend. »Das heißt, Sie sehen, ich bin eben im Begriff auszugehen. Wie geht's Ihnen sonst, Prosit?«
»Danke, – schlecht; die Nerven, die Nerven!« klagte der polnische Herr schläfrig, indem er sich mit dem Handrücken über die hochgewölbten Augendeckel fuhr. »Warum sagen Sie immer ›Prosit‹ zu mir, lieber Freund?«
»Ja, wissen S',« versetzte Florian Mayr gemütlich, »bis ich Ihren Namen glücklich herausgeniest hab', sag' ich lieber gleich ›Prosit‹! Ich könnt' aber auch ›G'sundheit‹ sagen, wenn Ihnen des vielleicht lieber wär'.«
Der polnische Kollege klappte mit Anstrengung seine schönen, faden Augen weit auf, und nöhlte, mit sanftem Vorwurf in der stets nasig umflorten Stimme: »Lieber Freund, warum wollen sich immer über mich lustig machen? Wenn Ihnen mein Name zu schwerr ist, nennen Sie mich doch beim Vorrnamen. Wir sind doch Kunstgenossen.«
»Also, is recht, wie heißen denn Sie?«
»Aber bitte, lieber Freund, hier ist meine Karte: ich heiße Antonin – vergessen Sie doch nicht immer!«
Florian nahm die Karte in Empfang, betrachtete sie mit scheinbarem Erstaunen vorn und hinten, und es zuckte eigentümlich um seine Mundwinkel, als er nach einer kleinen Pause erwiderte: »I da schau, richtig bloß Antonin. Ich hätte Sie entschieden auf etwas mit ›laus‹ hinten taxiert.«
»Warum? Bitte.«
»Ja, ich kann mir nit helfen – Sie machen mir halt so einen lausigen Eindruck. Nichts für ungut, lieber Freund.«
Der schöne Pole schaute zweifelhaft zu seinem langen Kollegen auf, und seine Schnurrbartenden vibrierten leicht gekränkt. »Es kommt mir vorr, Sie wollen Witz machen,« sagte er betrübt. Und da Florian Mayr nichts Verständliches erwiderte, so trat er langsam an den Schreibtisch – ein hellpoliertes, sogenanntes Cylinderbureau – und starrte unentschlossen, fast trübsinnig auf die Zettel und Papierstreifen darauf nieder. Er stieß ein paarmal vorbereitend Luft durch die Nase, ehe er fragte: »Was werrden Sie da machen?«
»O, ich habe nur etwas geschriftstellert,« versetzte Florian Mayr seelenvergnügt, wie er immer war, wenn er eine rechte Bosheit an den rechten Mann gebracht hatte.
»Merkwürdig,« sagte der Pole nach einer kleinen Pause kopfschüttelnd und dann las er mit sterbensmüder Stimme die Inschrift von den Zetteln ab: »Erstens: Pfui!! Scham di!!! Zweitens: Ha! Du bist erkannt! Drittens: Dumme Gans! Viertens: Affenschwanz! Fünftens: Eingegangen! Sechstens: Alte Kuh! Siebentens: Gibst jetzt Ruh?! Achtens: Mir war's gnua!«
Florian schien mit der Ratlosigkeit seines Freundes Antonin Mitleid zu empfinden, oder war es ein gewisser Erfinderstolz, der ihn zur Mitteilung drängte – kurz und gut, er ließ sich zu einer Erklärung herbei. Er legte je einen der Zettel in die acht Schubkästen des Cylinderbureaus und verklebte sodann die Vorderwand jedes Kastens mit der Zwischenleiste des darüber befindlichen mittelst eines schmalen Papierstreifens. Wenn die neugierige Wirtin nun in seiner Abwesenheit irgend eine Schublade öffnete, so war sie durch das Zerreißen des Papierstreifens unfehlbar verraten, und er hatte dann die Genugtuung, daß sie den betreffenden schmeichelhaften Zettel gelesen haben mußte. Als das schwierige Werk der Verklebung glücklich vollbracht war, richtete sich Florian Mayr stolz auf und flüsterte triumphierend: »Na, was sagen S' dazu, Antonin Prositlaus? Die Spatzenfalle ist patent, was? Aber wissen S', wie ich die G'sellschaft neulich für ihren permanenten Kaffeediebstahl g'straft hab'? Ein Viertelpfund Rhabarber hab' ich mir um schweres Geld gekauft und ihn mit einem halben Pfund feingemahlenem Kaffee sorgfältig vermischt. Ich sag' Ihnen, die Wirkung war wunderbar! Den ganzen Tag hat nachher dahinten das Thürl geklappt und eins ist immer angstvoll davorgestanden. Eine Eselsfreud hab' ich gehabt und jedesmal, wenn ich's im Korridor hab' laufen und ängstlich flüstern hören, hab' ich den Kopf nausgesteckt und hab' g'sagt: Ihnen ist wohl nicht recht wohl, liebe Frau? oder liebes Kind, je nachdem.«
Prositlaus lächelte fast unmerklich und sagte: »Merkwürdig, – serr komisch! Apropos, lieber Freund, was ich sagen wollte: können Sie mir nicht zwanzig Mark leihen?«
»Augenblicklich nicht, bedaure sehr; aber von dem G'sundheitskaffee is noch reichlich vorhanden, falls Sie vielleicht Bedarf haben. Entschuldigen Sie, ich muß jetzt wahrhaftig fort.«
Damit stürzte sich Florian Mayr in seinen Winterrock, stülpte den Hut auf und – legte den Schlüssel zum Schreibbureau augenfällig oben auf dasselbe. Er wußte, daß Frau Stoltenhagen dieser Versuchung nicht widerstehen würde. So boshaft war Florian Mayr. Dann öffnete er seinem Gaste die Thür weit und sagte mit einer einladenden Handbewegung: »Es hat mich sehr gefreut.«
Mit einem tiefen Seufzer verließ Prczewalsky das Zimmer. Mayr folgte ihm auf dem Fuße, warf die Thür kräftig ins Schloß und rief in den schmalen Hinterkorridor hinein: »Frau Stoltenhagen, ich gehe jetzt.«
Den Schlapphut tief in die Stirn gezogen, düster wie ein ehrlicher Leidtragender, stelzte der edle Pole die enge Treppe hinunter. Seinem Kollegen Mayr jedoch war es nicht gegeben sich mit solcher Langsamkeit abwärts zu bewegen. »Entschuldigen S', ich hab' wirklich keine Zeit,« sagte er, flüchtig an seinen Cylinderhut greifend. »Behüt Sie Gott, Herr Kollege.« Und damit sprang er in Riesensätzen wie ein übermütiger Junge die Treppen hinunter.
Er hörte, wie jener ungeschickt hinter ihm drein polterte und mit Aufbietung seiner schwachen Lungenkräfte ihm nachrief. War's Mitleid, oder that ihm seine allzugroße Rücksichtslosigkeit schon leid, kurz, er erwartete den Kollegen unten an der Hausthür.
Keuchend gesellte sich Prczewalsky zu ihm. »Bitte, lieber Freund, Doktor hat mir gesagt, ich leeide an Fettherz. Lassen Sie mich Ihnen doch begleeiten. Ich habe nichts zu thun.«
»Is recht,« sagte Florian und schlug eine Gangart an, welche den armen Polen sehr bald nötigte, ihn beim Arm zu ergreifen, um sich mitschleppen zu lassen. Atemlos trippelte er neben dem langbeinigen Kollegen her, aber er konnte sich die Gelegenheit, sein Anliegen vorzubringen, nicht entgehen lassen, denn dieser Florian Mayr war so schwer zu fassen. Immer hatte er so viel zu thun.
»Also, was ich sagen wollte,« hub er an. »Ich brauche Geld. Ich habe keeinen Pfennig in der Tasche, kann mich heute nicht rasieren lassen. Sagen Sie, wie macht man, daß man Stunden geben kann für zehn Mark in vorrnehmen Familien, wo schöne Töchter sind?«
»Aber Sie haben doch Vermögen?« wandte Mayr ungeduldig ein. »Sie lassen ja Ihre Sonaten auf eigene Kosten drucken. Da müssen Sie doch ein Geld haben! Sie sind eingerichtet wie ein Graf und speisen in einem feinen Weinrestaurant.«
»O ich glaube, Sie haben kein Verständnis für den schaffenden Kinstler. Etwas Bequemlichkeit und Luxus brauche ich für die Inspiration. Die Inspiration kommt nicht, wenn ich Knoblauchwurst esse und Bier dazu trinke. Ich kann auch nicht komponieren mit zerrissene Hosen und Fettfleck auf der Krawatte. Wagner braucht sogar gelbes Atlas im Futter.«
»Naja, des is halt der Wagner!« unterbrach Florian lakonisch.
»Das weeiß ich,« erwiderte jener, den Kopf aufwerfend, mit einem verächtlichen Lächeln. »Aber warrum soll ich nicht über Nacht der Prczewalsky werrden? Der schaffende Kinstler hat das Recht auf Stimmung. Ich bin ein weeicher Kinstler, ich brauche weeiche Stimmung, weeiche Stoffe, weeiche Polster, weeiche Farben um mich, und grobbe Speisen machen mir Indigestion.«
»Essen Sie doch weeiche Eeier, die sind nicht teeier,« versetzte Florian, indem er sich bemühte, des Kollegen auffallend östliche Aussprache des eï nachzuahmen.
Der weiche Künstler überhörte diesen freundschaftlichen Rat und fuhr eifrig fort: »Ich habe meine neueste Sonate für Klavier und Cello drucken lassen. Sie wissen – Grützmacher gewidmet – kostet mich eine Monatsrente – und was bleibt mir übrig? Ich muß Geld verdienen. Sie haben ja so viele Lektionen und bekommen so gut bezahlt. Können Sie mir nicht eine reiche Familie mit schönen Töchtern abtreten?«
»Schön müssen sie auch noch sein?«
»Ja, gewiß; ich gehe doch nicht, um dumme Gänse Klavier zu lernen. Ich will heeiraten. Ich werrde das Opfer bringen für die Kunst, ich werrde mich verkaufen. Den Menschen werrde ich verkaufen, damit der schaffende Kinstler gerettet wird.«
Florian Mayr wandte seinen Kopf zur Seite, um seinen Gefühlen durch eine heimliche Grimasse von großer Anmut passenden Ausdruck zu geben. Und dann versetzte er, den schönen Antonin so freundschaftlich in den Arm zwickend, daß er kläglich aufwinselte. »Also Sie glauben, daß die schönen und reichen Mädchen mit solcher Leichtigkeit auf den weichen Künstler anbeißen würden?«
Der Pole maß ihn mit einem fast mitleidigen Blick. »Aber lieber Kollege, ich werrde doch die Weiber kennen! Mit Zucker fängt man sie alle, die Kammerkatze wie die Fürstin, besonders wenn sie musikalisch sind. Wenn ich Ihnen meine Abenteuer erzählen würde, Sie würden nicht glauben. Die Gräfin Proskowsky hat für mich Gift genommen, und der Fürst Smirczicky hat sich mit mir schießen wollen. Aber ich hatte keine Zeit, ich hatte am andern Abend ein Konzert in Warschau, wo ich meine Symphonie Opus 7 dirigierte. Die Fürstin Smirczicky ließ mir da bei einen Lorbärkranz überreichen. Ich versichere, die ganze hohe Aristokratie steht mir zur Verfügung. Aber diese Damen heeiratet man nicht – sie werrden leicht unbequem und kosten mehr, als sie einbringen. Eine kleeine Kaufmannstochter ist besser, so mit ein paar hunderttausend Mark. Wissen Sie nicht so etwas für mich?«
»Wenn sie eine Gans sein darf –?«
»Gewiß, zieh' ich sogar vorr.«
»Und unmusikalisch wie ein Mops –?«
»Hm, wenn sie nur nicht lang und mager ist.«
»Nein, nein, sie ist schön rund und reich und romantisch dazu.«
»Serr gut, wo wohnt sie?«
»Es ist die einzige Tochter vom reichen Konsul Burmester in der Markgrafenstraße. Ich werde Sie dort empfehlen. Sie thun mir sogar einen Gefallen, wenn Sie mir die Stunden abnehmen. – Aber hier sind wir an Ort und Stelle. Ich muß da hinauf. Also Herr Kollege –« damit lüpfte er ein ganz klein wenig seinen Cylinder und klingelte an dem Hause in der Roonstraße, vor dem sie stehen geblieben waren.
»Danke serr, lieber Freund,« versetzte der Pole. »Apropos, können Sie mir nicht zehn Mark leihen? Ich muß mich doch rasieren lassen.«
»Des können S' doch für zehn Pfennige haben.«
»Mein Gott, mein Gott, Sie sind ein merkwürdiger Mensch! Sie haben kein Verständnis für den schaffenden Kinstler. Da sitzen die Louisdors zu Tausenden,« er schlug sich vor die Stirn, »und Sie wollen mir nicht zehn Mark leihen!«
Die schwere eichene Hausthür war inzwischen aufgesprungen. Florian Mayr stemmte seinen Fuß in die Spalte, damit sie nicht wieder einschnappte, dann zog er sein Portemonnaie aus der Tasche, entnahm ihm ein Zehnmarkstück und sagte: »Also bitte, Verehrtester, bis zum Ersten, nicht wahr? wann die Renten von Ihren polnischen Gütern eintreffen. Ich hab' es auch nicht übrig. Lassen Sie sich nur ja recht sauber barbieren.«
Prczewalsky schnaubte fast unhörbar seinen Dank durch die Nase, ließ das Goldstück in seine Westentasche gleiten und reichte dem Kollegen zum Abschied die Hand.
»Ä pfui Deifel! Als ob einem ein Fuchsschwanz durch die Finger gezogen würde,« brummte Florian Mayr halblaut vor sich hin, während er die vornehme teppichbelegte Treppe hinaufstieg. Und er schüttelte seine bloße Hand, als wäre ihm was Ekliges daran kleben geblieben.
Der »weiche Künstler« aber äußerte sich im langsamen Dahinwandeln auf polnisch in noch weniger schmeichelhafter Weise über seinen Kollegen. Er haßte diesen knorrigen, rücksichtslosen Menschen, und er ersehnte brennend eine Gelegenheit, um sich an ihm zu rächen für all die boshaften Scherze, durch welche ihn der Rohling zu kränken liebte. Langsam wandelte er dahin, bis er auf einen feinen Friseursalon stieß, wo er sich für zwanzig Pfennige rasieren lassen konnte. Und vom Barbier ging er zum Konditor und trank eine Tasse Schokolade und aß Aepfelkuchen mit Schlagsahne dazu, denn er war ein »weeicher Kinstler«.
Zweites Kapitel.
Die verfluchte Musik!
Mit den Stiefeletten des Herrn Konsuls in der Hand wollte der Diener das Schlafzimmer seines Herrn verlassen.
»Ach Fritz, Sie könnten mir die Lampe mit dem grünen Schirm bringen! Ich möchte gern, – 's wird ja wohl noch 'n Viertelstündchen dauern mit dem Thee, – holen Sie mir doch die Abendzeitung aus meinem Zimmer; ich glaube, sie liegt noch auf dem Schreibtisch.«
»Sehr wohl, Herr Konsul.«
Der Diener verschwand, und Herr Konsul Burmester, ein kleiner, wohlbeleibter Herr von etlichen fünfzig Jahren, zog seinen Rock aus und warf sich dann mit einem tiefen Seufzer der Erleichterung in einen niedrigen Polstersessel vor dem Ofen, in welchem ein frisch angeschürtes Feuer just mit vollem Atem zu prasseln begann. Der kleine Herr polierte sich mit seinem seidenen Schnupftuch die stattliche Glatze, bis sie so blank war, daß das flackernde Feuer sich darin spiegeln konnte, dann kraute er sich mit allen zehn Fingern in dem spärlichen blonden Haarkranz, der seinem Schädel noch verblieben war, und ebenso in dem gleichfalls blonden, kurzgehaltenen Vollbart. Dann knöpfte er sich den hohen, steifen Halskragen los, streckte die kurzen, dicken Beine weit von sich, lehnte den Oberkörper zurück und gähnte. Er gähnte langgezogen, stoßweise, tremolierend, aus höchster Lage langsam in ein natürliches Tonregister hinuntergleitend. Er gähnte wieder und immer wieder; das Thema u–ah kunstvoll variierend: ua–ha–ha – uaiaiaiaiai – hu–huhuhuhhhu! Wie ein raffinierter Sybarit kostete er den Genuß des Gähnens mit pedantischer Gründlichkeit aus, bis er sich endlich mit einem kurzen wohligen Grunzen zufrieden gab und die Hände über dem Bäuchlein faltete. Den schlappgeschwitzten Hemdkragen hielt er dabei immer noch zwischen zwei Fingern fest. So erwartete er die Rückkehr seines Dieners.
Zur selben Zeit war die gnädige Frau gleichfalls damit beschäftigt, es sich zum Nachtmahl bequem zu machen. Frau Olga Burmester hatte ihr Schlafzimmer nach vorn hinaus verlegt, neben den Salon. Wenn es Gesellschaft gab, so pflegte sie die Flügelthüren nach dem Schlafzimmer weit zu öffnen. Sie hatte gehört, daß es bei den vornehmen Pariser Damen Stil sei, das Schlafzimmer der Herrin den Gesellschaftsräumen beizuzählen und sogar an Migränetagen, sowie ähnlichen wohlanständigen Elitekrankheiten im Schlafzimmer, welches natürlich zu diesem Zweck einen intimen Boudoircharakter an sich tragen mußte, Besuche zu empfangen. Und da Frau Konsul Burmester, geborene von Studnitzka, mit ganz besonderer Vorliebe ausländische Gepflogenheiten nachahmte, die für deutsche Begriffe noch den Reiz des Ungewöhnlichen besaßen, so hatte sie der Ausstattung ihres Schlafzimmers eine besondere Sorgfalt angedeihen lassen. Das breite, sehr niedrige Himmelbett, ein rares Stück altdeutscher Schnitzkunst, stand auf einem teppichverkleideten Podium, links und rechts daneben verdeckten ein paar große, imitierte Gobelins die Wände, sowie ein dicker Smyrnateppich den ganzen Fußboden. Die Kopfkissen waren mit breiten Spitzen besetzt und lagen auch bei Tage oben auf der kostbaren Steppdecke von bronzefarbenem Atlas zur Schau. Mit bronzefarbenem Atlas waren auch die wenigen zierlichen Polstermöbel überzogen. Ein Trumeau, der fast bis an die Decke hinaufreichte, ein höchst eleganter Toilettentisch und eine schöne Kommode aus der Barockzeit vervollständigten die Einrichtung. Das Waschgerät und die übrigen notwendigen Gebrauchsmöbel waren in ein kleines Vorzimmer verwiesen. Die Gnädige saß bereits in einen weichen weißen Schlafrock gehüllt auf einem niedrigen Lehnsessel vor einem großen Wandspiegel und ließ sich von ihrer Zofe, die vor ihr kniete, die Stiefel ausziehen und die eleganten türkischen Pantoffeln über die Füße streifen. »Wann ist meine Tochter zu Bett gegangen?« fragte sie das Mädchen. »Wissen Sie, ob es ihr besser geht mit ihren Kopfschmerzen?«
»Ich kann's nicht sagen, gnädige Frau; ich habe das gnädige Fräulein seit acht Uhr nicht mehr gesehen. Da saß sie in dem Herrn sei'm Zimmer und las.«
»Las? Mit Kopfschmerzen liest man doch nicht. Ich will doch selbst mal nachsehen.« Und Frau Burmester erhob sich rasch, warf noch einen Blick in den Spiegel, hakte ihr loses Gewand vollends zu und verließ dann raschen Schrittes das Schlafzimmer. Sie durchschritt den Salon und das Eßzimmer, in welchem der Diener noch beschäftigt war, die letzte Hand an das Arrangement des Theetisches zu legen. Mit einem flüchtigen Blick streifte die Gnädige im Vorübergehen den Tisch.
»Wozu denn drei Couverts, Fritz? Meine Tochter hat sich doch schon zu Bett gelegt.«
Der Diener versuchte vergebens ein Lächeln zu unterdrücken, während er erwiderte: »Ich habe das gnädige Fräulein eben noch im Studierzimmer gesehn, als ich die Zeitung für den gnädigen Herrn herausholte.«
»Eben noch?« Dabei warf die Frau Konsul den Kopf auf und blickte den lächelnden Diener verwundert an. Sie zog die Stirn in Falten. »Na, es ist gut, ich werde sehen.« Und sie beschleunigte ihren Schritt und ging hinaus über den Hinterkorridor nach dem Zimmer ihrer Tochter.
Unmittelbar nachdem die Herrin hinaus war, erschien Marie, die hübsche Zofe, im Eßzimmer.
Fritz ging ihr entgegen, faßte sie vertraulich um die Taille und flüsterte: »Ei weih! Jetzt setzt es was ab für Fräulein Thekla. Die sollte wohl schon längst zu Bette sein, was? Eben hab' ich sie noch im Herrn sei'm Zimmer sitzen sehn, – so mit zwei Finger in die Ohren, über die rote Hefte, die Sie ihr jeborgt haben.«
»Ach du lieber Gott!« rief das Zöfchen leise, indem sie sich aus Fritzens Umarmung losmachte. »Wenn sie bloß unsre Gnädige nicht damit abfaßt; denn krieg ich's auch noch.«
Fritz grinste schadenfroh. »Sehn Se, mein süßer Engel, das haben Se nu davon. Was müssen Sie auch so 'n halbes Kind mit so 'ne aufregende Lektüre versehn.«
»Herrgott nee, so 'n armes Mädchen kann einen doch auch leid thun! Nichts darf sie, was sie gern möchte. Immer und ewig nur Klavierspielen und Singen, das ist doch auch reine zum Dollwerden! Mir thut sie leid; sie ist doch sonst so 'n gutes Mädchen. Raus kommt sie auch kaum wo anders hin, als in die feinen Konzerte, wo's nicht mal 'n Glas Bier zu trinken gibt. Man will doch mal was anders vom Leben sehn in den Jahren.«
»Natürlich, und besonders von wegen die sogenannte Liebe möchte man doch gerne Bescheid wissen,« neckte Fritz. »Nu ja, Sie haben ja recht; mir thut sie ja auch leid. So jung und so hübsch wie sie is und die Olle immer hinterher und aufgepaßt, daß sich das Kind nur ja nicht etwa zu jut amüsiert. Ich begreife bloß nich, wie die Leute zu das Kind kommen.«
»Nee, Fritz, Sie werden auch nie richtig deutsch lernen! Zu den Kind heißt es!« belehrte Marie überlegen lächelnd. »Uebrigens wundert's mich gar nich, daß Sie sich wundern. Ich weiß auch was, was Sie nich wissen.«
»Nanu? Des wäre –?«
»Werd' ich Ihnen gerade sagen! Sie und 'n Geheimnis!«
»Nanu machen Sie mich aber neugierig. Sagen Se's doch! Ich bin doch verschwiegen wie so 'n Jrab – und 'n schönen Kuß kriegen Se auch von mir, Mariechen.«
»Na so dumm! Da hab' ich auch recht was von. Lassen Sie mich los. Ich habe zu thun.«
Das niedliche Zöfchen wich geschickt der Umarmung des verliebten Burschen aus und lief hinaus. Ein kleines Weilchen stand sie draußen auf dem Korridor vor der Thüre des gnädigen Fräuleins still und horchte. Richtig. da drin gab's Thränen und strenge Worte.
Wenige Minuten später trat Frau Burmester wieder heraus und schritt, sichtlich erregt, einen kleinen Pack roter Hefte in der Hand haltend, über den Korridor nach ihres Gatten Schlafzimmer.
Der Konsul saß noch immer in Hemdärmeln und las beim Schein der grünbeschirmten Lampe seine Abendzeitung. Sein großes buntseidenes Taschentuch hatte er über die Kniee gebreitet und oben darauf schlängelte sich der welke Hemdkragen über den dicken Schenkel des kleinen Herrn.
»Aber Willy!« rief seine Gattin unwillig, während sie die Thüre hinter sich ins Schloß drückte. Dann blieb sie auf der Schwelle stehen und richtete ihre äußerst schlanke Gestalt zu ihrer ganzen, nicht unbeträchtlichen Länge empor, – ein lebendiges Ausrufzeichen, die Fleisch, oder, genauer ausgedrückt, Haut und Knochen gewordene Mißbilligung – so stand sie dort im Thürrahmen lebendes Bild.
Herr Burmester ließ mit einem betrübten Seufzer die Zeitung sinken und schaute über die Gläser seines goldenen Zwickers hinweg zu seiner Gattin hinauf. »Was gibt's denn, mein Schatz? Sitzt ihr schon beim Thee?«
»Nein,« erwiderte sie nähertretend. »Ich habe ernstlich mit dir zu reden. Aber du thätest mir einen Gefallen, wenn du erst deine Toilette etwas vervollständigen wolltest. Du weißt doch, daß ich diese saloppen Garçonmanieren nicht leiden kann.«
»Ach Gott, jaa,« versetzte der Konsul sanft und erhob sich mit einem ergebenen Seufzer. »Also was gibt's denn so Wichtiges? Zehn Minuten, um meine Zeitung ungestört zu lesen, hättest du mir auch wohl gönnen können.« Und er knöpfte sich einen reinen Kragen um und zog ein bequemes Jaquet an.
Währenddessen hielt ihm seine Gattin die roten Hefte mit aufgeregter Gebärde vor die Augen und sagte: »Da! Schau dir mal das an! Was ist das? Rate mal, wo ich das gefunden habe.«
»Zweihundert Klafter tief unter der Erde«, oder: »Die Blutgräfin«, las der Konsul gleichgültig von dem Titelblatt ab. »Nun was weiter? Ein Schundroman, den du wahrscheinlich im Küchenkasten gefunden hast. Verlangst du vielleicht von mir, daß ich deswegen der Köchin eine Scene machen soll?«
Frau Burmester dämpfte ihre Stimme zu einem erregten Geflüster herab. »Das ist die Lektüre unsrer Tochter!« rief sie, indem sie die roten Hefte verächtlich auf den nächsten Tisch schleuderte. »Thekla schützt Kopfschmerzen vor, um nicht mit ins Konzert gehen zu müssen, und während wir denken, sie liege im Bett, sitzt sie heimlich über dieser Schandlektüre; von der Marie hat sie sich das Zeug geborgt. Ich erwischte sie in ihrem Schlafzimmer. Sie wollte sich geschwind ausziehen, um uns glauben zu machen, sie sei schon längst zu Bett gegangen. Und wie ich hereintrete, will sie gerade die Hefte unter ihrem Kopfkissen verstecken.«
»Hmhmhm,« machte Herr Burmester und versenkte ratlos seine Hände in die Hosentaschen.
»So; ist das alles, was du zu sagen hast? Du weißt wohl gar nicht, was diese schöne Entdeckung zu bedeuten hat? Da kommt es nun heraus; dieser Hang zum Gemeinen, der ist angeboren – das beruht auf Vererbung!«
»Du sagst das in einem Tone, als ob ich was dafür könnte. Es ist doch nicht mein Kind.«
»Meins auch nicht, Gott sei Dank!« versetzte Frau Olga, fast höhnisch auflachend.
Nun wurde der Konsul auch aufgeregt. Er klimperte mit den Schlüsseln in seiner Tasche und wippte mit den Knieen. »Versündige dich, bitte, nicht!« rief er vorwurfsvoll. »Das Kind ist sanft und gut und liebevoll, und wenn es weiter keine lasterhaften Anlagen geerbt hat, als die Lust an geschmackloser Lektüre, so können wir, meine ich, sehr zufrieden sein. Auf den Geschmack kann man doch bildend einwirken. Uebrigens stammt die Idee, ein ganz fremdes Mädchen zu adoptieren, doch von dir, wie du dich vielleicht erinnern wirst. Ich war ja immer dafür, lieber eine arme Verwandte ins Haus zu nehmen.«
»Ich habe dir doch aus meiner Familie allein ein halbes Dutzend junger Mädchen zur Auswahl gestellt,« versetzte Frau Olga pikiert.
Und er fiel prompt ein. »Die waren mir bloß nicht übermäßig sympathisch, aber du hast überhaupt an keiner auch nur ein gutes Haar gelassen. Du wolltest ja durchaus eine Schönheit haben und ein musikalisches Genie daraus züchten. Darum war dir die Tochter des fahrenden Musikanten und des hübschen Hotelzimmermädchens lieber als alle legitimen Töchter unsrer beiderseitigen Familien. Aber jetzt trage auch die Folgen.«
»Was meinst du damit?« rief Frau Olga aufgeregt. Ihre tiefliegenden dunkeln Meerkatzenaugen sprühten kampflüstern ihren Gatten an. Sie setzte sich in den Lehnstuhl, den er vorher eingenommen hatte, und trommelte mit den Fingern auf der Tischplatte. »Ich habe dich ausreden lassen, mein Lieber,«.fuhr sie spitzig fort. »Du willst mich mit ironischen Ausfällen ducken. Na ja, das ist ja ganz amüsant, aber ich denke doch, diese ernste Frage erfordert eine ernste Ueberlegung. Du wäschst deine Hände in Unschuld, nicht wahr? ich soll die Folgen allein tragen. Was denkst du dir eigentlich darunter? Soll ich gottergeben zuschauen, wie die Natur der Mutter in diesem Kinde wieder die Oberhand gewinnt?«
»Die Mutter hat mir einen sehr angenehmen Eindruck gemacht. Sie ist doch auch eine brave, solide Frau geworden. Der Vater scheint mir gefährlicher. Der kann ja ein großer Lump gewesen sein, wenigstens wissen wir nichts vom Gegenteil.«
»Aber er hat gewiß keine Hintertreppenromane gelesen.«
»Dafür hat sie den Hang zum Dienstpersonal doch sicher einmal von ihm! – Uebrigens Scherz beiseite! Hast du's ihr nicht vielleicht an guter und geschmackvoller Lektüre fehlen lassen?«
»Ich? Die ausgewähltesten klassischen und edelsten modernen Werke habe ich ihr zur Verfügung gestellt. Aber natürlich, das langweilt sie.«
»Natürlich,« lachte der Konsul ihr nach. »Das langweilt solche halben Kinder meistens. Uns Erwachsene manchmal nicht minder.«
»Dich freilich,« höhnte die Gattin. »Der Mangel einer klassischen Bildung ist eben durch nichts zu ersetzen. Das zeigt sich recht eklatant an dir, mein Lieber.«
»Du bist außerordentlich freundlich, meine Beste.« Dabei zog der Konsul seine Hände aus den Hosentaschen und steckte sie zur Abwechslung in die Rocktaschen. Aber mit einem Nachdruck, dem man es wohl anmerkte, daß er sich an einer empfindlichen Stelle getroffen fühlte. Er schob ärgerlich seine dicke Unterlippe vor und ging ein paarmal auf und ab. Dann blieb er vor seiner Gattin stehen und sagte: »Auf diese Weise kommen wir zu nichts. Ich werde mal selbst mit Thekla reden.«
Frau Olga rümpfte die Nase. »Bravo! Jetzt hast du dich ja glücklich in die rechte Stimmung hineingeredet, um dem Fräulein gewaltig zu imponieren.«
»Das Imponierenwollen überlasse ich dir. Das gehört durchaus nicht zu meinen Erziehungsgrundsätzen. Ich habe das Kind lieb – ich kann wirklich sagen, wie wenn's mein eigenes wäre. Ich hoffe, daß Thekla das fühlt. Und wenn sie das fühlt, dann wird sie auch auf mich hören. Aber bitte, laß mich allein mit ihr reden.« Er öffnete die Thür und ließ seine Frau vorangehen.
Thekla Burmester saß bereits wartend im Eßzimmer. Beim Eintritt der Eltern erhob sie sich, ging dem Vater einige Schritte entgegen und reichte ihm mit ängstlich befangener Miene die Hand. Er drückte sie ihr warm zur Ermutigung. Da schlug sie die Augen auf und begegnete seinem freundlichen Blick. Mit einem kleinen Seufzer der Erleichterung begab sie sich wieder auf ihren Platz.
Die Nachtmahlzeit verlief aber doch in recht gedrückter Stimmung, denn die gnädige Frau saß streng und steif da und sprach kaum ein Wort, und der Konsul wollte in ihrer Gegenwart nicht von der Sache anfangen, die sie alle bedrückte. Man beeilte sich, mit dem Essen fertig zu werden. Dann wurde der Diener hinausgeschickt, um im Zimmer des Herrn die Lampe anzuzünden, und dann erhob sich Thekla, um den Eltern »gut' Nacht« zu wünschen.
»Ach bitte, noch ein Weilchen!« rief Herr Burmester. »Ich habe mit dir zu reden, mein Kind. Komm mit mir in mein Zimmer.«
Ohne ein Wort zu erwidern, schritt das junge Mädchen hinter ihrem kleinen dicken Pflegevater her, den feinen runden Kopf mit den zwei langen, üppigen dunkelblonden Zöpfen schuldbewußt gesenkt und mit ängstlich zuckenden Lippen. Sobald sie in seinem reich und behaglich eingerichteten Arbeitszimmer angelangt waren und er die Thür hinter ihr eingeklinkt hatte, fing das große Kind auch schon an zu weinen.
Der Konsul setzte sich in einen Lehnstuhl, hieß Thekla nähertreten, ergriff sie bei beiden Händen und betrachtete sie sich mit mitleidigem Lächeln. Achtzehn Jahre war sie alt, ziemlich groß und reizend gewachsen, schlank und lieblich rundlich dabei. Sie hatte ein schlichtes braunes Tuchkleid an und eine dunkelblaue Matrosenbluse, wie sie jüngere Knaben mit Vorliebe zu tragen pflegen, mit einem hellgelben Ledergürtel um die Taille zusammengehalten. Es zuckte um das feine weiße Hälschen, es zuckte um die niedliche kleine Nase, über die etwas stubenblassen Wangen liefen die Thränen und neue wollten sich aus den langen, dunklen, gesenkten Wimpern hervordrängen.
Herr Burmester wurde selbst ganz weich ums Herz, wie er das Kind so weinen sah, und er wußte seine väterliche Strafpredigt nicht anders zu beginnen, als indem er fragte: »Hat dir's Mama sehr arg bös gegeben?«
Thekla nickte eifrig und dann schluchzte sie mühsam heraus: »Ach Papa – ich bin doch nicht – so schlecht! Niedrige – Instinkte hätte ich – hat sie gesagt. Die scheußlichsten – Verbrecher – hätten alle so angefangen – mit solche Romane zu lesen – hat sie gesagt.« Sie putzte sich die Nase und wischte sich die Thränen ab und dann fuhr sie fließender fort: »Ich habe mir doch wahrhaftig nichts Schlimmes dabei gedacht. Neulich sollt' ich mal die Marie schnell zu Mama rufen, und da hörte sie gar nicht. Sie saß in ihrer Kammer und las: ›Die Blutgräfin‹, und wie ich sie rief, sagte sie, ich möchte entschuldigen, aber die Blutgräfin wäre so sehr spannend, man könnte sich rein gar nicht losreißen, wenn man mal darüber wäre. Na und da sagt' ich, das müßte sie mir auch mal borgen, denn so was Spannendes hätte ich noch nie gelesen. Heute abend hab' ich doch erst angefangen, darin zu lesen, weil ich mal nicht mit ins Konzert brauchte. Sonst hab' ich doch nie Zeit. Und es war wirklich so spannend, wie die Marie gesagt hat; ich habe gar nicht gemerkt, wie die Zeit verging. Weiter hab' ich doch wirklich nichts Schlimmes gethan. Und das ist doch noch kein niedriger Instinkt, nicht wahr?«
Der Konsul mußte lächeln. »Na komm mein Kind,« sagte er, »setz dich hierher, wir wollen mal vernünftig miteinander reden.«
Sie holte sich einen Stuhl herbei und nahm vor ihm Platz, die Hände im Schoß gefaltet, und dann fuhr er fort: »Sieh mal Theklachen, erstensmal sollte doch die Tochter des Hauses von ihrem Dienstmädchen nichts borgen, denn das schickt sich nicht. Und zweitens sollte ein junges Mädchen, das eine feine Erziehung genossen hat, an solcher Hintertreppenlektüre keinen Gefallen finden; denn das ist ein Zeichen von sehr schlechtem Geschmack. Menschen ohne festen Charakter, und besonders sehr junge Menschen, werden wirklich durch solche Schundromane leicht verdorben, – darin hat deine Mutter ganz recht. Es wäre ein wahrer Segen, wenn das Gesetz Mittel und Wege fände, das Volk vor diesem giftigen und gefährlichen Zeug zu behüten. Da wird immer mit fürchterlichen Geheimnissen und schrecklichen Verbrechen gearbeitet und die Verbrecher werden zu romantischen Helden. Das vergiftet die Phantasie und reizt zur Nachahmung.«
»Aber Papa, du denkst doch nicht, daß ich so was thun werde, wie in der Blutgräfin steht?« unterbrach Thekla kläglich.
»Nein, mein Herzchen, das glaub' ich dir gerne, daß du dir keinen Giftmord und keinen Einbruch aufs Gewissen laden wirst; aber deine Vorstellungen vom Leben und deinen guten Geschmack verdirbst du dir einmal ganz sicher. Und das ist auch schon schlimm genug. Ein gebildeter Mensch sucht in seiner Lektüre die Wahrheit, denn die ist gesund, und die Schönheit, denn die wirkt erhebend und befreiend. Aber lassen mir das einmal jetzt. Du versprichst mir, künftig der Versuchung, solches Zeug in die Hand zu nehmen, zu widerstehen, nicht wahr? Da, gib mir die Hand darauf – so ist's recht. Nun muß ich dir aber auch sagen, was ich schlimmer finde, als diese Kinderei mit der Blutgräfin. Ich habe dich bisher immer offen und ehrlich gefunden, mein Kind. Es thäte mir sehr leid, wenn du jetzt anfangen wolltest, krumme Wege einzuschlagen. Sieh mal, daß du heute Kopfschmerzen vorschützest, um dich ungestört über deinen Schmöker hermachen zu können, statt ein gutes Konzert zu hören, das ist doch wirklich nicht recht von dir.«
»Aber Papa, ich hatte doch wirklich Kopfschmerzen,« entgegnete Thekla eifrig. »Wenn ich so viel geübt habe, krieg' ich immer Kopfschmerzen. Und wenn ich dann noch ein langes Konzert hören soll, dann werde ich vollends ganz dumm.«
Herr Burmester blickte überrascht auf. Auf ein solches Geständnis war er nicht vorbereitet gewesen. Er spielte mit den Quasten an seinem Sessel und sagte erst nach einer ganzen Weile: »Ja, ist dir denn die Musik so unangenehm? Du weißt doch, Mama möchte so gern eine tüchtige Künstlerin aus dir machen. Na, und wenn du's auch nicht zu treiben brauchst, um dir dein Brot damit zu verdienen, – es ist doch immer gut, wenn ein junges Mädchen in irgend einem Fache etwas Tüchtiges lernt.«
»Das möcht' ich ja auch so gern, Papa,« erwiderte Thekla; »ich möchte gern so viel lernen und gute Bücher lesen und das alles. Die jungen Mädchen, mit denen ich zusammenkomme, die wissen auch alle viel mehr wie ich. Aber die brauchen auch alle nicht so viel Klavier zu üben. Ich habe doch wirklich zu gar nichts anderm mehr Zeit. Singen soll ich auch noch, und dabei habe ich doch bloß eine Stimme wie ein Zwirnsfaden. Und das Klavierüben macht mich so furchtbar müde. Ich bin immer wie zerschlagen danach; die Hämmerchen trommeln immer alle auf meinen Kopf los, so daß ich manchmal das Gefühl habe, als wäre er schon ganz weich, – als brauche ich nur ein bißchen stark zuzudrücken, und ich könnte mit dem Finger ein Loch hineinbohren. Und nachts träume ich immer so schreckliche Sachen: unser Flügel steht da wie ein großer, schwarzer Sarg, und dann wird der Deckel ein bißchen gehoben und aus der Spalte kriechen lauter Notenköpfe hervor mit Armen und Beinen dran. Die haben alle Hämmerchen auf dem Rücken; damit rennen sie mir nach und wollen mich schlagen; dann muß ich im Hemd aus dem Bett und auf die Straße hinaus und immer weiter laufen in der finstern Nacht, und den Wind hör' ich so schrecklich pfeifen. Und die Töne, die mir nachlaufen, hör' ich alle klingen. Und sie schreien hinter mir drein: ›Siehst du nicht, daß ich ein bvorhabe, du Gans?‹ Und ein andrer schreit: ›Ich heißecis, verstanden? Ich werfe dir mein Kreuz an den Kopf, wenn du nochmalcspielst –‹ ach lieber Papa, du glaubst es gar nicht, es ist so schrecklich! Denke dir, sie haben alle die Stimme von Herrn Mayr, die Noten, wenn sie mir so was nachrufen. Und außerdem steht Herr Mayr noch hinter ihnen und kommandiert und hetzt sie auf mich. Ich habe solche Angst vor Herrn Mayr.«
»Mein armes Kind, was sind das bloß für Ideen!« rief der Konsul erschrocken, und dann stand er auf, zog das Mädchen zu sich empor, drückte ihren Kopf an seine Schulter und strich ihr beruhigend über das dichte, weiche Haar. Eine lange Zeit hielt er sie so, ohne ein Wort zu sprechen. Dann nahm er ihren Kopf zwischen beide Hände, küßte sie auf Stirn und Wangen und sagte: »Geh jetzt schlafen, mein Liebling, und rege dich nicht so auf mit solchen krankhaften Phantasien. Ich will schon mit Mama reden. Wir müssen dir's erleichtern, ich seh's ja ein. Du darfst uns nicht krank werden über der verf–, ich meine, über der verehrten Musik.«
»Du bist so gut, Papa; nicht wahr, du hilfst mir?« sagte Thekla, indem sie seine kurze, fette Hand ergriff und einen raschen, heißen Kuß darauf drückte. Dann ließ sie sich sanft von ihm zur Thür hinausschieben.
Sobald sie aber draußen war, reckte Herr Konsul Burmester seine beiden Fäuste hoch empor, bekam einen ganz roten Kopf und sprach es leise, aber deutlich aus, was er vorhin verschluckt hatte: »Die verfluchte Musik!«
In den wenigen Minuten, in denen sich sein gequältes und verängstigtes Kind an seiner Schulter ausgeweint hatte, war ihm sein ganzes Leben in der Erinnerung vorbeigezogen. Sein Vater hatte in Lübeck die Firma begründet und aus einer anfänglich recht bescheidenen Stellung sie zu einem der angesehensten unter den großen Welthandelshäusern seiner Vaterstadt emporgebracht. Aber viele freundliche Erinnerungen hatte Wilhelm Burmester nicht an sein Vaterhaus. Eine thörichte Ehe, die der alte Burmester in jungen Jahren mit einem ungebildeten, durchaus unbedeutenden und überdies entwickelungsunfähigen Mädchen von nicht eben sanftem Charakter eingegangen war, hatte ihn früh um alle Lebensfreude gebracht. Es ward ein bloßes Arbeitstier aus ihm. Ein strenger Herr und harter Vater. Und so hatte auch dem Sohn das beste Teil einer guten Erziehung gefehlt, nämlich die reine, friedevolle Sonntagsstimmung, welche eine harmonische Ehe über ein ganzes Haus auszugießen vermag. So war auch er ein Alltagsmensch und ein Arbeitstier geworden. Und als er in reiferen Jahren erkannt hatte, woran es lag, daß man in seinem Hause nicht recht froh werden konnte, da hatte er sich selbst das Wort gegeben, sich vor einer übereilten Heirat ängstlicher als vor Pest und Cholera zu hüten. Aber vor lauter Besorgnis, sich durch die Leidenschaft hinreißen zu lassen, war überhaupt die Fähigkeit zur Leidenschaft in ihm abgestorben. Er war ein alter Knabe und ein großer, angesehener Handelsherr geworden, bevor er sich entschloß, eine rein vernünftige Ehe einzugehen. Er brauchte, um seinem Hause auch gesellschaftlich zu dem Ansehen zu verhelfen, welches sein Reichtum und die Solidität der Firma beanspruchen durften, eine Dame aus der wirklich besten Gesellschaft, welche die feine Form absolut beherrschte und auch Geist genug hatte, um nicht nur gleichgültige Schmarotzer, sondern auch eine wirklich intelligente Gesellschaft an das Haus, dem sie vorstand, zu fesseln. Und so hatte er denn das feinerzogene ältliche Fräulein aus verarmter, adeliger Familie geheiratet; von Liebe war weder bei ihm, noch bei ihr die Rede gewesen; aber er meinte, sich begründeten Anspruch auf ihre ewige Dankbarkeit dadurch zu erwerben, daß er sie in eine Umgebung setzte und ihr reichlich die Mittel gewährte, um ihre gesellschaftlichen Talente glänzend zu entfalten und ihren Hang nach verfeinertem Wohlleben zu befriedigen. Seine Frau war niemals hübsch gewesen, aber sie sah trotz ihrer tiefliegenden Augen und ihrer erschreckenden Magerkeit doch ganz vornehm aus und wußte sich so geschmackvoll zu kleiden und besonders ihrem üppigen, fast schwarzen Haar so viele originelle Wirkungen abzugewinnen, daß sie zuweilen, wenn Schneiderin und Friseuse sich wirksam in die Hände gearbeitet hatten, sogar für eine ganz interessante Erscheinung gelten konnte. Was hatte er auch für einen Anspruch auf Schönheit? Er war sich wohl bewußt, ein reichlich garstiger, fetter Geselle zu sein. Uebrigens war er mit dem Ausfall seiner Ehe ziemlich zufrieden, solange er noch in Lübeck wohnte und in seinem Geschäft thätig war. Nach fünfjähriger, vorsichtiger Minierarbeit wußte sie's endlich durchzusetzen, daß er das Geschäft einem Neffen übergab, der schon längere Zeit unter ihm gearbeitet hatte, und sich mit dem Titel eines Konsuls von Uruguay in Berlin niederließ. Allerdings verstand sie es vortrefflich, in den vornehmsten Kreisen festen Fuß zu fassen und ihrem eigenen Hauswesen den entsprechenden Stil aufzuprägen, aber er war das Opfer dieses gesellschaftlichen Aufschwungs. Die Musikschwärmerei seiner Gattin war der Schlüssel gewesen, welcher ihr die Thüren der vornehmen Gesellschaft geöffnet hatte. Sie war bei allen musikalischen Ereignissen dabei und sah die berühmtesten Virtuosen bei sich zu Gaste. Damit lockte sie die Gesellschaft an. Und er mußte, obwohl er ganz unmusikalisch war, sich von Konzert zu Konzert schleppen lassen, fahrendem Musikantenvolk beiderlei Geschlechts, mochte es noch so dumm und eitel sein, den Hof machen, Begeisterung heucheln, wo er gähnende Langeweile empfand, und sich mit Leuten scheinbar anfreunden, zu denen er innerlich nicht die geringsten Beziehungen hatte. Da er schlechterdings nichts zu thun hatte, so fehlte es ihm an jeglichem Vorwand, sich um die Pflichten, die seine Frau ihm aufbürdete, herumzudrücken. Und that er es doch einmal, in höchster Verzweiflung, so ließ sie ihn mit kalter Rücksichtslosigkeit fühlen, daß er aufgehört habe, in ihrem Lebensplan überhaupt noch einen Wert darzustellen. Die lächerliche Rolle eines gänzlich kaltgestellten Gatten wollte er nicht spielen und für einen Dummkopf wollte er auch nicht gehalten werden; so nahm er denn lieber das Martyrium auf sich, fortzuheucheln, wie seine Frau es verlangte.
Damals, als sie nach Berlin zogen, hatten sie auch das vaterlose Kind adoptiert; in der Gesellschaft galt Thekla allgemein als ein legitimes Fräulein Burmester, und auch er widersprach dieser Annahme nicht, denn er war eitel auf das schöne Mädchen, und er liebte es wegen seiner Herzenseinfalt und Güte. Nein, das Kind hatte er sich durch seine Liebe zu eigen gemacht, er wollte trotzen auf sein Vaterrecht. Das sollte nicht auf denselben Dornenpfad gejagt werden, auf dem er seinen müden, schweren Leib dahinschleppte. Ihre Klage hatte ihn aufgeschreckt aus seiner lahmen Gleichgültigkeit. Das Kind hatte ja so recht, er konnte ihr alles so nachfühlen. Ja, ja, dumm wird man davon und stumpf! Und wieder ballte er die Fäuste und knirschte vor sich hin: »Die verfluchte Musik!«
Drittes Kapitel.
Herr Mayr haut.
Am andern Morgen erlebte Frau Olga Burmester eine große Ueberraschung. Ihr Mann war in ihren Augen ein Frühaufsteher, denn er erhob sich jeden Morgen pünktlich um acht Uhr, einerlei, wie spät er zu Bett gekommen war, wogegen die Auferstehungsstunde der Gnädigen je nach dem Nervenstande erst zwischen Neun und Zwölf schlug. Sie hatte heute ihren Kakao – sie genoß immer nahrhafte Getränke, da sie die Hoffnung, etwas voller zu werden, immer noch nicht aufgegeben hatte – um neun Uhr zu sich genommen, gedachte jedoch, um den möglichen üblen Folgen der Alteration vom gestrigen Abend zu begegnen, noch ein Stündchen oder zwei liegen zu bleiben.
Sie tupfte sich eben mit der zierlichen Serviette die Spuren von Kakao und weichem Ei aus den Mundwinkeln, als ihr Gatte fix und fertig zum Ausgehen gekleidet hereintrat und ihr ankündigte, daß er in Theklas Begleitung einen größeren Spaziergang im Tiergarten zu machen beabsichtige.
»Thekla kann heute nicht mitgehen,« versetzte seine Gattin kühl, indem sie die Kissen wieder unter dem Rücken hervorzog, mit deren Hilfe sie sich zum Zwecke des Frühstückens aufrecht hingesetzt hatte, und sich wieder behaglich lang ausstreckte. »Du hast wohl vergessen, lieber Willy, daß um elf Uhr Herr Mayr zum Unterricht kommt?«
»Bis um elf Uhr sind wir wieder zu Hause.«
»Ach du weißt doch ganz gut, daß Thekla vor dem Unterricht immer eine Stunde Fingerübungen machen muß. Was soll denn Herr Mayr mit ihr anfangen, wenn sie sich mit steifen Knöcheln ans Klavier setzt?«
»Das ist mir ganz gleichgültig,« versetzte der Konsul mit erstaunlicher Bestimmtheit. »Ich glaube, das Kind wird frischer und gesammelter an seine Aufgabe herantreten, wenn es sich nicht schon vorher ermüdet hat. Uebrigens ist mir das auch ganz egal, ob Thekla heute oder sonst wann mehr oder minder gut Klavier spielt: Die Hauptsache ist, daß wir für ihre Gesundheit sorgen und sie nicht übermäßig anstrengen.«
»Ja mein Gott, was ist denn das für ein Ton?« rief Frau Olga, ihre Augen vor Erstaunen weit öffnend, indem sie sich mit einem Ruck emporrichtete. »Ich meine doch, es wäre zwischen uns eine abgemachte Sache, daß du mir die künstlerische Erziehung allein überläßt.«
»Ach was, künstlerische Erziehung! Redensart!«brummte der Konsul ärgerlich. »Wenn in der Ehe der eine Teil unvernünftig am Kinde handelt und der andre Teil das einsieht, so hat er die verfluchte Pflicht und Schuldigkeit, dagegen aufzutreten und dem Schaden nach Möglichkeit vorzubeugen. Ich habe unrecht gethan, mich so wenig um Theklas Erziehung zu bekümmern. Ich werde jetzt versuchen, das Versäumte nachzuholen. So, also guten Morgen, liebe Olga.«
Der kleine Herr schwenkte stolz seinen Hut gegen die Gattin und verließ eiligst das Schlafzimmer, bevor sie noch Worte gefunden hatte, um ihrer Entrüstung Ausdruck zu geben. Sie hatte nicht übel Lust, aus dem Bette zu springen, einen Morgenrock überzuwerfen und ihrem aufrührerischen Gemahl nachzulaufen, um ihm womöglich Thekla noch zu entreißen, bevor er sie sicher außerhalb der Wohnungsthür hätte. Aber der Gedanke, sich durch eine Scene dieser Art vor den Dienstboten zu blamieren, hielt sie zurück. Sie griff nach der Birne der elektrischen Klingel, die ihr zu Häupten hing, und drückte wütend auf den weißen Knopf. Und immer wieder ließ sie, da das Mädchen nicht sofort erschien, mit kaum sekundenlangen Pausen dazwischen ihr aufgeregtes Läuten erschallen.
Die Marie kam ganz erschrocken hereingestürzt und hatte gleich einen feuchten Lappen mitgebracht, denn sie war überzeugt, daß die Gnädige den Kakao über die Atlasdecke gegossen habe.
»Rufen Sie meine Tochter zurück, ich habe ihr noch etwas zu sagen!« rief die Frau Konsul dem Mädchen entgegen, ehe es noch nach ihren Wünschen fragen konnte.
»Das gnädige Fräulein sind schon längst fort,« erwiderte Marie. »Sie sind vorausgegangen und haben den gnädigen Herrn unten auf der Straße erwartet.«
Es kostete der gnädigen Frau keine geringe Anstrengung, ihre Gefühle nicht vor dem Mädchen zur Explosion gelangen zu lassen. Sie hieß die Marie das Frühstücksgeschirr hinaustragen. Aber sobald sie allein war, schlug die Gnädige wütend mit der flachen Hand um sich und lachte dazu nicht eben lieblich. »Unerhört! Dieser dicke, kleine Willy Burmester! Jetzt will er plötzlich anfangen, sich aufzuspielen! Macht mir die Thekla rebellisch. Unglaublich! Aber Angst haben sie doch alle beide, die Helden! Er rennt davon, ohne mich zu Worte kommen zu lassen, und sie läuft gar gleich bis auf die Straße hinunter, damit ich sie nicht zurückholen kann. Na wartet nur! Ich denke, solche Scherze sollen sich nicht allzuhäufig wiederholen. Es ist wirklich zu arg! Kaum hat man sich die Aufregung von gestern abend ein bißchen herausgeschlafen, so muß man sich am frühen Morgen schon wieder krank ärgern!«
Um die Morgenruhe war's nun doch geschehen. Es war schon am besten, gleich aufzustehen und mutig zuzuschauen, wie sich die Welt so früh am Tage und wie sich das friedliche Heim nach erfolgter Kriegserklärung ausnahm. – –
Pünktlich wie immer erschien um elf Uhr Herr Florian Mayr zur Klavierstunde. Die gnädige Frau empfing ihn im Salon.
Mit den Worten: »Ich bedaure unendlich, mein lieber Herr Mayr, daß Sie einen Augenblick warten müssen,« rauschte sie ihm in ihrem schweren, kostbaren Morgengewande entgegen. »Mein Mann hat unsre Thekla entführt. Er behauptet, es sei gesünder, spazieren zu gehen, als Klavier zu üben.«
»Darin hat er ohne allen Zweifel recht,« fiel Florian Mayr lachend ein, indem er der stummen Aufforderung, Platz zu nehmen, folgte.
Frau Burmester setzte sich ihm gegenüber aufs Sofa und fuhr, ohne seinen Einwurf weiter zu beachten, fort: »Mein Mann ist leider nicht musikalisch genug, um mir in der künstlerischen Erziehung unsrer Tochter den nötigen Beistand zu leisten. Mein Gott, als ehemaliger Geschäftsmann ist er gewohnt, die Künste nur als angenehmes, aber müßiges Beiwerk zu betrachten – das heißt, so lange man nicht seinen Unterhalt dadurch verdienen will. Es fehlt ihm ganz die Einsicht dafür, daß selbst der Dilettant, der etwas Anständiges leisten will, mit Ernst und Anspannung arbeiten muß. Sie können sich wohl vorstellen, daß meine Tochter demjenigen von uns am willigsten folgt, der ihr das Leben am bequemsten zu machen verspricht. Mein Gott, dafür ist sie jung. Aber ich bin recht froh über die Gelegenheit, Sie einmal allein zu sprechen, mein lieber Herr Mayr. Ich habe Sie schon immer bitten wollen, mit meiner Tochter doch ja recht streng zu verfahren. Sie läßt sich gar zu gern gehen, wenn man sie nicht ganz straff herannimmt. Also bitte, kümmern Sie sich gar nicht darum, daß sie ein junges Mädchen von guter Familie ist, die es nicht nötig hat, sondern behandeln Sie sie einfach wie irgend einen Schüler, aus dem was Tüchtiges werden soll und der etwas schärfer angepackt werden muß als andre, die vielleicht von Natur größeren Fleiß oder eine leichtere Auffassungsgabe besitzen. – Wollen Sie mir das versprechen?«
Der Pianist antwortete nicht gleich. Er lächelte vor sich hin und betrachtete seine langen, knochigen Finger. Endlich sagte er: »Wissen Sie, gnädige Frau, daß mir das zum erstenmal passiert, daß ich um größere Strenge beim Unterricht ersucht werde? Ich bin nämlich sonst als einsalva veniasaugrober Kerl bekannt. Es ist mir auch ziemlich einerlei, ob ich eine feine junge Dame, oder einen dummen Buben vor mir habe. Wenn ich sehe, daß bei meinem Schüler Talent vorhanden ist, so nehme ich auch die Sache ernst und verlange die höchste Anspannung. Aber da wir gerade davon reden, um Ihre Fräulein Tochter thät' es mir doch leid.«
»Wie so? Was meinen Sie damit?«
»Also ehrlich gesagt, ich bin nicht der Meinung, daß das Fräulein Talent genug hat, um meine schärfste Tonart zu vertragen. Ich glaub' schon, daß der Herr Konsul recht hat. Lassen Sie's nur brav spazieren gehen und nit mehr Klavier spielen, als wie's das Fräulein selber freut. Viel weiter kommt sie doch nit, und selbst wenn's weiter kommt – was Gescheits wird doch nit draus.«
Die Frau Konsul machte ihren Rücken steif und blickte recht geärgert drein. »O Herr Mayr,« versetzte sie gezwungen lächelnd, »mir scheint, Sie gehen etwas zu weit. Thekla ist doch so jung, ihr Charakter ist doch wohl noch zu unentwickelt, um . . . Uebrigens sind Sie ja auch noch recht jung: ich weiß nicht, ob Sie nicht etwas vorschnell urteilen. Sie entschuldigen – aber ich glaube, die Erfahrung dürfte Sie später doch darüber belehren, daß auch in der Kunst Talent und Temperament nicht allein ausschlaggebend sind und daß beharrlicher Fleiß und ernste Auffassung vieles zu ersetzen im stande sind.«
»Ja, gnädige Frau, wenn Sie meinen, daß ich nichts davon versteh' . . .«
»Pardon, Herr Mayr,« unterbrach ihn Frau Burmester, indem sie sich rasch erhob, »ich höre draußen Schritte, ich glaube, sie sind zurückgekommen, Sie entschuldigen.« Damit neigte sie leicht den Kopf gegen ihn und rauschte zur Thür hinaus.
Florian Mayr blieb allein. Mit überlegenem Lächeln blickte er der Dame des Hauses nach, und dann zeichnete er mit dem Zeigefinger ein bedeutungsvolles Kreuz auf seine hohe Stirn. Im Nebenzimmer vernahm er ein erregtes Flüstern. Er lachte kurz auf, und dann setzte er sich vor den Flügel, klappte den Deckel auf, und begann in weitgriffigen Accorden zu präludieren. Wenige Minuten später trat Fräulein Thekla ein. Er that, als ob er ihrer nicht gewahr worden wäre, und nahm eine der schwierigsten Lisztschen Etüden in Angriff, bei deren Studium er gerade begriffen war. Thekla stand einige Schritte hinter ihm und hörte zu. Plötzlich drehte er sich auf dem Schraubstuhl herum und lachte ihr gutmütig ins Gesicht. »Na, mein Fräulein, da sind Sie ja.«
Sie wollte sich entschuldigen. aber er ließ sie gar nicht ausreden. »Weiß schon alles. Jetzt wollen wir mal sehen, wie Sie mit roten Backen Klavier spielen können. Ich hab' Sie noch nie mit roten Backen gesehen, Fräulein Burmester.« Damit stand er auf, um ihr den Klavierstuhl einzuräumen, und zog sich selber einen andern Stuhl heran.
Thekla errötete noch tiefer. Sie wußte nie, wie Herr Mayr es eigentlich meinte. Es klang so ironisch. Ob er auch böse mit ihr war, wie die Frau Mama, von der sie soeben eine komprimierte Strafpredigt im Flüsterton genossen hatte? Sie suchte ihr Notenbuch hervor, legte es auf das Pult und schraubte sich den Stuhl zurecht. Herr Mayr saß mit untergeschlagenen Armen daneben und guckte ihr fortwährend ironisch lächelnd ins Gesicht. Sie wußte gar nicht, wo sie hinschauen sollte. Hochklopfenden Herzens setzte sie sich nieder. zog ihre Ringe vom Finger, strich sich ihr Kleid über den Knieen glatt und sagte endlich ganz schüchtern. »Ach, Herr Mayr!«
»Was denn? Sind Sie nicht gesund?«
»Doch, ja, danke. Aber so wie Sie lerne ich doch nie spielen.«
»Recht haben S'!« lachte er. »Also fangen wir an! Spielen Sie nur, so schlecht Sie wollen. Ich werde nachher schon meine Maßregeln treffen.« Und er lachte wieder so unerklärlich.
Sie begann zu spielen, eine Chopinsche Mazurka, zaghaft, matt im Ausdruck, schwankend im Takt, schlecht phrasiert und alle Augenblicke, besonders im Baß, daneben greifend. Was war denn das? Herr Mayr hörte wohl gar nicht zu? Er ließ sich doch sonst keinen Batzer gefallen, ohne sie anzuschreien. Ganz verstohlen wagte sie ein wenig nach ihm herumzuschielen. Ach je! Er starrte sie immer noch mit seinen kleinen braunen Augen so komisch an und lächelte verschmitzt dazu.