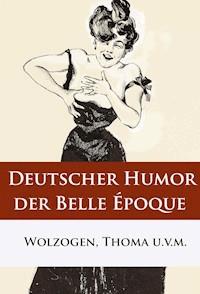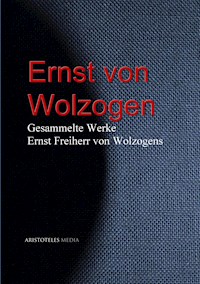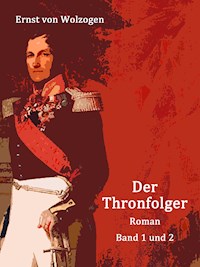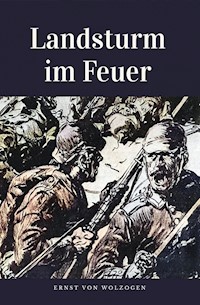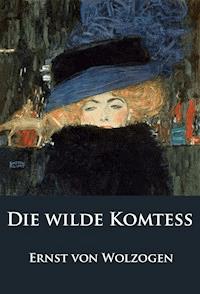Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Autor führt uns in das Berlin des ausgehenden 19. Jahrhunderts, die parlamentarische Soirée bei Bismarck klingt an, und es prickelt der Champagnergeist darin! Mittelpunkt seiner zweibändigen Erzählung ist eine "kühle Blonde", eine charakterstarke Frau und musterhaften Aristokratin, die an der Ehe mit einem charakterlosen Mann, einem Gesellschaftsblender und geistreichen Schwätzer, zugrunde geht. Von Wolzogen verfolgte in seinem Werk stark das Vorbild Theodor Fontanes. Auch in diesem Roman sah die Kritik Verbindungen, beispielsweise in der Zeichnung des Berliner Spießbürgertums, feierte die "Kühle Blonde" jedoch als ebenbürtiges kleines Meisterwerk. Der Roman vereint humoristische Elemente, zum Beispiel die leise Karikatur der Militärgrade, mit psychologischen Fragestellungen im Bereich der Partnerschaft und Ehe.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 271
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ernst von Wolzogen
Die kühle Blonde
Zweiter Band
Bersiner Sittenbild in zwei Bänden
Saga
Zehntes Kapitel.
Das Gewitter bricht los.
Seinem Vorsatz getreu, verfügte sich Günther von Schlichting schon am andern Morgen nach der Flemmingstrasse. Er hoffte um diese frühe Stunde seine schöne Base allein zu treffen, da er den Doktor Renard auf der Börse vermuten durfte. Aber das Dienstmädchen, das ihm auf sein Klingeln öffnete — Renards hatten bei ihrem Umzug auch die zierliche, gewandte Zofe entlassen und dafür eine pausbäckige Nymphe frisch vom Lande angenommen — glotzte ihm so verstört ins Gesicht, dass er alsbald Unheil ahnen musste. Ihr pommersches Platt mühsam bekämpfend, erzählte ihm die Magd, dass Walther, Renards kleiner Sohn, an der Diphtheritis erkrankt sei, und dass ihr infolgedessen streng verboten sei, irgend jemanden einzulassen. Günther drückte sein Bedauern aus, liess gute Besserung wünschen und entfernte sich recht missvergnügt. Der Aufschub, den seine Rache nun erleiden musste, ärgerte ihn nicht wenig, und zudem — gefährliche Krankheiten der Kinder tragen oft dazu bei, Ehegatten einander wieder zu nähern, und der Tod besonders pflegt ein gewaltiger Bussprediger zu sein, der selbst verstockte Herzen für die Aufnahme des Evangeliums der Liebe und des Friedens wohl vorzubereiten weiss! —
Günthers Voraussetzung war in der That zutreffend: Renards bange Sorge um das Leben seines kleinen Lieblings und Loris ernstes Bestreben, dem Gatten bei dieser Gelegenheit einen vollgültigen Beweis ihrer opferfähigen Teilnahme zu geben, hatten gleichmässig dazu beigetragen, den Sturm zu beschwichtigen, der sich trotz der jüngsten Versöhnung bereits wieder auf das schwankende Schifflein ihrer Ehe zu werfen drohte. Loris Hoffnung, dass mit dem Abbruch der zahlreichen allzuvertrauten Beziehungen mit jener Welt der glatten Lüge, des schnöden Mammondienstes, mit der Rückkehr in bescheidenere, aber ihrer wirklichen Lage angemessenere Verhältnisse dem Gatten auch die Einkehr in sich selbst erleichtert und ihr der Weg zu seinem Herzen geebnet werden würde, hatte sich leider nur allzubald als eine Seifenblase erwiesen. Wie ehrlich es Gisbert auch mit seiner Reue gemeint, wie mutig er auch die Schiffe hinter sich verbrannt, mit wie reiner Sehnsucht nach Wahrheit er auch den Dornenweg in das neuenunbekannte Gebiet betreten hatte, in das sein schönes Weib ihm als Engel der Verheissung voranschreiten wollte, so zeigte es sich doch nur allzubald, dass seine schwache Narur dem plötzlichen Wechsel des Klimas nicht stand zu halten vermochte. Er war nun einmal gross geworden in dem feuchtwarmen Treibhausdunst der grossstädtischen Gesellschaft, gewöhnt, im tiefen Schatten des tropischen Sumpfwaldes schmiegsam verschlungene Pfade zu finden, das Gekreisch possierlicher Affen und bunter Papageien, die sich auf den üppigen Lianenranken zu seinen Häupten schaukelten, war ihm ein liebvertrauter Ton — aber das helle Himmelsblau, welches über dieser nördlich gemässigten Zone sich ausspannte, in der seine „kühle Blonde“ ihn heimisch machen wollte, die scharfe, dünne Höhenluft beängstigte ihn; es fröstelte ihn bis in das innerste Mark seines Wesens; die ruhige Farbenharmonie grüner Wiesen und dunkler Fichtenwälder langweilte sein verwöhntes Auge, und das Liebeslied der unscheinbaren Nachtigall dünkte ihm eine weichlich sentimentale Musik. Wohl hatte ihm Lori, als Ersatz für alles, was er aufgegeben, einen Schatz wahrer Liebe zu bieten; doch die Art, wie sie sie ihm darbot, enttäuschte wieder seine Erwartungen. Niemals eine Ueberraschung, keine lieblich verwirrende Laune, keine Erfindungskraft — eine stille Flamme, kein Feuerwerk! Er meinte, für seinen Teil doch nun vorläufig genug geleistet zu haben — sie schien die Grösse seines Liebesopfers gar nicht fassen zu können. Hätte sie sonst auch jetzt noch zögern dürfen, auch ihrerseits den Versuch zu machen, ihre Natur nach seinen Wünschen umzuwandeln?! In der lärmenden grossen Welt liess sich mit dieser stillen Frau nicht leben — aber auf der einsamen Insel ebensowenig! Wie konnte ein junges, schönes, hochgebildetes Weib nur so langweilig sein!
Eine kleine Weile ging es ja freilich ganz gut. Sie richteten sich ihre so viel bescheidenere Wohnung recht behaglich ein und Gisbert wurde sehr häuslich. Mehr als sonst beschäftigte er sich mit seinen Kindern und widmete die langen Abende, die er sonst im Theater, in Gesellschaft, im Restaurant zugebracht hatte, dem ernsthaften, fast alle Gebiete der Wissenschaft und Kunst berührenden Gespräche mit seiner Lori. Er besprach auch einige dramatische Entwürfe aus früherer bewegter Zeit mit ihr, ohne freilich dadurch einen besonderen Antrieb zum wirklichen Beginn der Arbeit zu empfangen, denn Lori war ebenso kritisch, wie sie phantasielos war. Sie verleidete ihm durch ihre tausend Bedenklichkeiten die Freude an seinen Plänen und wusste doch nichts Besseres an deren Stelle zu setzen! Er wollte es sie nicht merken lassen, wenn sie seine Autoreneitelkeit verletzte; er zwang sich, momentan manchen kleinen Aerger hinunterzuschlucken — aber aus so verdriesslicher Stimmung heraus wollten sich natürlich keine glücklicheren Ideen entwickeln.
Schon nach den ersten acht Tagen hatte Gisbert das beängstigende Gefühl, dass sein guter Humor ihn zu verlassen drohe. Was seiner Seele dadurch an Nahrung entging, suchte er durch verdoppelte Zärtlichkeit zu ersetzen, — ein zweiter Honigmond sollte mit seinen verschwiegenen Wonnen den Champagner ersetzen, den ihm bisher das prickelnde Leben in der Gesellschaft kredenzt hatte. Die „kühle Blonde“ aber liess sich nach wie vor jede Gunst nur abtrotzen oder heimlich erschleichen: fast niemals konnte er sich der süssen Täuschung hingeben, dass auch sie in seinen Umarmungen sich berausche, dass sie einmal auch die Beglückte sei, nicht nur die liebreich Duldende. Und was diese kennzeichnende Eigenart ihrer Liebe ihm jetzt noch besonders schwer erträglich machte, das war der ewige stille Vorwurf, der nach jener versöhnenden Auseinandersetzung in ihren schönen Augen lag. Ihre Blicke verfolgten ihn mit einem fast zudringlichen Ausdruck christlichen Erbarmens, wie ihn wohl ein eifriger Seelsorger in einer Besserungsanstalt für entlassene Sträflinge oder in einem Magdalenenstift für angebracht halten mag.
Ja, wenn Gisbert wenigstens tüchtig zu arbeiten gehabt hätte und erst gegen Abend ruhebedürftig zu seinem jungen Weibe zurückgekehrt wäre, dann hätte sich vielleicht ein freundlicheres Verhältnis zwischen ihnen herausgebildet. Aber sie litt ja nicht, dass er, wie bisher, die Börse besuche. Er hatte ihr feierlichst versprochen, der entwürdigenden Spekulation zu entsagen, — und für den Beginn der neuen Arbeit war, wie gesagt, die Stimmung noch nicht gekommen. Die erzwungene Unthätigkeit machte ihn schlaff — er begann sich mit seinen vierzig Jahren alt zu fühlen.
Von seinen alten Freunden waren es hauptsächlich Sanitätsrat Magnus und der grosse Werner Grey, welche nach wie vor treu zu ihm hielten; doch auch ihre Besuche waren für Gisbert bald keine Freude mehr, da er sowohl aus den Blicken der beiden gescheiten Männer und noch mehr aus denen ihrer Frauen ein gewisses ironisches Mitleid herauszulesen glaubte. „Mann, Mann! Wie kann man sich so von seiner kleinen Frau ins Bockshorn jagen lassen!“ Das lag so ungefähr darin. So kam er sich denn auch diesen wirklich guten Freunden gegenüber — der wohlhabende Sanitätsrat hatte ihm aus freien Stücken Geld zur Verfügung gestellt, für den Fall, dass er etwas Neues unternehmen wollte! — als ein Gegenstand beleidigenden Mitleids vor. Und als eines Abends die beiden Familien bei ihm zum Thee waren und durch die Unterhaltung seiner Frau, das kalte Abendbrot und den leichten Wein, den es dazu gab, ausserordentlich befriedigt zu sein erklärten, ihm immer wieder mit warmem Dank für den reizenden Abend die Hand drückten, da war es heiss in ihm emporgewallt und er hatte nach ihrem Weggang der froh und zufrieden dreinschauenden Lori das harte Wort entgegengeschleudert: „Da siehst du nun, was wir erreicht haben mit unsrer blödsinnigen Ueberstürzung! Wie sie mich mit Glacéhandschuhen anfassten und sich verständnisinnig zublinzelten — haha! Für einen Narren sehen sie mich an, den man mit äusserster Schonung behandeln muss! Nächstens werden sie mir, nach dem bewährten Rezept, einen eigens hierzu mitgebrachten Vogel vorweisen und mir einreden wollen, den hätten sie eben aus meinem Köpfchen fliegen sehen!“
Gisbert kannte keine ärgere Demütigung als die, von seinesgleichen belächelt und bemitleidet zu werden. Als er daher wenige Tage nach jenem kleinen Einweihungsschmause für die neue Wohnung seinem Freunde Werner Grey Unter den Linden begegnete, nahm er die Gelegenheit wahr, ihn gerade heraus zu fragen, ob er ihn für verrückt halte? Und da antwortete Grey ebenso gerade heraus: „Ja!“
„Na, das ist ja recht erfreulich!“ knirschte Renard erbost. „Also wenn einer meinesgleichen endlich ’mal den moralischen Mut findet, sich von dieser Welt des Schwindels abzukehren, seinen wirklichen Verhältnissen entsprechend zu leben und es mit der ehrlichen Arbeit zu versuchen, anstatt wie bisher so raubtiermässig der menschlichen Dummheit aufzulauern oder ein stumpfsinniges und dabei nervenaufzehrendes Glücksspiel zu treiben — wenn ein sonst anständiger Mann endlich ’mal sein bisschen Grips zusammennimmt, um einzusehen, dass diese niederträchtige Jobberei eines Mannes von feineren Empfindungen und Geist unwürdig sei, dann schreit ihr alle wie aus einem Munde: ‚Der arme Kerl! Hihi! Er ist verrückt!‘“
„Sie ereifern sich ganz unnötig, lieber Freund!“ versetzte Grey mit ruhigem Lächeln. „Es wäre doch sehr merkwürdig, wenn ich Ihnen einen Vorwurf machen wollte aus etwas, was ich selbst gethan habe! Ich hatte tatsächlich alles verloren durch die verunglückte Geschichte mit der Gründung — Sie wissen ja. Ich bin ein reicher Mann gewesen, meine Frau und meine Kinder waren an Luxus gewöhnt, mir selbst war eine gewisse Ueppigkeit im Essen, Trinken und Rauchen Bedürfnis geworden — da kam der grosse Krach; und dann gab ich mein erstes lustiges Buch heraus und liess mich als Schriftsteller entdecken — und da tauchten mir gute Freunde von allen Seiten auf und stürzten mich auf die liebenswürdigste Weise in Schulden. Weil ich ein ehrlicher Mann bleiben wollte, ihnen gegenüber, musste ich arbeiten, schreiben, ich könnte beinahe sagen Tag und Nacht. Ich habe ja viel gesehen und erlebt, der Stoff fliesst mir reichlich zu, aber doch begreife ich es manchmal selbst nicht, wie alle diese Romane, manchmal drei bis vier Stück im Jahre, und dann noch all der novellistische Kleinkram zu stande kommt! Ich muss sagen, dass ich jetzt erst weiss, was arbeiten heisst, obschon ich als Kaufmann auch nicht auf der Bärenhaut gelegen habe. Und dann die Betriebskosten, das Gehirnschmalz, das man verbraucht, der Gedanke, dass es nun kein Aufhören mehr gibt, solange noch Schulden zu tilgen und Kinder zu ernähren sind — die Furcht, dass meine Bücher matter und öder werden könnten, je mehr dieser Krater hier ausbrennt — (er deutete auf sein Herz) — ich sage Ihnen, lieber Renard, da gibt es schlaflose Nächte, — Aufregungen, die vielleicht schlimmer sind als die eines Börsenspekulanten, ja — hören und staunen Sie! — es gibt sogar litterarische Gewissensbisse! Glauben Sie mir, ich renommiere nicht!“
„Wollen Sie mich damit abschrecken von meinem Vorhaben?“ unterbrach ihn Gisbert.
„Nein, im Gegenteil, ich wollte vielmehr mit allem Nachdruck erklären, dass ich trotz alledem und alledem dem Schicksale dankbar bin, das mich so gewaltsam aus dem Kaufmannsstande hinauswarf. Es liegt nun einmal in der produktiven Arbeit eine reinigende, erhebende Kraft, die ... Ja, aber was ich sagen wollte: Ihr Fall ist ein ganz andrer.“
„Ich möchte wissen, wieso?“
„Nach allem, was Sie mir da erzählt haben über Ihre kleine Kalamität, haben Sie wirklich — nehmen Sie mir es nicht übel! — einen Narrenstreich damit begangen, dass Sie darum so mutwillig sich selber den Kredit abschneiden. Ich bitte Sie, wenn man ein so glänzendes Geschäft in Aussicht hat, wie Sie mit dem Verkauf des bewussten Terrains — und ich kann Ihnen sagen, die Sache ist faktisch vollkommen sicher; in ein paar Wochen schon kann die Entscheidung kommen — dann ist es doch geradezu unverantwortlich gehandelt, besonders gegen die Kinder, wenn Sie so mir nichts dir nichts die Flinte ins Korn werfen, anstatt Ihren Kredit in Anspruch zu nehmen! Wenn das Geschäft zu stande gekommen ist, dann können Sie ja nicht nur ihre Verbindlichkeiten mit Leichtigkeit einlösen, sondern Sie bleiben dann immer noch ein recht wohlhabender Mann. Dann wäre es Zeit gewesen, sich von den Geschäften zurückzuziehen und sich der Muse in die Arme zu werfen. Glauben Sie mir, ein Schriftsteller, der es nicht nötig hat, dem wird es auch unendlich viel leichter, ein Künstler zu bleiben, als unsereinem! Und Sie ziehen sich ohne alle zwingende Notwendigkeit von der Gesellschaft zurück, die Sie auf Händen trägt, verkaufen Ihre Kostbarkeiten, verkriechen sich in die Flemmingstrasse ...“
„Mit einem Wort: ich bin verrückt geworden!“ warf Gisbert voll Bitterkeit dazwischen. „Nun, Sie werden wohl recht haben, lieber Freund, obschon. ... Wenn Sie wüssten. ... Man kann das nicht so sagen, was alles ...“ Er brach ab und ging schweigend, nervös die Unterlippe nagend, neben seinem grossen Freunde her. Er hatte ihm in Bezug auf die Ursache seines Verlustes nicht die Wahrheit gesagt; er hatte ihm vor allen Dingen verschwiegen, ein wie schlechtes Gewissen er in seiner Eigenschaft als angeblicher Eigentümer jenes grossen Grundstückes hatte, das ihm voraussichtlich bald ein neues Vermögen einbringen sollte; verschwiegen hatte er ihm auch, eine wie furchtbare Zuchtrute die Mitwisserschaft des edlen Agenten Feilchenfeld für ihn geworden war, und dass er die Rache dieses Menschen erst jüngst von neuem heraufbeschworen hatte durch seine Weigerung, das Grundstück jetzt zu verkaufen, wozu gerade Grey die Veranlassung gewesen war. Renard wirbelte der Kopf, sein Herz schlug laut vor Erregung und auf seine bebenden Lippen wollten sich Worte legen, die seine schwere Schuld verrieten und des erfahrenen Freundes Mitleid und guten Rat anriefen.
Zum Glück für den Unbesonnenen nahm da Grey selbst wieder das Wort: „Nehmen Sie mir es sehr übel, lieber Renard,“ begann er, „wenn ich Ihnen ganz offen sage, was Sie meiner Meinung nach zu diesem unglücklichen Schritt getrieben hat?“
„Bitte sehr, ich nehme Ihnen nichts übel.“
„Nun denn, offen heraus: Ich halte Ihre entzückende Madonna für die Hauptschuldige! — Habe ich recht?“
Gisbert zuckte die Achseln und seufzte statt aller Antwort.
„Ja, lieber Freund, dass ich Ihnen noch eine Vorlesung über die Weiber würde halten müssen, das hätte ich mir auch nicht träumen lassen! Sie wissen ja, wie sehr gerade ich das Geschlecht verehre — und nun gar, seit ich Dichter bin — entschuldigen Sie das harte Wort! — Schon aus Geschäftsrücksichten verehre ich sie alle, ohne Unterschied des Temperaments, der Komplexion und der Konfession! Aber noch nie bin ich meinem Grundsatze untreu geworden, erstens ’mal: eine Frau nie um Verzeihung zu bitten — denn dann bleibt man sein ganzes Leben lang im Unrecht! — Und zweitens: einer Frau nie Einblick in und Einfluss auf Geschäftsangelegenheiten zu gestatten, denn sonst ist man ein für allemal drunter durch! O weh mir Armen, wenn das die Madonna wüsste, dass ich Sie so gegen sie aufhetze! Ich kann mich freilich auch so ihrer Gunst nicht eben rühmen, aber dann ... Sie sind mir doch wohl böse, Renard, was? Sie haben auch recht — es ist so schön, verliebt zu sein! — Wozu einem glückseligen Blinden den Star stechen wollen?“
„Nein, nein, ich bin Ihnen durchaus nicht böse,“ versetzte Gisbert matt lächelnd. „Sie haben es mir ja vorhergesagt, wie es kommen würde mit der ‚kühlen Blonden‘! Erhalten Sie mir nur Ihre Teilnahme. Es könnte kommen, dass ich einmal gute Freunde noch nötiger habe als jetzt!“
Die beiden Männer waren unterdes am Brandenburger Thor angelangt. Hier schieden sich ihre Wege, denn Grey wollte durch den Tiergarten nach Hause spazieren und Gisbert die Pferdebahn nach Moabit besteigen. — —
Kaum eine halbe Stunde früher hatte auch Lori mit ihren beiden Stiefkindern dieselbe Linie benutzt. Sie war mit ihnen im Tiergarten spazieren gegangen; der kleine Walther, der ein wenig kränkelte, sollte sich in der frischen Luft des ersten sonnenhellen Apriltages wieder rote Backen holen. Aber das Kind war verdrossen und unlustig zum Spielen. Der kleine Wildfang, der sonst so unermüdlich seinen Reifen schlug oder sich mit Schwester Evchen jagte, hängte sich heute schwer an das Kleid seiner Stiefmama; er klagte über Schmerzen im Halse, über Schwäche in allen Gliedern und erklärte bald, dass er nicht mehr laufen möge.
Als Lori den Pferdebahnwagen am Brandenburger Thor bestieg, wurde sie von zwei auf der hinteren Plattform stehenden jungen Männern sehr höflich begrüsst. Sie dankte, wie das ihre Art war, mit kaum merklichem Kopfnicken. Das Gesicht des einen kam ihr bekannt vor, doch wusste sie nicht, wo sie es gesehen habe. Sobald Plätze im Wagen frei wurden, setzten sich die jungen Leute hinein und Lori bemerkte, dass sie von ihnen aufmerksam betrachtet, ja augenscheinlich bewundert wurde. Doch der Zustand des kleinen Walther begann sie derart zu ängstigen, dass sie darauf nicht mehr sonderlich acht gab. Stirn und Wangen des Kleinen glühten bereits im Fieber — sie konnte es durch den Handschuh hindurch fühlen; er atmete rasch und schmiegte sich eng an ihre Seite.
Als sie an der Werftstrasse mit den Kindern aussteigen wollte, taumelte Walther so sehr, dass sie ihn auf den Arm zu nehmen im Begriff war; da sprang der eine der jungen Leute rasch zu und kam ihr zuvor.
„Sie gestatten, dass ich Ihnen behilflich bin, gnädige Frau,“ sagte er, indem er, den Knaben auf dem Arm, abstieg und dann ihr selbst seine freie Hand stützend darreichte. „Das arme Bürschchen ist wohl plötzlich krank geworden? Ich will ihn Ihnen gern nach Hause tragen.“
„Ich weiss nicht, ob ich Ihre grosse Liebenswürdigkeit annehmen darf,“ versetzte Lori errötend. „Wir wohnen allerdings ganz nahe; aber wir können ja auch eine Droschke nehmen. Das Kind ist schwer.“
„Aber nein, bitte! Ich mache mir ein Vergnügen daraus,“ beharrte jener; „ich hatte ja schon einmal das Glück, Ihnen einen kleinen Dienst erweisen zu können ... Sie entsinnen sich wohl nicht mehr, gnädige Frau? Im Geschäft von Lüders, als ich Ihnen das helle Spitzenkleid auswählen half. Mein Name ist Vollborth, Maler. Gestatten Sie vielleicht, dass ich Ihnen auch meinen Freund vorstelle: Herr Reinecke, Komponist.“
Tief errötend zog Henri, der mit der kleinen Eva den andern folgte, den Hut vor seiner schönen Schwägerin und empfing ihren kühlen, ein wenig verwirrten Gegengruss. Dann trat er wieder bescheiden zurück und liess Vollborth mit Lori vorangehen. Er fühlte sich eigentümlich bewegt durch diese Laune des Zufalls, die ihn so unvermutet und unerkannt dem kleinen Neffen, den er heute zum erstenmal sah, dem Nichtchen, das er als Wickelkind verlassen hatte, wieder nahe brachte. Walther hatte sein heisses Gesichtchen matt an Vollborths Schulter verborgen. Er konnte nur Evchen, die mit einer wohl schon koketten Grazie neben ihm einhertrippelte, beobachten. Das Kind war eine pikante kleine Schönheit geworden, eine Schönheit, wie sie in diesem Alter in Bezug auf die fast reif zu nennende Formenfülle und die bereits charakteristischen Züge des Gesichtes fast nur Judenkindern eigen ist.
„Nun, Kleine,“ entschloss sich Henri endlich, ein Gespräch zu eröffnen, „du bist doch nicht krank? Oder soll ich dich vielleicht auch auf den Arm nehmen?“
„Nein, danke,“ erwiderte das Kind mit einem drolligen Knicks, „aber Sie können mir die Hand geben.“
Henri hielt das Pätschchen fest und drückte es unbewusst von Zeit zu Zeit, so dass Evchen mit ihren grossen dunklen Mandelaugen immer wieder fragend zu ihm aufsah. Und als sie nach wenigen Minuten vor der Thür des Hauses angelangt waren, in dem Renards wohnten, da vergass er sich gar so weit, „Adieu, liebes Evchen!“ zu sagen. Er wartete unten auf der Strasse, während Vollborth den kranken Knaben auch noch die Treppe hinauftrug.
Auf dem ersten Treppenabsatz zupfte Eva die Stiefmama am Kleide, bedeutete ihr, dass sie ihr Ohr herabneigen möge, und flüsterte ihr zu: „Ach, Mama, das war ein hübscher Mann, mit dem ich ging, den mag ich leiden! Denk’ nur, er hat mich Evchen genannt! Woher weiss er denn, wie ich heisse?“
In ihrer grossen Sorge hatte Lori jetzt keinen Sinn für die schlaue Entdeckung der kleinen Kokette. Sie zuckte nur die Achseln und schritt eilig dem Maler nach.
„Ich weiss wirklich nicht, wie ich Ihnen danken soll, Herr Vollborth,“ sagte sie herzlich, als sie oben im zweiten Stock angelangt waren und das Dienstmädchen den Knaben hineingetragen hatte. „Mein Mann ist leider noch nicht zu Hause, sonst würde ich Sie bitten ...“ Sie wusste eigentlich nicht, worum sie ihn bitten würde, und brach verlegen ab.
Da kam Vollborth ein kühner Gedanke. Ihre dargereichte Hand warm drückend, stiess er hastig hervor: „Sie könnten mir allerdings danken, gnädige Frau, und mich sehr glücklich machen, wenn Sie mir erlauben wollten — Ihr Porträt zu malen.“
„Ich werde mit meinem Mann sprechen,“ versetzte Lori, flüchtig errötend. „Wenn er es erlaubt ...“
Noch einmal reichte sie ihm die Hand — dann schloss sich die Flurthür, und Manuel Vollborth stürmte glückstrunken die Treppe hinunter. — —
Als Gisbert Renard etwa eine Stunde später nach Hause kam, empfing ihn Lori mit der Schreckenskunde, dass sein Walther von der tückischen Diphtheritis befallen worden sei. Sanitätsrat Magnus hatte sie soeben verlassen und die kleine Eva mit sich genommen. Aus freien Stücken hatte er sich erboten, das Kind bei sich zu behalten, bis die Ansteckungsgefahr vorüber sei.
Nun kamen trübe Tage, in denen, bleiern wie der graue Regenhimmel über der Riesenstadt, die Sorge auf dem Gemüte des Vaters und der Stiefmutter lastete. Und wieder einmal führte das gemeinsame Leid die getrennten Herzen zusammen. Lori wollte ihm zeigen, dass sie für sein Kind der Aufopferung einer leiblichen Mutter fähig sei, und er bewies ihr durch die zärtlichste Sorgfalt, mit der er sie davor zu behüten suchte, sich der Ansteckungsgefahr allzusehr auszusetzen, dass ihm ihr Leben noch teurer sei, als das seines eigenen Fleisches und Blutes. Er liess es sich nicht nehmen, die schwersten Pflichten der Krankenpflege selbst zu leisten. Er gab es durchaus nicht zu, dass sie ihre Nachtruhe opferte, sondern sass selber Nacht für Nacht an dem Bettchen des kleinen Dulders. Es war eine schwere Aufgabe, die Vorschriften des Arztes genau zu erfüllen, da das Kind in seiner matten Gleichgültigkeit geradezu störrisch alle Linderungsmittel, die man ihm eingeben mochte, zurückwies. So war es z. B. unmöglich, das Kind zum Gurgeln zu bringen, und es musste statt dessen das Einblasen pulverförmiger Heilmittel in den Rachen versucht werden. Aber auch das liess sich oft nur durch Anwendung von Gewalt bewerkstelligen, wenn der Kleine durch kein Zureden dazu zu bewegen war, seinen Mund aufzusperren. Den grossen vorwurfsvollen Blick, den die fieberweiten Kinderaugen auf den Peiniger richteten, vermochte Lori nicht zu ertragen, und es blieb daher Gisbert diese grausame Pflicht ganz allein überlassen. Selbst am Tage musste er zur Erfüllung derselben von seinem wohlverdienten Schlummer aufgerüttelt werden.
Schon am vierten Tage nahm die Krankheit einen sehr drohenden Charakter an. In der Nacht stellte Gisbert eine Temperatur von nahezu zweiundvierzig Grad fest. Oefter denn bisher noch erneuerte er die Eisumschläge, zwang er das Kind, das die glänzenden Augen unverwandt auf ihn gerichtet hielt, Eisstücke zu schlucken. Er wusste nicht, dass seit dem letzten Besuche des Arztes eine gefährliche Wendung zum Schlimmeren eingetreten war, nach welcher das Eis keine Wirkung mehr üben konnte. Es war bereits eine Blutvergiftung erfolgt, gegen die nichts mehr auszurichten war.
So ernst Gisbert auch immer seine Vaterpflicht nehmen mochte, so machte doch die gemisshandelte Natur, nachdem sie sich vier Nächte hinter einander um den Schlaf hatte betrügen lassen, endlich ihre Rechte unwiderstehlich geltend. Als der kleine Walther für einen Moment die Augen schloss und das dunkle Lockenköpfchen wie zum Schlummer auf die Seite neigte, glaubte Gisbert sich gleichfalls auf ein paar Minuten ausruhen zu dürfen. Er warf sich auf den alten Schlafdiwan, reckte und dehnte die vor Ermüdung schmerzenden Glieder und schloss die Augen. Doch trotz seines festen Vorsatzes, wach zu bleiben, war er nach wenigen tiefen Atemzügen schon in schweren Schlaf versunken. Er hörte nicht das angstvolle Röcheln aus der zugeschnürten Kehle — er hörte nicht den letzten Seufzer seines Kindes! — —
Lenzgoldig leuchtend stieg an diesem Morgen die Sonne über den knospenden Wipfeln des Tiergartens empor, und als sie endlich auch über die Dächer in die Höfe der Flemmingstrasse hineinzuschauen vermochte, da stahl sich durch den schmalen Spalt der Vorhänge auch ein Strahl in das dumpfe karbolduftende Krankenzimmer und huschte über das bleiche Antlitz des schlafenden Vaters. Der blinzelte erst unbehaglich dem störenden Lichte entgegen, und dann, plötzlich zum Bewusstsein kommend, sprang er auf die Füsse und trat an das Bettchen. Die vor wenigen Stunden noch flammend roten Wangen waren bleich, das glühende Körperchen kühl und die glänzenden braunen Augen starrten verglast nach der Zimmerdecke hinauf. Ein Frostschauer rieselte Gisbert eiskalt über den Rücken. Sein Kind war tot — und er hatte vielleicht gerade in der entscheidenden Stunde seine heilige Pflicht versäumt! Ein plötzlicher Schwindel erfasste ihn. Er taumelte nach dem Fenster, riss die Vorhänge beiseite und die Fensterflügel weit auf. Das helle, lebenspendende Licht floss in breitem Strome in das Totenzimmer herein; die kühle feuchte Morgenluft strich durch Gisberts wirres Haar und hauchte ihre erfrischenden Küsse auf seine brennenden Augenlider. Und als der Schwindel von ihm gewichen war, da bemerkte er, wie das Dienstmädchen von gegenüber, den Besen geschultert, ein rotwollenes Tuch um den Kopf geschlungen, mit dummer Neugier zu ihm herüberglotzte. Ueber den asphaltierten Hof schlurrten die Pantoffel des Bäckerjungen, und er pfiff die schöne Melodie vor sich hin: „Mutter, der Mann mit dem Coaks ist da!“ Zu der Spatzenfamilie, die piepsend auf der Dachrinne hockte, kam ein früher Morgenbesuch geflogen und brachte Neuigkeiten mit, über welche die ganze Gesellschaft in grosse Aufregung geriet. Aus dem offenen Küchenfenster des untersten Stockwerks tönte in schrillem Diskant das Schelten einer übereifrigen Hausfrau. Von der nahen Stadtbahn her hörte er deutlich das Puffen der Lokomotiven und ein scharfes Klingeln kündigte die Nähe des Bolleschen Milchwagens an.
Tief aufseufzend strich Gisbert das Haar von der hohen Stirn zurück und eilte dann mit leisen Schritten, abgewandten Blickes, an dem Totenbettchen vorüber nach der Thür des ehelichen Schlafgemaches. Geräuschlos trat er ein und schlich sich an Loris Bett. Sie schlief noch, leise vor sich hinpustend. Die schwache Dämmerung, die in dem Zimmer herrschte, liess ihn nur eben die weichen Formen ihres Antlitzes erkennen, die sich von dem weissen Linnen des Kopfkissens und der getollten Stickerei um den Hals rosig abhoben. Das üppige Blondhaar fiel lose in leicht gewellten Strähnen bis auf den friedvoll sich hebenden und senkenden Busen herab. An ihrem linken Arm hatte sich der Aermel weit hinaufgeschoben, die schmale Hand hing lässig über den Bettrand hinab.
Gisbert setzte sich seitwärts auf das Bett, hob diese Hand leise auf und beugte sich zu einem langen Kusse darüber. Und dann begann er, den wunderschönen blossen Arm kosend zu streicheln. Er fühlte die Pulse in dem blauen Geäder klopfen — und da musste er plötzlich daran denken, wie sein Auge sich an dem rosigen, warmduftenden Körperchen seines toten Lieblings so oft heimlich geweidet hatte, wenn er noch spät in der Nacht an das Bettchen des Schlummerden getreten war. Er fühlte sich im Innersten erbeben, der starre Schmerz löste sich in heisse Thränen auf — er umklammerte mit beiden Händen den Arm seines Weibes und drückte ihn, sich neben sie auf das Lager streckend, aufschluchzend an seine Brust.
Mit einem erschrockenen Aufschrei erwachte Lori und suchte ihn mit der freien Hand von sich zu drängen. Dann aber, ihn erkennend, rief sie innig besorgt: „Was ist? Was hast du, Gisbert? Du hast mich so erschreckt! Ist etwas mit dem Kinde ...?“
„Es ist tot!“ schluchzte er auf, indem er sein verstörtes Antlitz auf einen Augenblick zu ihr erhob. „Ach, Lori, mein süsses Weib, lass mich hier liegen und mich ausweinen! Drücke mich an deine Brust — ich kann es nicht allein tragen!“
Und sie liess ihn, wie ein müdes Kind, sein Haupt an ihrem Busen betten uud weinte mit ihm. —
Am andern Tage schon trugen sie die kleine Leiche hinaus — und dann blieben Gisbert und Lori ganz allein in der verwaisten Wohnung zurück; denn auch Eva sollte erst nach vierzehn Tagen heimkehren, nachdem durch gründliche Reinigung und Lüftung aller Räume die Gefahr der Ansteckung möglichst beseitigt war. Wie wohl that ihm nun das warme Mitgefühl seines Weibes, ihr herzlicher Zuspruch, die sanfte Betäubung, die wie ein warmer Regenschauer sein Denken überrieselte, wenn sie mit ihren schlanken Fingern durch seine Locken strich!
Doch ach! Selbst dies trübselige Glück der versüssten Trauer hatte kaum eine Woche Bestand! Sein stets arbeitender lebhafter Geist hielt die vollkommene Ruhe nicht länger aus. Er bedurfte der Zerstreuung, der belebenden Gemütsbewegung — und die vermochte ihm Lori nicht zu bieten. Schon wieder offenbarten sich die schroffen Gegensätze ihrer Naturen und führten zu gegenseitigen Missverständnissen, welche den kurzen Frieden ihrer Ehe wieder grausam zerstörten. Sie begriff seine wechselnden Stimmungen nicht und reizte ihn oft, trotz ihres besten Willens, durch ihren Zuspruch erst recht zu heftigen Ausbrüchen des Missmuts.
Renard hatte den Tod seines Knaben dem Bekanntenkreise durch gedruckte Anzeigen bekannt gemacht. Es waren darauf die üblichen Beileidsbezeigungen in den mehr oder minder kühlen Wendungen eingelaufen. Er fragte solchen herkömmlichen Höflichkeitsbezeigungen herzlich wenig nach, aber dennoch fiel es ihm auf, dass von dem alten Döhmke kein Zeichen des Beileids einlief. Sollte der alte Sonderling Verdacht geschöpft haben? Gisbert meinte doch bei der letzten Verhandlung mit ihm und Herrn Zwillich sein Spiel so gut gespielt zu haben! Sie waren ja auch in aller Freundschaft auseinander gegangen. Der Alte hatte sein bares Geld richtig in der Tasche. Dass Vater Döhmke inzwischen von seinem andern, viel ärgeren Vertrauensbruch Wind bekommen hatte, davon liess sich Gisbert nichts träumen. — — —
Etwa vierzehn Tage nach dem Begräbnis — die kleine Eva war inzwischen nach Hause zurückgekehrt — hatten Renards den in letzter Zeit verhältnismässig selteneren Besuch des Freiherrn von Drenk erhalten. Es hatte an dem Tage bereits eine ziemlich heftige Scene zwischen den Eheleuten gegeben, verursacht durch eine Meinungsverschiedenheit über die Erziehung der kleinen Eva, bei welcher die von der Mutter ererbte Anlage zur Gefallsucht, und was schlimmer war, zur Lüge Lori immer bedenklicher hervorzutreten schien. Dass Gisbert gerade jetzt dem Kinde seine ganze Zärtlichkeit zuwandte, war ja am Ende nur natürlich und von Lori war es unklug, gerade jetzt vor dem Verziehen zu warnen. Da fielen denn von seiner Seite wieder einmal harte Worte: ob es ihm denn nicht mehr erlaubt sein solle, um die Liebe seines Kindes zu werben? ob denn das arme Geschöpfchen doppelt verwaisen solle, nur darum, weil seine Stiefmutter sich dadurch gekränkt fühlte, dass das Mädchen schon jetzt die Anmut, die leichtherzige Liebenswürdigkeit des Wesens zu zeigen beginne, welche ihr Vater an den Frauen so liebte und die sie eben gar nicht besass! Zum Schlusse wurde er gar pathetisch und rief aus: nur der Tod werde ihn von seinem Kinde trennen, dem einzigen Wesen, bei welchem er immer auf liebevolles Verständnis für seine Natur rechnen dürfte.
So fand denn der gute Schwiegervater, als er um die Vesperstunde sich einstellte, recht verstimmte Gesichter vor. Er schob die trübe Laune der Renards auf die Trauer und war ängstlich bemüht, auch von seiner Unterhaltung alle Glanzlichter, auch des harmlosesten Humors, fern zu halten, gewissermassen einen Kreppschleier achtungsvoller Trübseligkeit darüber zu breiten. Gisbert, der seines Schwiegervaters Unterhaltung schon in gewöhnlichen Zeiten nicht gerade hervorragend amüsant fand, wurde heute durch seine unvermeidlichen Aufklärungen über die umstürzlerischen Bestrebungen des Freimaurertums dermassen nervös gemacht, dass er ihn einigemal mit recht unehrerbietigen, fast höhnischen Aeusserungen unterbrach.
Als der Freiherr gegangen war, konnte sich Lori nicht enthalten, ihrem Manne ziemlich heftige Vorwürfe zu machen. Darauf hatte er ihr gar keine Antwort gegeben, sondern sich mit finster gerunzelter Stirn in sein Zimmer zurückgezogen und die Thür laut hinter sich zugeschlagen.
Fast unmittelbar danach klingelte es wieder, und das Mädchen meldete Herrn Döhmke an. Gisbert knurrte einen Fluch vor sich hin — aber es ging doch nicht wohl an, den alten Herrn, der sich aus Treptow bis nach Moabit hinaus bemühte, zurückzuweisen! Zum Schutze gegen seine schlimme Laune, die ihn leicht auch dem alten väterlichen Freunde gegenüber zu unvorsichtigen Aeusserungen verleiten konnte, kam ihm plötzlich der Einfall, sein Kind zu Hilfe zu rufen. Während Vater Döhmke in das Wohnzimmer geführt wurde, rannte er nach der Kinderstube, nahm, ohne ein Wort zu sagen, das grosse, schwere Mädchen auf seinen Arm und trat so dem Besuche entgegen. Und Lori, die gerade beschäftigt gewesen war, das nicht eben lernlustige Kind buchstabieren zu lassen, folgte mit verwundertem Kopfschütteln ihrem Manne in den Salon nach. Sie fuhr ein klein wenig zusammen, als sie Döhmke erkannte. Da Gisbert sie zu bleiben aufforderte, so bemühte sie sich, eine möglichst liebenswürdige Miene aufzusetzen — es lag ihr ja auch selbst daran, ihm die Meinung zu benehmen, als ob sie etwa auf die alten Freunde ihres Mannes hochmütig herabsehe. Gisbert suchte seine Unruhe dadurch zu bemeistern, dass er die kleine Eva fortwährend an sich drückte, streichelte und küsste.
Der Alte leitete das Gespräch damit ein, dass er sich wegen seiner Nichtbeantwortung der Todesanzeige entschuldigte.
„Nich wahr, mein Junge, so ’ne Redensarten, wie man bei der Jelejenheit zu schreiben pflegt, die können einem doch man wenig Trost bringen? Ich hab’s wenigstens mit alten Freunden immer so jehalten: erst ’ne Weile janz in Ruhe lassen un denn ’mal hinjehen und de Hand drücken und — denn aber von was anderem reden. Hab’ ich da nich recht?“
Damit streckte er Gisbert die Hand entgegen, welche dieser — etwas erleichtert aufatmend — lebhaft ergriff.