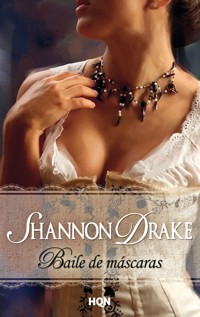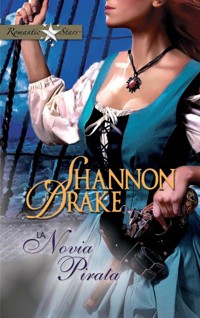Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Midnight Kiss
- Sprache: Deutsch
Denn die Liebe besiegt auch das uralte Böse! Der Urban-Fantasy-Roman »Der Kuss der Dunkelheit« von Bestseller-Autorin Shannon Drake als eBook bei dotbooks. Kurz vor Halloween reist die Sängerin Megan Douglas mit ihrem Ehemann Finn in ihre Heimatstadt Salem, um dort ein Konzert zu geben. Doch schon in der ersten Nacht wird Megan von schrecklichen Albträumen heimgesucht – finstere Visionen, in denen Finn sie bedroht. Schaudernd erinnert sich Megan an die Vorhersage einer Kartenleserin: Ist ihr Ehemann etwa von einem Dämon besessen? Tatsächlich verhält er sich immer abweisender und grausamer. Muss Megan fürchten, dass Finn sie töten wird? Oder ist ihre Liebe stärker als das uralte Böse, das gierig seine Klauen nach ihnen ausstreckt? New-York-Times-Bestseller-Autorin Shannon Drake bietet in ihren Erotic-Fantasy-Romanen alles, was die Fans dieses Genres lieben! »Die Autorin kombiniert Mystery mit knisternder Romantik.« Publishers Weekly »Eine unglaubliche Geschichtenerzählerin.« Los Angeles Daily News Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der Urban-Fantasy-Roman »Blutrote Nacht« von Shannon Drake. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 753
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Kurz vor Halloween reist die Sängerin Megan Douglas mit ihrem Ehemann Finn in ihre Heimatstadt Salem, um dort ein Konzert zu geben. Doch schon in der ersten Nacht wird Megan von schrecklichen Albträumen heimgesucht – finstere Visionen, in denen Finn sie bedroht. Schaudernd erinnert sich Megan an die Vorhersage einer Kartenleserin: Ist ihr Ehemann etwa von einem Dämon besessen? Tatsächlich verhält er sich immer abweisender und grausamer. Muss Megan fürchten, dass Finn sie töten wird? Oder ist ihre Liebe stärker als das uralte Böse, das gierig seine Klauen nach ihnen ausstreckt?
»Die Autorin kombiniert Mystery mit knisternder Romantik.« Publishers Weekly
»Eine unglaubliche Geschichtenerzählerin.« Los Angeles Daily News
Über die Autorin:
Hinter dem Pseudonym Shannon Drake verbirgt sich die New-York-Times-Bestseller-Autorin Heather Graham. Bereits 1982 veröffentlichte sie ihren ersten Roman. Seitdem hat sie über zweihundert weitere Romane und Novellen verfasst, die in über dreißig Sprachen übersetzt und mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet wurden. Sie lebt mit ihrem Mann und ihren fünf Kindern in Florida.
Von Shannon Drake erscheinen bei dotbooks ebenfalls:
Blutrote Nacht
Bei Anbruch der Dunkelheit
Verlockende Finsternis
Das Reich der Schatten
Unter ihrem Namen Heather Graham veröffentlicht sie bei dotbooks:
In den Händen des Highlanders
***
eBook-Neuausgabe März 2019
Dieses Buch erschien bereits 2009 unter dem Titel Das Erwachen in der Verlagsgruppe Weltbild GmbH
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 2003 by Shannon Drake
Published by Arrangement with KENSINGTON PUBLISHING CORP., NEW YORK, NY 10018 USA
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2003 unter dem Titel The Awakening bei Zebra Books.
Copyright © der deutschen Ausgabe 2009 Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerne Furt, 86167 Augsburg
Copyright © der Neuausgabe 2019 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/kiuikson und travelview
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ca)
ISBN 978-3-96148-754-7
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort Der Kuss der Dunkelheit an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Shannon Drake
Der Kuss der Dunkelheit
Roman
Aus dem Amerikanischen von Angela Schumitz und Heinz Tophinke
dotbooks.
Prolog
Der NebelSeptember
Die ganze Strecke vorbei an New York hatte es geregnet. Auf dem viel befahrenen New Jersey Turnpike staute sich der Verkehr, bis es nur noch in einem elend langsamen Schritttempo weiterging. Die wachsende Ungeduld der Fahrer führte zu zahlreichen Blechschäden. Hinter dem Hudson hätte Finn Douglas beinahe die Abzweigung zu den Neuengland-Staaten übersehen. Maine war noch immer höllisch weit weg, und er war mittlerweile hundemüde.
Er hatte gehofft, es in dieser Nacht zumindest noch bis zum nächsten Bundesstaat zu schaffen, doch das würde wohl nicht klappen.
Als er auf dem Massachusetts Pike Richtung Osten durch Connecticut fuhr, merkte er, dass er allmählich zur Gefahr für sich und andere wurde. Mit zwanzig konnte er mühelos achtundvierzig Stunden wach bleiben, ohne die geringste Müdigkeit zu verspüren. So lange war das noch gar nicht her, stellte er sarkastisch fest. Er sollte auch im reifen Alter von achtundzwanzig noch einigermaßen fit sein. Seltsam – sobald er die Grenze nach Massachusetts hinter sich hatte, war er nicht nur todmüde, er verspürte einen regelrechten Drang, die Straße zu verlassen. Sobald er die ersten Schilder von Boston sah, wurde aus dem Drang ein Zwang. Er musste anhalten, und zwar gleich.
Doch in Boston haltzumachen war nicht besonders klug. In dieser Stadt wurde ständig gebaut, es wimmelte von Einbahnstraßen. der Verkehr war schrecklich, und die Motels, Hotels und Restaurants waren hier bestimmt wesentlich teurer als weiter im Norden. Trotzdem ...
Weg von der Straße! Und zwar sofort! Halt an!
Eine Stimme in seinem Kopf. Die Stimme eines Verkehrspolizisten, dachte er erschöpft. Eines Polizisten, der ihn warnte, dass er sich selbst oder einen anderen umbringen würde, wenn er nicht ein Weilchen ausruhte.
Er hätte irgendwo in Connecticut den Highway verlassen sollen, bevor er auf den Mass Pike und den Highway in die Stadt eingebogen war.
Vor ihm war eine Ausfahrt. Er befand sich im Norden der Stadt, in der Nähe der alten Ausfahrt zum Flughafen.
Er hatte keine Ahnung, wohin ihn die nächste Ausfahrt bringen würde. Natürlich landete er in einer Einbahnstraße. Boston. Hier würde er nie einen Parkplatz finden.
Aber immerhin – Boston, eine tolle Stadt. Essen, ein Drink ... Das war momentan das Wichtigste. Er war im frühen Morgengrauen in Louisiana aufgebrochen und war seitdem ohne Unterbrechung gefahren, abgesehen von kurzen Tankstopps. Wie viele Stunden saß er nun schon im Auto? Er war ein Vollidiot. Auch, weil er so lange gebraucht hatte, um diese Fahrt anzutreten. Viel zu viele Nächte hatte er herumgesessen und sich eingeredet, sie würde schon wieder zu ihm zurückkehren. Er hatte doch nichts Schlimmes getan. Megan würde es einsehen und zurückkehren.
Aber sie kam nicht.
Schließlich hatte er erkannt, dass es keine Rolle spielte, im Recht zu sein. Megan hatte sich etwas eingeredet, und er war zu stolz gewesen, es abzustreiten, ja, er hatte sich sogar stur dagegen gewehrt, die Sache aufzuklären. Deshalb war ihr kaum eine Wahl geblieben. Diese Einsicht war ihm im Schlafzimmer gekommen. Er hatte die vom Balkon hereinwehende Brise gespürt und die gedämpfte Kakofonie vernommen, die die Straßen von New Orleans Tag und Nacht erfüllte. Und er hatte all das wahrgenommen, was ein Teil von Megan war: die im Nachtwind flatternden beigefarbenen Vorhänge, das Kopfteil und den Baldachin des großen Bettes, die antiken Kommoden, die noch nicht komplett restauriert waren. Eine der Schubladen stand offen, etwas aus Seide und Spitze quoll heraus. Er hätte schwören können, ihr Parfüm zu riechen.
Und wenn er in dem Moment aufgestanden wäre und eine CD eingelegt hätte, dann hätte er ihre Stimme gehört.
Am liebsten hätte er sie angerufen, doch dann unterließ er es. Es waren zu viele böse Worte gefallen. Er sah sie so deutlich vor sich, ihr langes blondes Haar, ihre Leidenschaft, die Tränen in ihren tiefdunkelblauen Augen. Ein Anruf hätte nicht gereicht, nicht, nachdem er es mit einem Schulterzucken abgetan hatte, als sie ihm erklärte, sie müsse ihn verlassen, müsse nach Hause zurückgehen ...
Auf einmal merkte er, dass er den Wagen bereits geparkt hatte. Er kniff die Augen zusammen und sah sich um. Offenbar war er irgendwo in der Nähe von Little Italy. Gottlob kannte er sich in Boston ein wenig aus, er hatte hier schon ein paar Mal gespielt. Doch viel hatte er nicht mitbekommen, weil sie immer per Flugzeug hierhergekommen waren. Fast direkt vor ihm blinkte ein Neonlicht. Ein wahres Wunder: Er hatte in Boston einen Parkplatz direkt vor einem Restaurant oder einer Bar gefunden. Irgendetwas in der Art war es wohl.
Finn konnte den Namen nicht entziffern, und das lag nicht nur an seiner Erschöpfung. Es war der Nebel, der sich über die Stadt gelegt hatte.
Er taumelte aus dem Auto und streckte sich. Er blinzelte. Egal, wo er jetzt war, er brauchte etwas zu essen und zu trinken. Und egal, wie sehr es ihn inzwischen danach verlangte, Megan zu sprechen, erst brauchte er eine Mütze Schlaf, und zwar möglichst hier in der Nähe, selbst wenn das Hotelzimmer viel zu teuer war. Auf der Straße würde er es nicht mehr lange machen, und am Ende würde er noch jemand in den Tod mitnehmen, wenn er nicht bald etwas Schlaf bekam.
Aber zuerst etwas essen.
Und ein kaltes Bier.
Theresa Kavanaugh verließ die Bar ziemlich spät und – zugegeben – auch ziemlich betrunken. Verdrossen stellte sie fest, dass sie jetzt wohl zu Fuß nach Hause musste. Eigentlich hatte George Roscoe sie heimfahren wollen, aber das hatte er ihr versprochen, bevor er mit der hübschen Blondine hinter der Bar angebandelt hatte. Da war es Theresa noch egal gewesen, weil der Bursche am Billardtisch sie völlig fasziniert hatte und sie davon ausgegangen war, dass er sie nach Hause bringen würde. Sie war sehr darauf bedacht gewesen, ihn nicht Sandra Jennings oder Penny Sanders vorzustellen. Obwohl sie alle zusammen in einem Büro arbeiteten, waren sie nicht die besten Freundinnen. Und selbst die besten Freundinnen stürzten sich oft genug auf einen süßen Kerl, den eine von ihnen in einer Bar aufgabelte. Sandra hatte den Burschen als Erste entdeckt, wie er Kreide auf sein Queue aufgetragen hatte. Aber er war allein gewesen.
»Ich bin ziemlich gut«, meinte sie. »Hast du Lust, gegen mich anzutreten?«
»Um welchen Einsatz?«
»Spielen wir um einen Zwanziger.«
»Ich hatte gehofft, wir könnten uns auf einen ... etwas höheren Preis einigen.« Seine Augen funkelten schelmisch.
»Sehen wir doch erst mal, wie wir spielen«, antwortete sie, und er willigte ein.
Das erste Spiel gewann sie, und er bezahlte anstandslos. Sie lachten und redeten. Vielleicht hatte sie zu viel geredet? Denn als sie von der Toilette zurückkam, war er verschwunden.
Und George war auch verschwunden.
Als die Bar schloss, merkte Sandra, dass sie allein war, und deshalb musste sie wohl oder übel auch allein nach Hause.
Natürlich hatte sie nach einem Taxi Ausschau gehalten, die es normalerweise im Überfluss gab. Aber im Stadtzentrum wurde momentan wahnsinnig viel gebaut, und die Taxifahrer mieden diese Gegend, wenn es irgendwie ging. Vielleicht waren sie auch alle auf Tour, vielleicht waren viele schon heimgefahren, schließlich war es ziemlich spät. Natürlich hätte sie nach einem Taxi telefonieren können, aber als sie noch einmal in die Bar wollte, war schon abgeschlossen, und niemand reagierte auf ihr Klopfen. Ihr Handy nützte ihr auch nichts, weil der Akku leer war. Pech auf der ganzen Linie.
Aber trotzdem – so schlimm war es auch wieder nicht. Im Stadtzentrum gab es genügend Licht, und zu ihrer Wohnung war es nicht weit.
Als sie sich auf den Weg machte, war es wirklich nicht schlimm.
Aber dann kam der Nebel.
Anfangs dachte sie, sie würde es sich nur einbilden. Selbst in Boston gab es nicht oft Bodennebel, der innerhalb weniger Minuten so dick wurde wie Erbsensuppe. Aber jetzt war es so. Als sie aus der Bar trat, war die Sicht noch völlig klar gewesen, doch nach zwei Blocks watete sie plötzlich durch blaugraue Nebelschwaden.
Sie begann zu pfeifen. Warum machte dieser Nebel sie so nervös?
Sie hörte das Klappern ihrer Absätze. Warum trug sie keine Tennisschuhe? Aber sie hatte noch ihre Arbeitsklamotten an: klassisches Kostüm, eine schicke Bluse und darunter eines ihrer Lieblings-Tanktops. Natürlich hatte sie gewusst, dass sie heute Abend zum Essen und danach in eine Bar gehen würden. Freitagabend – die arbeitende Bevölkerung lebte für die Freitagabende, zumindest in Boston oder bei den Leuten in ihrer Firma war es so. Sie war in einem Maklerbüro beschäftigt, in dem von Montag bis Freitag von neun bis fünf gearbeitet wurde. Sie war jung, ehrgeizig, gut in ihrem Job, und dennoch ...
Na ja, jung eben. Sie feierte gern. Vor ein paar Monaten hatte sie sich von ihrem Freund getrennt und fühlte sich allmählich etwas einsam. Am Freitagabend hatte sie gern Gesellschaft. Natürlich würde sie sich nicht ernsthaft auf einen Kerl einlassen, den sie in einer Bar aufgegabelt hatte. Aber als sie heute Abend den Typ am Billardtisch entdeckt hatte ... Den hätte sie gern zu sich eingeladen.
»Du hast ja keine Ahnung, was du versäumst, Freundchen!«, murrte sie laut.
Der Nebel war inzwischen bis zu ihren Knien hochgestiegen. Er hatte wirklich eine sehr merkwürdige Farbe.
Sie pfiff unablässig weiter auf ihrem Weg vorbei an allen möglichen Häusern, manche so alt, dass sie wohl schon zur Geburt der amerikanischen Nation da gewesen waren, andere neue Wolkenkratzer. Als sie an einem der ältesten Friedhöfe der Stadt vorbeikam, lief ein Schauder über ihren Rücken. Na ja, aber dieser Nebel war auch wirklich schaurig.
Sie wollte nicht hinsehen und lieber an den Mann aus der Bar denken. Aber sie konnte sich weder an die Farbe seiner Augen noch die seiner Haare erinnern, und auch nicht an seine Kleidung. Sie wusste nur noch, dass er etwas an sich gehabt hatte ...
Eine Art Magnetismus. Eine seltsame Anziehungskraft.
Möglicherweise würde er ja mal wieder in der Bar vorbeischauen. Vielleicht hatte sie einfach zu viel geplappert. Aber trotzdem ... Er hatte doch bestimmt gemerkt, dass er bei ihr hätte landen können. Sie wusste, dass sie attraktiv war: Das maßgeschneiderte Kostüm betonte ihre Kurven, sie hatte lange, naturblonde Haare und ein hübsches Gesicht. Eigentlich hätte sie schon längst jemanden in der Arbeit kennenlernen müssen. Aber in ihrer Abteilung waren die. Männer entweder verheiratet oder schwul; und die, die weder das eine noch das andere waren, hatten eine Glatze oder einen Schmerbauch.
Na ja, sie hatte noch viel Zeit, um dem Richtigen zu begegnen.
Ihr Blick schweifte zum Friedhof. Gespenstische Grabsteine stiegen aus dem blauen Nebel auf.
Etwas berührte sie am Fuß. Sie stieß einen lauten Schrei aus.
»Hey, junge Frau, ham' Se mal 'n bisschen Kleingeld für mich?«
Sie schrak entsetzt vor dem Penner zurück, der sie angefasst hatte. Er lag einfach so auf dem Gehsteig.
»Nein!«
»Na gut, dann vielleicht 'nen Schein?«
»Besorgen Sie sich einen Job!«, rief sie erbost.
Und fing an zu rennen.
Einen ganzen Block lang.
Dann brach ein Absatz und sie wäre beinahe gestürzt. Fluchend richtete sie sich wieder auf. Ihre Wohnung war doch ganz in der Nähe. Warum brauchte sie bloß so lange? Es kam ihr vor, als würde sie gar nicht laufen oder rennen, sondern waten – durch den Nebel waten. Inzwischen reichte er ihr bis zur Taille. Bald würde er alles verschlucken.
Sie ließ den Friedhof hinter sich. Bald ... nur noch zwei, drei Blocks ...
Der Nebel stieg immer höher.
Auf einmal blieb sie jäh stehen, denn sie erblickte im Nebel eine Gestalt. Sie hielt den Atem an und betete, dass es nicht noch ein Penner sein möge.
»Hey! Da bist du ja!«
Es war der Typ aus der Bar – charmant, anziehend, verführerisch. Er stand am Ende des Blocks vor einem der wenigen Bäume in dieser Gegend. Er strahlte etwas Seltsames aus, aber sie wusste nicht recht, was es war.
»Hey!«, antwortete sie. Weil ihr ein Absatz fehlte, humpelte sie auf ihn zu. Sie musterte ihn stirnrunzelnd und versuchte herauszufinden, was jetzt so anders an ihm war. »Ich dachte, du wärst gegangen.«
»Und ich dachte, du wärst gegangen!«, entgegnete er leise. Seine Stimme war wie Seide. Obwohl er reglos dastand, umgab ihn eine Aura von Kraft und Energie. »Ich hatte gehofft, dich wiederzusehen«, erklärte er.
Sie lächelte und dachte daran, dass der Friedhof mit seinen Grabsteinen, der im Nebel so unheimlich gewirkt hatte, nun hinter ihr lag und auch der Penner, der sie angefasst hatte. Doch die Nacht ... die Nacht lag vor ihr, und sie barg ein erregendes, neues Geheimnis.
»Theresa, komm, komm zu mir, Theresa.«
Aber natürlich, Süßer, dachte sie und lächelte leise.
Und sie kam zu ihm.
Ihr Absatz klapperte auf dem Asphalt, ein mitleiderregendes Geräusch. Der Nebel reichte ihr nun bis zur Brust, die Schwaden zogen um sie herum. Sie war dem Mann nun ganz nahe. Zusammen würden sie dem Nebel trotzen.
Sie sah ihn lächeln. Sie sah seine Zähne aufblitzen, so nah war sie ihm schon.
Jetzt sah sie auch, was anders war an ihm – seine Kleidung. Seltsam, dass er in einer solchen Nacht so etwas trug.
Aber bei einem solchen Mann spielte das keine Rolle.
Sie kam immer näher und fühlte sich so trunken, wie sie es alkoholisiert nie gewesen war. Na ja, vielleicht waren es doch die Reste der Cosmopolitans, die sie heute Abend getrunken hatte und die sie jetzt noch wärmten. Bei jedem Schritt, der sie ihm näher brachte, hüpfte ihr das Herz vor Erregung.
Es war, als wäre selbst der seltsam blaue Nebel ein Teil seines Zaubers.
Schließlich stand sie direkt vor ihm. »Ich kann es gar nicht glauben, dass ich dich wiedergefunden habe«, murmelte sie.
»Schicksal«, sagte er leise. »Bestimmung. Großartiges kommt auf dich zu.«
Seine Stimme klang noch immer sehr verführerisch. Und seine Augen ...
Selbst wenn sie es gewollt hätte, sie hätte sich nicht mehr rühren können. Und dennoch ...
Etwas war seltsam. Etwas stimmte nicht.
Schicksal. Bestimmung. Und trotzdem ...
Ihr war nicht klar, warum sie wusste ... was sie wusste; was sie sah oder fühlte. Sie wusste nur, es war ... Sie versuchte, es zu verstehen.
»Komm mit!«
»Ja!«
»Diene mir!«
»Oh ja!«
Er ging weiter.
Oh, wie verführerisch. Gefährlich. Verboten und deshalb umso reizvoller. Aber trotzdem ...
Ihr war, als würde die Tiefe der Nacht sie verschlingen.
Und die blauen Nebelschwaden.
»Hey!«
Jemand schüttelte Finn ziemlich unsanft. Er blinzelte, schlug die Augen auf.
»Hey, zeigen Sie mir mal Ihre Papiere!«
Der Polizist vor ihm streckte die Hand aus. Finn griff automatisch in seine Gesäßtasche. So desorientiert, wie er war, bewegte er sich völlig mechanisch. Wo zum Teufel war er eigentlich? Dann merkte er, dass er auf der Straße lag, er hatte sich an eine Hauswand gelehnt und war eingeschlafen.
Im ersten Moment fürchtete er, er würde seine Brieftasche nicht finden. Er wusste nicht mehr, wie er hierhergekommen war – wo immer das sein mochte. Er konnte sich nur noch daran erinnern, dass er ein Bier und einen Hamburger bestellt hatte,
Erleichtert fand er die Brieftasche dort, wo sie sein sollte – in seiner Gesäßtasche.
»Sie kommen aus New Orleans?«, fragte der Beamte.
»Ja.«
»Was machen Sie hier? Sind Sie ohnmächtig geworden?«
Finn schüttelte den Kopf und betete, dass man ihn nicht verhaften möge.
»Ich ...« Er zögerte, dann beschloss er, die Wahrheit zu sagen. »Ich habe versucht, in einem Stück nach Maine durchzufahren. Aber als ich Boston vor mir auftauchen sah, dachte ich, es wäre besser, anzuhalten und einen Happen zu essen. Ich glaube, ich war so hundemüde, dass ich mich einfach an die Wand gelehnt habe und weggedöst bin. Aber ich bin nicht betrunken, und ich war es auch nicht. Ich habe nur ein Bier getrunken, und das schon vor einigen Stunden, glaube ich.« Er warf einen Blick auf seine Uhr. »Ja, vor Stunden. Sie können mir gern Blut abnehmen oder mich pusten lassen, wenn Sie wollen.«
Der Polizist war um die vierzig, schätzte Finn. Klare braune Augen, graue Schläfen, gedrungener Körperbau.
Er reichte Finn seine Brieftasche. »Sie sind also nach Maine unterwegs?«
»Meine Frau ist dort oben. Ihre Familie stammt ursprünglich aus Massachusetts. In ihrem ersten Collegejahr sind sie nach Maine gezogen.«
»Wie kommt es, dass Sie es so eilig haben?«
Finn zögerte abermals, dann zuckte er die Schultern. »Wir hatten eine Auseinandersetzung. Sie hat mich verlassen. Ich will sie holen.«
»Eine Auseinandersetzung?«
Finn hätte einem Polizisten nicht seine Ehe erklären müssen, aber der Polizist hatte ihn aufgeweckt, als er in aller Öffentlichkeit geschlafen hatte. »Es war wohl eine Frage des Stolzes. Sie hat sich etwas eingebildet, was nicht stimmte. Ich war wütend. Sie wissen ja, wie das so geht – ich wollte kein Schwächling sein und war zu selbstgerecht, um ihr die Sache zu erklären.«
»Und jetzt stürmen Sie also nach Maine. Sie hatten Glück, dass Sie kein Dieb behelligt hat. Aber Sie sind ja ziemlich groß und drahtig. Und so, wie Sie reagiert haben, als ich Sie schüttelte, haben Sie wohl auch schon den einen oder anderen Kampf hinter sich. Trotzdem – gegen 'nen Kerl mit 'ner Knarre hat selbst ein Schwarzgurtträger keine Chance.«
»Ich weiß, aber sehen Sie – ich schwöre, als ich beschloss, sie zu holen, koste es, was es wolle, dachte ich, ich würde es ohne Pause schaffen. Jetzt weiß ich es besser.«
Der Cop grinste.
»Es ist nun mal kein Katzensprung von Louisiana nach Maine, und Sie brauchen Ihren Schlaf, darauf können Sie wetten. Aber andererseits ist es schön, dass Sie Ihre Frau zurückholen wollen. Sie werden sich schon wieder einigen. Heutzutage streichen zu viele Leute schon beim kleinsten Anzeichen von Ärger die Segel. Ich bin jetzt seit fünfundzwanzig Jahren mit meiner Laura zusammen. Auch sie hat mich mal verlassen.«
»Und was haben Sie getan?«
»Ich habe sie zurückgeholt. Haben Sie Geld bei sich?«
»Ja, und Kreditkarten.«
»Nun denn – Sie haben von Anfang an nicht den Eindruck eines Landstreichers auf mich gemacht, auch wenn Sie eine Betonmatratze benutzt haben. Sie sind wahrhaftig nicht wie ein Landstreicher gekleidet, und Ihre Geschichte klingt glaubhaft. Haben Sie eine Arbeit?«
Finn zögerte erneut. »Ich bin Musiker«, meinte er schließlich. Der Beamte hob die Brauen. Erschöpft erklärte Finn: »Ein guter Musiker. Und ja, ich verdiene Geld, ich kann von meiner Musik recht gut leben.«
Der Beamte grinste. »Kein Grund, Sie einzusperren. Aber jetzt suchen Sie sich wohl besser ein Hotel, ja?«
»Das mach ich.«
»Fahren Sie ein Stück aus der Stadt raus und passen Sie auf sich auf. Was soll's – ich mache meine Arbeit lang genug, ich weiß, wenn ich einen Betrunkenen vor mir habe. Und Sie sehen einfach nur erledigt aus. Ziehen Sie los, aber fahren Sie nicht weiter wie ein Wahnsinniger. Maine ist noch ein ganzes Stück weg.«
»Danke, vielen Dank. Ich habe noch nie auf der Straße geschlafen, das schwöre ich«, meinte Finn. »Ich hätte einfach nicht so lange hinterm Steuer sitzen dürfen.«
»Hoffentlich kommt mir nicht zu Ohren, dass Sie in einen Unfall verwickelt waren.«
»Nein, bestimmt nicht«, versprach Finn.
»Na dann, fort mit Ihnen, und fahren Sie vorsichtig!«
»Ja, das werde ich. Und vielen Dank noch mal.«
Der Beamte tippte an die Mütze. Finn lächelte und erwiderte den Gruß, dann drehte er sich um und suchte sein Auto. Verlegene Stille trat ein. Er wusste nicht, wo zum Teufel sein Auto stand.
»Das Parken kann ziemlich lästig sein hier, stimmt's?«
»Ja, aber ich parke gleich in der Nähe«, erwiderte Finn.
»Soll ich Sie hinfahren?«
»Nein, nochmals vielen Dank. Es ist wirklich ganz in der Nähe.«
»Na denn. Ein kleiner Spaziergang an der frischen Luft tut Ihnen bestimmt gut.«
Finn nickte. Er war froh, dass der Beamte in sein Auto stieg, das er in zweiter Reihe geparkt hatte.
Schließlich setzte sich Finn zögernd in Bewegung. Er hatte Angst, dass ihn der Cop durch die ganze Stadt verfolgen würde.
Aber so weit musste er nicht laufen. Nach etwa zehn Minuten hatte er seinen Wagen gefunden. Er glitt hinters Steuer und machte sich auf den Weg zum Highway. Leider landete er auf dem US-1 statt auf der Interstate 95, doch nach ein paar Minuten sah er ein Hotel auf einer kleinen Anhöhe.
Zum Teufel, die Nacht war fast schon vorbei, und mittags musste man sein Hotelzimmer räumen. Trotzdem – es hatte ihm einen ziemlichen Schrecken eingejagt, mitten auf der Straße aufzuwachen. Er brauchte wirklich ein ordentliches Bett.
Im Zimmer fiel er sofort auf die Matratze. Er machte sich nicht einmal die Mühe, sich auszuziehen. Innerhalb weniger Minuten schlief er wie ein Stein.
Als er aufwachte, war die Welt wieder in Ordnung. Er war froh über das Hotel, über die Dusche und einen Klamottenwechsel. Und froh, weil Maine zwar noch immer ziemlich weit weg war, er aber am Abend dort sein würde, bei Megan. Und dann musste er sie nur noch von der Wahrheit überzeugen: Er liebte sie mehr als sein Leben. Er brauchte sie. Und sie brauchte ihn.
Er wusste, dass auch sie ihn liebte, dass ihre Beziehung voller Leidenschaft war und sie vieles teilten, wofür es sich lohnte, zu kämpfen. Am ehesten würde er Megan zurückgewinnen, wenn er ihr sagte ...
Was zum Teufel sollte er ihr sagen?
Selbst in der Mittagspause, die er einlegte, grübelte er über diese Frage nach. Eigentlich dachte er auf der ganzen Fahrt die Küste entlang an nichts anderes.
Bei der Ankunft am Haus ihrer Eltern hatte er sich die passenden Worte zurechtgelegt. Megan war im Garten, sie saß auf einer Schaukel.
Als sie ihn bemerkte, glitt sie herunter, doch dann blieb sie wie versteinert stehen. Ihr blondes Haar schimmerte im Mondlicht, und ihre blauen Augen sahen aus wie die eines Rehs, das plötzlich vom Scheinwerferkegel eines Autos erfasst wird.
Alles, was er sich zurechtgelegt hatte, war wie weggeblasen. Wortlos ging er zu der Gestalt, die reglos dastand, wie hypnotisiert. Er nahm sie in die Arme. Sie war ziemlich lange starr, doch dann schien sie richtig zu schmelzen.
»Du bist hergefahren? Den ganzen Weg? Um mich zu sehen?«
»Um dich zu holen«, entgegnete er kurz und bündig.
»Und was ist, wenn ich Nein sage?«
»Das werde ich nicht zulassen, Megan. Ich habe dir viel zu sagen.«
»Ich auch, Finn, aber ... wir haben noch jede Menge Zeit zum Reden. Später.«
Sie schmiegte sich noch enger an ihn. Geballte Spannung und Hitze schlugen ihm entgegen, ihm war, als würde er in flüssiges Feuer getaucht. Er erbebte von Kopf bis Fuß. Seine Stimme wurde ganz rau.
»Was ist mit deinen Eltern?«
»Auf einem Wochenendausflug«, wisperte sie.
Sie zitterte. Er hob sie hoch und trug sie ins Haus.
Erst viele Stunden später redeten sie.
Und irgendwie fand er die richtigen Worte.
In Boston war der Tag herrlich gewesen.
Kristallblauer Himmel, wunderschön.
Ein Samstag. Kinder bevölkerten die Parks. In Little Italy wurde überall Boccia gespielt. Touristen strömten durch die Faneuil Hall und standen Schlange vor dem Geburtshaus des amerikanischen Freiheitskämpfers Paul Revere. September und Oktober brachten einen steten Strom an Menschen nach Neuengland und vor allem nach Beantown, wie Boston im Volksmund hieß, aber auch an die nördliche Küste und weiter hoch. Das Herbstlaub war wie ein hell leuchtendes Signalfeuer, eine wahre Augenweide.
Langsam brach die Nacht herein, es war zwar kühl, aber nicht richtig kalt – einfach angenehm. Samstagabend war die Zeit, in der es sich Paare wie Alleinstehende gut gehen ließen. Familien gingen zum Essen, die Klubs hatten lange geöffnet.
Der Sonntag kam und ging.
Alles in allem war es ein ruhiges Wochenende für eine Großstadt, in der es wie in allen Großstädten natürlich auch Verbrechen gab.
Erst am Dienstagmorgen, als Theresa Kavanaugh den zweiten Tag in der Arbeit fehlte, meldete man sie als vermisst.
Alle möglichen Leute wurden befragt, doch seit sie Freitagnacht die Bar verlassen hatte, war sie von niemandem mehr gesehen worden.
Sie hatte mit einem Mann am Billardtisch geflirtet.
Seltsamerweise konnte ihn niemand näher beschreiben.
Nichts wies darauf hin, dass sie in ihre Wohnung zurückgekehrt war. Aber auch auf dem Weg von der Bar zu ihrer Wohnung deutete nichts auf ein Gewaltverbrechen hin.
Es gab keine Hinweise, nichts.
Es war, als hätte sie sich in Luft aufgelöst.
Wie jährlich Hunderte, ja Tausende junger Frauen im ganzen Land war Theresa Kavanaugh einfach verschwunden.
Sie war über einundzwanzig, also erwachsen. Vielleicht hatte sie beschlossen, einfach zu verschwinden. Das Recht dazu hätte sie gehabt.
Ihre Kolleginnen spekulierten, was wohl aus ihr geworden war.
Keine konnte sich näher an den Mann vom Billardtisch erinnern. Alle wussten nur eines: Er hatte verdammt gut ausgesehen, ja, richtig ... teuflisch aufregend.
Kapitel 1
Megan schrie. – In der schrecklichen Wirklichkeit, die sie umfing, hörte sie sich schreien.
In der Dunkelheit stieg eine Angst in ihr auf, die sie zu überwältigen, zu ersticken drohte. Eine düstere Gestalt betrat den Raum und sie fühlte sich entsetzlich ausgeliefert. Adrenalin strömte durch ihre Adern, Verzweiflung ergriff sie, und sie wusste, dass sie handeln und um ihr Leben kämpfen musste.
Das Geräusch hielt an, sie hörte sonst nichts, sie schrie und schrie im Bewusstsein der tödlichen Bedrohung. Und noch eines wusste sie: Sie hatte irgendetwas gesagt oder getan, um all das herbeizuführen. Es kam ihr alles bekannt vor – die Gestalt, die erschien, die Angst, das schreckliche Wissen darum, was als Nächstes kommen würde. Sie fühlte die Gewalt, die von ihm ausging, seine Berührung auf ihrem Haar, auf ihren Kleidern; die Schläge, als sie sich wehrte; die Hände um ihren Hals ...
Gesichtslos – er war gesichtslos. Aber sie kannte ihn, sie kannte ihn ganz bestimmt.
Sie kannte seine Hände. Zuerst legten sie sich um ihren Hals, dann drückten sie sie nach unten. Sie wusste, dass sie sterben würde. Sie wusste nur noch nicht, wie. Würden diese kräftigen Hände das Leben aus ihr pressen, oder wollten sie sie nur bezwingen? Würde es ein Messer geben, eine Klinge, die ihr den Hals aufschlitzte und das Blut spritzen ließ?
Egal – es würde passieren, und sie wusste es. Noch immer konnte sie sein Gesicht nicht sehen, sie sah nur Dunkelheit. Und plötzlich vernahm sie andere Geräusche, ein leises Flüstern hinter ihrem Kreischen, ein Summen, Stimmen, viele Stimmen.
Wispern, Lachen.
Unheimliches Lachen, böses Lachen ...
Sie schrie noch lauter, kämpfte noch heftiger. Jetzt kämpfte sie nicht nur verzweifelt um ihr Leben; nein, sie wollte auch diese spöttischen Laute ersticken, die bis in ihre Seele zu dringen schienen, sich um ihre Seele legten und das Leben aus ihr herauspressen wollten, wie es die Hände mit ihrem Körper versuchten.
Sie trat um sich.
Sie versuchte weiterzuschreien, aber ihr Atem reichte nicht mehr, sie brachte keinen Laut mehr zustande, keine Luft drang mehr in ihre Lunge.
Nur ihr Puls, das Hämmern ihres Herzens ...
Kämpf weiter! Kämpfe! Selbst als eine Finsternis, dunkler als die Nacht, sich vor ihre Augen legte. Tritt, kratze, kämpfe! Pack diese Hände!
Die Hände ... die nachgaben, als sie ihre Nägel tief darin vergrub.
Schreie, noch immer laute Schreie.
»Megan! Herr im Himmel, so hör doch auf! Megan!«
Wieder legten sich Hände auf ihre Schultern und schüttelten sie. Sie schlug danach, fest, verzweifelt.
»Megan! Verflixt noch mal, Megan! Wach auf!«
Verblüfft schlug sie die Augen auf. Noch immer hörte sie ferne Schreie, aber sie stammten von ihr.
»Megan!«
Finn saß rittlings auf ihr. Mit der Rechten umklammerte er ihre Handgelenke, mit der Linken rieb er sich das Kinn. Er starrte auf sie herab. Seine Augen blitzten wie Messerstahl, sein Gesicht war aschfahl.
»Megan! Was zum Teufel ist los mit dir?«
Sie hörte abrupt zu schreien auf.
Sie wurde aus der unglaublichen Realität ihrer Traumwelt in die Wirklichkeit zurückgeholt. Und im wirklichen Leben lag sie im Bett einer ruhigen kleinen Pension, die sich in einem ruhigen, historisch bedeutsamen Ort befand, der nur im Oktober etwas belebter war.
»Firm! Oh mein Gott, Finn!«
Sie versuchte, sich aus seinem Griff zu befreien.
»Willst du mir noch einen Kinnhaken verpassen?«
»Das habe ich nicht getan!«
»Doch.«
»Es tut mir schrecklich leid. Bitte ...!«
Er ließ sie frei. Sie schlang die Arme um seinen Nacken. Sie zitterte, am liebsten hätte sie hemmungslos geweint.
Ein Traum, es war doch nur ein Traum gewesen.
Er schob sie nicht weg, aber seine Schultern waren steif wie ein Brett. Als sie sich zurückzog, lag ein wachsamer, distanzierter, vorwurfsvoller Blick in seinen zusammengekniffenen grünen Augen.
»Megan, du meine Güte, was war denn das?«
»Ich hatte einen grauenhaften Albtraum.«
»Einen Albtraum? Und dabei musstest du schreien, als wären dir tausend Bluthunde auf den Fersen? War es denn so schlimm?«
In diesem Moment pochte es lautstark an der Tür.
Megan biss sich auf die Unterlippe und zuckte zusammen. Finn sprang auf und schlüpfte in den Frotteemantel, den sie auf den Boden hatte fallen lassen.
Er machte die Tür auf. Vom Bett aus sah Megan den schwach beleuchteten Gang und Mr Fallon, den Verwalter und Mann für alles in Huntington House. Er stand auf der Schwelle und musterte Finn grimmig.
»Was geht hier vor, Mr Douglas?«, fragte er streng.
»Tut mir leid, offenbar hatte Megan einen Albtraum«, erklärte Finn.
Mr Fallon musterte Finn von oben bis unten. Es war ihm anzumerken, dass er Finn kein Wort abnahm. Er sah vielmehr aus, als überlege er, die Polizei zu rufen und ihn wegen häuslicher Gewalt anzuzeigen.
»Es klang eher so, als würde hier jemand ermordet«, meinte Fallon.
Megan konnte nicht vortreten und alles erklären – sie lag nackt im Bett. Deshalb rief sie mit schwacher Stimme: »Es geht mir gut, Mr Fallon, glauben Sie mir. Ich hatte nur einen grässlichen Albtraum. Es tut mir wirklich sehr leid.«
»Na gut – zum Glück übernachten Sie in diesem Flügel. des Hauses«, entgegnete Fallon schroff. »Sonst hätten Sie mit diesem Geschrei das ganze Haus aufgeweckt. Haben Sie öfter solche Albträume, junge Frau?«
»Nein, nein, natürlich nicht!«, versicherte Megan.
»Wie Sie sehen, ist hier alles in bester Ordnung«, erklärte Finn gereizt.
»Eigentlich kann ich nicht viel sehen, es ist ja stockfinster. Aber in Huntington House können wir keine Gäste brauchen, die streiten. Hier nicht, wir sind ein gutes Haus mit einem guten Ruf.«
»Selbstverständlich«, sagte Finn.
»Und die Merrills haben in dieser Gegend auch einen Ruf«, meinte Fallon, auf Megans Familie anspielend.
Sie wusste nicht, ob ihre Familie hier einen guten oder einen schlechten Ruf hatte.
»Es tut mir wirklich leid, Mr Fallon. Ich glaube, vor dem Einschlafen sind mir einfach zu viele Geschichten im Kopf herumgegangen.«
»Hm.«
»Ich hatte einen Albtraum«, erklärte Megan noch einmal mit festerer Stimme. Plötzlich war ihr Mr Fallon zuwider, denn auf einmal war sie sich sicher, dass er von der Familie Merrill wenig hielt.
»Sehen Sie zu, dass Sie etwas leiser sind«, meinte Fallon. »Keine derartigen Ausbrüche mehr, Sir!« Der erste Satz war an Megan gerichtet, der zweite eindeutig eine Warnung an Finn.
»Gute Nacht«, sagte Finn.
Fallon nickte und ging, wenn auch zögerlich.
Finn machte die Tür zu. Jetzt, wo das Nachtlicht aus dem Gang nicht mehr hereinfiel, war es wieder ganz dunkel im Raum. Doch gleich darauf drückte Finn den Lichtschalter neben der Tür. Er lehnte sich an die Tür, verschränkte die Arme und starrte auf Megan.
»Er denkt, ich habe dich geschlagen.«
»Oh, Finn, das kann doch nicht ...«
»Jeder weiß, dass wir erst seit Kurzem wieder zusammen sind.«
»Das ist doch lächerlich. Fallon weiß doch überhaupt nichts von uns.«
»Na ja – von deiner Familie scheint er eine ganze Menge zu wissen, und deshalb weiß er wahrscheinlich auch, dass wir erst seit Kurzem wieder zusammen sind. Und jetzt glaubt er bestimmt, dass du irgendwas falsch gemacht hast und ich dir den Hals umdrehen wollte, bevor er hereinkam.«
»Finn, hör auf! Es ist bestimmt schon mal jemand schreiend in seiner Nähe aufgewacht, weil er einen Albtraum hatte.«
»Glaubst du? Ich bin noch nie neben einer Frau aufgewacht, die so laut schrie, dass mir fast das Trommelfell geplatzt wäre.«
»Himmel noch mal, Finn! Ich habe doch schon gesagt, dass es mir leidtut. Ich habe es nicht absichtlich getan. Ich hatte einen Traum, einen absolut grässlichen Albtraum. Jemand wollte mich töten!«, sagte sie. Verwundert stellte sie fest, dass wieder Angst in ihr aufstieg und jedes weitere Wort zu ersticken drohte. »Wie wär's mit ein wenig Mitgefühl?«
Er stand noch immer an der Tür und starrte sie an. Selbst in diesem lächerlichen, viel zu kleinen Frotteebademantel, der seine langen, unter dem weißen Saum hervorragenden Beine noch länger wirken ließ, liebte sie ihn über alle Maßen, von seinem verwuschelten Haar bis zu den nackten Füßen. Doch zwischen ihnen war alles noch etwas wackelig. Früher hätte sie sich unverzüglich in seine Arme geworfen. Aber jetzt ...
Es war erst einen Monat her, dass er die Ostküste hoch bis nach Maine gefahren war, um alles auf eine Karte zu setzen und sie bei ihrer Familie abzuholen.
»Finn!«, sagte sie noch immer ziemlich erschüttert, doch. allmählich auch etwas verärgert.
»Entschuldige, aber du hast mir fast den Kiefer ausgerenkt, Megan.«
»Kapierst du es nicht? Ich habe tief und fest geschlafen. Ich hatte einen Albtraum, der mich in Angst und Schrecken versetzt hat.«
In seiner Wange zuckte ein Muskel. Trotz seines wirren Haars und des lächerlichen Morgenmantels wirkte er mit den vor der Brust verschränkten Armen ebenso imposant wie anziehend. Sie liebte sein Gesicht. Es war nicht beeindruckend schön, sondern eher klassisch männlich: ein markantes Kinn, ausgeprägte, hohe Wangenknochen, ein voller, sinnlicher Mund, eine kerzengerade, aristokratische Nase, nicht zu groß, nicht zu klein. Dunkelgrüne Augen unter einer breiten Stirn, volles, dunkles Haar. Er hatte einen athletischen Körper und war immer in Form, egal, in welcher Lebenslage. Sie kamen gerade aus Florida, wo sie eine Woche Urlaub gemacht hatten; deshalb war er von Kopf bis Fuß gebräunt und umso attraktiver.
Sie drehte sich zur Seite und wandte den Blick von ihm ab. Kurz darauf saß er neben ihr und streichelte ihr sanft über den Rücken. »Also gut, Megan – es tut mir leid.«
»Wahrscheinlich waren es die Geschichten am Kaminfeuer«, murmelte sie, noch immer ein wenig verärgert. Aber sie wollte jetzt nicht weiter mit ihm streiten.
Doch damit hatte sie wohl das Falsche gesagt. »Du kommst doch aus dieser Gegend«, entgegnete er und schnaubte leicht verächtlich. »Du hast hier eine Menge Verwandte. Wie kannst du dich da von Geschichten über Salem so verschrecken lassen?«
»Es waren andere Geschichten, es ging nicht direkt um Salem, vor allem nicht um das historische Salem«, meinte sie.
»Ah ja! Demnächst ist Halloween, aber das ist ja eigentlich ein uralter keltischer Feiertag, Halloween, und das Böse ist etwas, das wächst und von der Atmosphäre genährt wird. Und es ist an Orte gebunden, an denen Menschen Grausames angetan wurde. Hör doch auf mit diesem Quatsch, Megan! Denk doch nur an die Geschichte der Menschheit, dann weißt du, dass das Böse überall sein kann.«
»Ja, ja, du hast ja recht«, erwiderte sie steif.
»Andererseits haben wir bald Vollmond, und der Nebel wird wabern, und es gibt auch heute noch Menschen, die an die dunklen Mächte glauben und Tote aus ihren unheiligen Gräbern auferstehen lassen wollen; Leute, die die dunklen Winde des Bösen freisetzen wollen, um die Welt in Angst und Schrecken zu versetzen.«
Sie richtete sich auf. Plötzlich hatte sie das Gefühl, sich verteidigen zu müssen. »Finn, Salem ist heute ein hübscher Ort. Hier leben Leute, die sich über Hexerei lustig machen, aber auch solche, die ihre Wicca-Lehre für eine echte Religion halten. Es gibt putzige Läden, die nicht schlecht von der Geschichte leben, und tolle Restaurants, bei denen die Geschichte keine Rolle spielt. Es ist traurig, aber wahr – die Menschen, die hier früher verfolgt wurden, haben bestimmt nicht die Verbrechen begangen, die man ihnen zuschrieb. Aber weißt du was: Es gab immer Leute – und vielleicht gibt es sie auch heute noch –, die an Hexerei glaubten, oder vielleicht nicht an Hexerei, sondern an Satanismus oder wie man das auch immer nennen will. Und diese Leute begehen schlimme Verbrechen im Namen ihres Glaubens. Verflixt noch mal, Finn, denk doch mal darüber nach! Gibt es dort draußen auch heute noch schlechte Menschen? Natürlich, davon bin ich felsenfest überzeugt. Also habe ich mir Geschichten angehört, die vom Bösen in den Herzen der Menschen handeln und über Menschen, die an die Mächte der Finsternis glauben, und von seltsamen Dingen, die nachts passieren; und dann habe ich einen schlimmen Traum gehabt. Ist das denn so unverständlich oder unverzeihlich?«
Er legte sich wieder hin und verschränkte die Hände hinter dem Kopf. »Und du hast eine Cousine, die einen Laden mit Hexenartikeln hat.«
»Morwenna ist nicht böse.«
»Das habe ich auch nicht behauptet.«
»Dem Wicca-Kult anzuhängen ist heute völlig legal. Im siebzehnten Jahrhundert war Hexerei illegal.«
»Stimmt.«
»Morwenna glaubt an die Erde und an die Natur. Sie glaubt daran, dass man seinen Mitmenschen Gutes tun soll, vor allem, weil jeder böse Gedanke und jede böse Tat dreifach auf einen Wicca zurückfällt.«
»Und ihr einschüchternd großer, dunkler, unheimlicher, handlesender Ehemann Joseph ist eine verdammte Stütze der Gesellschaft?«, fragte er sarkastisch.
»Warum streiten wir uns über meine Cousine und ihren Mann?«, gab sie ziemlich verzweifelt zurück.
»Weil ich allmählich glaube, dass es ein großer Fehler war, hierherzukommen«, erwiderte er.
»Du wolltest es«, erinnerte sie ihn barsch. »Du meintest, es sei wichtig für deine Karriere.«
»Ich dachte nicht, dass du nach Hause kommst und zu einer kreischenden Harpyie wirst.«
Sie drehte ihm wieder den Rücken zu, so gekränkt, dass sie gar nicht wusste, wie sie es ihm sagen sollte. Ein Fehler? War alles ein Fehler gewesen?
Sie hatte sich auf den ersten Blick in Finn verliebt, gleich an ihrem ersten Tag auf dem College. Noch nie war sie so verliebt gewesen. Sie hatte ihn geradezu schamlos verfolgt. Doch das war in Ordnung gewesen, denn er war genauso in sie verliebt. Nach wenigen Tagen dachte sie kaum noch ans Studium, sie war nur noch von dem Bestreben, ja von richtiger Verzweiflung erfüllt, mit ihm zusammen zu sein. Immer wieder hatten sie ihre Freunde versetzt, um die kostbare Zeit gemeinsam zu verbringen. Am Anfang hatte es keine Meinungsverschiedenheiten gegeben. Na ja, eigentlich redeten sie zu wenig, um sich zu streiten; sie wollten nichts weiter, als sich zu berühren, als nackt und eng umschlungen dazuliegen, als sich zu lieben. Das Feuer der Leidenschaft war so stark gewesen, dass sie jeden Rat in den Wind geschlagen und schnell geheiratet hatten. Im engsten Familien- und Freundeskreis waren sie in einem kleinen Ort in Georgia getraut worden. Ein paar Jahre hatten sie in der Glückseligkeit der Jungen und Unschuldigen gelebt. Finn schloss sein Studium ab, die Stipendien und die studentischen Arbeitsmöglichkeiten versiegten. Megan hatte noch zwei Jahre vor sich. Das Geld wurde knapp, Musikzubehör war teuer. Sie begannen zu streiten. Womit ließ sich Geld verdienen und womit nicht? Was war gut, was nicht? Die Unterschiede zwischen ihnen, die anfangs nur den Reiz erhöht hatten, wurden zu Reibungspunkten. Megan hatte immer irgendwelche Vorahnungen und Eingebungen, er war durch und durch nüchtern. Sie stammte aus Massachusetts, und abgesehen von ihrer anfänglichen, vorbehaltlosen Bewunderung für ihn neigte sie wie die meisten Leute aus Neuengland eher zur Zurückhaltung. Finn stammte aus dem tiefen Süden, er war stets bereit, sich auf Abenteuer einzulassen und jedem alles zu geben, was sie hatten. Sie war immer eine gute Tochter und eine gute Studentin gewesen, er war alles andere als ein Musterknabe; in der Highschool hatte er ab und zu eine Zwangspause einlegen müssen, weil er in irgendwelche Schlägereien verwickelt gewesen war; und aufs College hatte er es nur mit knapper Not dank eines Musikstipendiums geschafft, das er erhalten hatte, weil er ausgesprochen musikalisch war.
Sie war ihren Eltern immer sehr nah gestanden, seine Eltern waren geschieden und mit neuen Partnern verheiratet. Einmal im Monat telefonierte er mit seiner Familie, was ihm stets ziemlich schwerfiel, und seinen kleinen Halbgeschwistern schickte er ab und zu eine Postkarte oder ein kleines Geschenk, aber Besuche fanden nur selten statt. Finn hasste seinen Stiefvater und ertrug seine Stiefmutter nur mit Mühe. Er war gleich nach der Highschool ausgezogen.
Dann starb sein Vater an einem Herzinfarkt. Finn war hin- und hergerissen zwischen Wut, dass er im Testament überhaupt nicht bedacht worden war, und Schuldgefühlen, dass er sich unabhängig von seiner Abneigung gegen seine Stiefmutter nicht um mehr Kontakt bemüht hatte. Gerade als Megan dachte, jetzt würde er sie am meisten brauchen, fing er an, immer öfter auszugehen und immer mehr auswärtige Jobs anzunehmen. Eifersucht und Misstrauen breiteten sich aus – die kleinen Feinde, die sich verbünden, um eine Beziehung zu zerstören. Dann keimten Zweifel und Wut auf. Der letzte qualvolle Tropfen, der für Megan das Fass zum Überlaufen brachte, war die Flötistin, die Finn in die Band aufnahm, mit der sie auftraten, wenn sie nicht als Duo arbeiteten.
Sie ging nicht sofort weg, sie liebte ihn noch immer zu sehr. Und Streit ließ sich so einfach beilegen. Wut war ein so kraftvolles Gefühl, und so ließen sich die Streitigkeiten ohne viel Mühe beenden, indem man der Hitze und dem Adrenalin nachgab und zusammen ins Bett ging – nur um später aufzustehen und festzustellen, dass nichts gelöst war.
Zum Schluss reichten die Zweifel zu tief. Megan wollte sich den letzten Rest Selbstachtung bewahren und ihre Hoffnung auf eine eigene, erfüllende Karriere nicht zerschlagen lassen, indem sie in den Hintergrund trat und auf ganzer Linie nachgab. Sie stritten, wobei sie diesmal so aufgebracht war, dass sie ihm schließlich ein Baguette auf den Kopf schlug. Der Streit fand auf dem Balkon statt, und die Nachbarn bekamen alles mit. Beim Weitererzählen wurde aus dem Baguette eine Weinflasche; manchen Geschichten zufolge hatte sie Finn geschlagen, anderen zufolge er sie. Gerüchte verbreiteten sich, was Finn stinksauer machte; er beschäftigte sich mehr mit dem Gerede als mit Megan, bis sie ihn schließlich verließ.
Aber eigentlich konnte sie Finn nicht richtig verlassen. Sie liebte sein Aussehen, wie er sich anfühlte, seine angenehm tiefe Stimme, sein fröhliches Lachen, wie gut er roch. Ihre Familie lebte inzwischen in Maine, sie ging heim und fand Arbeit bei einem alten Bekannten, einem Gitarristen. Sie spielten Folkmusik und Rockballaden in Bistros und Cafés. Viel Geld sprang dabei nicht heraus, aber die Arbeitszeiten und die Vergünstigungen waren nicht schlecht – herrlicher Kaffee, gutes Essen und Zeit, um Lieder zu texten, eine Arbeit, der ihre wahre Liebe und Leidenschaft galt – was das Arbeiten anging. Das Leben bei ihren Eltern war unkompliziert. Sie hatten ein großes Haus in Maine, und Megan hatte einen ganzen Teil des Hauses für sich, eine Remise, aus der eine wundervolle Wohnung entstanden war.
Sie war ein halbes Jahr weg gewesen und hatte immer wieder überlegt, ob sie die Scheidung einreichen sollte. Als sie dann wieder ein Paar wurden, war er leidenschaftlich und aufrichtig, er vergaß seinen Stolz völlig. Zwischen ihm und der Flötistin war nie etwas gelaufen, und auch mit keiner anderen Musikerin, mit keiner anderen Frau, Punktum. Er konnte ohne sie nicht leben, und er wollte, dass sie zu ihm zurückkehrte.
Sie war auf der Stelle dahingeschmolzen. Sie warf sich ihm in die Arme und hätte ihn am liebsten an Ort und Stelle ausgezogen. Seitdem hatten sie über alles geredet, und sie fühlte sich geborgen und geliebt. Sie waren nach New Orleans zurückgekehrt, und Megan war sich noch keiner Entscheidung in ihrem Leben so sicher gewesen. Sie liebte Finn und würde ihn immer lieben.
Dennoch wäre es ihr lieber gewesen, sie hätte ihn hier, in Salem, mit ihrem Albtraum verschont. Trotz ihrer tiefen Verbundenheit war die Episode mit dem Baguette noch nicht vergessen. Sie hatten sich zwar alles verziehen, dennoch lastete die Erinnerung auf beiden.
Erstaunlich, dass ein Gerücht so weit reisen konnte, bis nach Massachusetts. Hierher, wo alle sie kannten, sie und ihre Familie.
Eigentlich war sie nicht in Salem aufgewachsen, sondern in Marblehead, ganz in der Nähe. Obgleich sie gerne ihre Verwandten besuchten, waren sie nicht aus diesem Grund hier. Finn war eines Tages heimgekommen und hatte ihr von einem äußerst lukrativen Angebot berichtet: Sie sollten eine Woche lang in einem neuen Hotel in Salem auftreten, in der Woche vor Halloween. Ein gewisser Sam Tartan, Leiter der Abteilung für Unterhaltung und Öffentlichkeitsarbeit des Hotels, hatte einen Artikel über sie gelesen und hielt sie für bestens geeignet.
Finn war anfangs etwas skeptisch gewesen, er wollte sicher sein, dass nicht Megans Familie das Angebot eingefädelt hatte.
Aber das war nicht der Fall gewesen. Megans Eltern hatten noch nie von einem Sam Tartan gehört. Als Megan unter fremdem Namen im Hotel anrief und sich nach Sam Tartan erkundigte, wurde ihr erklärt, dass der Leiter der Hotelunterhaltung irgendwo aus dem Mittleren Westen stammte.
Die Gage war wahrhaftig beeindruckend, und das Prestige eines solchen Solo-Auftritts war verlockend. Aufgeregt hatten sie das Angebot angenommen.
Davor hatten sie sich noch einen kleinen Urlaub in Florida gegönnt, sie wollten ihre Flitterwochen nachholen. Erst das sonnige Florida, dann das schaurige alte Salem. In ihrer Abwesenheit hatten die Handwerker Zeit, ein paar Kleinigkeiten in ihrer Wohnung im French Quarter zu reparieren. Es schien alles perfekt. Vielleicht war Finn nicht klar gewesen, wie weit sich die Gerüchte schon verbreitet hatten und dass ihre Verwandten ihn anstarren und überlegen würden, ob er ein prügelnder Ehemann war und ob sich Megan nicht besser möglichst fern von ihm halten sollte.
Sie drehte sich zu ihm um und wollte ihn um Verzeihung bitten. Sie wünschte, sie hätte dieses Baguette nie angefasst.
Zu ihrer Überraschung schlief er schon. Seine Augen waren geschlossen, die Lippen leicht geöffnet, und er atmete tief und regelmäßig.
»Finn?«
Keine Antwort.
Megan schlüpfte aus dem Bett. Auch dadurch wachte er nicht auf. Verwundert runzelte sie die Stirn. Sie trat an den großen, dick gepolsterten antiken Sessel am Kamin und zog ihren Morgenmantel an. Dann schob sie die Vorhänge an der Balkontür zurück und trat nach kurzem Zögern hinaus.
Oktober in Massachusetts. Eine kühle Brise wehte, aber es war nicht ungemütlich kalt. Der Himmel war wunderschön und ein bisschen seltsam, tiefdunkel, an manchen Stellen fast schwarz, an anderen hell und fast durchsichtig. Unten auf der Straße hatte sich Nebel gebildet, und Megan musste an die Worte des verrunzelten Alten denken, der am Abend in einer Bar in der Stadt vor dem Kamin seine Geschichten zum Besten gegeben hatte.
Ja, höchstwahrscheinlich waren die, die man damals festgenommen, aufgehängt oder erstickt hatte, wie den alten Giles Corey, völlig unschuldig. Doch vielleicht waren die alten Hüter des Gesetzes nicht so töricht in ihrer Angst vor dem Bösen, auch wenn ihre Methoden, es aufzuspüren, töricht waren. Denkt doch nur, Freunde: Wenn es das Gute gibt, gibt es auch das Böse, und das Böse ist tief in der Geschichte der Menschheit verwurzelt. Zu allen Zeiten gab es Geschichten über Menschen und Monster und über Geschöpfe, die wohl dazwischen anzusiedeln sind. So wie es Engel gibt, gibt es auch Teufel. Es gibt die Bibel, aber auch Werke teuflischen Wahns. Zu allen Zeiten haben Menschen nach den Geheimnissen des Teufels getrachtet, nach Geheimnissen von Geschöpfen und Dämonen aus dem Jenseits, von wilden Wesen, an die wir uns nur in den tiefsten und dunkelsten Winkeln unseres Herzens erinnern. Es heißt, dass an Halloween, der Nacht vor Allerheiligen, die Toten aus ihren Gräbern steigen ... vor allem, wenn sie gerufen und aufgefordert werden, aus den Feuern der Hölle zur Welt hinaufzusteigen und sich in das Leben und die Seelen der Lebenden einzunisten.
An dieser Stelle war ein dickes Scheit im Kamin zerborsten; die Hälfte der Zuhörer war laut schreiend aufgesprungen, dann hatten alle gelacht. Auch Megan war es so ergangen. Sie hatte nicht geglaubt, dass sie in ihrem Pensionszimmer vom Bösen träumen und laut schreien würde.
Der Nebel zu ihren Füßen wirkte bläulich. Er schien herumzuwirbeln, Schwaden zu bilden, sich zu bewegen, als sei er lebendig.
Sie hatte keine Angst vor Nebel.
An ihrem Nacken spürte sie etwas, Finger berührten sie sacht, hoben ihr Haar hoch, ganz sanft. Sie schloss die Augen und lächelte.
Finn war wach. Er stand hinter ihr.
Das war sein Ritual. Er kam oft zu ihr, stand ganz still, berührte ihr Haar, hob es hoch, presste die Lippen auf ihren Nacken. Sie spürte, wie er sie berührte. Seine heißen, feuchten Lippen, die warme, erregende Schwüle seines Atems – gleich würde er die Arme um sie schlingen und ihr sagen, dass er sie liebte. Und wie sie Finn kannte, würde er dann seine Hüften an sie pressen und ihr ins Ohr flüstern, dass er, falls sie schreien wollte, ihr einen guten Grund dafür liefern würde ...
Sie spürte seine Hände, die über den Frotteemantel strichen, darunterglitten, ihre nackte Haut berührten ...
Dann hörte er auf. Sie glaubte, seinen Atem zu hören, zu spüren, wie er wartete. Darauf, dass sie sich zu ihm umdrehen und in seinen Armen zerfließen würde, wie sie es immer tat.
»Finn ...«
Sie drehte sich um.
Er war nicht da.
Sie stand allein auf dem Balkon.
Plötzlich wurde der Wind kälter. Der unheimliche blaue Nebel stieg höher, er bewegte sich rasch, er stieg immer höher, als wolle er sie verschlingen.
Kapitel 2
In der Pension logierten noch zwei andere Parteien, ein Paar Mitte dreißig mit seinen Kindern, einem etwa zwölfjährigen Jungen und einem Mädchen um die zehn, und ein jüngeres Paar Ende zwanzig, Anfang dreißig ohne Anhang. Als Finn und Megan zum Speisesaal gingen, um zu frühstücken, überlegte Finn unwillkürlich, ob die anderen wohl Megans Schreie in der Nacht gehört hatten.
Offenbar war es so.
Das wurde Finn klar, sobald sie sich dem Speisesaal näherten. Drinnen wurde laut geplaudert, doch als er mit Megan hereinkam, erstarben die Gespräche auf einen Schlag, und alle sechs starrten sie an. Dann – wie auf ein Stichwort hin – starrte jeder der sechs auf seinen Teller, als habe er plötzlich ein ausgesprochen starkes Interesse an seinem Toast, dem Schinken, den Eiern oder den Cornflakes entwickelt.
»Die halten mich alle für einen gewalttätigen Ehemann«, flüsterte er Megan zu.
»Unsinn!«, entgegnete sie. Aber auch sie waren einen Moment lang erstarrt, und Megans Stimme klang unsicher.
»Na gut, stehen wir es durch«, murmelte er, drückte ihre Hand und zwinkerte ihr zu. Er wusste eigentlich gar nicht, warum ihn die ganze Sache so beschäftigte. Sie hatte einen Albtraum gehabt, sein Zorn war unberechtigt gewesen, und das wollte er heute unbedingt wiedergutmachen. Ein Teil des Problems war wohl, dass er Megan so sehr liebte, verzweifelt liebte. Vor einer Weile hatte er noch gedacht, er würde ihr keine Erklärungen liefern oder sie um Verzeihung bitten für etwas, das er nicht getan hatte. Aber jetzt war er anderer Meinung. Zwar fand er noch immer, dass sie ihm hätte vertrauen sollen, aber er sah auch ein, dass Zweifel und Probleme, über die man sich nicht aussprach, eine Ehe zermürben konnten. So weit wollte er es nie mehr kommen lassen.
»Guten Morgen!«, sagte er munter und trat mit Megan an der Hand an den großen, rechteckigen Tisch. Zwei Plätze waren frei für sie, und er rückte einen Stuhl für Megan zurecht. Mit einem etwas verlegenen Lächeln setzte sie sich.
»Morgen«, sagte die Frau Mitte dreißig. Finn hatte den Eindruck, dass ihr Mann sie unter dem Tisch am Bein anstupste.
Susanna McCarthy, Fallons weibliches Gegenstück – eine große, dürre Frau, ebenso mürrisch wie er –, kam mit einer Kaffeekanne herein und füllte wortlos ihre Tassen. »Wie wollen Sie Ihre Eier?«, fragte sie und beäugte die beiden, als müsse sie entlaufene Sträflinge bedienen.
»Ich hätte gern Rührei«, meinte Megan.
»Für mich bitte ein gewendetes Spiegelei«, sagte Finn, entschlossen, gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Außerdem wollte er das Eis am Tisch brechen, sollten die anderen doch denken, was sie wollten.
»Ich bin Finn, und das ist meine Frau Megan«, verkündete er. »Sie waren doch gestern Abend auch in der Hotelbar am Platz, wo der Alte seine Geschichten erzählt hat, oder? Ich habe Sie nur kurz im Foyer gesehen, aber wahrscheinlich besuchen wir alle dieselben Veranstaltungen.«
Es trat eine kurze Stille ein, dann meldete sich der Mann Ende zwanzig zu Wort. »Ich heiße John, und das hier ist meine Frau Sally. Ja, wir haben uns gestern Abend auch die Geschichten angehört.«
Sally, eine hübsche kleine Blondine, meinte: »Der Bursche hatte es ja wirklich drauf! An einer Stelle bin ich fast vom Stuhl gekippt.«
»Er war toll!«, meinte der kleine Junge. »Einfach toll. Manches ist natürlich nur Hokuspokus, so Zeug, das sie einem auch in einem Geisterhaus erzählen. Aber der Typ war wirklich gut.«
»Sehr gruselig«, pflichtete Megan ihm bei und lächelte ihn an. Sie konnte gut mit Kindern umgehen, sie sah ihnen immer direkt in die Augen und hörte ihnen aufmerksam zu. Finn war sich sicher, dass sie eines Tages eine wundervolle Mutter sein würde. Seiner väterlichen Qualitäten war er sich leider nicht so sicher.
»Hey«, meinte der Junge, »ich kann euch sagen, was ihr tun müsst, wenn ihr den Hokuspokus nicht mögt.«
»Joshua!«, mahnte seine Mutter. »Vielleicht wollen die beiden das ja selbst herausfinden.« Sie blickte von ihrem Sohn auf Finn und Megan. Allerdings wirkte sie so, als fühle sie sich dazu verpflichtet und sei nicht besonders glücklich darüber.
»Wir würden uns sehr gern seine Vorschläge anhören«, erklärte Megan ernsthaft.
»Aber Sie kommen doch von hier, oder?«, fragte der Vater.
»Ja, aus dieser Gegend«, räumte Megan ein. »Aber in meiner Kindheit gab es all die Museen und Veranstaltungen noch nicht. Viele sind eher jüngeren Datums.«
An diesem Punkt brachte sich Joshuas kleine Schwester, ein süßer Rotschopf mit ein paar Sommersprossen, in das Gespräch ein. »Stimmt, Mr Fallon hat gesagt, dass Ihre Familie schon lange hier wohnt. Aber wenn Sie über Geister und all so was Bescheid wissen, warum haben Sie dann gestern Nacht so geschrien?«
»Ellie!«, tadelte sie der Vater bestürzt.
Megan lachte, und ihr Lachen klang locker und echt, es verbreitete seinen Zauber wie immer. »Ellie, nur weil ich ein paar dieser Geschichten kenne, heißt das noch lange nicht, dass sie mir keine Angst machen. Du und dein Bruder, ihr seid wirklich ausgesprochen tapfer. Ich hingegen hatte gestern Nacht einen grauenhaften Albtraum, so schlimm, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen.« Sie sah die Eltern der beiden um Verzeihung heischend an. »Es tut mir sehr leid. Ich fürchte, ich habe alle aufgeweckt.« Sie schüttelte den Kopf. »Es war wirklich ein ganz grässlicher Traum.«
Offenbar glaubte man ihr, denn der Vater schien endlich etwas lockerer zu werden. »Na ja, in unserer letzten Pension haben uns Pfauen aufgeweckt. Ich bin übrigens Brad Elgin.«
»Und ich heiße Mary«, meinte seine Frau.
»Und ich ...«
»Du heißt Joshua, und das da ist Ellie«, beendete Megan den Satz für ihn. »Schön, euch kennenzulernen. Ja, ich komme aus dieser Gegend, aber hier verändert sich ständig etwas. Finn und ich sind also wirklich offen für ein paar gute Tipps. Außerdem ist Finn noch nie hier gewesen. Vielleicht hört er lieber auf eure Vorschläge, weil ich etwas voreingenommen sein könnte.«
»Na ja, immerhin bin ich hier schon mal durchgefahren«, warf Finn ein und sah Megan an. »Ich hatte mir in den Kopf gesetzt, in einem Stück von New Orleans nach Maine hochzufahren«, erklärte er den anderen. »Ich kannte die Strecke nicht und nahm ein paar falsche Abzweigungen. Schließlich bin ich in diesem Ort gelandet und habe hier zu Mittag gegessen.«
Megan grinste ihm zu. Im Allgemeinen hatte er einen ausgezeichneten Orientierungssinn. Es hatte sie amüsiert, dass er sich in Neuengland verfahren hatte, noch dazu auf dem Weg zu ihr.
Susanna kam herein und stellte wortlos die Teller mit Eiern, Schinken und Toast vor ihnen ab. Sie machte nicht einmal den Mund auf, als Finn sich bedankte. Erst als sie schon halb aus dem Zimmer war, drehte sie sich um und meinte: »Müsli und so weiter gibt's am Büfett.«
Nachdem sie weg war, herrschte noch eine Zeit lang Stille.
»Sie müssen mit Ihrem Mann unbedingt in das Museum neben dem Denkmal von Roger Conant, das ist das beste, das wir bislang gesehen haben«, meinte Sally schließlich munter und nahm den Gesprächsfaden wieder auf. »Darauf hatten wir uns gerade alle geeinigt, als Sie hereinkamen.«
»Genau«, meinte John zustimmend und drückte ihre Hand. »Und Brad, du meintest doch, die Kinder seien vom Dorf der Pilgerväter so begeistert gewesen.«
»Ja, das war echt cool«, stellte Joshua fest. »Und wissen Sie was? Wenn man mal hier ist, dann versteht man auch, warum die Leute aus Neuengland angeblich alle spinnen.«
»Joshua!«, stöhnte seine Mutter.
»Nein, so meinte ich das nicht«, beeilte er sich zu sagen, als ihm klar wurde, dass auch Megan aus Neuengland stammte. »Die Pilgerväter, das waren doch alles Puritaner, die durften nichts tun, weder singen noch tanzen oder Spaß haben und sich ganz normal benehmen. Sehen Sie sich doch nur all die Leute an, die gestorben sind, nur weil so eine Frau ein paar alte Geschichten erzählt hat. Ich meine, echt wahr, eine Menge Leute wurden gehängt, weil hier alle völlig verrückt waren. Das ist zwar über vierhundert Jahre her, aber es ist doch klar, dass die Leute hier – wie hast du's genannt, Mom, reserviert, oder? – ja, dass die Leute hier alle so reserviert sind, wenn ihre Vorfahren so durchgeknallt waren.«
»Joshua!«, stöhnte seine Mutter wieder. »Die junge Frau hier ist aus Neuengland.«
»Ja, ja, aber sie ist sicher nicht so reserviert und verrückt. Schließlich hat sie uns erklärt, dass sie einen Albtraum hatte.«
Mary wurde vor Verlegenheit rot wie eine Tomate.
Ungeachtet der mürrischen Serviererin hatte sich Finn bislang die Eier schmecken lassen, doch auf einmal verschlug es ihm den Appetit.
»Leute aus Neuengland können wirklich sehr reserviert sein«, erklärte Megan lächelnd. »Ach, übrigens – hier in Salem ist der Gallows Hill, der Galgenberg, wo die Verurteilten hingerichtet wurden. Und Richter Hathorne ist am Burial Point begraben. Daneben gibt es noch eine Reihe anderer Sehenswürdigkeiten. Aber die Leute, die in diese Sache verwickelt waren, stammten nicht nur aus dem Ort, der heute Salem heißt.