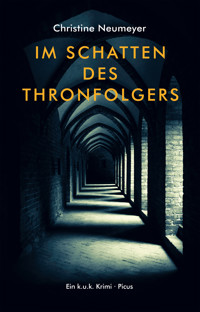Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Picus Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Polizeiagent Pospischil steht vor einem Problem: Zu einer Leiche fehlt ihm der Kopf – und er muss sich mit hochnäsigen Beamten aus dem Hofstaat des Thronfolgers herumschlagen. Wien im Herbst 1908: Während der Vorbereitungen zur Präsentation eines neuen Gemäldes von Gustav Klimt in der Modernen Galerie des Schlosses Belvedere – der berühmte »Kuss« – sorgt ein grausamer Mord für Aufregung. In den Brunnen des Schlossparks wird eine zerstückelte Leiche gefunden – jedoch ohne Kopf. Die Kriminalbeamten Pospischil und Frisch stehen vor schwierigen und heiklen Ermittlungen, denn das Schloss Belvedere ist die Residenz des Thronfolgers Franz Ferdinand. Welches Motiv steckt hinter einer derart brutalen Tat? Wie soll der Tote identifiziert werden – und vor allem: Wo befindet sich der Kopf? Ihre Spurensuche führt die Polizeiagenten zu den Bediensteten der Galerie, denn nur Amtssekretär Josef Krzizek und die Bedienerin Erna Kührer haben uneingeschränkten Zutritt zum Schlosspark …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 332
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Copyright © 2023 Picus Verlag Ges.m.b.H., Wien
Alle Rechte vorbehalten
Grafische Gestaltung: Dorothea Löcker, Wien
Umschlagabbildung: © Alexandre Cappellari / Arcangel Images
ISBN 978-3-7117-2136-5
eISBN 978-3-7117-5487-5
Informationen über das aktuelle Programm des Picus Verlags und Veranstaltungen unterwww.picus.at
CHRISTINE NEUMEYER
Der Kuss des Kaisers
EIN HISTORISCHER WIEN-KRIMI
PICUS VERLAG WIEN
INHALT
KAPITEL 1
KAPITEL 2
KAPITEL 3
KAPITEL 4
KAPITEL 5
KAPITEL 6
KAPITEL 7
KAPITEL 8
KAPITEL 9
KAPITEL 10
KAPITEL 11
KAPITEL 12
KAPITEL 13
KAPITEL 14
KAPITEL 15
KAPITEL 16
KAPITEL 17
KAPITEL 18
KAPITEL 19
KAPITEL 20
KAPITEL 21
KAPITEL 22
KAPITEL 23
KAPITEL 24
KAPITEL 25
DANKSAGUNG
DIE AUTORIN
KAPITEL 1
1. JUNI 1908
K. u. k. Amtssekretär Josef Krzizek war im Auftrag Seiner Majestät, des Kaisers von Österreich unterwegs. Er musste den Erwerb des neuen Gemäldes von Gustav Klimt, »Der Kuss«, in die Wege leiten, bevor Seine Hoheit, Thronfolger Franz Ferdinand von einer Ungarnreise nach Wien zurückkehrte. Heute bot sich eine günstige Gelegenheit. Hunderte Künstler, man beachte, ein Drittel davon Frauen, stellten zwischen Schwarzenbergplatz und Stadtpark in einem für die Kunstschau von Architekt Josef Hoffmann geplanten Areal von Pavillons, Höfen und Gärten ihre Werke dem Publikum vor. Der bekannteste unter ihnen war zweifelsohne Gustav Klimt. In wenigen Augenblicken würde der Meister die Eröffnungsrede halten.
Josef Krzizek war vorbereitet. Er hatte sich erkundigt. Dieser Klimt war ein interessanter Mann, konnte allein mit der Malerei sein Leben finanzieren. Viele Damen der jüdisch-bürgerlichen Gesellschaft ließen sich von Herrn Klimt porträtieren. Der kleine Skandal vor acht Jahren um die pikant freizügigen Frauenporträts für den Festsaal der Wiener Universität hatte dem Ansehen des Künstlers ebenso wenig geschadet wie die Verbreitung erotischer Studien unter den Ladentischen, für die er angeblich minderjährige Mädchen anheuerte. Dieser Gustav Klimt führte ein erstaunlich freies und unabhängiges Leben, wenn man den Klatschspalten in den Zeitungen glauben durfte. Tief durchatmend steuerte Krzizek auf den Eingang des Gebäudes zu. An der Tür blieb er stehen und betrachtete das Plakat zur Ausstellung. Ein Frauenkopf mit langen blond gewellten Haaren. Offenbar war das Motiv mit wenigen Strichen und Farbklecksen zu Papier gebracht worden. Was sollte er von dieser Art von Kunst halten? Ungern galt er als altmodisch, aber in Sachen Kunstgeschmack stand er dem Erzherzog Franz Ferdinand, der die Nase rümpfte bei allem, was als modern galt, näher als dem Kaiser. Krzizek schnalzte mit der Zunge. Wie auch immer. Er würde den Auftrag des Ministeriums vorschriftsmäßig ausführen. Das umstrittene Gemälde war schon so gut wie im Staatsbesitz. Er straffte die Schultern, richtete den steifen Hemdkragen und wischte mit dem Ärmel den Schweiß von der Stirn. Verdammt heiß war es in Wien für Anfang Juni. Entschlossen trat er in den kühlen Vorraum. Aufmerksam musterte er die Damen in langen, saumgebauschten Kleidern und ausladenden Hüten. Viele der Herren waren in Frack und Zylinder. Er selbst trug einen schlichten Gehrock. Schließlich war er im Dienst und nicht zum Vergnügen hier. Weiter ging es in den hellen, mit schwülem Damenparfum erfüllten Raum. Da trat der Meister in sein Blickfeld. Herr Klimt stach allein durch seine Körpergröße aus der Menge heraus. Mit unbedecktem Haupt unterhielt er sich mit einer Gruppe älterer Männer. Krzizek suchte sich ein ruhiges Plätzchen, um die Szenerie ungestört überblicken zu können. Niemanden aus dem Hofstaat konnte er entdecken, keine einzige blaue Uniform. Die Innenarchitektur des eigens für die Künstlergruppe um Klimt errichteten Gebäudes war für eine Veranstaltung im Jahr des Kaiserjubiläums auch kaum angemessen ausgestattet. Auf schlichten Wänden verloren sich blasse Blumenranken wie billige Bordüren auf einem Bauernkittel. Da fuhr ein ehrfürchtiges Raunen durch die Menge. Gustav Klimt trat an das Rednerpult.
»Wir sind keine Genossenschaft, keine Vereinigung, kein Bund«, begann Klimt, »sondern haben uns in zwangloser Form eigens zum Zweck dieser Ausstellung zusammengefunden, verbunden einzig durch die Überzeugung, dass kein Gebiet menschlichen Lebens zu unbedeutend und gering ist, um künstlerischen Bestrebungen Raum zu bieten, dass auch das unscheinbarste Ding, wenn es vollkommen ausgeführt wird, die Schönheit dieser Erde vermehren hilft, und dass einzig in der immer weiter fortschreitenden Durchdringung des gesamten Lebens mit künstlerischen Absichten der Fortschritt der Kultur begründet ist.«
Krzizek runzelte die Stirn. Wollte der Meister die ganze Welt mit seiner Kunst beglücken? Prüfend spähte er ins Publikum und staunte, wie andächtig die Leute der Ansprache lauschten. Zum Schluss bezeichnete Klimt die Ausstellung als Kräfterevue österreichischen Kunststrebens und als Präsentation der vielfältigen Kultur im Reich. Das gefiel ihm. Einer Förderung der Heimatliebe durch die Kunst stimmte er zu. Vielleicht wäre dieses Gemälde doch eine schöne Ergänzung zu den dunklen Landschaften der traditionellen Meister und den düsteren Porträts der Habsburger in der Galerie des unteren Schlosses, überlegte er. Gold war die Farbe der Sonne. Gold galt auch als Farbe der Macht, der Erhabenheit und der Würde. Möglicherweise sah dies auch der Thronfolger so und seine Sorge um die Intervention gegen den Ankauf war gänzlich unbegründet, sinnierte er weiter.
Freundlicher Applaus begleitete Gustav Klimt, als er vom Pult stieg und sich dem Publikum im Saal zuwandte. In diesem Moment trat Krzizek auf den Künstler zu, streckte sich und raunte dem groß gewachsenen Mann ins Ohr, dass er im Auftrag des kaiserlich-königlichen Kultusministeriums den Ankauf des Gemäldes heute abzuwickeln gedenke.
»Nach der Führung können wir im angrenzenden Verwaltungsraum verhandeln«, antwortete Klimt kühl.
Aha! Verhandeln will er, dachte der Amtssekretär und zwang sich zu einem gefälligen Lächeln. Keinesfalls wollte er dem Künstler durch seine Mimik verraten, dass das k. k. Ministerium für Kultus und Unterricht jeden Preis zu zahlen bereit war. Krzizek fühlte sich als beeideter Beamter der Sparsamkeit verpflichtet. »Ich freue mich darauf, Herr Klimt«, heuchelte er. »Bittschön geben S’ mir ein Zeichen, wenn Sie so weit sind.«
Klimt nickte, drehte sich um, ließ den Amtssekretär stehen und deutete den Gästen mit der Hand, ihm zu folgen. Krzizek schluckte die kleine Demütigung hinunter und schloss sich der Führung an.
»Hier sehen Sie Sonja Knips mit dem roten Skizzenbuch. Es war ein außerordentliches Vergnügen, das Fräulein im Garten ihrer Eltern unter einem blühenden Rosenstrauch zu malen. Die Amseln zwitscherten, Insekten surrten und dennoch regte Sonja keine Miene, blieb beharrlich in der Position, um die ich sie gebeten hatte. Trotz der sommerlichen Hitze trug sie das langärmelige, um den Hals geraffte Kleid mit bewundernswerter Würde. Kein einziger Schweißtropfen benetzte ihre Haut bis zum Ende des ersten Entwurfs.«
Krzizek musterte das Gemälde. Die Porträtierte saß in leichter Vorbeuge in einem hellen Lehnstuhl, die Kante des blutroten Skizzenbuchs in ihrer rechten Hand berührte das bedeckte Knie. Wach, neugierig, vielleicht ein wenig zu stolz für ein so junges Fräulein, blickte sie von der Leinwand auf jeden hinab, der sie betrachtete. Gustav Klimt bat weiter in den nächsten Raum. Neben der Tochter eines adeligen Offiziers sah man die enge Vertraute Klimts, Emilie Flöge, eine stadtbekannte Schneiderin. Auch sie im Freien gemalt. Das war ungewöhnlich. Wohlhabende Bürger ließen sich bevorzugt im Inneren ihrer Häuser und Wohnungen porträtieren. Auf einem Gemälde zeigte sich Frau Flöge in einem weit geschnittenen Kleid aus wild gemustertem Stoff. Selbst ihr dichtes schwarzes Haar zeigte Wildheit. Krzizek musste sich eingestehen, dass er von den lebendigen Frauendarstellungen Klimts angetan war. Ginge es nach seinem Geschmack, hätte er eines der Frauenbilder für die Staatsgalerie angekauft, nicht den »Kuss«. Den Thronfolger hätten die schönen Damen wohl auch mehr angesprochen. Das Gemälde Klimts mit dem Kuss gefiel Krzizek am wenigsten. Nicht, weil das Bild unvollendet war, was die meisten bestimmt erst auf den zweiten Blick bemerkten. Hier, wo er es nach den Schwarz-Weiß-Abbildungen in der amtlichen Korrespondenz im Zuge des Ankaufs zum ersten Mal in natura sah, verstörte ihn der Anblick der in grellen Farben dargestellten eng aneinandergedrückten Körper. Der Mann war einzig an dem schwarz behaarten Hinterkopf als solcher zu erkennen. Die Gestalt der Frau war höchstens zu erahnen, wobei der Künstler wenigstens ihr entrücktes Gesicht zeigte. Ein hässlich bunter Stoff ohne konkretes Motiv verhüllte das Paar fast zur Gänze. Erneut fragte er sich, was in aller Welt an diesem Bild so bemerkenswert sein solle. Abgesehen von dem vielen Gold.
Langsam bewegte sich die Gruppe weiter in einen Raum mit Bauern- und Blumenbildern. Danach folgte das Gemälde mit der Witwe Judith aus dem Alten Testament. Wieder sah man viel Gold. Und, man staune, eine entblößte Brust. Auch diese Dame trug das schwarze störrische Haar in Wangenhöhe. In allen Gesichtern der dargestellten und nach Krzizeks Empfinden meist zu spärlich bekleideten Personen erkannte er jüdische Züge. Das Dunkle und Unergründliche eines sich in Wien epidemisch ausbreitenden Volkes.
»Herr Klimt, darf ich Ihnen eine Frage stellen?« Ein älterer Herr trat an den Künstler heran. »Herr Klimt, was halten Sie von der Fotografie? Wird diese neue Technologie die Malerei ersetzen?«
Gustav Klimt lächelte. »Nein, denn die Hand des Künstlers kann der Wirklichkeit etwas Sichtbares hinzufügen, das in der Seele des Modells verborgen liegt. Die Technik der Fotografie wird die Geheimnisse der Seele niemals in gleicher Intensität erfassen können.«
»Hochinteressant.« Der Herr bedankte sich mit einer angedeuteten Verbeugung.
»Meine Herrschaften!« Die klare Stimme erfüllte den Raum. »Bittschön, erkunden S’ weiter die anderen Exponate. Ich muss mich kurz entschuldigen wegen dringender Geschäfte.« Er deutete eine Verbeugung an und wandte sich dem Amtssekretär zu. Klimt ging mit ihm in einen Raum im hinteren Teil des Gebäudes. Zwischen Kisten mit Flaschen kam es nun endlich zum Gespräch über den Ankauf des Klimt-Gemäldes für die Moderne Galerie im unteren Teil des Schlosses Belvedere.
»Sie wissen, dass ich noch etwas Zeit für die Fertigstellung benötige«, sprach Klimt. »Frühestens im November kann das Bild verfrachtet werden. Zuvor möchte ich die Räumlichkeiten am Rennweg begutachten. Ich behalte mir das Recht vor, den Verkauf bei ungenügender Aufstellungsqualität und Sicherheitsbedenken rückgängig zu machen.«
»Selbstverständlich, Herr Klimt. Schicken Sie mir bitte eine kurze Nachricht, sobald es Ihnen genehm ist. Ich werde Sie zu jeder Tages- oder Nachtzeit durch die Räume führen.«
»Nur bei Tag, Herr Krzizek.« Klimt lachte gepresst. »Ich möchte die Lichtwirkung zu den Öffnungszeiten prüfen. Im Moment kann ich mir leider nicht vorstellen, wo das Bild in den düsteren Zimmern des Unteren Belvedere entsprechend zur Geltung käme.«
»Selbstverständlich, Herr Klimt. Zu Ihren Diensten. Ich werde mich um alles kümmern. Das Licht lasse ich nach Ihren Wünschen richten. Auch für die Sicherheit wird gesorgt sein.«
»Fünfundzwanzigtausend Kronen«, sagte Klimt und fügte in einem Tonfall hinzu, der signalisierte, dass er keinen Widerspruch duldete. »Bar auf die Hand bei der Übergabe.«
Krzizek hüstelte. »Der österreichische Staat hat sparsam zu haushalten.« Unter verhandeln hatte er sich etwas anderes vorgestellt, aber das k. k. Kultusministerium wollte das Bild zu jedem Preis.
»Fünfundzwanzigtausend Kronen, Herr Krzizek.« Die Miene blieb hart.
»Ja dann. Fünfundzwanzigtausend Kronen, Herr Klimt.«
Der Sekretär kramte ein gefaltetes Blatt Papier aus der Seitentasche des Gehrocks, entfaltete es mit zittrigen Fingern und trug in die freie Stelle des vorab von ihm gestempelten und unterzeichneten Kaufvertrages die genannte Summe ein. Bar bei Übergabe, kritzelte er hinzu.
Klimt schrieb mit Vorbehalt unter den Text und fetzte mit rascher Hand seine Signatur darunter. »Habe die Ehre, Herr Krzizek. Nun muss ich mich wieder meinen Gästen widmen.«
Der Sekretär faltete den Kaufvertrag und steckte ihn in die Innentasche des Gehrocks. Er schwitzte und verspürte großen Durst. Der steife Kragen drückte gegen seine Kehle. Torkelnd trat er aus der Kammer und nahm ein mit Weißwein gefülltes Glas vom Tablett eines vorbeigehenden Dieners. Er trank es in einem Zug aus.
»Ah, da is ja mein Freund, der Josef!«, hörte er eine ihm vertraute Stimme im Rücken. Erleichtert drehte sich Krzizek um und stand vor Major Brosch, dem Leiter der Militärkanzlei am Rennweg. Endlich ein Mann in Uniform!
»Ich hab grad einen unglaublich hohen Preis für ein unfertiges Bild bezahlt«, raunte Krzizek, »was soll ich machen, wenn das Ministerium den hohen Staatsschulden zum Trotz stante pede diesen ›Kuss‹ von Klimt besitzen will.«
Brosch hob die Augenbrauen. »Geh Josef, um die Staatsschulden brauchst dich nicht zu sorgen. Das Bankhaus der Rothschilds wird’s schon richten. Komm, trink was.« Der groß gewachsene Brosch hielt seinem Freund ein Sektglas vor die Nase. »Sei unbesorgt. Nichts im Staate Österreich geschieht ohne den Willen unseres unfehlbaren Kaisers. Auf die Monarchie!«
Obwohl er kein Freund von Sprudelwasser war, schon gar nicht um diese Tageszeit, nahm Krzizek das Glas und trank. »Fünfundzwanzigtausend Kronen, Brosch. Ich weiß nicht, wie ich das Bild versichern soll, trau mich dem Klimt nicht zu sagen, dass unsere Räumlichkeiten in der Nacht unbewacht sind. Unsere Mittel reichen nicht für einen Nachtwächter.« Krzizek fand Gefallen an den blubbernden Sektperlen, die ihm in die Nase stiegen und auf der Zunge kribbelten. Er nippte gleich noch mal. »An der Zeit, dass der geplante Museumsbau am Karlsplatz verwirklicht wird. Der Sicherheit der Kunstwerke wird dort oberste Priorität eingeräumt, hat man mir zugetragen, und es soll mehrere Nachtwächter geben.«
»Wien mausert sich neben Paris zu einer Stadt der Kultur«, sagte Brosch und hob das Sektglas an seine Lippen hinter dem Schnauzbart. »Das Moderne hat neben den Sammlungen des Hauses Habsburg ein ebenso prominentes Platzerl verdient. Ein neues und freundliches Museum tät dieser Stadt gut, lieber Josef.«
Krzizek nickte und trank von dem Sprudelwasser.
»Ich fürcht, bis sich in Wien das Moderne gegen das Traditionelle durchsetzt, ist der Papst ein Weibsbild«, scherzte Brosch.
Da musste Krzizek herzhaft lachen. »Der Papst ein Weib! Das werden wir nie erleben. Im Ernst, vorn und hinten wird’s zu eng in unserer Galerie. Von jedem halbwegs bekannten lebenden Künstler können wir maximal ein bis zwei Werke ausstellen, und das nur gedrängt. Der Rest wird im Keller verstaut.«
»Unsere Militärkanzlei platzt genauso aus den Nähten. Die Akten stapeln sich bis zu den Decken hinauf.«
»Soll ich dir was sagen, Alexander«, nuschelte Krzizek. »Es gibt zu viele Leut in Wien. Das ist das Problem. Es sollte mehr Gebäude und weniger Menschen geben.«
»Aber was«, Brosch lachte, »die doppelte Staatsführung ist das Dilemma. Solange es einen Kaiser und einen Thronfolger mit zwei konkurrierenden Beamtenebenen gibt, wird sich die Lage nicht bessern. Alle Pläne für Erneuerungen liegen auf Eis. Verdammt teuer kommt uns die Doppelführung.«
»Mir scheint, du wünschst dem alten Kaiser gar den baldigen Tod«, scherzte Krzizek. »Pass nur auf, dass sie dich nicht wegen Hochverrats hängen.«
Der Major verzog das Gesicht. »Du als ziviler Hofbeamter hast es auch nicht leicht. Du musst dich mit zwei Befehlshabern mit gegensätzlichem Kunstgeschmack herumschlagen. Meine Aufgabe am Rennweg ist wenigstens klar umrissen. Ich habe alles Nötige für die Thronbesteigung von Erzherzog Franz Ferdinand vorzubereiten. Mit dem alten Kaiser in der Hofburg habe ich nichts zu schaffen.«
»Mit dem Thronfolger ist es in der Tat nicht leicht für mich. Niemals hätte er die Räumlichkeiten im unteren Schloss Belvedere für moderne Kunst zur Verfügung gestellt. Ginge es nach ihm, hätte ich ein verstaubtes Antiquariat im Neobarock zu führen.« Dem Sekretär entfuhr ein Rülpser. »Oh Pardon.«
»Du hast recht«, pflichtete der Major seinem Freund bei. »Vielleicht gelingt es mir ja, ihn ein wenig für das Neue zu öffnen. Ich glaub, er hört ein bisserl auf mich.«
»Das wär schön, lieber Alexander.« Krzizek räusperte sich. »Apropos. Dürft ich dich um einen kleinen Gefallen bitten?« Der Sekretär sah zu seinem Freund auf.
»Nur zu, Josef. Was liegt dir auf dem Herzen?«
»Du bist doch für das Protokoll des Thronfolgers zuständig und über jeden seiner Schritte informiert. Kannst mich nicht vorwarnen, wenn der Erzherzog die Absicht hat, die Galerie zu besichtigen? Letzte Woche hat er bei einem überraschenden Besuch meine Angestellten verstört, indem er sich über die Hängung einer seiner Ansicht nach obszönen Malerei echauffiert hat. Wegen a bisserl blanker Haut, meine Güte! Vor Zorn geschrien soll Seine Exzellenz haben. Ich selbst hab den Auftritt nicht erlebt, mir wurde vom Portier der Vorfall danach allerdings sehr bildhaft geschildert.«
»Willst leicht die modernen Bilder, die du für den amtierenden Kaiser ankaufst, vor dem künftigen Kaiser verstecken?« Brosch lachte.
Krzizek zog die Schultern hoch bis zum Hals. »Der Kaiser und das Ministerium verlangen, dass ich die Neuerwerbungen zu gleichen Teilen neben die alten Meister hänge, der Thronfolger will ausschließlich die alten Schinken in den vorderen Räumen sehen, das Neue will er, wenn überhaupt, ganz hinten haben. Ich bin nur ein kleiner Beamter, der sich an Weisungen und an Vorschriften zu halten hat. Also werd ich halt in Gotts Namen die beanstandeten Bilder abhängen, wenn der Erzherzog vorbeikommt, damit er nicht wieder seine Wut bei uns auslässt.« Krzizek, der Alkohol schlecht vertrug, redete wie aufgezogen.
Dem Major standen Tränen der Belustigung in den Augen. »Gut, ich werde dir helfen und meiner Kanzlei Anweisung erteilen, dich vor jedem geplanten Besuch des Thronfolgers in der Galerie zu warnen.«
»Ich dank dir von Herzen, Alexander. Jetzt muss ich aber los. Hab eine Menge zu tun im Büro. Grüße an die liebe Gemahlin.«
»Dank dir, Josef. Auch deine verehrte Freifrau lass grüßen, hoffe, es geht ihr wieder einigermaßen. Und pass auf, dass der Janaczek nichts von unserer Abmachung erfährt.« Alexander Brosch hob mahnend den Zeigefinger. »Der alte Schleimer ist imstand und verpetzt mich beim Thronfolger. Meine Karriere wäre im Arsch.«
»Lieber Alexander, wo denkst du hin? Mit dem Haushofmeister vom Franz Ferdinand red ich überhaupt nicht. Der ist mir aufs Tiefste zuwider, weil mit Verlaub, der stinkt nach nassen Fetzen, so wie unser verehrter Thronfolger Allerhöchstderselbe auch an manchen Tagen.«
Major Brosch zog den Kopf ein und blickte um sich. »Hoffentlich hat uns grad niemand belauscht.«
KAPITEL 2
12. JUNI 1908
Erna Kührer stand seit acht Uhr Früh an der Wiener Ringstraße und wartete auf den Kaiser. Wenn sie sich auf die Zehenspitzen erhob, konnte sie über beinahe alle Köpfe hinwegsehen. Fremd klingende Sprachlaute flogen um ihre Ohren, ein Gemisch von Schweiß und unterschiedlichen Parfumnoten wehte um ihre Nase. Plötzlich vernebelte ein leichter Schwindel ihre Sicht. Die frühe Hitze in diesem Jahr war unerträglich. Sie hätte eine Flasche mit Wasser einpacken sollen. Erna strich mit der Zunge über ihre trockenen Lippen und atmete tief durch. Da kündigte ein Paukenschlag das Nahen des Festzugs an. Erna vergaß auf den Moment der Schwäche und reckte neugierig den Hals. Im Takt des Radetzkymarsches bewegten sich bunt gekleidete Schausteller entlang der eisernen Einfriedung der Ringstraße. Zwischen den darstellenden Gruppen thronten die vom Sonnenlicht gedämpften blau-schwarzen Uniformen der Gardeoffiziere auf ihren Pferden. Gleichmäßiger Hufschlag donnerte über das Kopfsteinpflaster. Erna staunte mit großen Augen. Etwa eine Stunde später endete der historische Teil mit dem Aufmarsch der strammen Tiroler Schützen. Lange Federn wippten von Hüten, schwere Waffen hingen an breiten Männerschultern. Der Vergangenheit folgte die Zukunft, die passenderweise mit der Jugend dargestellt wurde. Mit berüschten Kniestutzen, bunten Bändern über straff gescheitelten Frisuren bewegten sich etwa zwanzig Fräulein im zackigen Schritt. Hinterher eine Gruppe von Buben und Mädchen mit Rosensträußen in den Händen. Über das hübsch anzusehende Schauspiel wachten drei hagere Frauen mit gelegentlichen Ordnungsrufen. Die Säume ihrer bodenlangen blauen Kleider flogen über die Pflastersteine. Blumengeschmückte Hüte beschatteten ihre Gesichter.
Erna kamen Tränen der Rührung. Der Anblick ließ sie an ihre einzige Tochter, Klementine, denken. Keines der Mädchen im Festzug hatte nur annähernd die helle Schönheit ihrer Tochter. Keines hatte so glasklare Augen und eine so weiße Haut, wie Schnee an einem sonnigen Bergwintertag. Erna blickte in Reihen von sonnengebräunten, derben Bauerngesichtern. Sie lächelte wehmütig. Nicht selten blieben die Menschen auf der Straße stehen und starrten auf ihre Klementine. Dabei ahnte das naive Kindlein gar nicht, wie besonders es geraten war. Still und zurückhaltend mied es die Gesellschaft von Fremden, Freundschaften schloss es schwer. Erna stieß einen seligen Seufzer aus. Da fuhr ein Raunen durch die Menge. Sie streckte sich und spähte neugierig zum Ring hinüber. Der Jubilar, Seine Kaiserliche und Königliche Apostolische Majestät Franz Joseph, näherte sich, flankiert von den Generälen in mit Orden behängten Uniformen. Tobender Applaus setzte ein. Mit kerzengeradem Rücken saß Seine Majestät auf dem gefleckten Schimmel. Und das bei einem Alter von siebenundsiebzig Jahren. Die schlanken Schenkel drückte er wie ein Junger in die Flanken, die Arme winkelte er straff an seine Seiten. Alles an seiner Haltung zeigte Disziplin. Das einzig Verspielte war der Helm mit den weißen Federbuschen, die fast seine Augen verdeckten. Erna versuchte, sich jedes Detail einzuprägen, damit sie es später dem Franzl berichten konnte. Zackig hob der Kaiser die Hand. Die Musik verstummte. Der Monarch verbeugte sich vor seinem Volk, winkte gar. Erna hielt den Atem an. Dann hörte man die Pauken wieder schlagen. Unter Jubelgeschrei führten die Generäle den Zug in Richtung Prater. Vor zehn Jahren war Erna schon einmal hier an ähnlicher Stelle gestanden, um dem Kaiser zu huldigen. Damals, zum fünfzigjährigen Regierungsjubiläum, flatterten von sämtlichen herrschaftlichen Prachtbauten und auch von vielen bürgerlichen Fassaden unzählige Fähnchen und Flaggen in Rot und Goldgelb. Erna sah sich um. Heuer, zum sechzigjährigen Jubiläum, schien die Begeisterung im Volk für Fähnchen und Flaggen nachgelassen zu haben. Nur vereinzelt wehten schwarz-goldene Stoffe von den Mauern. Dafür hatte sich Wien mit Blumen geschmückt. Überall standen Tröge oder hingen Kisten mit Blüten in Gelb und Violett. Trotz des Gedränges hatte Erna den Eindruck, weniger Menschen als bei den Jubiläumsfeierlichkeiten vor zehn Jahren zu sehen. Dem Kaiser von Österreich und König von Ungarn die Ehre zu erweisen, schien etwas aus der Mode gekommen zu sein. Obwohl es vermutlich nicht mehr viele Gelegenheiten geben würde, Seine Majestät Franz Joseph I. leibhaftig zu erleben. Nach dem Selbstmord des Sohnes und dem Mord an der geliebten Gemahlin Sisi zeigte sich der Kaiser immer seltener seinem Volk. Erna stimmte in den Jubel mit ein. Schad, dass ihr Franzl nicht da war. Er mochte den alten Kaiser. Mehr noch als sie. Aber dann war sie es gewesen, die sich in aller Herrgottsfrüh aufgerafft hatte, um dem Huldigungszug beizuwohnen. Dem lieben Gatten war es heute zu heiß. Auch die Kinder waren zu Hause geblieben. Dabei hätte es in Schönbrunn eine Parade mit dem Kaiser für die Jugend gegeben. Erna blinzelte. Ein Sonnenstrahl brach sich an einem Kupferdach und blendete. Sie hob die Hand an die Stirn und blickte in die Rücken der vorbeiziehenden Tiroler Schützen in Kniehosen und Waffenröcken. Mit ihren Gewehren feuerten sie Salven ab. Deutlich spürte Erna ein kollektives Zucken durch die Körper der Passanten rund um sie. Jemand hinter ihr kreischte: »Ein Hoch dem Kaiser! Ein Hoch dem Reich!« Viele stimmten mit ein. »Ein Hoch dem Reich!« Ein drängelnder Ellbogen stieß so heftig gegen Ernas Rücken, dass ihr kurz der Atem stockte. Sie hatte genug von der Hofparade. Mit an den Körper gepressten Armen drängte sie sich durch die zunehmend unruhig werdende Menge. Der Widerhall der Marschmusik dröhnte noch in ihren Ohren, als sie vom Kärntner Ring über den Schwarzenbergplatz auf den Rennweg einbog. Auf der Höhe des Unteren Belvedere hörte sie den Wirbel von der Parade nur mehr dumpf. Erna bewegte sich im Schutz einer hohen Mauer zügig voran. Beim imposanten Haupttor mit seinen Steinfiguren fiel ihr Blick in den menschenleeren Ehrenhof. Über den weißen Kies flimmerte das Sommerlicht. Erna schwitzte. Mit schwerem Atem dachte sie an Seine Exzellenz, den Thronfolger Franz Ferdinand. Im Huldigungszug hatte sie ihn vermisst. War er am Ende zu stolz, um dem alten Onkel die kaiserliche Ehre zu erweisen? Die Antipathie zwischen dem Kaiser und dem Erzherzog war allgemein bekannt.
Der Klang hart gegen das Pflaster schlagender Pferdehufe ließ sie herumfahren. Da schau her, die Frau Gruber aus der Vorstadt, mit ihrem fetten Töchterlein, fein aufgebrezelt. Was der Pöbel für Aufwand betrieb, um etwas darzustellen. In einem billigen Einspänner, der Gaul so mager, dass man das Gerippe durch die Haut sehen konnte. »Grüß Sie, Frau Gruber!« Erna hob die Hand und winkte.
Die Mutter des Mädchens, das vor ihrem Umzug neben Klementine die Schulbank gedrückt hatte, reckte das Kinn, öffnete den geschminkten Mund und wachelte behandschuht zurück. »Haben S’ leicht scho g’nua g’sehn vom Kaiser, Frau Kührer?«
»Bleder Trampel«, murmelte Erna mit gesenktem Kinn und tat, als hätte sie die krächzende Stimme ebenso wenig wie das hämische Grinsen aus dem fetten Gesicht des Töchterchens wahrgenommen. Einen Einspänner könnte sie sich leicht von ihrem Lohn als Bedienerin in der Galerie des Unteren Belvedere leisten, wenn sie nur wollte, selbst wenn der Franzl momentan keine Arbeit in Aussicht hatte. Auf dem Heimweg bis in die Ungargasse Nummer zwei ärgerte sie sich über den protzenden Trampel aus der Vorstadt. Erst als sie nach dem Schlüssel in ihrem Beutel kramte, beruhigte sich ihr aufgewühltes Gemüt. Tief durchatmend strich sie eine Haarsträhne hinter das Ohr, trocknete den Schweiß auf der Stirn, straffte den Rücken, betrat den dunklen kühlen Flur und stieg die Treppen in den vierten Stock hinauf. Die schöne Zweizimmerwohnung in der feinen Gegend mit den Fenstern nach hinten zum ruhigen Hof hatte ihr der Herr Amtssekretär vor fünf Jahren vermittelt. Josef Krzizek wohnte unten in der Beletage mit der gnädigen Frau Gemahlin. Eine Freifrau von adeligem Blut, wie es hieß. Eigentlich wusste Erna nicht, wie die Frau des Amtssekretärs aussah. Bei den seltenen Gelegenheiten, bei denen Erna der feinen Dame im Stiegenhaus begegnet war, hatte diese stets ihr Gesicht hochmütig hinter einem Schleier versteckt. Selbst bei großer Hitze sah man die schmale Gestalt nie mit blankem Haupt. Das Eheleben des Amtssekretärs ging sie ja nichts an, obwohl sie sich schon manchmal wunderte, dass er ihr immer wieder an die Wäsche wollte, obwohl er eine viel Jüngere, Edlere zu Hause sitzen hatte. Nichtsdestotrotz war sie dem Herrn Krzizek verpflichtet. Wegen der schönen Wohnung in der Ungargasse und für die Arbeit im Unteren Belvedere, ohne die sie jetzt, nachdem der Franzl arbeitslos geworden war, in einem Armenhaus Tag für Tag um eine heiße Suppe anstehen oder als Mörtelmischerin auf einer der vielen Baustellen in Wien arbeiten müsste. Dass dem Herrn Amtssekretär manchmal die Hand zwischen ihre Brüste und unter den Rock rutschte, brauchte keiner zu erfahren, schon gar nicht ihr Franzl. Erna warf den Kopf in den Nacken und stieß einen Schwall heißer Atemluft aus. Bis zum Herbst würde alles wieder gut sein. Bis zum Herbst würde der Franzl wieder eine Arbeit haben.
Seufzend sperrte sie die Tür zur Wohnung auf. Ihr Ehemann saß gebeugt in der Küche am Esstisch, die Arme aufgestützt, die Hände an die Schläfen gelegt. Ein Stich fuhr ihr in die Magengegend, als sie die Schuppen um Mund und Kinn sah. Auch an der Nase bis hinauf zu den Brauen und bis zum zurückgewichenen Haaransatz klebten sie. Erna schlug die Hände zusammen. Ihr Franzl wurde wieder zum Reptil.
»Jessas, was ist denn passiert?«
»Ich hab einen Schub«, sagte er schulterzuckend.
»Diese verdammte Krankheit!« Erna rutschte zum Franzl und nahm seine Hand. Immer wenn er sich aufregte, stieß sein Körper die Haut in kleinen Stückchen ab, als wäre sie vergiftet. Im Gesicht und an den Händen fing es an, später befiel es manchmal den ganzen Körper. Armer Franzl!
»Was ist denn los? So sag was!« Erna griff an seine Schulter. Als er den Blick hob, sie in seine hellen, großen Augen schaute, stieg ein schrecklicher Verdacht in ihr auf. »Wo sind die Kinder?« Erna sah sich suchend um. Auf dem Tisch lagen neben der Schere Bastelbögen. Die Kronen Zeitung hatte zum Jubiläum das Kaiserpaar samt edler Garderobe zum Ausschneiden herausgebracht. Die Zwillinge liebten diese Spielerei.
»Wo sind die Kinder?«, wiederholte Erna etwas lauter.
Franzl hob die Hände von der Stirn und richtete sich auf. »Unseren Kindern geht’s gut. Klementine ist mit den Zwillingen im Hof.«
Erleichtert atmete Erna aus. »Ich hab den Kaiser gesehen«, sagte sie, »alt ist er worden. Sehr alt.« Sie streichelte über seine Hand. »Was ist geschehen, Franzl? Warum schuppt deine Haut schon wieder?«
»Der Daniel ist zurück«, presste er hervor.
»Der Daniel?« Erna riss die Augen auf. »So sag, wo ist er, unser Ältester?«
»Beim Wirten zum Alten Heller hockt er. Die Umstände, hat er g’sagt, hätten ihn zurückzwungen nach Wien. Er hätt ka Geld mehr und möcht wieder bei uns wohnen. Sein Haar ist dunkler worden und der Ausdruck im Gesicht, ich kann’s gar net beschreiben … hätt ihn fast nicht wiedererkannt.«
Erna stand auf. »Hast ihm net g’sagt, dass ma kan Platz mehr für ihn haben in der kleinen Wohnung? Seit die Zwillinge da sind …«
»Hör mir zu, Erna.« Franzl verzog den Mund und blickte zu ihr hinauf. Seine Unterlippe zitterte. »I schlaf unten im Stall und wenn du bei Klementine im Kabinett …«
»Na!« Erna stemmte die Arme in die Hüften. »Des kommt net infrage. Du bist mei Mann und g’hörst zu mir.«
»Er ist unser Sohn, Erna. Du kennst ihn. Erinner dich, wie er reagiert, wenn …«
»Franzl«, fuhr sie ihm ins Wort, »wir geben dem Daniel net unser schönes großes Schlafzimmer. Er wird unten im Stall übernachten, du bleibst bei mir.«
»Des hab ich ihm vorg’schlagen, Erna. Er vertragt den G’stank vom Gaul net, hat er g’sagt.« Franz stieß einen tiefen Seufzer aus. »Wir müssen z’sammhalten. In guten wie in schlechten Zeiten. Wir sind eine Familie.«
Erna biss die Zähne aufeinander. »Ja du hast recht. Wir sind eine Familie. Wir halten z’samm. In guten wie in schlechten Zeiten.«
Erna küsste Franzl auf den Mund.
KAPITEL 3
ENDE AUGUST 1908
Gegen Ende August blies der Wind vertrocknetes Laub durch die Straßen von Wien. Die Wohlhabenden kehrten aus der Sommerfrische in den Voralpen zurück in die Reichshauptstadt. Man merkte es am tobenden Straßenverkehr. Die Stille des Sommers wich dem geschäftigen Treiben nahender Herbst- und Wintermonate.
Klementine Kührer stand vor dem offenen Küchenfenster, blickte gedankenverloren in den Hinterhof und atmete den süßlich-herben Duft der feuchten Erde. Der Moment hatte etwas Friedliches, und dennoch nagte Kummer an ihrer jungen Seele. Es war wegen der Rückkehr des großen Bruders an jenem schwülen Tag der Kaiserparade. Die Erinnerung an die Zeit vor seinem Verschwinden war verblasst. Vater und Mutter hatten während seiner Abwesenheit kaum von ihm gesprochen. Als wäre er für immer in die Fremde gezogen. Irgendwann hatte sie ihn für tot gehalten.
Manchmal schlich sie heimlich ins Schlafzimmer und sah sich bei ihm um, wühlte in der Unordnung, in der Schmutzwäsche, zwischen den Zigarettenpackungen und den Zeitschriften. Nach irgendetwas, das ihr verraten könnte, welches Geheimnis er verbarg. Neugierig hatte sie in einer Schachtel mit Postkarten gestöbert und Bilder nackter Frauen gesehen. Es verstörte sie, weil sie sich magisch angezogen fühlte von allem, was Daniel umgab. Immer mehr wollte sie sehen von der fremden, verruchten Welt des großen Bruders. Daniel schien ihr Interesse zu bemerken, denn immer öfter richtete er das Wort an sie und ließ dabei den Blick auffallend lange auf ihr ruhen.
Klementine hob seufzend die Schultern. Zu viele Gedanken quälten sie. Vielleicht hatte Daniel in einem fernen Land Ehre und Ruhm erreicht, und deshalb stand ihm das größte Zimmer in der Wohnung alleine zu. Nicht dass es ihr unangenehm war, wenn die Mutter nachts neben ihr lag und leise schnaufte. Aber der Vater tat ihr leid, weil er von der Mutter getrennt unten im Stall schlafen musste. War seine Krankheit am Ende ansteckend?
Kalte Luft pfiff durch die Ritzen der Fensterläden. Fröstelnd rieb sich Klementine über die Oberarme. Unheimlich war es hier geworden. Das ständige Wispern der Eltern, die verschwörerischen Blicke. Selbst die Zwillinge hatten sich verändert. Den ganzen Tag über blieben sie beim Vater und dem Pferd. Wenn sie die Eltern fragte, warum der große Bruder sich alles erlauben durfte, sie hingegen gehorsam sein musste, hieß es, das verstehe sie nicht, dafür sei sie noch zu jung. Ebenso seltsam war, dass die Mutter einmal pro Woche in der Nacht aus dem Bett stieg, auf Zehenspitzen nach draußen schlich und Stunden später mit zerwühltem Haar und mit dem Geruch nach Stroh und Pferdedung wieder neben ihr lag. Irgendetwas stimmte nicht mit ihrer Familie. Sie spürte es. Vielleicht konnte sie bei Daniel Antworten finden. Nach einem prüfenden Blick auf die Wanduhr lief sie hinaus auf die Ungargasse. Sie hatte Daniels Gewohnheiten beobachtet, wusste in etwa, zu welcher Zeit er am Nachmittag nach Hause kam, bevor er abends wieder wegging. Schon sah sie die gedrungene Gestalt des Bruders aus der Tür des Wirtshauses zum Alten Heller treten. Schlendernd querte er die Gasse und kam langsam auf das Zinshaus Nummer zwei zu. Blitzschnell versteckte sich Klementine im Schatten eines Mauervorsprungs. Als er an ihr vorbeigegangen war, schlich sie ihm hinterher, atmete den Tabakgeruch seiner Zigarette. Wenige Augenblicke, nachdem er die Tür zum Zimmer hinter sich geschlossen hatte, klopfte sie. Er öffnete und grinste breit. Als hätte er sie erwartet. Wusste er, dass sie ihn beobachtete? Sie hielt seinem Blick nicht nur stand, sie musterte ihn frech. Er war nicht besonders hübsch, nicht besonders groß. Die Ohren standen ab, die Nase war zu dick und der Mund zu klein. Einzig in seinen hellen Augen sah sie etwas Vertrautes, etwas von sich selbst. An diesem Nachmittag war Daniel geduldig und nahm sich Zeit für seine kleine Schwester. Sie erfuhr von seinen Schulden, von dem vielen Geld, das er auftreiben musste, um nicht wieder ins Gefängnis zu müssen. Sie empfand Mitleid. Dann fragte er, ob sie mit ihm in einer Stunde zu einem Freund in die Innenstadt fahren wolle. Klementine freute sich, selten ging jemand mit ihr aus. Das schönste Kleid, die besten Strümpfe und Schuhe holte sie aus dem Schrank. Da an diesem Tag ein frisches Lüftchen wehte, wollte sie ihre Weste überziehen. Doch die war ihr über den Sommer zu eng geworden. So nahm sie eine aus dem Schrank der Mutter. Sie reichte bis zu den Knien, die Ärmel krempelte sie hoch. Und weil ihr der schöne Sonntagshut der Mutter ins Auge stach, setzte sie den auf ihre zwei dicken Zöpfe. Richtig erwachsen kam sie sich vor. An Daniels Seite ging es zu Fuß Richtung Stadtpark. Er nahm ihre Hand in die seine. Klementine genoss die verstohlenen Blicke der Passanten. Eigentlich ist er ganz nett, dachte sie und lächelte.
Die Geschwister Kührer marschierten entlang der Wollzeile bis zum Stephansplatz. Klementine staunte über die Geschäfte mit den feinen Waren und den hell gestrichenen Fassaden der Palais und über die bunten Blumen an den großen Fenstern. »Hier wohnen die reichen Leute«, erklärte Daniel. Dann waren es nur noch wenige Schritte bis zum Ziel. In dem feinen Haus auf der Tuchlauben bewunderte Klementine die Pracht des Stiegenhauses. »Alles Marmor und Stuck.« Daniel blieb auf der obersten Stufe stehen und zündete sich eine Zigarette an. »Mein Freund ist ein wohlhabender Herr«, sagte er und betätigte den Türklopfer. Die Räume in der Wohnung des Freundes waren so hoch, wie es Klementine von der Wartehalle des Südbahnhofs her kannte. Von den Decken hingen lange, mit glitzernden Kristallen geschmückte Luster von beachtlicher Größe. Goldgerahmte Bilder mit Porträts schmückten die Wände. Auf den Lehnen der Polstermöbel lag feinste Spitze. Die gleiche Spitze hing als Vorhang an den Fenstern. Auf einem Tisch standen geschliffene Gläser, in denen sich das einfallende Sonnenlicht spiegelte. Daniel sprach mit dem Freund, während Klementine nah an die dunklen Rosen in einer Vase auf dem Tisch herantrat und den süßen Duft der Blüten einsog. Durch die blitzblanken Fensterscheiben sah man über die Dächer der Stadt bis hinüber zum Prater mit dem Riesenrad.
»Das ist Klementine, meine Schwester«, hörte sie Daniel sagen. »Sie ist noch Jungfrau.«
»Guten Tag, Klementine.« Der Mann drehte sich zu ihr.
»Guten Tag, gnädiger Herr.« Klementine machte einen Knicks.
»Jungfrauen duften wie Rosen.« Der Freund zählte dem Bruder mehrere Münzen in die offene Hand. Dann flüsterte er ihm etwas ins Ohr. Daniel fragte daraufhin seine Schwester, ob sie einen Tanz vorführen könne.
Klementine schüttelte den Kopf.
»Aber sicher kannst du das, Schwesterherz.«
Klementine starrte zu Boden.
»Komm, Kleines«, hörte sie ihren Bruder mit der Zigarette im Mundwinkel raunen, »dreh dich und zeig dich von allen Seiten. Jedes Kind kann das.«
»Ich … ich versuch’s, Daniel.«
»Na also.«
Sie hörte ihn seufzen.
»In einer Stunde komme ich wieder und hol dich ab. Sei schön artig.«
»Bitte, bleib da.« Sie hob den Blick.
»Ich muss etwas erledigen. Mein Freund kümmert sich um dich. Hab keine Angst.« Und dann ging er.
Das Ticken der Uhr an der Wand dröhnte in Klementines Ohren. Tick, tack, tick, tack.
»Mädchen, zieh dich aus.«
Sie war allein mit dem Fremden.
Er hob die Hand. »Ach nein, die Strümpfe und die Schuhe lass!«
»Mein Herr.« Klementine schluckte. »Mein Herr, bitte.«
Da ging er auf sie zu, hob die Hand, zog mit gespreizten Fingern an ihrem Zopf. »Jetzt mach.« Er schwitzte an der Stirn und atmete laut. »Hat dir dein Bruder nicht erklärt, was du zu tun hast?«
»Sehr wohl, mein Herr.« Klementine duckte sich, nahm den Hut der Mutter vom Kopf und entkleidete sich bis auf das Leibchen mit den am Saum durch Bändchen befestigten Strümpfen und die Schuhe, so wie der feine Herr es wünschte.
»Braves Mädchen. Und jetzt tanz für mich.«
Klementine dachte an die Bilder von den Frauen in den Zeitschriften ihres Bruders. Sie versuchte die Posen nachzuahmen, hob die angewinkelten Arme an den Kopf, drehte sich zur Seite und dehnte den Rücken. Sie gab sich Mühe zu gefallen. Ihr Atem ging schwer. In der Miene des Mannes las sie dennoch Unzufriedenheit.
»Genug«, sagte er und schubste sie zu einem Sitzmöbel.
»Bitte, der Herr, tun Sie mir nichts.« Klementine kämpfte mit den Tränen.
»Ist ja gut. Sei still, sei endlich still.«
Klementine sank zitternd auf den weichen Stoff des Stuhles. Da sank der große, breite Mann vor ihr auf die Knie und begann mit unruhigen Händen ihre Haut von den Knien aufwärts zu betasten. »Brav«, murmelte er mit geschlossenen Augen, »braves Mädchen.«
Reglos beobachtete sie das Geschehen, spürte die fremden fordernden Hände. Ihr Herz pochte wild gegen die Brust. »Aber der Herr wollten mich doch tanzen sehen.«
»Halt still.« Er griff an ihr Gesäß. Seine Finger tasteten über ihren Bauch bis zum weichen Flaum zwischen ihren Beinen.
Klementine hielt den Atem an. Sein Gesicht kam näher. Mit gekräuselter Nase schnupperte er an ihr wie der Hund an einem Stück Fleisch. Da stöhnte er plötzlich auf.
»Gnädiger Herr?«
»Ein duftender Engel«, raunte er, »etwas Besonderes, etwas Kostbares bist du. Ich muss dich wiedersehen.« Dann wich er zurück, sank schnaufend auf einen Stuhl.
Eine heiße Röte stieg in ihre Wangen.
»Du kannst dich jetzt anziehen und in dem Zimmer nebenan auf deinen Bruder warten.«
Rasch raffte Klementine ihre Kleidungsstücke zusammen. Im Halbdunkel streifte sie Unterwäsche, Kleid und Weste über, setzte den Hut auf und wartete auf Daniel. Nach wenigen Minuten kam er, dann verließen sie die Wohnung, ohne dem fremden Mann noch einmal zu begegnen. Draußen auf der Straße streichelte Daniel zärtlich über ihren Rücken und küsste sie auf die Stirn. »Das hast du gut gemacht, Klementine. Ich bin stolz auf dich.«
Von nun an begleitete sie ihren Bruder mehrmals die Woche in die Innenstadt. Daniel hatte Klementine ein paar Tanzschritte beigebracht. Manche der Männer freuten sich, wenn sie tanzte, andere wollten sie nur berühren, alle wollten an ihr schnuppern. Der Duft einer Jungfrau sei etwas Kostbares, sagten sie. Langsam fand Klementine Gefallen daran, dass man sie ansehen, dass man sie berühren und bewundern wollte. Es gefiel ihr, mit Daniel ein Geheimnis zu teilen. Und er brachte ihr Süßigkeiten, die wunderbar schmeckten und im Mund zerschmolzen wie Schnee in der Wintersonne. Die letzten Sommertage brachten warmen Regen.
Als Daniel seiner Schwester den Besuch bei einem gewissen Grafen Theodor Rollowitz ankündigte, war Klementine aufgeregt, da sie noch nie vor einem Grafen getanzt hatte. Unter einem großen schwarzen Regenschirm erreichten sie und Daniel die Wohnadresse in dem äußerst vornehmen Palais am Fleischmarkt. Der Graf empfing das Geschwisterpaar im Bademantel. Er trug einen Spitzbart und ein Monokel am rechten Auge. Wie sich herausstellte, war der Graf bei Weitem nicht so vornehm, wie Klementine es erwartet hatte. Sobald Daniel gegangen und sie entkleidet war, schob der feine Herr sie mit groben Griffen ins Schlafzimmer und warf sie auf ein Bett. Keuchend lag dann sein schwerer Körper auf ihr und nahm ihr den Atem. Immer fester drückte er sie in das Laken, bis sie einen brennenden Schmerz im Unterleib verspürte. Klementine schrie in der Hoffnung, Daniel würde ihr zur Hilfe eilen. Nichts dergleichen geschah. Alleine ihr kreischendes Geschrei veranlasste den Grafen, abzulassen. Als Klementine das Blut zwischen ihren Beinen bemerkte, lief sie panisch aus der