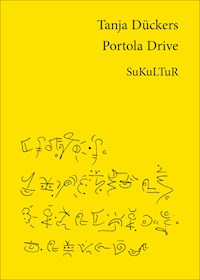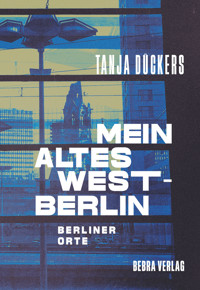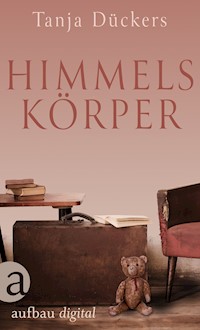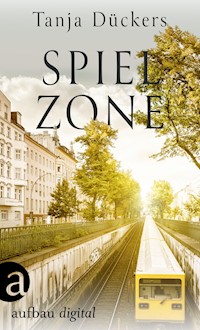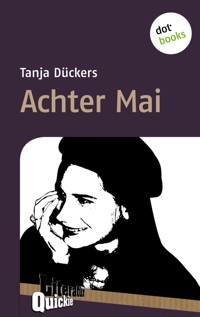10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Roman, der unser aller Leben betrifft.
Am 21. Juni, dem längsten Tag des Jahres, reißt das Läuten des Telefons vier Geschwister aus ihrem Alltag: Gerade ist der Vater, das "Zentralgestirn" der Familie, gestorben. Ganz überraschend kommt der Tod des Vaters nicht. Seit er seine Zoohandlung wegen wirtschaftlicher Schwierigkeiten schließen mußte, schien er jeden Lebensantrieb verloren zu haben. A
Unter dem Eindruck der Todesnachricht erkennen die längst erwachsenen Kinder auch den eigenen Lebensweg in unerbittlicher Schärfe.
In ihrem raffiniert erzählten Roman blickt Tanja Dückers hinter die Kulissen einer Familie, in der Erfahrungen und Lebensstile zweier Generationen aufeinanderprallen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 267
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über das Buch
Ein Roman, der unser aller Leben betrifft.
Am 21. Juni, dem längsten Tag des Jahres, reißt das Läuten des Telefons vier Geschwister aus ihrem Alltag: Gerade ist der Vater, das »Zentralgestirn« der Familie, gestorben. Ganz überraschend kommt der Tod des Vaters nicht. Seit er seine Zoohandlung wegen wirtschaftlicher Schwierigkeiten schließen mußte, schien er jeden Lebensantrieb verloren zu haben. Unter dem Eindruck der Todesnachricht erkennen die längst erwachsenen Kinder auch den eigenen Lebensweg in unerbittlicher Schärfe.
In ihrem raffiniert erzählten Roman blickt Tanja Dückers hinter die Kulissen einer Familie, in der Erfahrungen und Lebensstile zweier Generationen aufeinanderprallen.
Über Tanja Dückers
Tanja Dückers wurde 1968 in Westberlin geboren. Sie studierte Nordamerikanistik, Germanistik und Kunstgeschichte. Neben Prosa und Lyrik schreibt sie Essays, Hörspiele und Theaterstücke. Sie erhielt zahlreiche Preise und Stipendien, die sie u.a. nach Kalifornien, Pennsylvania, Gotland, Barcelona, Prag und Krakau führten. Sie lebt in Berlin.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
https://www.aufbau-verlage.de/newsletter-uebersicht
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Tanja Dückers
Der längste Tag des Jahres
Roman
Übersicht
Cover
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Der Schrank
Die Fahrstunde
Im Garten
Das Kopfkissen
Die Wüste
Dank
Impressum
Dies ist ein Werk der Fiktion. Figuren und Handlung des Romanssind frei erfunden.
»Wir könnten weggehen«, erwiderte ich, »und von Neuem beginnen.«
Cécile Wajsbrot
Der Begriff Zentrum oder Zentralität gibt ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit – weil er den Ort beschreibt, an dem die meisten Menschen zusammenkommen. Aber man neigt dazu, die Peripherie, die Ränder zu vergessen … Doch kann man weder die Mitte ohne Betrachtung der Außenränder noch die Peripherie ohne ihr Zentrum begreifen, beide bedingen jeweils einander. Es ist als Künstler ganz spannend, die Ränder zum Zentrum hin zu verschieben und das Innere nach außen.
Robert Smithson
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Newsletter
Der Schrank
Die Fahrstunde
Im Garten
Das Kopfkissen
Die Wüste
Dank
Impressum
Der Schrank
Der Anruf kam um zwölf Uhr mittags. Benjamin und Nana waren erst vor einer Woche in diese Wohnung gezogen, das Telefon stand noch nicht, wo es später einmal stehen sollte; am Boden lagen einige Kabel, zusammengerollt wie schwarze Schlangen. In der Luft hing der harzige Geruch einer schwedischen Holzlasur. Sie waren gerade damit beschäftigt, einen alten Kleiderschrank, den Benjamins Eltern vom Dachboden geholt und per Umzugswagen quer durch Deutschland geschickt hatten, zu streichen.
Für Sekunden stand die Frage im Raum, wer zum Telefon gehen würde. Nana hielt den Pinsel in die Luft, zwei, drei braune Tropfen fielen auf ihre hellen Leinenturnschuhe, kühle Nässe drang an ihre Zehen. Dann gab sich Nana einen Ruck, weil Bennie mit dem Pinsel gerade eine so schöne Bahn auf dem alten Holz zog.
Als sie in den Flur zum Telefon lief, rief sie noch über die Schulter: »Hoffentlich ist das nicht Filou!«
Im nächsten Moment geriet sie mit einem Fuß in das Kabelgewirr und wäre beinahe hingefallen, als sie nach dem Hörer griff. Ihr »Hallo?« klang ziemlich atemlos.
Es war Bennies älteste Schwester Sylvia. Schon an ihrer Stimme erkannte Nana, daß etwas Besonderes vorgefallen war.
Nana und Bennie waren ineinander verliebt. Das war offensichtlich, für jeden. In der Galerie waren immer sie es am Ende einer Vernissage, die noch eng umschlungen tanzten, wenn das Neonlicht schon längst ausgeknipst war und nur das fahle Straßenlicht von draußen in den schmalen Raum fiel. Vorm Einschlafen gaben sie sich Gutenachtküsse, die kaum ein Ende nahmen, weil keiner derjenige sein wollte, der den letzten Gutenachtkuß nicht mehr erwiderte. Morgens beim Frühstück unterhielten sie sich ausführlich über exotische Orte, die sie, wenn sie es sich irgendwann leisten können sollten, gemeinsam bereisen wollten. Sie planten eine längere Nordafrika-Reise. Vielleicht im nächsten Sommer. Auf keinen Fall in diesem! Denn dieser Sommer sollte der heißeste seit über hundert Jahren werden. Hitzerekorde wurden schon in dieser zweiten Junihälfte gebrochen. Selbst in Skandinavien schien ununterbrochen die Sonne. In Südfrankreich waren sechstausend vorwiegend ältere Menschen an Herz-Kreislauf-Beschwerden gestorben. In Griechenland neuntausend. Und in Süddeutschland folgte ein Hoch dem anderen. Bennies Eltern hatten neulich am Telefon über das unerträglich schwüle Wetter in Fürstenfeldbruck geklagt – im Garten sei so viel verdorrt! – und gefragt, ob Bennie und Nana sich denn ein paar Tage oder gar eine ganze Woche für das Renovieren frei nehmen konnten. Was sie nie verstanden, war, daß Bennie und Nana sich nirgendwann »frei nehmen« mußten. Sie hatten immer oder nie frei. Wen interessierte es schon, ob die Ausstellungen bei Bennie & Clyde (Bennies Partner hieß tatsächlich Clyde) alle vier, sechs oder acht Wochen wechselten? Und wer fragte danach, wann Nana ihre Doktorarbeit oder ihren Essayband abgeben würde?
Was sie nicht wissen konnten, war, daß Bennie und Nana bei aller Liebe in erster Linie zusammengezogen waren, um Geld zu sparen. Ein Telefonanschluß, ein Kühlschrank, eine Stereoanlage, eine Waschmaschine, eine Kaffeemaschine, da kam etwas zusammen. Abgesehen davon sparte man Miete und Strom. Und Zeit und Geld für die viele Fahrerei zwischen den beiden Wohnungen. Die Berliner Verkehrsbetriebe hatten die Preise ihrer Tickets schon wieder erhöht.
Bennie und Nana hatten sich das alles vorher genau überlegt. Wie Leute das eben machen, die zu zweit von tausendeinhundert Euro im Monat leben.
Zwei Minuten nach dem Telefonat mit Sylvia, an das sie sich eigentlich ein Leben lang hätte erinnern müssen, wußte Nana partout nicht mehr, wie das Gespräch verlaufen war und was sie Sylvia geantwortet hatte. Aus Unsicherheit und Überforderung hatte sie vermutlich höfliche, belanglose Dinge gesagt. Ihr ging merkwürdigerweise das Wort »Präzedenzfall« durch den Kopf, und sie sprach Bennie gegenüber von »durch Schock hervorgerufener Amnesie«. Den passenden Ausdruck für ihren Zustand hatte sie natürlich parat, aber was passiert war, konnte sie immer noch nicht richtig einordnen. In Extremsituationen reagiere sie völlig ruhig, sagte sie zu Bennie. Der Schreck, die Angst würden erst später einsetzen. Als Kind hatte sie sich mit einem elektrischen Dosenöffner so in den Finger geschnitten, daß dieser wie etwas Fremdes, etwas, das schon nicht mehr richtig zu ihr gehörte, an ihrer Hand herabhing. Sie weinte nicht einmal, sondern ging langsam, eine tröpfelige Blutspur hinterlassend, die Straße hinunter bis zum Krankenhaus, das um die Ecke lag. Erst ein halbes Jahr später hatte sie wiederholt auftretende Alpträume von Fingern, die wie Salzstangen zerbrachen, und von Händen, die sich verformten und zerflossen wie Wachs.
Woran sie sich erinnern konnte, war, daß Sylvia anfing zu weinen, nachdem sie mit einer ungewöhnlich hohen, hektischen Stimme alles berichtet hatte.
Alles, was nach dem Telefonat kam, hatte Nana wiederum genau vor Augen. In einer völlig sinnlosen Präzision. Als würde die eigene Erinnerung sie absichtlich quälen wollen. Oder welchen Sinn sollte es haben, daß man Dinge, an die man sich später gern erinnern würde, oft innerhalb von Sekunden vergaß und andere, die einem das Weiterleben nur schwermachten, noch nach Jahren in allen Einzelheiten wiedergeben konnte?
Nana hielt den Hörer in der Hand und sah in die Wohnküche zu Bennie hinüber.
Er wollte gerade damit beginnen, die Innenwände des Schranks zu streichen. Als er die Schranktür öffnete, glaubte sie bis in den Flur riechen zu können, wie sich der kräftige frische Geruch der Lasur mit dem von altem, staubigem Holz, von Dachböden und Geheimnissen, von für immer Vergessenem und vergangenen Lebensabschnitten verband. Nana schien, daß sich ihr altes und ihr neues Leben untrennbar miteinander vermischten.
Sie sah jetzt, wie sich Bennies von den wenigen Nachmittagen im Park schon braungebrannter Arm auf und ab bewegte und wie das trockene Holz die glänzende, im Sonnenlicht funkelnde Holzlasur in sich aufsog.
Nana erinnerte sich genau, wie Bennie sich beim Anblick einer komplett gestrichenen Schranktür freute, sie von innen und außen erst prüfend, dann zufrieden betrachtete. Etwas Kindliches und Zuversichtliches lag in seiner Haltung.
Er schenkte ihr keine Aufmerksamkeit, da er dachte, sie spräche wieder einmal endlos mit Filou. Doch in diesem Moment wußte Nana bereits, daß sein Vater heute morgen völlig unerwartet gestorben war.
Dieser Moment, vielleicht eine halbe Minute, die ihr Wissen von seinem Nichtwissen trennte, war das schlimmste.
Wie oft hatte Nana schon das Gefühl gehabt, ihr Leben bliebe einfach stehen. Wochen, Monate, gleichförmig wie Hochebenen in den Anden – oder, prosaischer: wie eine ewige Warteschleife. Dieses Gefühl, daß man sich jeden Zentimeter Vorwärtskommen erkämpfen muß, jeder Schritt, jede Veränderung einem schwerfällt – und dann diese unglaubliche Geschwindigkeit, mit der alles auf den Kopf gestellt wird!
Ihr fiel plötzlich der sechzigjährige Mann ein, der mit ihr und Tausenden anderen im rauchverdunkelten New York über die Brooklyn Bridge rannte – diese plötzliche Nähe zu diesem so viel älteren Fremden, das lange Gespräch, die – nicht von Begierde geprägten – Blicke, der rasche Austausch von Adresse und Telefonnummer. Und dann: nie wieder voneinander gehört.
Sie hielt den Hörer in der Hand und schaute zu Bennie, der dreißig Sekunden länger in der alten Welt, der alten Zeitrechnung, lebte. Er erschien ihr so weit entfernt, wie er da vor dem Schrank stand. Vielleicht war das alles der Beginn einer neuen Fremdheit zwischen ihnen. Eben noch hatten sich ihre Ellenbogen beim Schrankstreichen berührt, hatten sie über Kinofilme gesprochen. Dieser Blitz, der zwischen sie fuhr.
Nana wußte einfach nicht, wie sie Bennie den Hörer übergeben sollte. Ob sie etwas andeuten sollte? Aber wie und was? War ein dummer Satz wie »es ist etwas Ernstes« nicht schon eine Art Euphemismus? Oder schlicht überflüssig? Sollte sie Bennie irgendwie, ja wie?, tief in die Augen schauen?
Für allzu psychologisch ausgebuffte Strategien war sie selber noch viel zu überrumpelt. Aber so zu tun, als ob es sich um einen gewöhnlichen Wochenend-Anruf von Bennies etwas zu anhänglicher Schwester handelte? Das wiederum kam ihr feige vor.
Sie hielt den Hörer in der Hand – die wartende und weinende Sylvia am anderen Ende der Leitung – und stand einige Momente im Flur, starrte auf die vielen Kabel, die auf ihre Füße zu krabbelten, um sich ihrer zu bemächtigen. Erst als sie nahezu panisch anfing, sich mit den Füßen aus diesem Schlamassel herauszustrampeln und dabei beinahe wieder hinfiel, legte sie den Hörer auf das Holzbrett mit ihrem Adreßbuch und stakste steifen Schrittes in die Wohnküche.
Jeder dieser Schritte fühlte sich eigenartig an, nicht nur wegen ihrer durchgedrückten Knie. Wie fremd ihr die Wohnung doch noch war. Die Sonne fiel direkter und greller als in ihrer alten Wohnung in die Küche, und Nana fühlte sich nicht wie bei ihrer ersten Wohnungsbesichtigung wohlig durchwärmt, sondern unangenehm bloßgestellt. Jeder Schritt schien ihr schwerer, unvorstellbarer – plötzlich hatte sie das Gefühl, an Agoraphobie leidende Menschen verstehen zu können.
Während sie durch den großen, leeren Raum schritt, schoß ihr wieder durch den Kopf: Was sage ich Bennie bloß? Sie nahm sich vor, ihm in die Augen zu schauen, und schaffte es nicht. Vielleicht, dachte sie später, wollte ich in diesem Moment einfach nur diskret sein. Bennie sollte den Tod seines Vater erst einmal »für sich allein haben«, ihm wenigstens einmal ganz kurz allein gegenüberstehen, diesem Tod seines Vaters, bevor sie ihn die restlichen Jahrzehnte ihrer Beziehung teilen, aufteilen und zerreden würden.
Sie sagte – fast im Befehlston: »Für dich! Deine Schwester Sylvia!«
Als nächstes fragte sich Nana, ob sie die Tür hinter Bennie schließen solle, damit er in Ruhe telefonieren könne. Oder würde das abweisend wirken? Er zog die Tür dann selber hinter sich zu.
Die Zeit, bis Bennie zurückkam, zerrann unglaublich langsam. Die hochsommerliche Sonne schien zu stark in ihre noch viel zu kahle Wohnung. Nirgendwo gab es Schlupfwinkel, gemütliche Kramecken, einen schattigen Platz; sie fühlte sich allem, auch dem Schicksal, unmittelbar ausgesetzt, my home is not yet my castle. Nur der dunkle Schrank mit seinem erdig-harzigen Geruch war wie ein Meteorit aus einer anderen Welt, genauer gesagt aus der Kindheit von Bennies Vater, hier hineingeraten.
Nana stand in der Küche, frei und einsam wie eine Vogelscheuche auf einem offenen Feld. Sie, die immer etwas zu tun hatte und gern über einen »vollen Terminkalender« klagte, konnte nichts anderes tun, als zu warten und zu schwitzen.
Einen Moment lang überlegte sie tatsächlich, ob sie irgendeinen Roman, einen Film, ein Theaterstück kennen würde, in dem jemand in der gleichen Situation wie jetzt sie war. Ihr fiel nichts ein – was wahrscheinlich wiederum ihrer momentanen Verwirrung zuzuschreiben war. Ihr fiel aber auch keine Freundin ein, die so etwas erlebt hatte, ganz genau diesen Moment … Man erfuhr doch nie von diesen ersten Stunden nach solch einer Nachricht – was man nachher erfuhr, war eine Erzählung, eine story, schön aufbereitet für die Weitergabe an Dritte. Nicht mal der Tod konnte das Muster der Erzählung verwirren. Plot bleibt Plot. Wie ist das, wenn man plötzlich ungefragt Kenntnis über das vielleicht Intimste erhält, was ein anderer, wenngleich geliebter Mensch in seinem Leben erfahren kann?
Während Bennie mit Sylvia telefonierte, ertappte sich Nana dabei, an den Tod von Fridolin zu denken. Was für ein unpassender Gedanke! Aber was war jetzt schon passend? Setzte das Wort »passend« nicht voraus, daß man die Form, den Rahmen, den Kontext kannte, in den etwas hineinpassen sollte? Großeltern, Onkel, Tanten, von jedem einzelnen Tod hatte sie stets nur durch einen Trauerbrief bzw. aus dem Munde ihrer Mutter erfahren. Wohlfeile Worte. Die Ruhe nach dem Sturm. Dabeigewesen war sie nie. Aber als Fridolin nach wochenlanger Qual an Krebs starb, hatten Filou und sie gemeint, nichts Vergleichbares bislang erlebt zu haben. Sie waren damals acht gewesen. Noch Jahre pflegten sie Fridolins Grab hinter den Mülltonnen und dem Flaschencontainer im dritten Hinterhof.
Bennies Vater war tot, und sie dachte allen Ernstes an ein Meerschweinchen.
Als Jacques, ihre große Liebe vor Bennie, mit seinen zwei Überseekoffern ihre Wohnung verließ, blieb etwas eingetrockneter Sand auf der Türschwelle. Der Sand trug noch das Muster seiner Schuhsohlen. Wie lange hatte Nana diese Spuren nicht weggefegt. Besucher lotste sie unter Vorwänden daran vorbei. Das Schlimmste aber war die Stille gewesen. Wie hatte sie sich plötzlich nach den Nächten gesehnt, in denen sie in voller Lautstärke herumgebrüllt hatte: »China und so lang! Und was ist mit uns? Karriere geht dir über alles? Nie hätte ich geahnt, daß du solche Prioritäten setzen könntest!«
Später war der Adressat oder vielmehr die Adressatin ihres Ärgers eine gelangweilte Psychotherapeutin mit strähnigen Haaren und ausgebeulten Jeans gewesen.
Die Stille. Damals fing es an mit dem Hyperventilieren. Lautes Atmen gegen die Stille. Die Freundinnen, die immer reden wollten, die glaubten, Nana müsse sich nun richtig aussprechen. Die glaubten, sie bräuchte jetzt »Ablenkung«. Bei Fridolin wie später bei Jacques. Alles, was sie wollte, war, im Regen hinter den Mülltonnen zu stehen und klatschnaß zu werden beziehungsweise auf dem Globus die Entfernung von Berlin nach Shanghai staunend mit den Augen abzuwandern. Vor und zurück, zurück und vor. Einatmen, ausatmen, ein und aus und ein. Und bloß nicht zu schnell.
Plötzlich bekam Nana Angst. Angst vor dem Moment, wo Bennie vom Telefon zurückkam, Angst davor, diese Wohnung einzurichten, Angst vor der nächsten Vernissage – sie wußte nicht, was mit ihr los war. Eine Weile lang hielt sie die Hände vor ihr Gesicht und drehte sich von der Sonne weg. Bis sie das Brennen im Nacken nicht mehr aushielt.
Dann hockte sie sich im Schatten des Schranks auf das frisch verlegte Linoleum, das durch die Hitze unangenehm zu riechen begonnen hatte. Auch die Farbe des Bodenbelags, ein heller Sandton, den sie vor drei Tagen noch phantastisch gefunden hatte, störte sie plötzlich. Wie sehr wünschte sich Nana jetzt ein Moosgrün, ein Taubengrau, ein tiefes Blau, irgend etwas, das den Blick verengte. Etwas – Vertrautes. Ihr Kiefer, ihre Schultern, ihre Hüften, ihre Knie, alles tat ihr weh, so verkrampft saß sie da. Plötzlich verwandelte sich Nanas Angst, ihre Anspannung in den drängenden Wunsch, etwas zu unternehmen. Sie schoß hoch, durchschritt aufmerksamen Blickes die Wohnküche, das Schlafzimmer und ihr Arbeitszimmer und dachte krampfhaft darüber nach, wo sie in der neuen Wohnung ihre drei selbstgemalten Bilder aufhängen könnte. Diese Kahlheit, diese Leere – sie hatte auf einmal das Gefühl, sie keine fünf Minuten mehr ertragen zu können. Die hohen Wände waren für Bennie und sie ein Argument für die Wahl dieser Wohnung gewesen – jetzt jedoch hatte sie das Bedürfnis, sie so schnell wie möglich von oben bis unten vollzuhängen. Sie dachte an ihre Bilder: sprühende Farben. Ein bißchen zuviel Hellgrün, zuviel Kobaltblau. Freilich: umhegt, umgrenzt von bleifarbenen Linien, ein geordnetes, diszipliniertes Chaos war das, kein Wildwuchs. Natürlich nicht.
Sie fand ungefähr zehn Stellen, an denen sie sich die Bilder gut vorstellen konnte, und jeder Platz wäre besser als der, wo sie jetzt abgestellt waren, nämlich neben zwei Umzugskisten im Bad.
Nana war schon drauf und dran, die Bohrmaschine und Sechser-Dübel aus der Werkzeugkiste zu holen, als ihr der Gedanke kam, daß solch ein Lärm auf Bennie und Sylvia, die ihn auch hören würde, ziemlich pietätlos wirken könnte.
Sie fragte sich nun, was sie statt dessen tun könnte, um ihre Hände und damit hoffentlich auch ihren Geist zu beschäftigen. Natürlich fiel ihr der Schrank wieder ein. Aber wen interessierte es schon, ob ein Schrank fertig lasiert wurde, wenn er gerade seinen Vater verloren hatte?
Sie nahm den Pinsel und setzte da an, wo sie vorhin aufgehört hatte. Während sie die abgebrochene Bahn weiterzog, fing sie plötzlich an zu weinen. Erst jetzt wurde ihr bewußt, daß sie Bennies Vater nie wiedersehen würde. Nie würde sie sich ein eigenes Urteil über ihn bilden können, nie verstehen, warum Bennie zu Hause so anders war als in Berlin. Sie lehnte ihren Kopf an die Schranktür. Ihre Tränen fielen auf die glänzende Holzlasurbahn und hinterließen helle Krater, die sie für immer an diesen Tag erinnern würden.
Nana weinte nicht gern, sie empfand es als Kapitulation. Beim Weinen verlor sie vollkommen die Kontrolle, verrannte sich in die alte gedankliche Sackgasse, in die sie auch bei Fridolins Ableben, beim Tod ihres Großvaters, beim Selbstmord eines Nachbarn und nach dem Verlust ihrer Lieblingskette in einer Jugendherberge hineingeraten war: Ich sehe sie nie wieder! Sie konnte sich das nicht wirklich vorstellen. Wie kann man ein Wort wie »nie« begreifen? Oder »endlich«? Schon als Kind quälte es sie, daß sie sich weder vorstellen konnte, daß das Weltall endlich noch daß es unendlich war. Sie hatte so lange über diese Frage nachgedacht, bis sie ein unglaublicher Schläfenkopfschmerz quälte. Und sie hatte es gehaßt, diese Frage, ohne auch nur eine im entferntesten befriedigende Antwort gefunden zu haben, auf sich beruhen zu lassen und von ihrer Mutter vor die Rotlichtlampe geschoben zu werden, um diese dämlichen Kopfschmerzen loszuwerden.
Zweimal hatte sie Bennies Eltern bisher gesehen. Das erstemal hatten Bennie und sie einen Abstecher zu den beiden auf einer Reise nach Prag gemacht. Als Paul ihr entgegenkam, war sie überrascht, wie schlank und sportlich er aussah. Sie hatte sich einen Wüstentierspezialisten irgendwie weniger attraktiv, gebeugter, vielleicht sogar am Stock gehend vorgestellt. Er trug einen gepflegten weißen Bart und knielange Shorts (da sie ihn beide Male im Sommer gesehen hatte, schien es ihr, er hätte jahrein, jahraus kurze Hosen getragen), und sie erinnerte sich an seine Hände – diese großen, aber nicht zu derben Männerhände, die auch Bennie hatte.
Das Haus überraschte sie ebenfalls. Es war auffallend dunkel und vermittelte trotz seiner Größe einen höhlenartigen Eindruck. Das hellste Licht spendeten die zahlreichen Terrarien.
Das Wohnzimmer, das mit schweren flaschengrünen Polstermöbeln und einem wuchtigen Ledersofa eingerichtet war, wurde von einem langgestreckten Terrarium mit orangerotem Tropenlicht dominiert. Der Fernseher wirkte neben ihm wie ein achtlos zur Seite geräumtes Spielzeug. Vor dem Terrarium lag ein abgenutztes braunes Cordkissen, von dem Nana auf einen oft hier sitzenden Beobachter schloß. Der höhlenartige Charakter des Raumes wurde durch die Gemälde und gerahmten Poster an den Wänden unterstrichen: Entweder zeigten sie sehr deutsche Landschaften – kleine Pfade, die in dichtem Wald auf Nimmerwiedersehen verschwanden, rotwangige Wanderer mit frohgemut ausholendem Schritt, denen in ihrer ungestümen Wanderlust etwas Kindlich-Zielloses anhaftete – oder aber Fotos von Lurchen, Geckos und ähnlichem – Nana kannte die Unterschiede nicht. Die Tiere waren immer ein wenig heroisierend von schräg unten aufgenommen worden. Auf einem Poster standen sich zwei mächtige Echsen mit aufgestelltem rotschwarz geflecktem Kamm gegenüber. Darunter hatte jemand, vielleicht Bennies Vater, mit Bleistift geschrieben: »Galapagosinseln. Kampf der Giganten.«
In einem der Flure stieß Nana auf eine gerahmte Sammlung von Briefmarken aus aller Welt, die Echsen und dergleichen abbildeten. Da taten sich besonders pazifische Inselstaaten hervor. Je kleiner und unbekannter das Land, desto bunter und pompöser die Marken. Auf die Sammlung war extra ein Deckenstrahler gerichtet, hier war also etwas mehr Licht.
Richtig hell und weniger grottenhaft war eigentlich nur die Küche. Sie quoll über von Postkarten, Urlaubsfotos, krakeligen Kinderbildern, Topfpflanzen, Küchenkräutern, Hinstellerchen aller Art und war damit ziemlich eindeutig das Refugium von Bennies Mutter, die offenbar sonst nicht viel Mitspracherecht hatte, was das Haus und seine Einrichtung betraf.
Zunächst hatte Bennies Vater Nana seine Wüstentiere gezeigt. Sie erinnerte sich, daß sie von Pauls Wüstenwaran Overlord – so nannte er ihn, weil er einen überraschend anspringen konnte – besonders beeindruckt war. Paul erklärte ihr, daß für wechselwarme Tiere in der Wüste die ständige Kontrolle der Körpertemperatur überlebenswichtig sei. Deshalb trägt der Wüstenwaran eine Art »Thermometer« auf dem Scheitel. Dieses »dritte Auge« enthält lichtempfindliche Zellen, mit denen er tatsächlich die Intensität der Sonnenstrahlen messen kann. Er tritt nur dann aus seinem Versteck hervor, wenn eine bestimmte, für ihn noch ungefährliche Temperaturhöhe nicht überschritten wird.
Nana ertappte sich bei dem Gedanken: So ein eingebautes Thermometer wie diese dicke Echse da hätte ich auch gern, aber sie schwieg lieber. Paul wirkte nicht unbedingt humorvoll.
Pauls Büro war von Chromregalen und dunklen Aktenordnern beherrscht, irgendwie maskulin, mußte Nana denken, obwohl sie sich die Begriffe »feminin« und »maskulin« seit Jahren abzugewöhnen versuchte.
In dem abweisenden Zimmer hing wie das Symbol einer fernen Hoffnung ein großes gerahmtes Poster mit dem goldenen Schriftzug »Atacama-Wüste«: kobaltblaues Meer, glitzernde Gischt-Schaumkronen, in der Sonne leuchtende Küstenstreifen, buttergelbe Wüste, dahinter die schneebedeckten gestochen scharfen Gipfel der Anden – im Bildvordergrund eine im Sand eingerollte Schlange, von der man nur die hellbraun gesprenkelte Augenpartie sah. Bei ihrem Anblick meinte man das Beben ihres Körpers unter dem Sand spüren zu können. Was für ein heimtückisches Vieh!
Neben dem Poster hing eine Schwarzweißaufnahme von Bennies Großvater in einer Tropenuniform. Später hatte Nana erfahren, daß er in Nordafrika gefallen war.
Sein Blick beherrschte den ganzen Raum.
Dann zeigte Bennies Vater ihr die Springenden Nachtschwärmer. Sie konnten aus dem Stand heraus zwei bis drei Meter weit springen und hatten ein entsprechend großes Terrarium, das größte, das Nana bisher in einem Privathaushalt gesehen hatte. Paul hatte es liebevoll und durchaus originell mit Steinen, Agaven, Wüstenblumen und kleinen Dünen ausgestattet. Mit der Terrariengestaltung hatte er sich offenbar mehr Mühe als mit dem Haus gegeben.
Anschließend gingen sie in den Garten. Bennies Eltern hatten nicht alles in Reih und Glied gepflanzt, wie Nana es sich bei den alten Herrschaften vorgestellt hatte. Auf einer Wiese stand eine Holzbank malerisch unter Apfelbäumen, einen großen flachen Stein daneben nutzen Bennies Eltern als Ablage für Bücher und einen Stapel zerlesener Geo-Hefte. Im Schatten des Hauses war ein Fischteich angelegt, Heidelbeer- und Stachelbeersträucher säumten kleine Wege. Am Ende des Grundstücks stand das Wüstenbienenhaus. Es war unterteilt in einen Bereich mit Bienen, die in Stöcken wohnten, und einen, in dem rötlicher Sand auf verschiedene Ebenen verteilt war. Hier hausten die Sand- oder Wüstenbienen. Sie gruben ihre Stöcke ins Erdreich, um sie auf diese Weise vor dem Austrocknen zu schützen.
Bevor Nana das Bienenhaus betrat, setzte Bennies Vater ihr einen Imkerhut auf. Als er mit ernster Miene das Netz noch ein wenig zurechtrückte, fand sie seine Nähe angenehm; es ging etwas durchaus Bezwingendes von ihm aus. Es war eine instinktive Zuneigung, die sie zu Paul hatte – obwohl sie sicher kaum eine Ansicht mit ihm teilte und davon überzeugt war, daß er sehr autoritär sein konnte.
Das Gespräch am Kaffeetisch drehte sich bald um die Schwierigkeiten, die Paul gerade mit der Tierhandlung hatte. Paul meinte, daß das Interesse an Wüstentieren in den letzten Jahren stark zurückgegangen sei. Die vieldiskutierte »Rückkehr ins Private« habe nicht zu einem neuen Interesse an exotischen Heimtieren geführt. Die Leute würden diese absolut einzigartigen Erdenbewohner plötzlich für Luxusartikel, für so etwas wie überteuertes Parfüm oder schicke Kugelschreiber, halten und sich lieber eine Kaffeemaschine oder ein Paar ordentlicher Winterstiefel kaufen. »Exotische Tiere und wirtschaftliche Stagnation in Deutschland, das verträgt sich nicht gut«, hatte Paul noch gesagt.
Später hatte sie erfahren, daß er die Tierhandlung schließen mußte. Wie eigentümlich distanziert Bennie und sein Vater doch miteinander umgegangen waren, obwohl beide offenbar gerade in einer ähnlichen Situation steckten: Bennie hatte die, wie er dachte, Stelle seines Lebens verloren. Er hatte als Journalist für eine der größten Zeitungen Deutschlands gearbeitet, die aber mit einemmal sehr viele Mitarbeiter entlassen mußte. Nach der Kündigung hatte er sich bei mehreren anderen Blättern beworben, aber gab es nicht Journalisten wie Sandkörner in der Wüste? Bennie, der nicht zu Trübsal neigte und dessen spielerische und phantasievolle Art sie von Anfang an sehr mochte, hatte kurzerhand mit Clyde die Galerie gegründet, die Malkurse in dem Jugendclub angeboten und ein Stadtteilmagazin ins Leben gerufen.
Bei ihrem zweiten Treffen mit Bennies Eltern – sie hatten bei Sylvia und Jan zu Sylvias vierzigstem Geburtstag in der Gartenlaube gesessen – war das Gespräch wieder sehr schnell auf die Arbeit gekommen, und Bennies Vater war froh zu hören, daß Nana, die inzwischen an der Uni unterrichtete, einen »richtigen Beruf« hatte und nicht, wie Bennie, »so dies und das« machte. Daß Nana für ihren Einführungskurs in Gedächtnisforschung vierhundert Euro pro Semester bekam und die Reader für die Studenten aus eigener Tasche bezahlen mußte, nahm er nicht recht zur Kenntnis. Nana hatte zu Bennies Verteidigung leicht entrüstet eingewendet, daß eine Galerie zu leiten, ein Stadtteilmagazin herauszugeben, Kunstkritiken zu schreiben und Malkurse in einem Jugendclub zu geben ihrer Meinung nach nicht »so dies und das« sei. Aber Bennies Vater schien vor allem zu irritieren, daß Bennie so vielen Jobs gleichzeitig nachging. Für ihn fehlte, wie er mehrfach betonte, »der Rahmen, das große Ganze«. »Wie kann man da etwas aufbauen? Ein jahrelanges, jahrzehntelanges, wie soll ich sagen, zielgerichtetes Arbeiten, kannst du dir so etwas überhaupt vorstellen?«
Bennie hatte höflich versucht, einen Seufzer zu unterdrücken. Dieser Dialog schien schon öfter stattgefunden zu haben. Natürlich wußte Nana, daß Bennie diese Art von »monumentalem« Denken, dem alle anderen Lebensbereiche untergeordnet werden, ziemlich fremd war. Zumindest, seitdem er schon einmal im Schnelldurchlauf (im Vergleich zu seinem Vater) erfahren hatte, was es bedeutet, wenn das eigene Geschäft bankrott geht. Bankrott, das war fast ein altmodischer Ausdruck – heute sprach ja jeder nur noch von Insolvenz. Das klang eleganter, harmloser. Bennie hatte Ende der neunziger Jahre mit seiner damaligen Freundin ein Luftballongeschäft gestartet, das, nachdem in Prenzlauer Berg und Mitte viele junge Leute Kinder bekommen hatten, kurze Zeit boomte. Bis es in irgendwelchen Billigläden Kopien von Bennies selbstgestalteten, ausgefallenen Luftballons gab, die die Hälfte kosteten.
Das einzige Argument, das Nana zu Bennies Verteidigung aufbrachte und das Paul ein wenig einzuleuchten schien, war, daß man mit verschiedenen Tätigkeiten weniger Gefahr lief, arbeitslos zu werden.
Etwas unvermittelt hatte Paul Nana gefragt, ob sie Chamäleons mögen würde. Spontan hatte sie »ja« gesagt. Chamäleons waren ihr ebenso wie Pinguine, Nasenbären oder Zebras sympathisch, ohne daß sie dies hätte begründen können. Bennies Vater schien hocherfreut und begann etwas umständlich zu erklären, daß Chamäleons ausgesprochene Wüstenliebhaber seien, was viele Menschen gar nicht wüßten, wie ihm immer wieder aufgefallen sei. Überhaupt hätten viele Menschen gar keine Vorstellung von der Flora und Fauna der Wüste. »Es ist unglaublich, wie diese Tiere unter den härtesten Bedingungen überleben können!« rief er aus und wiederholte, »unter den härtesten Bedingungen.« In Wadis, also in ausgetrockneten Flußläufen, würden Chamäleons bevorzugt leben. Aber anstatt wie viele Wüstentiere nomadenhaft mit dem Nahrungsangebot mitzuziehen und dabei riesige Strecken zurückzulegen, würden sie oft ihr Leben lang ein einziges Wadi, ein paar Quadratmeter Krüppelbüsche, nicht verlassen und einfach nur ihre unglaublich lange Zunge zur Nahrungsaufnahme entrollen. Statt Kraft zu vergeuden und hier und da herumzuspringen, hätten sie auf ein »Talent« gesetzt und damit erfolgreich ihre Überlebensstrategie optimiert.
Nana erinnerte sich nicht mehr genau an den weiteren Gesprächsverlauf. Es wurde wohl das Abendbrot serviert und das bei aller pädagogischen Absicht nicht ganz speisetaugliche Thema der Nahrungsaufnahme mit der langen Zunge fallengelassen.
Beim Essen driftete das Gespräch noch einmal kurz in die Politik ab. Bennies Vater schimpfte wenig sachkundig über die Rolle der Gewerkschaften, und niemand, außer Bennies älterem Bruder David, widersprach. David sah seinem Vater ebenfalls ähnlich, wirkte jedoch in sich gekehrter, irgendwie unberechenbarer als Bennie.
Bennie ließ die Bemerkungen seines Vaters unkommentiert im Raum stehen, ergriff aber auch nicht für David Partei, obwohl der eigentlich genau die Ansichten vertrat, die Bennie sonst Nana gegenüber geäußert hatte. Statt dessen ging Bennie zum bei seinem Vater offenbar stets willkommenen Thema »Klimakatastrophe« über.
Später hatte sie es bereut, daß Bennie und sie nicht einen Tag länger geblieben waren. Im Kreis seiner Familie hatte sie ihn plötzlich so anders erlebt, viel unentschlossener, ausweichender, irgendwie passiver als zu Hause, wo er den Kopf ständig voller Ideen hatte und ebensoviel redete wie jetzt sein Vater. Gegenüber seinem eigenbrötlerischen, aber auch energisch wirkenden Vater kam er nicht recht zur Geltung.
Die Vorstellung, daß Bennie noch irgendwo anders als in Berlin verankert war (der Gedanke an ein kleines Dorf war ihr sehr angenehm) und daß es Menschen gab, die ihn viel besser kannten als sie, hatte etwas Beruhigendes für sie gehabt. In Berlin lebten sie von der Hand in den Mund und wußten nie, was der nächste Tag bringen würde. In ihrem Freundeskreis gab es überraschende Trennungen, ebenso überraschende Hochzeiten, Kinder, tot geborene Babies, verschwundene Väter oder Mütter, esoterisch-erleuchtet Zurückgekehrte, Selbstmorde, schillernde Erfolge, Identitätsverwirrungen, Ekstasen … Das einzige Kontinuum in ihrem eigenen Leben war, dachte Nana, daß sie nie Geld hatte.
Die Nässe der Tränen tat gut bei der Hitze, sie weinte nicht mehr richtig, sie spürte nur die Tränen ihre Wangen und ihren Hals hinab in den T-Shirt-Saum laufen. Sie kannte Bennie noch nicht wirklich lange, sie waren erst dabei, sich aneinander heranzutasten. Gerade erst war sie seiner Familie – dieser großen Familie aus einer ganz anderen Ecke Deutschlands – ein bißchen näher gekommen, da wurden die Karten schon wieder neu gemischt, veränderte sich alles, stand alles kopf. Jetzt würde das Haus aufgegeben werden; wer weiß, wo Bennies Mutter hinziehen würde, vielleicht zu einer der beiden älteren Schwestern, zu Sylvia oder zu Anna – darüber würde es sicher noch Streit geben. Und nie wieder würde sie Bennie und seinen Vater zusammen an einem Tisch sitzen sehen.
Als Nana hörte, wie Bennie den Hörer auflegte, wischte sie sich die Tränen ab, denn sie hatte sich vorgenommen, »stark« zu wirken. Sie war inzwischen zu der Überzeugung gelangt, daß es für einen Mann, der gerade seinen Vater verloren hatte, das Beste sein müßte, eine zuversichtliche, »starke« Frau an seiner Seite zu haben, die »warmherzige Souveränität« ausstrahlte. Sie konnte diesen Gedanken kaum denken, ohne sich gleich darüber lustig zu machen, dennoch: Wie sollte sie jetzt mit Bennie umgehen? Sollte sie ihm vorschlagen, einen Spaziergang zu machen? Oder sich mit einem eisgekühlten Wasser an den Küchentisch zu setzen? Oder fragen, ob er erst einmal allein sein wollte?
Obwohl Nana die ganze Zeit auf diesen Moment gewartet hatte, schien er ihr auf einmal zu schnell gekommen. Erschrocken ließ sie den Pinsel in den Lasurtopf sinken. Erst starrte sie Bennie einfach nur an, dann lief sie wie ein kleines Mädchen auf ihn zu, streckte zaghaft eine Hand nach ihm aus, zupfte unsicher an seinem Hemd und senkte den Kopf. Bennie legte ihr eine Hand auf die Schulter – dann hatte sie wieder geweint, nicht er.
Sie hielten sich wortlos aneinander fest. Schließlich ließ er sie los und ging ins Schlafzimmer. Plötzlich war ihr klar, daß Bennie jetzt das tun würde, was er in jeder schwierigen Situation als erstes tat: sich eine anzünden. Sie hatte ihn breitbeinig auf dem Bett sitzen sehen, es war heiß, und ihm floß der Schweiß übers Gesicht. Sein Gesicht war leicht vom Rauch verhüllt, sein Blick war auf den Boden gerichtet, er hätte auch gerade verhaftet worden sein können.
Sie hatte ihn sehr begehrt in diesem Moment.