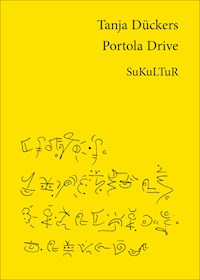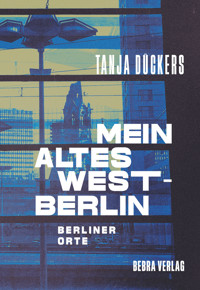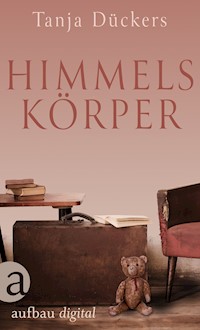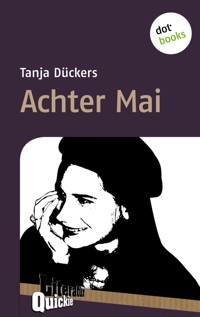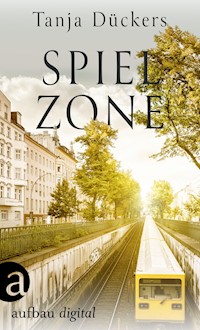
10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein rasanter Patchwork-Roman über das Szeneleben in Berlin zwischen Hippness, Überdruß und der Hoffnung auf so etwas wie Liebe
Berlin, Ende der neunziger Jahre, eine Stadt zwischen Provinzialität und Szeneleben. In Neukölln und Prenzlauer Berg - genauer in der Thomas- und in der Sonnenburger Straße - treffen beide Welten aufeinander. Da sind zum Beispiel Elida und Jason, zwei Paradiesvögel in Neukölln, die in schrillen Siebziger-Jahre-Klamotten herumlaufen. Von den Nachbarn werden die beiden Traumtänzer neugierig-wohlwollend beobachtet, von einem biederen Angestellten sogar vom Dach einer Friedhofsgruft observiert.
Für die jungen Leute ist Neukölln trotzdem ein langweiliger, fast verslumter Bezirk, ohne Szene, Spaßkultur oder Events. Die gerade findet man in Prenzlauer Berg, weswegen auch die Studentin Katharina dorthin zieht. Sie trifft auf Szenegänger zwischen zwanzig und dreißig, die ständig auf der Suche nach angesagten Locations sind, Eventhunting betreiben und natürlich ihr freizügiges Sexleben ausstellen. Dennoch holen sie auch hier Gewöhnung und Überdruß ein - und plötzlich geht es einfach wieder um so etwas Altmodisches wie Liebe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 323
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über das Buch
Ein rasanter Patchwork-Roman über das Szeneleben in Berlin zwischen Hippness, Überdruß und der Hoffnung auf so etwas wie Liebe
Berlin, Ende der neunziger Jahre, eine Stadt zwischen Provinzialität und Szeneleben. In Neukölln und Prenzlauer Berg – genauer in der Thomas- und in der Sonnenburger Straße – treffen beide Welten aufeinander. Da sind zum Beispiel Elida und Jason, zwei Paradiesvögel in Neukölln, die in schrillen Siebziger-Jahre-Klamotten herumlaufen. Von den Nachbarn werden die beiden Traumtänzer neugierig-wohlwollend beobachtet, von einem biederen Angestellten sogar vom Dach einer Friedhofsgruft observiert.
Für die jungen Leute ist Neukölln trotzdem ein langweiliger, fast verslumter Bezirk, ohne Szene, Spaßkultur oder Events. Die gerade findet man in Prenzlauer Berg, weswegen auch die Studentin Katharina dorthin zieht. Sie trifft auf Szenegänger zwischen zwanzig und dreißig, die ständig auf der Suche nach angesagten Locations sind, Eventhunting betreiben und natürlich ihr freizügiges Sexleben ausstellen. Dennoch holen sie auch hier Gewöhnung und Überdruß ein – und plötzlich geht es einfach wieder um so etwas Altmodisches wie Liebe.
Über Tanja Dückers
Tanja Dückers wurde 1968 in Westberlin geboren. Sie studierte Nordamerikanistik, Germanistik und Kunstgeschichte. Neben Prosa und Lyrik schreibt sie Essays, Hörspiele und Theaterstücke. Sie erhielt zahlreiche Preise und Stipendien, die sie u.a. nach Kalifornien, Pennsylvania, Gotland, Barcelona, Prag und Krakau führten. Sie lebt in Berlin.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
https://www.aufbau-verlage.de/newsletter-uebersicht
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Tanja Dückers
Spielzone
Roman
Übersicht
Cover
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Die Thomasstraße
Kobaltblau
Laura
Frühlingssalat
Walkman
Sonnenblumenblusen
Die Neptunier
Das Wörterbuch und das Krokodil
Der Plattenkäufer
Kobaltblau Reprise
Der Umzug
Die Sonnenburger Straße
Katharina
Ada und Alice
Abrasieren Ankleben
Karaul
Ada ist nicht Paul
Cats Lächeln
Ernie und Leo und Benno und Bert
It’s all over now, Baby Blue
Feuer im Rücken
Die Nachtburger (Ada Reprise)
Impressum
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Newsletter
Die Thomasstraße
Kobaltblau
Laura
Frühlingssalat
Walkman
Sonnenblumenblusen
Die Neptunier
Das Wörterbuch und das Krokodil
Der Plattenkäufer
Kobaltblau Reprise
Der Umzug
Die Sonnenburger Straße
Katharina
Ada und Alice
Abrasieren Ankleben
Karaul
Ada ist nicht Paul
Cats Lächeln
Ernie und Leo und Benno und Bert
It’s all over now, Baby Blue
Feuer im Rücken
Die Nachtburger (Ada Reprise)
Impressum
Die Thomasstraße
Kobaltblau
Da sind sie. Für Sekunden bohrt sich die Spitze des Fleischspießes durch ihre Köpfe, die in der dunstbeschlagenen Scheibe eines Döner-Ladens gespiegelt werden. Sie stolzieren weiter die Hermannstraße entlang. Zurück in ihre Wohnung. Vor ihnen schwankt ein Mann in abgelatschten Cowboystiefeln. Eine Bierspur auf dem frisch gefallenen Schnee.
Da sind sie. Die schlanke Frau in einem Nixenkleid, hautenges türkisfarbenes Nylon mit Schuppenmuster, und einer wie ein Fischschwanz aufgefächerten Schlaghose, wäscht Broccoli. Der Junge mit langem blauschwarzen Haar in einem »Ziggy Stardust«-Outfit putzt Mohrrüben und preßt Zitronensaft. Irgendwann legt er seine Hände von hinten um ihre Taille, zupft spaßhaft an einem an Algen erinnernden, seltsamen Geflecht in ihrem hochgesteckten Haar. Dann setzen sie sich auf den Kühlschrank, sie auf seinem Schoß, meerblaues PVC unter ihren baumelnden Füßen, löffeln Quark aus kleinen Schalen.
Ich drücke meine Zigarette zwischen ein paar feuchten Blättern aus.
Jetzt kämmen sie sich gegenseitig die Haare. Sie flicht einen Seestern in sein Haar, er hält ihr zwei große Miesmuscheln auf die Ohren. Sie stützt sich am Kühlschrank ab; mit trägen, weichen Bewegungen, als hätte sie keine Knochen mehr in ihrem Körper, läßt sie sich auf einen mit blauem Flokati gepolsterten Küchenstuhl sinken. Streichelt ihre linke Brust. Zieht eine Obstschale über den Tisch heran, legt ihre Brust zwischen die Orangen und Äpfel und spielt mit den Apfelstielen an ihrer Brustwarze.
Meine Gläser sind schon wieder verschmiert.
Sie flüstern irgend etwas miteinander, das ich nicht verstehen kann; sie essen Erdbeeren und Broccoli, Zitronensaft darüber, zwei Mohrrüben für jeden zum Nachtisch, und Rosinen picken sie sich aus den Händen wie Kinder. Ob ich das jetzt auch tun soll? Ob ihre Haarfarben wohl echt sind?
Ich schlendere über den Thomas-Friedhof, grüße kurz Frau Minzlin, reibe meine rotgefrorenen Hände wieder aneinander. Lutsche einen Salbei-Bonbon.
Bach oder Byrds? Maria Callas oder Diana Ross? Da steht Jason wieder lächelnd, mit nichts weiter an als einem kobaltblauen Slip, und Elida nimmt seinen Schwanz in den Mund. Eine Weile tut er noch ungerührt, sortiert weiter Platten, dann läßt er die Platten fallen und zerrauft ihr die Haare. Diese langen, roten Haare, die sie jetzt um seinen Penis wickelt, ihre Hände auf seinen Pobacken …
Ich ignoriere den kalten Stein unter meinen Knien.
Hach, Gisela ist bestimmt schon längst zu Hause, ich muß mich verdünnisieren. Sie kann’s nicht leiden, wenn sie mit dem Essen warten muß. Beinahe wäre ich abgerutscht, erwische gerade noch den kleinen Vorsprung mit den nasenlosen Engeln; die alte Minzlin mit der Gießkanne hat mich zum Glück nicht beim Runterklettern beobachtet. Aus einem Augenwinkel sehe ich noch, wie die beiden in ihrer über und über mit blauen Plastikblumen geschmückten Badewanne liegen, Kiwis löffeln und ihre Zungen über ihre Körper gleiten lassen. Müssen sie denn nie einmal Dinge tun, wie den Müll runtertragen oder Schuhcreme kaufen?
Rotes Licht brennt drüben im ersten Stock, Musik schallt zu mir herüber. Elida legt ein Samtband mit einem Skarabäus um ihren Hals, kleine Muschelketten um ihre Fußgelenke, dann macht sie sich drei verschiedene Sorten Schokolade gleichzeitig: eine mit Wald-, eine mit Flieder- und eine mit Hibiskushonig. Jetzt legt sie sich zu Jason, der nach ekstatischem Tanzen zu »Baccara« sein grünglitzerndes Paillettenkostüm (hat er beim »Zauberkönig« auf der Hermannstraße gekauft) ausgezogen und sich nackt auf ihrem Sofa ausgestreckt hat. Sie löffeln abwechselnd aus den drei Schokoladenbechern. Das Zeug sieht so dickflüssig aus, als würde der Honiganteil bei 50 % liegen.
Bis morgen noch nennt er sich Jason, am Montag denkt er sich wieder einen neuen Namen aus. Genau eine Woche habe ich immer Zeit, den aktuellen herauszufinden. Zur Zeit hat er eine Schwäche für amerikanische Namen. Terence, Roy, Kirk. Elida (ob das ihr richtiger Name ist?) spricht sie alle gleichermaßen zärtlich aus.
Und ich schreibe. Terence, Roy, Kirk, so heißen sie alle, die schwerelosen Figuren, die durch meinen weißen Blätterwald gleiten. Das wissen sie natürlich nicht.
Ich kenne sie schon eine Weile, doch sie nehmen keine Notiz von mir. Elida: Ihretwegen habe ich gestern ein Buch mit »Urlaubsgeschichten« des Bastei Lübbe Verlags bestellt, weil ich das, als sie bei »Rudis Reste Rampe« an der Kasse stand, in ihrem Lackhandtäschchen gesehen habe. Jason: mit seinen glitzernden Satinhosen, solche hab ich mir früher immer gewünscht, aber meine Mutter verdrehte nur die Augen. Wie er in ihrem Zimmer tanzt, Elida lachend mit einer Lamettagirlande zu sich hinzieht, zu sich herunterzieht. Schöne braune Arme. Und diese Indianerhaare: Als Kind hatte ich so eine Perücke mit Federn dran; hat das damals Spaß gemacht, mich zu verkleiden. Dazu hat Jason dann blaue Augen, dieses Meerblau, das mich U-Bahnstationen verpassen und Bordsteinkanten übersehen läßt. Wenn Gisela und ich doch noch ein Kind bekommen sollten, werde ich es »Neptun« nennen (als zweiten Vornamen, versteht sich, nach Roy) und versuchen, es in den ersten Lebensmonaten so oft wie möglich Jasons und Elidas flüchtigen Blicken auszusetzen, und die dunklen Augen unseres Kindes werden einen ganz leichten, nur für mich erkennbaren Stich ins Bläuliche bekommen. Denn Gisela und ich haben braune Augen, aber ihre Augen haben die Farbe des Stillen Ozeans auf den Globen im Schaufenster von Karstadt.
Eine schöne Metapher, das mit den Augen und dem Stillen Ozean – diesen Satz werde ich in keiner meiner Geschichten unterbringen, nein, der ist für sie reserviert, der Stille Ozean. In meinem Kopf.
Müde bin ich heute, müde. Hab vorhin die falsche braune Schuhcreme gekauft und müßte eigentlich noch mal los. Dabei geh ich so ungerne auf der Hermannstraße einkaufen, einfach zu laut und anstrengend. Und das auch noch zweimal an einem Tag. Aber erst mal Kaffee und eine Scheibe Schwarzbrot. Die Thermoskanne und die Schnitte habe ich mitgebracht, falls ich heute lange auf meinem Plätzchen ausharren muß. »Paechbrot« steht auf der Tüte. Dabei fällt mir ein, wie Elida und Jason letztens Bekannte in der U-Bahn getroffen haben (ich schob mich im U 7-Gewühle in ihre Nähe), die ihnen irgend etwas über PC, Political Correctness, erzählt haben. Und Jason amüsierte sich, weil er dachte, das sei eine neue Abkürzung für »Penis« und »Clit«. So sind sie. Ich selber habe leider selten das Vergnügen, einen Begriff oder ein Wort falsch zu verstehen. Egal, wo ich hingerate, in meinem Kopf oder auf dem Stadtplan, am Ende stehe ich doch immer bei uns zu Hause auf dem braunen Teppich.
Mir geht ein Vergleich durch den Kopf. Nur so. Weil die beiden keinen Funken Interesse an ihrer Umwelt haben (lesen natürlich auch nie Zeitung). Schon in der Schule hat mich die, wie soll ich sagen, Abgeschlossenheit von mathematischen Formeln fasziniert. Dieser Kosmos für sich, ob Kriege stattfinden oder die Menschen zum Mond fliegen, 2 mal 2 bleibt 4. Diese, ja, Ungerührtheit der Zahlen, ihre Absolutheit und Unnahbarkeit, das ist irgendwie der Reiz dabei, doppelte Buchführung zu machen im Abwasserpumpwerk, dieses tiefe Gefühl von Befriedigung, wenn sich alles in Symmetrie auflöst. Gisela denkt, ich hätte nur zuviel getrunken, wenn ich ihr gestehe, daß ich vor Zahlen, besonders vor der schönen 8, eigentlich einen Kniefall machen möchte.
In fünf Minuten schließt der Friedhof. Ist die Familie Peters, Karl-Otto und Magda, Paul und Ingrid, und die früh gestorbene Teresa, wieder für sich. Das Dach ihres Familiengrabs, zur Thomasstraße hin von Linden versteckt, dient mir als Beobachtungsplätzchen.
In Neukölln sind sie natürlich für alle Leute so etwas wie Tiere aus dem Zoo. Alle reden über sie, das ist noch freundlich gesagt, aber das scheint sie nicht zu stören, oder sie bemerken es einfach nicht. Einmal hat es ihnen doch etwas ausgemacht, da hat einer dieser gräßlichen Punks vor Karstadt einen Silvesterknaller an Jasons Samthosen geworfen, der zerriß ein Hosenbein, und es brannte sogar einen Moment. Jason fing plötzlich, nur ganz kurz, an zu weinen, eine Gesichtsentgleisung. Elida legte einen ihrer zarten Arme um ihn, flüsterte etwas, was ich nicht verstehen konnte. Sie haben gemeinsam mit ein paar Sicherheitsnadeln – daß sie so etwas dabeihaben, soviel Pragmatismus hatte ich ihnen gar nicht zugetraut – das, was von dem Hosenbein übriggeblieben war, zusammengesteckt, wobei Elida Jason die Knieinnenseiten und die Schenkel gestreichelt hat. Da versiegen Tränen schnell. Und dann sind sie natürlich in ihre unglaubliche Wohnung in der Thomasstraße gegangen, mein Schloß Charlottenburg von Neukölln.
Auch ich verschönere die Welt. Bin schließlich berufshalber damit beschäftigt auszurechnen, wieviel Liter Wasser in Tempelhof und Neukölln jeden Tag durch die Filteranlagen gehen.
Die Scheiben vom »Sarg Discount« auf der Hermannstraße sind so verschmiert, daß man den Glanz der lackierten Särge kaum erkennen kann, daneben die Pistolen bei »Waffen zweiter Wahl« stumpf und auf Pupillenhöhe. Schon wieder neue Graffiti an der Friedhofsmauer, irgendwas in Englisch, was ich nicht richtig verstehe. Fratzen dazugemalt. Wenn’s was Schönes wäre, hätte ich ja gar nichts dagegen, daß Wände und U-Bahnhöfe beschmiert werden. Die jungen Türken mit den Schmetterlingsmessern gucken komisch zu mir rüber. Nicht hinschauen, sagt Gisela immer. Die alte Becker räumt die Kränze vom Stand, da hinten stapft schon wieder Rosemarie Minzlin, die ich jeden Tag auf dem Friedhof sehe. Und jetzt schnell zu den Peters.
Drüben ist es zappenduster; Jason, ich meine Morris, und Elida sehen nie fern, hab noch nie das helle Flimmern in ihrer Wohnung bemerkt, das man bei den meisten Leuten abends sieht – im Moment kann man allerdings wegen dem Geblinke der ganzen Weihnachtsdekoration sowieso nichts davon erkennen. Keine Spur von Morris und Elida. Sehnsucht.
Ich habe kein Lieblingsbuch, aber eine Lieblingsstelle: in »Die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull«, das lese ich nämlich gerade in meinem Volkshochschulkursus über die Brüder Mann. Da gibt es eine Szene, wo Felix zu einem eleganten Geschwister- und/oder Liebespaar auf dem Balkon eines vornehmen Hotels hochschaut und die beiden gerade in ihrer Zweisamkeit so begehrlich findet. Wenn Morris und Elida sich eine Zeitlang nicht blicken lassen, verreist sind oder ganz von ihrer Zauberwohnung verschluckt, dann lese ich diese Stelle auf meinem Geheimplatz; nach 17 Uhr mit Taschenlampe.
Ich hab schon viel herausgefunden, war fleißig. Was ist Morris’ Lieblingssockenfarbe? Was für Kondome kaufen sie? Welche Farbe von Götterspeise bevorzugen sie?
Hellblau, Billy Boy, Kirsche. Jetzt ein besonderer Leckerbissen: Am 8. Dezember, ja, es war der 8., sind Elida und Morris nachts um 4 nach Hause gekommen. An der Ecke Altenbraker/Thomasstraße stand ein alter Chevrolet. Sie schlichen um das Ding herum, und dann, ich traute meinen Augen nicht, begann Morris mit irgend etwas am Schloß herumzufummeln, und zack ging die Tür auf. Und dann? Schraubten sie den Fahrersitz runter und schliefen miteinander. Eine halbe Stunde später kletterten Morris und Elida aus der schicken Kiste heraus, knallten die Tür zu und gingen nach Hause. Am nächsten Morgen konnte ich noch ein paar silberne Federn von ihren Federboas, die sie auch nachts im Partner-Look trugen, auf den Sitzen finden. Natürlich habe ich sie nicht angezeigt. Meine Neptunier. Obwohl ich das eigentlich … bisweilen denke ich, sie verwirren mich zu sehr. Was will ich eigentlich von ihnen?
Manchmal ärgere ich mich über sie.
Sie kaufen sich Karten für Ismael Ivo, die fünfzig Mark kosten, und lassen sie verfallen. Das ist doch blöde, so dicke haben sie’s ja nun auch nicht. Oder sie trödeln sich zwei Fahrräder, lassen sie unabgeschlossen im Hof stehen und wundern sich, wenn die am nächsten Tag weg sind. Aber es gibt auch Dinge, die man nicht bald wieder vergißt, Dinge, die die Liebe wirklich auf die Probe stellen. Zum Beispiel die Tatsache, daß Morris mal, ja, Pornodarsteller war. Das ging eindeutig aus einem Brief, den er von einem ominösen Herrn Ricker erhalten hat, hervor. Den habe ich in der U-Bahn doch gelesen! Morris hat mir nicht mal einen rügenden Blick zugeworfen, als ich mir fast die Pupillen ausrenkte. Das war letzten Sommer, als er dreimal die Woche mit der U 7 nach Schöneberg fuhr, um in einem Secondhand-Laden, der wie eine Garage aussah, Klamotten nach Farben zu ordnen und auf Bügel zu hängen. Was er jetzt macht, kann ich nicht sagen. Mir scheint, gar nichts. Elida hat hin und wieder in einem Esoterik-Klimbim-Laden in der Donaustraße gearbeitet. Saß still an der Kasse, in irgendwelchen Bildbänden über Indien oder die Galapagosinseln blätternd, guckte erst hoch, wenn ein Kunde vor ihrer Nase stand. Jetzt sitzt sie einmal im Monat walkmanhörend beim Arbeitsamt.
Die Sache mit den Pornoheften, das war ein ganz schlimmer Schock für mich. Als ich aus der U-Bahn ausstieg, hab ich mir erst mal im »Blauen Affen« am Hermannplatz einen Schnaps genehmigt und war den ganzen Tag, ach, die ganze Woche, verwirrt. Die Hefte habe ich tatsächlich aufgetrieben, das war nicht einfach, und es gab fürchterlichen Krach mit Gisela, die wegen einer Unaufmerksamkeit meinerseits die Hefte gefunden und beinahe in den Müll geschmissen hätte! Da ist wirklich Morris drin. Aber es gibt auch Augenblicke, in denen ich ihm das verzeihe, wo ich ihn unheimlich mutig, toll finde: er traut sich eben alles. Und dann gibt es Momente, wo ich es nicht begreifen kann. Für Geld. Um Geschirrspülmittel und Schuhcreme zu kaufen.
Aber das verdränge ich alles wieder und lege ihnen Blumen vor die Tür. Sie wundern sich kurz, nehmen sie dann und stellen sie in ihre Wohnung. Der Gedanke, daß diese Blumen, die ich da in meinen Händen gehalten habe, in den Zauber ihrer Wohnung geraten, sie sich gegenseitig mit ihnen streicheln, necken … Sie scheinen sich nie groß den Kopf zu zerbrechen, von wem die wohl sind. Sie nehmen sie einfach und erfreuen sich daran. Sie nehmen sich unbekümmert aus der Außenwelt das, was sie zur Ausstattung ihrer Innenwelt brauchen. Ich liebe sie.
Als ich das letzte Mal Morris’ Halsmuskulatur sah, Elida bewegte sich auf seinem Schoß auf und ab, ihre langen, roten Haare fielen über ihr Gesicht seinen Rücken hinunter bis fast an seine Hüften, und seine schönen, sehnigen Hände hinterließen feste rote Abdrücke auf ihren Pobacken, da wurde ich so unruhig, daß es mir fast den Kopf zersprengte. Aber – ich hab in ihrem Kosmos nix zu suchen. Wenn ich das bloß endlich einsehen würde. Eigentlich entzieht es sich auch meiner Vorstellungskraft, sie wirklich, ich weiß nicht, anzufassen oder so. Habe noch nie ein Wort mit ihnen gesprochen. Wenn ich versuche, ihnen auf der Hermann zuzunicken oder sogar ein Lächeln zustande zu bringen, wie letztens, als sie aus »Alibabas Imbiß« kamen, ignorieren sie mich völlig. Schauen geradewegs durch mich hindurch.
Ob ich einfach mal eine Anzeige in die Neuköllner Wochenpost setzen sollte?
»Nicht mehr ganz junger Betriebsleiter (stellvertretend), mittelgroß, nicht dick, besucht Schreibworkshops und Volkshochschulkurse. Hört Siebziger-Jahre-Platten (Disco/ Funk). Und möchte sehr gerne …«, ja, was eigentlich?
Na, ich weiß nicht. Alles Quatsch. Sie lesen das ja sowieso nicht (höchstens Gisela!).
Immer dieser beschissene Baustellenlärm an der Silberstein, da wird nichts Neues gebaut, nur ein paar stinkende Rohre ausgewechselt. In der braunroten Überpumpleitung das abgesaugte Grundwasser, 50 Kubikmeter pro Stunde. Taubenscheiße auf rostigen Scharnieren. Sollte man alle abballern, diese Ratten der Luft.
Morgen fahren wir nach Travemünde. Joachim und Cornelia besuchen. Nette Leute. Im Tierschutzverein hat Gisela sie kennengelernt.
Zähne putzen. Leise ins Bett gehen. Gisela schläft schon. Meine gelben Raucherzähne. Giselas Füße ragen aus dem Bett, gelbe Sohlen. Hornhaut auf meinen Zähnen. Ich träume wohl schon halb. Warum träume ich immer nur die Wirklichkeit weiter?
Hier bin ich wieder, Tageslicht. Tagebuch, Lexikon mit den vergilbten Seiten. Fragt mich doch irgend etwas. Nachwelt. Eine Welle, zwei Wellen, eine Welt. Ich verstehe nichts von Etymologie. Wenn es denn mal so heißt. Eine kleine Geschichte über David Bowie? Mein Idol, als ich 14 war. Diana Ross, Donna Summer. Hab alle ihre Platten. Im Schrank. Gisela mag sie nicht. »Stöhnplatten« nennt sie Donna Summers Siebziger-Jahre-Sachen. Diana Ross’ silberner Hosenanzug auf der Platte »Swept away« … oder Boney M.’s hautenge Kostüme auf »Nightflight to Venus«. Morris’ und Elidas kobaltblaue Plateau-Lackstiefel … morgens, auf meinem Weg zur Arbeit.
Morris’ und Elidas kobaltblaue Plateau-Lackstiefel, gespiegelt auf den verschmierten Scheiben vom »Sarg-Discount«, gespiegelt vor der bunten Tupperware bei »Rudis Reste Rampe«, vor den Teppichen mit türkischen Märchenmotiven, vor den Plastikengeln in der Hermann-Apotheke.
Morris’ und Elidas kobaltblaue Plateau-Lackstiefel … morgens, auf meinem Weg zur Arbeit. Wenn sie schlafen gehen.
Laura
Wir sitzen beim Abendbrot. Leise läuft im Hintergrund eine Easy-Listening-Cassette, meine Mutter guckt mich schon wieder wütend an: »Muß das sein, dieses Gedudel die ganze Zeit?«
Dann schaltet sie den Cassettenrecorder aus, die Nachrichten an. Meine Eltern verfallen in diese typische Nachrichten-Hör-Körperhaltung, Kopf zur Seite gelegt, Schultern schlaff nach vorne hängend, Bauch angespannt eingezogen. Irgendwas mit Rauchwolken über Indonesien, was interessiert mich das, eine Rauchwolke steigt aus unserem Toaster auf. Sven legt mir lachend den verkohlten Toast auf den Holzteller. Ich schütte ihm zum Spaß etwas von meinem Kakao in seinen Tee, er schmiert mir Honig auf die Cervelat-Wurst. So geht das, bis meine Mutter mir, weil ich neben ihr sitze und nicht Sven, der ihr schräg gegenüber sitzt, eine scheuert. Ich stehe auf und knalle die Tür zu. Von wegen antiautoritäre Erziehung und Kinderladen und so weiter, immer wenn’s ernst wird, dann: back to the roots. Meine Eltern wollen Hannelore und Wolf genannt werden, nicht Mama und Papa, das finden sie zu altmodisch und auch nicht gleichberechtigt, sie nennen uns ja auch nicht Sohnemann und Tochter, sondern Laura und Sven. Aber Ohrfeigen, das ist nicht altmodisch, nein.
Ich gehe in mein Zimmer, schmeiße meine neueste Easy-CD an und lege mich aufs Bett. Früher wäre ich nach einer Weile Grummeln zu meiner Mutter gegangen, hätte mich beschwert, und irgendwie hätten wir uns wieder ausgesöhnt, aber das mache ich jetzt nicht mehr. Mir fallen zu viele Widersprüche bei Hannelore und Wolf auf, als daß ich noch das Vertrauen für eines der früheren Klär-Gespräche hätte. Bestes Beispiel: Letztes Jahr Weihnachten. Hannelore und Wolf haben Sven und mir vorher erzählt, wir sollen nicht einfach phantasielos im Kaufhaus irgendein Geschenk kaufen, sondern lieber – jetzt das Zauberwort – »etwas Kreatives machen«. Nachher wurden unsere Collagen dann stillschweigend in den Müll geschoben, die Geschenke anderer Leute wie Tee-Eier, Vasen oder blöde Kunstbände natürlich nicht.
Ich bleibe also einfach im Bett liegen und höre weiter Herb Alpert & The Tijuana Brass, ganz übles Easy-Listening-Geklimper. Dann rufe ich Rike an, um mir ihre neuesten Geschichten über Pierre anzuhören, und meine Eltern lesen Zeitung. Noch während ich telefoniere, legt Hannelore mir eine Hand auf die Schulter. Ich muß mit dir gleich mal kurz reden, bedeutet diese Geste.
Ich telefoniere sehr lange mit Rike. Sie ist gerade zum ersten Mal mit Pierre alleine verreist gewesen, das haben ihre Eltern nach endlosen Krächen erlaubt, und jetzt nimmt sie die Pille und ist total happy, und ich höre mir zwei Stunden lang die Hymnen auf ihren Macker an. Hannelore wirft mir ab und zu einen stirnrunzelnden Blick zu, deutet mit einer Hand auf das Geschirr, das sie schon abgewaschen hat. Es muß noch abgetrocknet und weggeräumt werden, sie hat es aber, obwohl sie gerade nicht soviel zu tun zu haben scheint, für mich stehengelassen, damit ich auch noch etwas zu tun habe.
Ich rede mit Bedacht am Telefon, da meine Mutter, ich sehe es an ihrer Körperhaltung, mir genau zuhört. Ich meckere mich mal wieder über Jungs aus. Die Jungs in der achten Klasse kann man eben alle vergessen, und Igor, der schon in die zehnte geht, würdigt mich keines Blickes, obwohl ich mich auf dem Hof in der Raucherecke seit Wochen quasi neben ihm aufbaue. Ich sage zu Rike, und das sage ich gar nicht so leise, weil ich Mitleid immer gebrauchen kann, daß ich eine Depression hätte. Ich meine das ernst und bin froh zu sehen, daß Hannelore, als sie das hört, für einige Sekunden den Lappen in ihrer Hand still hält.
Langsam tut mir mein Ohr weh, Rike sagt, ihre Ohrmuschel hätte schon die Farbe ihrer Schamlippen, wir legen also auf. Ach, Rike hat es gut, die ist zwei Jahre älter als ich, sechzehn, wann bin ich bloß endlich sechzehn.
Ich presse mir einen O-Saft mit Hannelores neuer Maschine, einem schicken Chrom-Ding, und setze mich aufs Sofa. Auf dem Tisch liegt einer von Hannelores kleinen sechseckigen bunten Memo-Block-Zetteln, die sie mir und Sven dreimal am Tag irgendwo hinlegt. Ich beuge mich vor und lese:
»Liebe Laura! Wollte eigentlich lieber mit dir darüber reden, nun also schriftlich: Ich habe in der Zeitung wieder von diesem Mann gelesen, der auf dem Thomas-Friedhof, da wo du dich nachts immer mit Rike und Bettina und den anderen zum Rauchen triffst, herumstrolcht und vermutlich eine Frau vergewaltigt hat. In der Zeitung, guck mal in den Tagesspiegel von heute, steht mehr darüber. Ich finde es nicht gut + mache mir Sorgen, wenn ihr da immer hingeht, kann es nicht auch ein anderer Ort sein? Ich will dich nicht nerven, und ich weiß, du hörst so was nicht gerne von mir, aber ich mache mir einfach Sorgen – auch ob du zur Zeit glücklich bist, Laura-Schatz!? Deine H.«
Das hat sie mir doch schon letzte Woche erzählt, die Story mit diesem Vergewaltiger. Warum soll ich mich fürchten, wenn wir da zu viert sind? Außerdem finde ich, daß Hannelore sich mal fragen sollte, was sie so treibt. Sven und ich haben uns echt Sorgen gemacht, obwohl das eigentlich nicht so unsere Art ist, als sie und Wolf letztes Jahr Wildwasser-Kajak-Fahren in der Ukraine waren, ich meine, die beiden haben keine Ahnung von Kajaks und von der Ukraine auch nicht. Und daß Hannelore sich jede Woche von so einem komischen Inder in Trance versetzen läßt, »Hypno-Therapie« nennt man das, finde ich auch ziemlich suspekt.
Was soll’s, nun habe ich mich gerade mit Rike für heute abend auf dem Thomas-Friedhof verabredet, »das tut mir aber leid«.
Ich stecke meine Taschenlampe und meinen Joint ein, nehme zur Tarnung noch das Trivial-Pursuit-Spiel mit, weil ich Hannelore und Wolf erzählen muß, daß ich zu Bettina zum Spiele-Abend gehe, und schlurfe ins Wohnzimmer.
»Laura, alles okay, wohin gehst du denn wieder, willst du nicht mal einen Abend mit uns hier sein? Es gibt im Fernsehen gerade eine sehr gute Sendung über die Gedenkstätte Plötzensee.«
»Nein danke!« sage ich laut.
Ich bin schon zweimal höchstpersönlich in Plötzensee gewesen, einmal mit der Schule und einmal, falls sie sich erinnern können, mit meinen Eltern. Ich habe jedesmal Alpträume nachher gehabt, mich hat das überhaupt nicht kaltgelassen, wie Wolf mir vorwarf, bloß weil ich da drin ’ne Tüte Chips gegessen habe, was er aus irgendeinem Grund »sehr unpassend« fand.
»Wohin gehst du denn jetzt?« fragt Wolf.
»Zum Spiele-Abend bei Betti!« sage ich und sehe ihnen betont in die Augen.
»Ach, mit Bettinas Mutter sollte ich mich auch mal wieder austauschen«, sagt Hannelore. Ich hoffe, man hat mir mein entsetztes Gesicht nicht angesehen. Es ist nämlich schon vorgekommen, daß meine Mutter mir hinterhertelefoniert hat. Und diesmal habe ich nicht den Mega-Plan entworfen, um die Wahrheit luftdicht abzusichern. Aber Hannelore sieht wieder zum Fernseher. Auch Wolf guckt gespannt nach vorne, den Kopf zur Seite gelegt, die Stirn in Falten gelegt, die »Nachrichten-Haltung« eben.
Ich düse ab, bin die erste vor der Mauer, an unserem Plätzchen. Dann kommt Rike, kurz danach Betti, Sebastian und Jens. Wenn man sich breitbeinig zwischen den Baum und die Mauer stellt und dann langsam abwechselnd ein Bein hochschiebt, kann man am Ende auf die Mauer kommen. Der Rückweg ist leichter, weil die Familiengräber so viele Vorsprünge haben, daß man ohne Schwierigkeiten auf ihr Dach klettern kann und von da auf die Mauer, die ungefähr die Höhe der Familiengräber hat. Wir knipsen unsere Taschenlampen an und klettern herunter, jeder hat seine Lieblingsgräber, Lieblingswege. Ich laufe den Gang vorne an der Kapelle entlang, wo man von einer Allee hoher Gräber mit Kreuzen umgeben ist. Die Schatten der Kreuze werfen ein wirres Muster auf den schmalen Weg, und ich spiele immer, daß ich nie auf diese Schatten treten darf. Das ist nicht einfach, denn die Kreuze stehen dicht beieinander, und ihre Schatten bedecken fast den ganzen Weg, fast. Ein herrliches Gefühl hier rumzuspringen. Es ist ’ne ziemlich simple Angelegenheit, man fühlt sich wohl, weil man etwas Verbotenes tut, aber diese Einsicht schmälert nicht mein Glücksgefühl. Ich denke überhaupt nicht an Tod oder solche Sachen, es ist einfach nur eine abgefahrene Party-Location.
Nachdem wir unsere jeweiligen Lieblingsorte durchstreift haben, treffen wir uns hinten auf der Wiese, wo ausrangierte Grabsteine, manche zerbrochen, in großen Haufen aufeinanderliegen. Zwischen zwei dieser Haufen breiten wir unsere Prince-Decke aus. Wir trinken Brandy, rauchen unsere Tüten und albern herum. Diesmal haben gleich zwei Leute einen Cassettenrecorder mitgebracht, und so hören wir Easy und Jungle durcheinander. Dann machen wir noch Flaschendrehen, um uns gegenseitig die peinlichsten Geschichten zu entlocken. Der, auf den die Flasche zeigt, muß die sogenannte »Ober-Horst-« oder »Ober-Erna-Geschichte« auffahren, und ich erzähle wahrheitsgetreu, daß ich noch vor einem Jahr nicht in der Lage war, einen Tampon richtig zu benutzen, weil ich nicht schnallte, daß die Scheide so eine seltsame Kurve macht. Alle lachen, auch Sebastian und Jens, und ich bemerke im weiteren Verlauf des Flaschendrehens bei allen eine gewisse Tendenz, nicht völlig peinliche Geschichten zu erzählen, so daß ich es am Ende fast bereue, meine wirklich demütigende Tampon-Geschichte zum besten gegeben zu haben.
Bettina zuckt plötzlich zusammen. »Da war ein Geräusch«, sagt sie, und wir drehen uns in die Richtung um, in die Bettina guckt. Wir sind hin und wieder nachts anderen Leuten hier begegnet, Pennern, Punkern oder Party-Kids wie uns. Jetzt sehen wir einen stämmigen Typen, vielleicht Dreißig, mit einem Pitbull. Der Typ grinst, er hält eine Dose Bier in der Hand und prostet uns zu. Er spielt eine Weile auf den Grabsteinhaufen neben uns mit seinem Hund, dann verschwinden die beiden irgendwo auf dem Friedhofsgelände.
Wir küssen uns alle zum Abschied auf den Mund, Rike und ich am längsten, beste Freundinnen eben.
Ich bin um drei zu Hause, meine Eltern schlafen schon. Auf meinem Kopfkissen liegt ein sechseckiger Zettel:
»Bitte gieß morgen die Blumen, ich sehe nicht ein, warum ich das machen soll, wenn du Ferien hast und nichts tust – Schlaf gut, deine H.«
Das ist mal wieder typisch. Einerseits ärgert sich Hannelore über mich, aber dann macht sie einen Umschwenker, weil sie eben nicht nur meckern will, und schreibt noch »Schlaf gut«. Immerhin hat sie nicht getobt, von wegen erst so spät nach Hause kommen, und bei Bettinas Mutter hat sie offenbar auch nicht angerufen.
Am nächsten Tag streite ich mich mit Sven, weil er mir meine Blättchen weggenommen hat und zwei meiner Jungle-Cassetten, ohne mich zu fragen, an Oliver ausgeliehen hat. Toll. Die sehe ich nie wieder. Er kramt die steinalte Geschichte mit seinem sowieso total häßlichen T-Shirt aus, das ich mal verbummelt habe. Nur nervig. Am Ende sitzt jeder alleine in seinem Zimmer, ich höre »Body in Motion« und er – absichtlich Gegenprogramm – »Liquid Sky«.
Mir graut bei dem Gedanken, daß in fünf Tagen die Schule wieder anfängt. Ich habe zur Zeit das Gefühl, daß einfach nichts in meinem Leben passiert. Ständig kriege ich den Eindruck vermittelt, daß ich jetzt in das Alter komme, in dem man irre verliebt sein muß, abgefahrene Partys besucht und von einer spannenden Sache in die nächste stolpert. Manchmal denke ich auch, Wolf und Hannelore wollen vor uns angeben, wenn sie erzählen, was sie alles erlebt haben. Hannelore war im Mai 1968 in Paris, Wolf hat gesehen, wie auf Dutschke geschossen wurde, und ist sogar einmal selbst verhaftet gewesen. Allerdings nur für eine Nacht wegen wiederholtem Schwarzfahren, wie er später zugab. Hannelore erzählt hin und wieder von ihren Freunden, »meine lover« sagt sie, und Wolf guckt betont locker, aber ich habe doch das Gefühl, daß er das alles nicht so gerne hört.
Und was mache ich? Politik oder irgendeinen anderen Mannschaftssport gibt’s nicht mehr, ich habe noch keinen Freund gehabt, ich meine so einen richtigen, nicht nur Zungenkuß auf einer Party. Ich mache zweimal die Woche Modern Dance, höre gern Musik, klimper ein bißchen auf meinem Keyboard herum, aber Sven meint immer, das sei »Rausschmeißer-Musik«, die ich da fabriziere. Er ist drei Jahre älter als ich und darf schon solange abends wegbleiben, daß er weiß, welche Musik in den Clubs gespielt wird, um die letzten Leute rauszuekeln. Um mich zu ärgern, sagt er: »zum Schluß Easy Listening«, aber ich kläre ihn auf, daß er völlig verkalkt ist und keine Ahnung hat, wie hip Easy und Bad Taste gerade ist. »Ich finde es eher peinlich, immer so der Mode hinterherzulaufen«, belehrt Sven mich dann und stellt sein psychedelisches Gegluckse an.
Wir sitzen beim Frühstück, Wolf ist gestreßt, weil er gleich irgendeine Besprechung hat. Er arbeitet bei einer Zeitung. Es scheint ihn direkt zu stören, daß wir anderen deshalb keine schlechte Laune haben, und er sieht Sven und mich vorwurfsvoll an, als wir herumalbern. Jetzt kommen die Nachrichten, meine informationssüchtigen Eltern verfallen wie auf Knopfdruck in ihre Nachrichtenhör-Körperhaltung. Es geht um irgendwelche Rentenreformen, die mal wieder geplatzt sind, und um andere langweilige Sachen. Als eine Nachricht über einen Raubmord kommt und ich aufhorche, dreht meine Mutter gleich das Radio aus.
Am Abend treffe ich die anderen vor der Mauer. Heute sind Guido und Rebecca mitgekommen, und wir rauchen soviel, daß ich fast von einem der Familiengräber stürze, weil ich die Farbkontraste um mich herum nicht mehr richtig unterscheiden kann. Sonst ist es sehr lustig, Guido erzählt von komischen Weirdos mit einer Wohnung voller Schildkröten, die er in London kennengelernt hat. Ich weiß zwar nicht, ob alles stimmt, was Guido so erzählt, aber er hat eine sehr phantasievolle Art, einem Leute, die man gar nicht kennt, nahezubringen. Als wir nachher Flaschendrehen spielen, setze ich mich neben ihn, denn ich hoffe, daß er, wenn die Flasche auf ihn zeigt, aufgefordert wird, jemanden zu küssen, und das wäre dann ja praktisch. Tatsächlich ruft Jens, als die Flasche auf Guido zeigt: »Jetzt einen saftigen Kuß, Guido, wen und wohin du willst!« Und Guido dreht sich zu Rebecca, die auf der anderen Seite sitzt, und küßt sie zärtlich auf das Schlüsselbein, das von ihrem neonfarbenen Träger-Top freigelassen wird.
Obwohl ich es mir hätte denken können, weil die beiden vorhin so dicht nebeneinander an der Mauer lehnten, bin ich doch traurig. Ich habe mich dann sehr zugedröhnt, bin, wie gesagt, beinahe vom Dach eines Familiengrabs gestolpert und zu Hause in einen zementschweren Schlaf gefallen.
Wir haben kein weiteres Treffen ausgemacht, oder ich war so zugehämmert, daß ich es nicht mehr mitbekommen habe, jedenfalls wache ich am nächsten Morgen auf, ohne mich auf irgend etwas freuen zu können.
Ich rufe bei Rike an. Ihre Mutter sagt: »Rike ist heute für vier Tage nach Hamburg gefahren, zu ihrer Stiefschwester. Hat sie dir das nicht erzählt?«
Hab ich wohl gestern nicht mehr mitgekriegt, denke ich.
Meine Mutter sagt, wer nichts mit sich anzufangen wisse und sich oft langweile, sei selbst ein langweiliger Mensch. Selbst der ödesten Umgebung, »zum Beispiel einem sibirischen Gefängnis«, das ist ihr Paradebeispiel, könne man noch etwas abgewinnen, wenn man ein »kreativer und interessanter Mensch« sei.
Na, dann bin ich wohl ein langweiliger Mensch, denn heute, allein in Neukölln, alle Freunde verreist oder nur als Anrufbeantworterstimme zu hören, weiß ich nicht viel mit mir anzufangen.
Ich überlege, ob ich noch mal bei Igor anrufe, seine Stimme höre und dann ganz schnell wieder auflege. Vielleicht muntert mich das ja etwas auf.
»Hallo?« sagt eine tiefe warme Stimme.
»Ach, entschuldigen Sie, spreche ich mit Neuhaus?« frage ich mit verstellter Stimme.
»Äh, nein, hier ist Sachsleben, welche Nummer haben Sie denn?«
»Ach«, sage ich, »einen Moment, ja, hier habe ich sie, also das ist die 6 84 59 32.«
»Da haben Sie sich leider verwählt, hier ist nämlich die 6 83 59 32«, sagt Igor höflich.
Ich entschuldige mich einmal, nein zweimal, und lege auf. Er hat so eine nette, angenehme Stimme, jetzt muß ich wieder tagelang davon zehren, warum redet er denn nie mal mit mir?
Ich wälze mich auf der Wohnzimmercouch, lege das Kissen auf mein Gesicht, so daß ich seinen staubigen Geruch in der Nase habe, und rühre mich für die nächsten zwei Stunden nicht mehr.
Als Sven nachmittags nach Hause kommt, hat er einen Stapel Platten vom Trödelmarkt unter dem Arm und verzieht sich gleich in sein Zimmer. Er ist zur Zeit auch nicht so gut drauf, weil Jana ihn verlassen hat. Seitdem ist er mir sympathischer geworden. Nur leider drückt sich die Melancholie meines Bruders dahingehend aus, daß er ständig alleine sein will, absolut rede-unlustig ist und meist nur auf seinem Hochbett liegt, raucht und alte Platten hört. Mir wird klar, daß ich heute abend entweder alleine in meinem Zimmer sitzen werde oder, aber nur wenn ich kein Wort sage, bei Sven auf dem Hochbett sitzen darf und komische Seventies-Musik über mich ergehen lassen muß oder mit meinen Eltern irgendeine politische Sendung im Fernsehen verfolgen darf.
Ich schaue in den großen bis zum Boden reichenden Spiegel in meinem Zimmer: Ich bin 14, jung und schön, ich werde doch heute abend hier nicht versauern! Ich gehe ins Bad, dusche mich so ausgiebig und lustvoll wie lange nicht mehr, dann ziehe ich mir mein oranges Stretch-Minikleid an, meine quietschgrünen Turnschuhe mit dicker Sohle, dazu meine Baseballkappe und meine Sonnenblumen-Haarspange. Es ist noch nicht kalt, ich brauche keine Jacke. Wieder fängt mich Hannelore im Flur ab, wieder lüge ich, ich würde zu Sebastians Geburtstag gehen. Hoffentlich fällt nicht irgendwann auf, daß kein normaler Mensch andauernd Geburtstag haben kann. Ich glaube, ich hatte Sebastian schon mal kurz vor den Sommerferien. »Hast du denn kein Geschenk dabei?« fragt Hannelore mich, und ich laufe glühendrot an.
»Doch … äh, es ist ein Gemeinschaftsgeschenk … äh … Bettina bringt es mit … äh, wir schenken ihm zusammen eine Swatch …«
»Hättet ihr euch nicht etwas Einfallsreicheres überlegen können, die Dinger sind ja auch ganz schön teuer …«, meint meine Mutter. Ich sage nichts, hoffe bloß, daß sie das nicht mal Bettinas Mutter gegenüber erwähnt, und stürme los.
Ich habe beschlossen, heute alleine ins Kino zu gehen und mich nachher ins »Trash In Garbage Out« zu begeben und einen Jungen kennenzulernen. Ich fahre auf meinem Fahrrad zur Oranienstraße und bemerke zu meiner Freude, wie eine Gruppe von älteren Jungs in Lederjacken und Baseballkappen mir hinterherschaut. Ich drehe mich zu ihnen um, beinahe wäre ich gegen einen Lastwagen gefahren, und lächele ihnen zu. Sie winken zurück. Ach, kann das Leben schön sein.
Der Film ist blöd, kaum Liebesszenen, leider, nur so Ulk-Zeugs, das nicht mal richtig lustig ist. Einer der Schauspieler ist ziemlich niedlich – aber ich schwärme nicht mehr für Schauspieler, das machen nur Mädchen aus der sechsten und siebten Klasse – mir ist das zu primitiv.
Ich gehe nach dem Film auf die Damentoilette und betrachte mich im Spiegel, ich sehe heute richtig klasse aus, denke ich und gebe mir im Spiegel einen Kuß. Dann schlendere ich durch das Foyer, grinse dem Popcorn-Verkäufer zu, der mich schon kennt, und schaue mir die Filmfotos an den Wänden an. Neben mir steht ein blonder Typ mit einer schönen großen Nase, den ich unauffällig mustere. Plötzlich spricht er mich an: »Und hat’s dir eben gefallen?«
Er lächelt etwas schüchtern, ist vielleicht zwei, drei Jahre älter als ich, so alt wie Sven. Ich fahre mir kurz durch die Haare und sage: »Naja, ein bißchen albern, ich mag schon lieber Filme, die auch etwas Inhalt haben.«
»Verstehe«, gibt er zurück, »geht mir eigentlich auch so, weißt du, was ich letztens gesehen habe …«, er beugt sich recht vertraulich zu mir nach vorne, »im Open-Air-Kino in der Hasenheide war das«, fängt er an, da kneift ihn ein Mädchen von hinten neckisch in die Pobacke. »Tobias, du Charmeur, kaum bin ich mal auf Toilette …«, sie hakt sich bei ihm ein und guckt mich triumphierend an. Leider fällt mir nichts ein, was ich noch hätte sagen können. Es gibt Mädchen, die so dreist sind wie Rike und in solch einer Situation einfach ihre Telefonnummer rüberreichen und das verdutzte Gesicht der Tussie daneben ignorieren. So ist Rike, aber so bin ich nicht.
»Na denn euch noch einen schönen Abend«, sage ich schnell und laufe aus dem Foyer. »Tschüssi«, ruft Tobias mir noch hinterher, und schon bin ich draußen.
Ich fahre zum »Trash In Garbage Out«. Es ist voll, es sind ein paar Leute da, die ich vom Sehen kenne, aber plötzlich finde ich es sehr peinlich, hier alleine aufzukreuzen. Die denken dann, ich habe niemanden zum Weggehen. Eine Weile stehe ich unschlüssig vor der Tür, tue so, als warte ich auf jemanden, und gucke ab und zu auf die Uhr, dann setze ich mich doch auf mein Fahrrad.