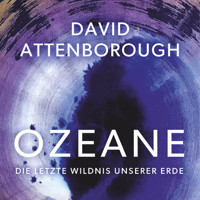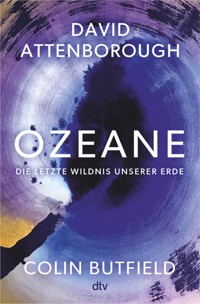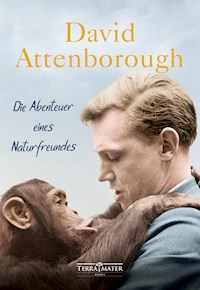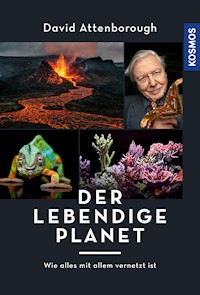
22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Franckh-Kosmos Verlags-Gmbh & Co. KG
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der legendäre Tierfilmer und Naturforscher Sir David Attenborough beschreibt in seiner unnachahmlichen Art die Lebensräume auf unserem Planeten und erklärt, auf welche geheimnisvolle Weise alles Lebendige zusammenhängt. Das Buch führt uns in eisige Zonen, durch Tundra, Wald, Wüsten und Ozeane bis in die einsamen Höhen des Himalaya. Attenboroughs forschender Blick und sein Enthusiasmus sind unmittelbar ansteckend. Man staunt über die Anpassungsfähigkeit einzelner Arten und begreift die wunderbaren Kräfte der Natur, die die komplexen Bedürfnisse von Tieren und Pflanzen in den verschiedenen Lebensräumen ins Gleichgewicht bringt. Die aktualisierte Ausgabe des Klassikers berücksichtigt den neuesten Stand der Forschung und beschreibt eindringlich die Verletzlichkeit unseres Planeten durch Klimawandel, Umweltzerstörung und Artensterben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
VORWORT
EINLEITUNG
1 | SCHMELZÖFEN DER ERDE
2 | WELT AUS EIS
3 | NÖRDLICHE NADELWÄLDER
BILDSTRECKE 1
4 | IM DSCHUNGEL
5 | MEERE AUS GRAS
6 | BRENNEND HEISSE WÜSTEN
BILDSTRECKE 2
7 | AM HIMMEL ÜBER UNS
8 | FRISCHES SÜSSWASSER
9 | AM RANDE DES FESTLANDS
BILDSTRECKE 3
10 | WELTEN VONEINANDER ENTFERNT
11 | OFFENER OZEAN
BILDSTRECKE 4
12 | NEUE WELTEN
DANKSAGUNG
IMPRESSUM
Vorwort
Dieses Buch basiert auf einer Reihe von Dokumentarfilmen für die BBC. Das Buch und die Filme schließen wiederum an eine frühere Serie von Fernsehprogrammen nebst zugehörigem Buch mit dem Titel Das Leben auf unserer Erde an. Hinter diesem Projekt stand die Absicht, die Entwicklung der Tiere und Pflanzen auf unserem Planeten in den letzten dreitausend Millionen Jahren zu beschreiben und die Erfolgsgeschichten verschiedener Gruppen von Tieren zu erzählen, darunter die noch gar nicht so lange zurückliegende Ausbreitung der Säugetiere sowie das Erscheinen der Menschen.
Das vorliegende Buch betrachtet nun die gegenwärtige Situation. Es untersucht, wie die Überlebenden uralter Gruppen und die Vertreter neuer Arten gemeinsam die vielfältigen Lebensräume unserer Erde kolonisiert und sich an sie angepasst haben. Dabei ist möglich, dass sich die beiden Narrative an einigen Stellen überschneiden. Jedoch ist die Vielfalt der Tiere und Pflanzen so groß, dass ich solche Episoden in den meisten Fällen anhand anderer Spezies als im früheren Buch veranschaulichen konnte.
Ich habe den gleichen Stil wie zuvor beibehalten, wobei ich technische und wissenschaftliche Begriffe so weit wie möglich vermieden und den Text nicht mit lateinischen Bezeichnungen überfrachtet habe. Das Stichwortverzeichnis soll indes als Glossar dienen, sodass jedes Lebewesen nicht nur mit einem Seitenverweis, sondern auch mit seinem wissenschaftlichen Namen darin aufgeführt wurde. Wer von den Lesern also genau wissen möchte, um welche Familie, Gattung und Art es sich handelt, findet diese Informationen im Register.
Das Buch entstand zur selben Zeit wie die TV-Programme. Ein Format ist deshalb nicht der Nachfolger des anderen. Vielmehr sind die beiden Cousins und das Ergebnis derselben Forschungsarbeit sowie unzähliger Reisen. Sie weisen also die Art von Unterschieden und Ähnlichkeiten auf, die man von einer solchen Beziehung erwarten kann. Ich hoffe, dass sie sich gegenseitig bereichern.
Einleitung
Die Kali Gandaki bahnt sich ihren Weg durch die tiefste Schlucht der Welt. Steht man in Nepal an ihren tosenden, milchig-trüben Fluten und schaut flussaufwärts zum Hauptgebirge des Himalaja, scheint der Fluss aus einer Gruppe gewaltiger schneebedeckter, eisgepanzerter Gipfel zu entspringen. Der höchste von ihnen, der Dhaulagiri, misst über 8000 Meter und ist der fünfthöchste Berg der Welt. Die Kuppe seiner unmittelbaren Nachbarin, der Annapurna, ist nur ein paar Meter niedriger und liegt gerade einmal 35 Kilometer entfernt. Man könnte annehmen, dass sich die Quelle des Flusses an der Südflanke dieser kolossalen Wand aus Felsen und Eis befindet. Dem ist aber nicht so. Die Kali Gandaki fließt nämlich zwischen den beiden Bergen hindurch und ihr Bett liegt gut sechs vertikale Kilometer unterhalb der Gipfel.
Die Menschen Nepals wissen schon seit Jahrhunderten, dass dieses Tal eine Verbindungsstraße ist, ein Weg mitten durch den Himalaja, der bis nach Tibet führt. Im Sommer schleppen sich jeden Tag ganze Maultiertrosse die steinigen, kurvenreichen Pfade hinauf. Das rote Pferdehaar an ihren Widerristen wippt im Takt ihrer Bewegungen auf und ab und rote Pompons an langen Schnüren schmücken ihre Saumsattel. Riesige Ladungen Gerste, Buchweizen, Tee und Stoffe werden von den Tieren nach Tibet getragen, um sie dort gegen Wollballen und Salzkuchen einzutauschen.
In den untersten Ausläufern des Tals ist es so warm und feucht, dass die Menschen hier Bananen anbauen können, und der Wald so üppig wie ein tropischer Regenwald. Im Nationalpark Chitwan und dem Valmiki-Tigerreservat fressen sich Nashörner am saftig-grünen Bewuchs satt und machen Tiger das Bambusdickicht unsicher. Sobald man aber in das eigentliche Tal hinaufsteigt, verändert sich die Pflanzenwelt. Ist man auf einer Höhe von rund tausend Metern angekommen, wachsen Rhododendren, recht dünne Bäumchen mit breiten, glänzenden Blättern, die bis zu zehn Meter hoch werden können. Im April sind sie mit hübschen, scharlachroten Blüten übersät, die kleine Honigsauger anlocken. Das schillernde Brustgefieder der Vögel glänzt metallisch im Sonnenlicht, wenn sie mit ihren gebogenen Schnäbeln den Nektar aus den Blütenkelchen saugen und beflissen den Pollen von einem Baum zum nächsten tragen. Auch Hanuman-Languren zieht es hierher. Sie sind wahrhafte Plünderer und stopfen sich ganze Hände voll Blüten in ihre Mäuler. Auf dem Boden wachsen Orchideen und Schwertlilien, trompetenförmige Aronstäbe und Primeln. Wo die Sonne durch das Blätterdach dringt und einen Felsen erwärmt, sonnt sich vielleicht eine kleine Eidechse. Mit etwas Glück erspäht man in den Tiefen des Waldes, bei der Futtersuche am Boden oder in den Bäumen sitzend, einen der prächtigsten Vögel der Welt, einen Tragopan. Der Fasan von der Größe eines Truthahns hat ultramarinblaue Kehllappen und karminrote Federn, die reihenweise hübsch mit weißen Tupfen verziert sind.
Die Pracht dieses Waldes ist dem reichlichen Niederschlag zu verdanken. Monsunwinde aus Indien blasen Wolken in das Tal, die umso kälter werden, je höher sie steigen. Irgendwann können sie ihre gesammelte Feuchtigkeit nicht mehr halten und ergießen sich in sintflutartigen Regenfällen. Die Landschaft rund um den unteren Abschnitt der Kali Gandaki ist deshalb einer der wasserreichsten Orte der Erde.
Aber auch dieser Wald hat seine Grenzen. Ist man auf einer Höhe von 2500 Metern angekommen, sind – bis auf ein paar einzelne Bäume an geschützten Hängen – die Rhododendren verschwunden. Ihren Platz nehmen hier oben Nadelhölzer ein, genauer die Himalaja-Tanne und die Tränenkiefer. Im Gegensatz zu den breiten Blättern der Rhododendren, auf denen der Schnee liegenbleibt, unter dessen Gewicht sie manchmal zerbrechen, haben die Koniferen lange, widerstandsfähige Nadeln. Zwischen ihnen rieselt der Schnee einfach hindurch und sie tolerieren selbst sehr niedrige Temperaturen. Mit viel Glück kann man in den Bäumen einen Kleinen Panda – fuchsbraun mit einem buschigen, schwarz geringelten Schwanz und gräulichen Kopf – dabei beobachten, wie er auf der Suche nach Vogeleiern, Beeren, Insekten oder Mäusen durch das Geäst klettert. Er bewegt sich trittsicher über den schneebedeckten Boden und die rutschnassen Zweige, denn das dichte Wollhaar an seinen Fußsohlen verleiht ihm eine ausgezeichnete Bodenhaftung.
Nach einer weiteren Halbtagswanderung lässt man den Kiefernwald hinter sich und mit ihm all die Vögel und Säugetiere, die direkt oder indirekt auf die Nadelbäume als Nahrungsquelle und Unterschlupf angewiesen sind. Bis auf ein paar Grasbüschel und vereinzelte Kreuzdorn- oder Wacholdersträucher haben die felsigen Berghänge hier nur wenig an Vegetation zu bieten. Der Fluss ist zudem geschrumpft und jetzt nur noch ein seichter Strom, der über eine Kiesbank fließt. Dabei ist das Tal an sich nach wie vor gewaltig und seine Sohle über einen Kilometer breit. Aber die Kali Gandaki schwillt hier auch zu anderen Jahreszeiten nicht weiter an. Die Wolken regnen größtenteils weiter unten ab und deshalb gibt es nicht genügend Wasser, um den Strom zu speisen. Hierin liegt dann auch das erste große Rätsel der Kali Gandaki: Wie konnte ein so kleiner Fluss bloß so ein riesiges Tal ausschwemmen?
Wildtiere sind in diesen Höhenlagen sehr selten. Für Eidechsen ist es viel zu kalt und für Languren gibt es nicht genügend Nahrung. Tatsächlich könnte man den ganzen Tag lang wandern, ohne einem einzigen Lebewesen zu begegnen – abgesehen von vereinzelten Alpenkrähen oder Rabenschwärmen sowie Gänsegeiern, die den Himmel hoch über den Berghängen patrouillieren. Die Anwesenheit letzterer ist indes ein sicheres Anzeichen dafür, dass hier irgendwo noch andere Tiere unterwegs sein müssen, denn ohne sie würden die Geier verhungern. Zwischen den Felsen und Steinen verstecken sich also scheue Nager wie Murmeltiere und Pfeifhasen, und knabbern das Gras und die Polsterpflanzen ab, die an den Schotterhängen wachsen. Der Bewuchs ist allerdings so spärlich, dass sich bloß wenige Tiere davon ernähren können, weshalb die hier überlebenden Arten nur in sehr geringen Beständen vorkommen. Unter ihnen befindet sich der Tahr. Er ist weder ein richtiges Schaf noch eine echte Ziege, mit der er jedoch etwas näher verwandt ist. Noch seltener ist der Feind des Tahrs, der Schneeleopard. Er gehört zu den schönsten Großkatzen der Welt, hat einen cremefarbenen Pelz mit grauen Rosetten und Haarpolster an seinen Fußsohlen, die seine Pfoten vor scharfkantigem Geröll sowie vor der Kälte schützen. Im Winter sucht er in den Wäldern niedriger Lagen Zuflucht, aber im Sommer wagt er sich nicht selten in Höhen von bis zu 5000 Metern vor.
Obwohl es hier oben – auf fast 3000 Metern Höhe – kaum zu starken Regenfällen kommt, weht ein fast ununterbrochener, bitterkalter Wind, der an den Kräften zehrt. Ist man aus dem vorderen Tal hier hinaufgestiegen und war jeden Tag auf den Beinen, spürt man deutlich, dass die Luft immer dünner wird. Sie fühlt sich kalt an in der Lunge und obwohl man tief einatmet, scheint man nur schwer Luft zu bekommen. Vielleicht gesellen sich auch noch Kopfschmerzen und Übelkeit hinzu. Aber keine Sorge, nach einer mehrtägigen Ruhepause gewöhnt man sich an die Höhe und die schlimmsten Symptome verschwinden. Nie im Leben wird man jedoch mit der körperlichen Ausdauer der Maultiertreiber mithalten können, die Reisende begleiten und in diesen Höhen zu Hause sind.
Selbst die Maultiere haben hier oben mit ihrer Last zu kämpfen, weshalb sich die Bewohner des Hochgebirges zähere, kräftigere Packtiere halten, die Yaks. Einst durchstreiften sie in stattlichen Herden das Hochland von Tibet. Mittlerweile hat man sie domestiziert und heute tragen sie Lasten oder ziehen Pflüge hinter sich her. Das wollene Fell des Yaks ist so dick und warm, dass die Tiere es im Sommer größtenteils abwerfen müssen, um sich nicht zu überhitzen, und mit Ausnahme des Menschen ist es das einzige größere Säugetier, das auf solchen Höhen überleben kann. Nun plötzlich öffnet sich das Tal. Die imposanten Gipfel der Annapurna und des Dhaulagiri, die man vor ein paar Tagen noch aus mehreren Kilometern Entfernung als hell leuchtende Pyramiden durch das Blätterdach der Rhododendren erspähen konnte, liegen jetzt hinter uns. Vor uns weichen die Schneewälle allmählich einem braunen Streifen am Horizont: der trockenen und halbgefrorenen Hochebene von Tibet. Wir haben soeben die größte Gebirgskette der Welt durchquert.
Hier zeichnet sich eine weitere Besonderheit der Kali Gandaki ab: Sie scheint verkehrtherum zu fließen. Flüsse entspringen normalerweise im Gebirge, strömen die Berghänge hinab, nehmen Wasser aus ihren Zuflüssen auf und bahnen sich ihren Weg ins Tiefland. Bei der Kali Gandaki ist es jedoch andersherum: Sie entspringt am Rand der weiten tibetischen Hochebene und steuert geradewegs auf die Berge zu. Sie windet und schlängelt sich zwischen den gigantischen, ineinandergeschobenen Gebirgsrücken talwärts, während die Gipfel auf beiden Seiten immer höher werden. Erst nachdem sie die Berge passiert hat, erreicht sie eine relativ flache Ebene und mündet in den Ganges, um daraufhin ins Meer abzufließen. Wenn man nahe ihrer Quelle hoch oben an ihrem Tal steht und mit den Augen nachverfolgt, wie sie sich wie eine silberne Schlange in Richtung der fernen Berge windet, kann man kaum glauben, dass sich die Kali Gandaki ganz allein ihren Weg durch das Gebirge gebahnt hat. Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass sie gerade diesem Lauf folgt?
Hinweise auf die Antwort liegen einem zu Füßen, verstreut im Geröll. Das Gestein besteht hier aus einem krümeligen, leicht splitternden Sandstein, der mit Abertausenden von Schneckenhäusern gespickt ist. Die meisten von ihnen bringen es auf nur wenige Zentimeter, aber manche sind so groß wie Wagenräder. Es handelt sich um Ammoniten. Heute gibt es keine lebenden Ammoniten mehr, aber vor hundert Millionen Jahren gediehen sie in rauen Mengen. Aus ihrer Anatomie und der chemischen Zusammensetzung des Gesteins, in denen ihre versteinerten Überreste zu finden sind, können wir mit ziemlicher Sicherheit schließen, dass sie im Meer gelebt haben müssen. Dennoch liegen sie hier – mitten in Asien – nicht nur 800 Kilometer vom Ozean entfernt, sondern obendrein noch vier Kilometer über dem Meeresspiegel.
Wie es dazu kam, war noch bis Mitte des 20. Jahrhunderts unter Geologen und Geografen heftig umstritten. Seitdem hat man jedoch eine Erklärung erarbeitet, deren Grundzüge unzweifelhaft sind. Einst befand sich zwischen den großen Kontinentalmassen Indiens im Süden und Asiens im Norden ein weites Meer. Dort lebten die Ammoniten. Flüsse, die von den zwei Kontinenten aus ins Meer strömten, führten große Mengen an Sedimenten mit, die sich Schicht für Schicht im Meer ablagerten. Starb ein Ammonit, sank sein Gehäuse auf den Meeresboden, wo er von frischem Schlamm und Sandablagerungen bedeckt wurde. Das Meer verengte sich jedoch zunehmend, denn Jahr um Jahr und Jahrzehnt um Jahrzehnt bewegte sich Indien weiter auf Asien zu. Je näher sich die zwei Kontinente kamen, umso stärker falteten sich die Sedimentschichten auf dem Meeresboden auf und desto flacher wurde das Wasser. Der indische Kontinent ließ sich aber nicht aufhalten und schob sich immer weiter in Richtung Asien. Die Sedimente, die sich inzwischen zu Sand-, Kalk- und Schlammstein verfestigt hatten, türmten sich zu Hügeln auf. Dieser Prozess ging unvorstellbar langsam vonstatten. Trotzdem behinderten die nun aufragenden Berge die Läufe einiger Flüsse, die von Asien in Richtung Süden strömten. Sie wurden gen Osten abgeleitet und umgingen den noch jungen Himalaja, indem sie um seinen östlichen Rand herumflossen und schließlich in den Brahmaputra mündeten. Die Kali Gandaki aber war stark genug, um die weichen Felsen genauso schnell zu durchschneiden, wie diese sich erhoben. So entstanden die großen Klippen aus aufgefalteten Gesteinsschichten, die man heute noch auf beiden Seiten des Tals sehen kann.
Dieser Vorgang setzte sich über die folgenden Jahrmillionen fort. Tibet war vor der Kollision der Kontinente eine feuchte Tiefebene am südlichen Rand Asiens gewesen und wurde jetzt nicht nur nach oben gedrückt, sondern vom jungen Gebirge auch allmählich des Niederschlags beraubt, wodurch es sich in die kühle Hochwüste von heute verwandelte. Der Oberlauf der Kali Gandaki wurde nun nicht mehr im gleichen Maße von Regenwasser gespeist, verlor dadurch seine anfängliche Erosionskraft und schrumpfte in seinem gewaltigen Tal zusammen. Wo einst das Urmeer gelegen hatte, stand jetzt das höchste und jüngste Gebirge der Welt, in dessen Inneren die Überreste von Ammoniten lagern. Der Prozess ist noch nicht beendet, Indien bewegt sich nach wie vor mit einer Geschwindigkeit von fünf Zentimetern pro Jahr Richtung Norden und jedes Jahr wachsen die schroffen Gipfel des Himalaja um einen Millimeter an.
Diese Verwandlung von Meer zu Land begann vor etwa 65 Millionen Jahren. Obwohl uns – einer Spezies, die es erst seit weniger als einer halben Million Jahren gibt – das unvorstellbar lange her vorkommt, ist es in Bezug auf die Geschichte des Lebens auf der Erde ein eher aktuelles Ereignis. Schließlich begannen einfache Tiere schon vor 600 Millionen Jahren in den Urmeeren herumzuschwimmen, und Amphibien und Reptilien bevölkerten bereits vor 200 Millionen Jahren das Land. Nur ein paar Millionen Jahre später entwickelten die Vögel Federn und Flügel und eroberten die Lüfte. Etwa zur selben Zeit wuchs den Säugetieren Fell und sie bekamen warmes Blut. Vor 66 Millionen Jahren verschwanden die Nichtvogeldinosaurier nach einer verheerenden Katastrophe und die Vögel sowie schließlich auch die Säugetiere übernahmen die Vorherrschaft über das Land und beanspruchen diese bis zum heutigen Tag. Vor 50 Millionen Jahren, als sich der indische Inselkontinent Asien näherte, existierten nicht nur bereits all die wichtigen Tier- und Pflanzengruppen, die wir auch heute noch kennen, sondern zudem fast all die großen Familien innerhalb dieser Gruppen. Beide Kontinente beherbergten ihre ganz eigenen, vielfältigen Pflanzen- und Tierwelten. Allerdings war Indien aufgrund seines langen Inseldaseins kurz nach dem Verschwinden der großen Reptilien zweifellos viel ärmer an höherentwickelten Tieren als Asien. Als die beiden vor rund 40 Millionen Jahren schließlich aufeinandertrafen und sich das neue Gebirge emporhob, weiteten die Tiere und Pflanzen der beiden alten Kontinente ihr Territorium in den jeweils anderen, unbesiedelten Teil aus.
Damals wie heute war Asien teilweise von Dschungel bedeckt. Die von dort stammenden Pflanzen und Tiere fanden im niedrigen Hügelvorland auf der Südseite des neuen Gebirges geeignete Bedingungen vor und siedelten sich an. Doch oberhalb des Vorgebirges lag eine neue Landschaft, und zwar auf Höhen, die es bisher nirgendwo sonst in Asien oder Indien gegeben hatte. Um dieses unbesiedelte Gelände zu kolonisieren, mussten sich die Lebewesen verändern. In manchen Fällen reichten bereits geringfügige Anpassungen aus. Alles, was die Languren für ihren Umzug aus den warmen Tiefländern in die kühleren Rhododendronwälder weiter oben – wo sie Blätter und Früchte sammeln konnten – benötigten, war ein etwas dichteres, wärmendes Fell. Ähnlich hielten es einige Weidetiere wie etwa die Vorfahren des Tahrs. Dem Schneeleoparden, der von denselben Urtieren abstammt wie der Tiefland-Leopard, wuchs nicht nur ein dichteres Fell, sondern er wurde auch heller, was ihm an den grauen Berghängen und im Schnee eine bessere Tarnung verschaffte. Außerdem passte er seine Essgewohnheiten an, indem er die Antilopen und wilden Rinder, von denen er sich vermutlich im Dschungel ernährt hatte, durch kleinere Beute wie Tahrs und Murmeltiere ersetzte. Für Vögel wie die Gänsegeier war die hohe Lage kein Problem. Sie schwangen sich ohnehin gewohnheitsmäßig in luftigere Höhen und hatten keine Schwierigkeiten damit, in die großen Täler umzuziehen, solange es dort genügend Futter in Form von Beutetieren gab.
Die neuen Wälder und ihre Bewohner hatten sich schon lange vor der Ankunft der Menschen vor rund 50 000 Jahren etabliert. Als die Menschen mit der Besiedlung der Täler begannen, passten auch sie sich an die neuen Gegebenheiten an. Im Gegensatz zu anderen Tieren waren sie jedoch nicht allein auf körperliche Veränderungen angewiesen, um sich vor der Kälte zu schützen. Ihre hohe Intelligenz und die Fähigkeiten, die nur uns Menschen eigen sind, ermöglichten es ihnen, warme Kleidung herzustellen und Feuer zu entfachen. Gegen den Sauerstoffmangel konnten sie allerdings nichts erfinden, er ließ sich nur durch die Veränderung physikalischer Vorgänge in ihren Körpern überwinden. Heute enthält das Blut der Menschen in diesen Höhenlagen dreißig Prozent mehr Blutkörperchen als das von Menschen, die auf Meereshöhe leben, weshalb es mit jedem Liter mehr Sauerstoff befördern kann. Die Bewohner des tibetischen Hochlandes verfügen also über eine besondere genetische Anpassung, die sich auf ihr Blut auswirkt und anscheinend als Folge von Paarungen mit ausgestorbenen Menschenformen vor langer Zeit vollzogen wurde. Zudem sind ihr Brustkorb und ihre Lunge außergewöhnlich groß, wodurch sie mit einem Atemzug mehr Luft aufnehmen können als ein Flachländer. Aber auch diese Menschen haben sich noch nicht an die allerhöchsten Gebirgslagen angepasst. Über 6000 Metern können Frauen keine Kinder austragen, weil die Luft so dünn ist, dass nicht genügend Sauerstoff ins Blut gelangt, um den heranwachsenden Fötus zu versorgen.
Die Geschichte der Entstehung des Himalaja und seiner anschließenden Kolonisierung durch Tiere und Pflanzen ist nur ein Beispiel für die vielen Veränderungen, die auf unserem Planeten ununterbrochen vonstattengehen. Gebirge werden nicht bloß aufgebaut, sondern zugleich von Gletschern und Flüssen abgetragen. Flüsse werden gestaut und ändern ihre Läufe, während sich Seen mit Sedimenten füllen und in Sümpfe und schließlich in Ebenen verwandeln. Auch ist Indien nicht der einzige Kontinent, der auf der Erdoberfläche umherdriftet. Alle anderen Landmassen sind im Laufe der unermesslich langen geologischen Zeit ebenfalls mit anderen verschmolzen oder haben sich voneinander getrennt. Während sie ihre Position verändern und sich etwa vom Äquator in Richtung der Pole verschieben, wird der Dschungel zur Tundra und das Grasland zur Wüste. Jede dieser physischen Veränderungen, sei es in Bezug auf den Sonneneinfall oder die Höhenlage, den Niederschlag oder die Temperaturen, führt in den betroffenen Pflanzen- und Tiergemeinschaften zu einer Auslese und verändert allmählich den Charakter der gesamten Population. Manche Organismen passen sich den neuen Gegebenheiten an und überleben, andere sind dazu nicht in der Lage und verschwinden.
Vergleichbare Umgebungen führen zu vergleichbaren Anpassungen und bringen in verschiedenen Regionen der Welt Tiere hervor, die zwar von ganz unterschiedlichen Vorfahren abstammen, aber dennoch bemerkenswerte Ähnlichkeiten aufweisen. So gibt es zum Beispiel an den Berghängen der Anden kleine, farbenfrohe Vögel, die Nektar aus riesigen Blüten naschen und den Honigsaugern des Himalaja sehr ähnlich sehen, obwohl sie zu einer ganz anderen Familie gehören. Das Lama – das dickfellige, trittsichere Lastentier der Andenbewohner – ist eine Art Kamel, wohingegen das Yak – das Packtier der Bewohner des Himalaja – zwar ähnliche Eigenschaften besitzt, aber zu den Rindern gehört.
Nur zwei große Lebensräume unserer Erde sind scheinbar über lange Zeiträume hinweg gleich geblieben: der Dschungel und das Meer. Doch selbst die Landmassen, auf denen der Urwald liegt, haben sich aufgrund der Kontinentalverschiebungen verändert, und die Aufspaltung und Verschmelzung der Kontinente hatten Auswirkungen auf die Ausdehnung der warmen, flachen Küstenmeere. Darüber hinaus veränderten sich mit der Zeit auch die biologischen Bedingungen in diesen Lebensräumen, denn die fortschreitende Evolution hat inner- und außerhalb ihrer Grenzen neue Organismen hervorgebracht und dadurch die alteingesessenen Bewohner vor neue, existenzielle Probleme gestellt.
So haben sich in nahezu allen Winkeln unserer Erde – von den höchsten bis in die tiefsten Lagen und von den wärmsten bis in die kältesten Gefilde sowie über und unter Wasser – einzigartige, voneinander abhängige Tier- und Pflanzengemeinschaften entwickelt. Wie genau die Anpassungen aussehen, die den Lebewesen eine so flächendeckende Ausbreitung auf unserem vielfältigen Planeten ermöglicht haben, darum geht es in diesem Buch.
KAPITEL 1
SCHMELZÖFEN DER ERDE
Die gigantischen Kräfte, die den Himalaja und alle anderen Gebirge der Welt hervorgebracht haben, gehen so langsam vonstatten, dass wir sie mit unseren Augen normalerweise gar nicht wahrnehmen können. Hin und wieder aber machen sie sich in den gewaltigsten Machtdemonstrationen bemerkbar, die unser Planet zu bieten hat. Die Erde bebt und der Boden explodiert.
Ist die aus der Erdoberfläche emporquellende Lava aus Basalt, schwarz und schwer, dann ist die Gegend möglicherweise schon seit Jahrhunderten ununterbrochen vulkanisch aktiv. So zum Beispiel in Island. Fast jedes Jahr kommt es dort zu irgendeiner Art von vulkanischer Aktivität. Gesteinsschmelze ergießt sich aus enormen Rissen, die sich über die ganze Insel ziehen. Oft geschieht das in Form einer bedrohlichen Flut aus heißem Basaltgeröll, die sich unaufhaltsam ihren Weg über das Land bahnt. Es knackt und knistert, wenn die Masse abkühlt und aufbricht. Es donnert und poltert, wenn sich Gesteinsbrocken von der Vorderkante der Lavawelle lösen. Manchmal ist der Basalt flüssiger. Dann kann schon mal eine fünfzig Meter hohe Feuerfontäne – orange und rot an den Rändern, stechend gelb in der Mitte – aus der Erde in die Höhe schießen und dabei so eindringlich dröhnen wie ein riesiges Düsentriebwerk. Der Schlot des Vulkans spuckt geschmolzenen Basalt. Lavaschaum wird bis über die Rauchwolke geprustet, wo ihn der heulende Wind erfasst, abkühlt und in entfernte Gegenden bläst, deren Felsen mit Schichten von grauem, körnigem Staub überzogen werden. Nähert man sich dem Vulkan von der Windseite, werden Hitze und Asche größtenteils von einem weggeweht, sodass man bis auf fünfzig Meter an den Schlot herantreten kann, ohne sich das Gesicht zu verbrennen. Dreht sich der Wind allerdings, dann fällt die Asche rings um einen herum und große, glühend heiße Felsbrocken landen dumpf und zischend auf dem nahen Schnee. Dann heißt es: Ausschau halten nach fliegenden Steinen oder die Beine in die Hand nehmen!
Aus dem Schlot des Vulkans fließt nach allen Seiten sich abkühlende schwarze Lava. Wer die wulstförmige, blasige Oberfläche betritt, erkennt beim Betrachten der Risse, dass die Lava nur ein paar Zentimeter darunter noch rot glüht. Hier und dort haben sich gewaltige, mit Gas gefüllte Blasen gebildet, deren Wände so dünn sind, dass sie unter dem Tritt eines Wanderschuhs leicht mit einem splitternden Krachen einbrechen können. Wer, hinzukommend zu solchen Warnsignalen, auch noch wegen unsichtbarer, unriechbarer Giftgase um Atem ringt, tut gut daran, wieder umzukehren. Allerdings wäre man jetzt nah genug, um die spektakulärste Attraktion überhaupt mit eigenen Augen zu sehen: einen Lavastrom. Die Gesteinsschmelze strömt mit solch einer Wucht aus dem Schlot, dass sie einen bebenden Dom bildet. Von dort aus ergießt sich die Lava in einer Sturzflut, die gut und gerne zwanzig Meter breit sein kann, und strömt mit einer erstaunlichen Geschwindigkeit von bis zu hundert Stundenkilometern bergab. In der Dunkelheit taucht dieser außerordentliche scharlachfarbene Fluss alles um sich herum in ein unheilvolles Rot. Aus seiner glühenden Oberfläche schießen Gasblasen und die Luft darüber flimmert vor Hitze. Nur wenige hundert Meter von seiner Quelle entfernt haben sich die Ränder des Stroms so weit abgekühlt, dass sie fest geworden sind und der leuchtend rote Fluss jetzt von Dämmen aus schwarzem Gestein begrenzt wird. Noch weiter unten bildet sich auf der Lava eine Haut. Allerdings fließt die Masse unter diesem scheinbar festen Dach weiter und das sogar noch über mehrere Kilometer. Basaltische Lava bleibt nämlich nicht nur bei relativ niedrigen Temperaturen flüssig, sondern wirken ihre nun festen Wände und die erstarrte Decke zudem dämmend und schließen die Hitze ein. Wenn nach Tagen oder Wochen keine neue Lava mehr aus dem Schlot austritt, fließt der Fluss so lange weiter bergab, bis der gesamte Tunnel leer ist und eine gewundene Höhle von beträchtlicher Größe zurückbleibt. Diese sogenannten Lavaröhren können bis zu zehn Meter hoch sein und sich im Inneren eines Lavastroms über mehrere Kilometer erstrecken. Ein beeindruckendes Beispiel dafür, wie ähnliche Ursachen ähnliche Wirkungen hervorrufen, ist das Vorkommen von Lavaröhren auf dem Mond und dem Mars.
Island ist Teil einer Kette von Vulkaninseln, die fast genau in der Mitte des Atlantischen Ozeans vertikal verläuft. Auf Jan Mayen im Norden folgen weiter südlich die Azoren, Ascension (Himmelfahrtsinsel), St. Helena und Tristan da Cunha. Die Kette ist lückenloser, als sie auf den meisten Landkarten aussieht, denn manche der aktiven Vulkane liegen unter der Meeresoberfläche. Sie alle sind Teil eines riesigen Bergrückens aus Vulkangestein, der sich ungefähr mittig zwischen Europa und Afrika im Osten und dem amerikanischen Doppelkontinent im Westen erstreckt. Proben des Meeresbodens beiderseits des Rückens zeigen, dass sich unter den Schlammschichten Basaltgestein befindet, wie es auch aus den Vulkanen austritt. Basalt kann dank chemischer Analysen datiert werden und somit wissen wir, dass die Gesteinsproben umso älter sind, je weiter entfernt sie vom Mittelozeanischen Rücken entnommen wurden. Die Kammvulkane erschaffen also den Meeresboden, der beiderseits des Gebirgszugs langsam von ihnen wegwächst.
Die Mechanismen, die für diese Bewegungen verantwortlich sind, liegen tief im Inneren der Erde. Zweihundert Kilometer unter der Erdoberfläche ist das Gestein so heiß, dass es formbar ist. Unter ihm befindet sich der metallische Erdkern. Dessen noch heißere Temperaturen verursachen langsame, wogende Strömungen in den darüber liegenden Schichten, die entlang des Meeresrückens aufsteigen und dann zu beiden Seiten wieder abfließen. Dabei ziehen sie den basaltischen Meeresboden mit sich wie die Haut auf einem Pudding. Solche beweglichen Segmente der Erdkruste werden als Platten bezeichnet. Auf den meisten dieser Platten liegen – ähnlich wie Sahnehauben – die Kontinente.
Vor 120 Millionen Jahren bildeten Afrika und Südamerika einen einzigen Kontinent, wie man an ihren Küstenlinien erkennen kann, die wie Puzzleteile zueinanderzupassen scheinen, und wie es die Ähnlichkeit des Gesteins auf beiden Seiten des Ozeans beweist. Vor etwa 60 Millionen Jahren kam es unter diesem Superkontinent zu einer aufwallenden Strömung und es bildeten sich eine Reihe von Vulkanen. Im Superkontinent entstand ein Riss und die beiden Hälften entfernten sich langsam voneinander. Der Mittelatlantische Rücken markiert heute diese Trennungslinie. Afrika und Südamerika driften nach wie vor auseinander und der Atlantik wird jedes Jahr um einige Zentimeter breiter.
Eine ähnliche Erhöhung zieht sich von Kalifornien Richtung Süden und schuf den Meeresboden des Ostpazifiks. Eine dritte erstreckt sich von der arabischen Halbinsel südöstlich gen Südpol und brachte den Indischen Ozean hervor. Dabei war es die Platte auf der Ostseite dieses Rückens, die Indien von der Flanke Afrikas wegzog und in Richtung Asien trug.
Die Konvektionsströme, die an den Meeresrücken nach oben steigen, müssen auch wieder abfließen. An den Linien, an denen sie das tun, trifft eine Platte auf die eines benachbarten Systems. Hier stoßen die Kontinente aufeinander. Als Indien auf Asien zutrieb, wurden Sedimente auf dem Meeresboden zwischen den zwei Kontinenten zusammengestaucht und aufgefaltet: Es entstand der Himalaja. Die Plattengrenze verbirgt sich hier unter einem Gebirge. An derselben Plattenlinie in südöstlicher Richtung befindet sich allerdings nur auf der asiatischen Seite eine kontinentale Masse. Dementsprechend ist die Zone, in der die Kruste am schwächsten ist, dort exponierter und sie ist durch eine Vulkankette gekennzeichnet, die sich von Sumatra über Java bis nach Neuguinea zieht.
Die absinkenden Konvektionsströme reißen den Meeresboden mit sich, wodurch ein langer, tiefer Graben entsteht. Dieser verläuft an der Südküste der indonesischen Kette entlang. Wenn sich der Rand der Basaltplatte absenkt, dann zieht er Wasser sowie den Großteil der Sedimente mit sich, die von der indonesischen Landmasse abgeschwemmt wurden und sich auf dem Meeresboden angesammelt haben. Das verändert die Zusammensetzung der Schmelzmasse tief in der Erdkruste und führt dazu, dass sich die in den indonesischen Vulkanen aufsteigende Lava bedeutend von dem Basalt unterscheidet, der aus einem Mittelozeanischen Rücken austritt. Sie ist viel zähflüssiger, weshalb sie nicht aus Rissen strömt oder einen Fluss bildet, sondern im Schlund der Vulkane gerinnt. Es entsteht der gleiche Effekt, wie wenn man das Sicherheitsventil eines Boilers festschraubt.
Einer dieser indonesischen Vulkane sorgte für einen der katastrophalsten Vulkanausbrüche der Geschichte. Im Jahr 1883 stiegen aus der nur sieben Kilometer langen und fünf Kilometer breiten Insel Krakatau in der Sundastraße zwischen Sumatra und Java plötzlich Rauchwolken auf. Die Ausbrüche wurden mit jedem Tag stärker. Vorbeisegelnde Schiffe mussten auf dem Wasser schwimmende Bimssteinteppiche durchqueren. Asche fiel auf ihre Decks und Vulkanblitze erhellten die Takelagen. Jeden Tag spuckte der Krater unter ohrenbetäubendem Lärm riesige Mengen Asche, Bims und Lavablöcke in die Luft. Die unterirdische Kammer, die das ganze Material gespeichert hatte, leerte sich mit der Zeit. Am 28. August um 10 Uhr morgens hielt ihre nur noch unzureichend gestützte Gesteinsdecke dem Ozean und dem Meeresboden nicht länger stand und brach ein. Millionen Tonnen Wasser und ein Drittel der Insel fielen auf die flüssige Lava. Es kam zu einer gewaltigen Explosion. Deren Knall ging um die ganze Welt und war das wahrscheinlich lauteste Geräusch, das jemals registriert wurde. Sogar im 3000 Kilometer südöstlich gelegenen Australien war der Donner klar zu hören. Auf der kleinen Insel Rodriguez in 5000 Kilometer Entfernung hielt der Kommandant der britischen Garnison den heftigen Schlag für fernes Kanonenfeuer und stach in See. Ein Sturmwind ging von der Ausbruchstelle aus sieben Mal um die Welt, bevor er schließlich nachließ. Die größte Katastrophe war allerdings die von der Explosion verursachte riesige Welle. Auf ihrem Weg Richtung Java wuchs sie zur Höhe eines vierstöckigen Gebäudes heran. Sie riss ein Kanonenboot der Marine mit sich und setzte es zwei Kilometer im Landesinneren auf einem Hügel wieder ab. Die Welle überrollte jedes Dorf an der dicht besiedelten Küste, das ihr im Weg stand, und kostete 36 000 Menschen das Leben.
Die größte Explosion des 20. Jahrhunderts geschah auf der anderen Seite des Pazifiks, wo der östliche Rand der pazifischen Platte an der Westküste Nordamerikas entlangreibt. Auch an dieser Plattengrenze befindet sich nur auf einer Seite eine kontinentale Kruste und die Kontaktlinie liegt nicht sehr weit unter der Oberfläche. Da die Kontinente aber aus Gestein bestehen, das leichter ist als Basalt, schieben sie sich über die absinkende ozeanische Platte, wodurch rund 200 Kilometer im Landesinneren eine Vulkankette aus der Erde bricht. Und wieder sorgen die Sedimente in der Lava im Inneren der Vulkane für ein hochexplosives Gemisch.
Bis 1980 war der Mount St. Helens für seinen herrlich symmetrischen Vulkankegel bekannt. Fast 3000 Meter ragte er in die Höhe und war das ganze Jahr über mit Schnee bedeckt. Im März 1980 begann er, furchteinflößend zu rumoren. Eine Wolke aus Dampf und Rauch quoll aus seiner Kuppe und hinterließ graue Streifen auf dem weißen Schneemantel. Die Rauchsäule nahm im Lauf des Aprils immer größere Dimensionen an. Am bedenklichsten war jedoch, dass sich die Nordseite des Berges rund tausend Meter unter dem Gipfel gefährlich nach außen wölbte. Jeden Tag schwoll sie um zwei weitere Meter an, denn Tausende Tonnen Gestein wurden nach oben und außen gedrückt. Tagtäglich spuckte der weiter oben gelegene Hauptkrater neue Asche und Rauch. Am 18. Mai um halb neun Uhr morgens explodierte der Mount St. Helens schließlich.
Rund ein Kubikkilometer der Nordwestwand wurde einfach weggesprengt. Die Kiefern, Tannen und Schierlinge, die die unteren Hänge auf einer Fläche von über 200 Quadratkilometern bewuchsen, fielen um wie Streichhölzer. Eine riesige schwarze Rauchwolke breitete sich über dem Gipfel aus und ragte zwanzig Kilometer in den Himmel. Die nähere Umgebung des Vulkans war nur dünn besiedelt und schon im Vorfeld hatte man die Bevölkerung gewarnt. Trotzdem starben sechzig Menschen. Geologischen Schätzungen zufolge explodierte der Mount St. Helens mit einer Schlagkraft 2500 Mal so stark wie die Atombombe von Hiroshima.
Unmittelbar nach einem Ausbruch kehrt das Leben nicht sofort auf einen Vulkan zurück. Im Fall einer Explosion steigen noch Wochen später Dampf, Rauch und giftige Gase aus den Gesteinstrümmern im Krater auf. Auch der extremen Hitze der Basaltflüsse, die aus den Vulkanen Mittelozeanischer Rücken austreten, kann kein Organismus standhalten. Ausbruchstellen müssen die wohl leblosesten, unfruchtbarsten Orte der Welt sein. Wenn sich allerdings die Konvektionsströme tief unter der Erdoberfläche auch nur leicht verschieben, dann nimmt die Zerstörungswut dieser vulkanischen Schmelzöfen ab. In den späteren Phasen eines Ausbruchs speit der sterbende Vulkan oft keine Lava mehr, sondern kochend heißes Wasser und Dampf. Dieses Wasser stammt teils aus der Magma, teils aus dem natürlichen Grundwasserspiegel der Erdkruste, und enthält in aufgelöster Form eine große Anzahl chemischer Substanzen. Einige davon haben ihren Ursprung in denselben tiefliegenden Quellen wie die Lava, andere wurden beim Aufstieg des heißen Wassers aus dem Gestein freigesetzt. Unter ihnen befinden sich Stickstoff- und Schwefelverbindungen, deren Konzentrationen oft ausreichen, um sehr einfache Organismen mit Nahrung zu versorgen. Tatsächlich ist es möglich, dass die allerersten Lebensformen auf der Erde vor rund 3,6 Milliarden Jahren unter genau diesen Umständen entstanden.
Zu jener unvorstellbar weit zurückliegenden Zeit umhüllte noch keine sauerstoffreiche Atmosphäre unsere Erde. Auch die Form und die Position der Kontinente unterschieden sich grundlegend von ihrer aktuellen Verteilung. Die Vulkane waren nicht nur viel größer als heute, sondern auch zahlreicher. Die Meere – entstanden durch Kometeneinschläge oder durch die Kondensation von Dampfwolken, die diesen neuen Planeten umgaben – waren noch sehr heiß. Wasser aus tief in der Erdkruste liegenden vulkanischen Quellen strömte in die Ozeane. In diesen an chemischen Elementen reichen Gewässern bildeten sich komplexe Moleküle und nach langer, langer Zeit erschienen mikroskopisch kleine Körnchen lebender Materie. Diese verfügten zwar kaum über innere Strukturen, konnten aber die chemischen Substanzen aus dem Wasser in Gewebe umwandeln und sich so fortpflanzen. Solche Populationen von Einzellern kann man sich wie Bakterien vorstellen.
Heute gibt es viele verschiedene Arten von Bakterien, die sich durch eine Fülle von chemischen Prozessen am Leben halten. Zu finden sind sie überall – auf dem Land, im Meer und in der Luft. Einige von ihnen florieren sogar in vulkanischen Umgebungen, die sehr wohl denen entsprechen könnten, in denen sie ursprünglich entstanden sind.
Aus einer vulkanischen hydrothermalen Spalte in der arktischen Tiefsee mit dem dramatisch klingenden Namen Lokis Schloss entnahmen Forscher im Jahr 2010 Schlammproben. Nach fünf Jahren umfassender Studien konnten die Wissenschaftler im Schlamm die DNA einer einzigartigen Bakterienart nachweisen, den Lokiarchaeen. Diese Organismen scheinen das Bindeglied zwischen verschiedenen einzelligen Lebensformen zu sein und ähneln in gewisser Weise dem Vorgänger aller mehrzelliger Lebewesen. Auch komplexe Ökologien hat man bereits an solchen Stellen im Meeresboden gefunden. Ein amerikanisches Tiefsee-Forschungsschiff untersuchte so zum Beispiel 1977 Unterwasservulkane auf einem Meeresrücken südlich der Galapagosinseln. Drei Kilometer unter der Wasseroberfläche entdeckten die Wissenschaftler Schlote im Meeresboden, aus denen heißes, an chemischen Stoffen reiches Wasser austrat. In diesen Fontänen sowie in den Gesteinsspalten der nahen Umgebung stellten sie hohe Konzentrationen von Bakterien fest, die eben diese Chemikalien aus dem Wasser filterten. Die Bakterien dienten wiederum riesigen, bis zu 3,5 Meter langen und zehn Zentimeter dicken Würmern als Nahrung. Der Wissenschaft waren diese Würmer komplett neu, denn sie hatten weder Maul noch Darm. Vielmehr nahmen sie die Bakterien über die dünne Haut ihrer gefiederten Tentakeln auf, die aus ihrem Vorderende wuchsen und reich an Blutgefäßen waren. Da diese Organismen in den dunklen Tiefen des Ozeans leben, können sie nicht direkt die Energie des Sonnenlichts nutzen. Auch eine indirekte Aufnahme durch Teile toter Tiere, die auf den Meeresboden sinken, ist aufgrund des fehlenden Mauls unmöglich. Ihre gesamte Nahrung stammt aus den Bakterien, die sich wiederum durch das nährstoffreiche Vulkanwasser am Leben halten. Diese Würmer könnten durchaus die einzigen größeren Tiere auf der ganzen Welt sein, die ihre Energie ausschließlich von Vulkanen beziehen.
Neben den Würmern liegen gewaltige Muscheln auf dem Meeresboden, die bis zu dreißig Zentimeter lang werden können und sich ebenso von Bakterien ernähren. Durch die aufsteigenden Heißwasserfontänen entstehen Strömungen, die in Richtung der Schlote auf dem Meeresboden abfließen. Sie enthalten organische Teilchen, die von anderen Organismen verspeist werden – sonderbare, bis dato unbekannte Fischarten und blinde weiße Krebse, die sich um die Würmer und Muscheln scharen. So gedeiht in den vulkanischen Quellen weit unter der Wasseroberfläche in tiefer Dunkelheit eine dichte und mannigfaltige Gesellschaft geheimnisvoller Kreaturen.
Heiße Quellen sprudeln auch an Land aus dem Boden. Ihr Wasser stammt teils aus sehr tief in der Erdkruste gelegenen Quellen, teils aus weit in den Boden eingedrungenem Regenwasser. Aufgeheizt von der Lavakammer, wird es anschließend durch Risse im Gestein wieder nach oben gedrückt. Man kann sich das so vorstellen wie kochendes Wasser, das im Schnabel eines Teekessels aufsteigt. Aufgrund der besonderen Geometrie der Röhren, Risse und Spalten im Erdboden kommt es manchmal zu stoßartigen Ausbrüchen des Wassers. Dieses staut sich in kleinen unterirdischen Kammern an und wird unter Druck überhitzt, bis es schließlich explosionsartig verdampft und als Wassersäule, genauer gesagt als Geysir, aus dem Boden schießt. In anderen Fällen ist die Aufwärtsbewegung regelmäßiger und das Wasser sammelt sich in einem tiefen, ständig gefüllten Becken. Es kann dabei so kochend heiß sein, dass an der Oberfläche Dampf entsteht. Doch sogar bei solch extremen Temperaturen florieren Bakterien. Sie gedeihen hier zusammen mit etwas weiterentwickelteren Organismen, den Blaualgen. Deren innerer Aufbau scheint kaum komplexer als die der Bakterien, aber sie enthalten Chlorophyll. Dank dieser bemerkenswerten Substanz können die Algen mithilfe erstaunlicher physikalischer Vorgänge die Sonnenenergie nutzen, um chemische Stoffe in lebendes Gewebe umzuwandeln, während sie gleichzeitig Sauerstoff ausscheiden.
Solche Organismen findet man zum Beispiel im Yellowstone-Nationalpark in Nordamerika. Dort bilden die Algen und Bakterien auf dem Boden der Heißwasserbecken schleimige grüne und braune Filme. Auch in den oberen Schichten des Meeres gedeihen schon seit Jahrmilliarden Algen. Sie verwandeln Sonnenlicht in Kohlenstoff, wodurch die riesigen unterirdischen Erdölvorkommen entstehen, die wir Menschen seit dem letzten Jahrhundert verbrennen.
An den heißesten Stellen der von diesen Schleimschichten bevölkerten Thermalquellen kann kein anderer Organismus überleben. Wo allerdings das Wasser über den Rand des Beckens tritt und einen Bach bildet, der sich abkühlt, wird es zum Lebensraum für andere Geschöpfe. Die Algenmatten sind hier so üppig, dass sie über die Wasseroberfläche hinausragen. Der Hauptfluss wird durch diesen lebenden Damm umgeleitet und fließt dann ungehindert weiter. Während das Wasser langsam hindurchsickert, kühlt es sich weiter ab, und Schwärme von Salzfliegen versammeln sich darüber. Fällt die Temperatur der Algen auf weniger als 40 °C, lassen sich die Fliegen nieder. Einige von ihnen paaren sich und legen ihre Eier auf den Algen ab, an denen sich schon bald nimmersatte Larven weiden. Sind die Larven groß genug, verpuppen sie sich. Dabei arbeiten sie allerdings auf die eigene Vernichtung und die ihrer Nachkommen hin, denn mit jedem hungrigen Biss schwächen sie die Algen- und Bakterienkolonien. Schließlich bricht die Matte auseinander, der Damm löst sich auf und viel heißeres Wasser fließt aus dem Becken in den Bach. Die übrigen Algen werden weggespült und die unersättlichen Larven verenden. Freilich werden bereits genügend von ihnen geschlüpft sein, sodass die Fliegen diesen Rückschlag verkraften und anderswo in der Thermalquelle mit dem ganzen Prozess wieder von vorn anfangen können.
In den kälteren Gefilden unseres Planeten muss die abnehmende Hitze eines Vulkans nicht unbedingt eine Gefahr darstellen, sondern kann ein Segen sein. Die Vulkankette, die an der Grenze der südamerikanischen und der ostpazifischen Nazca-Platte die Anden hervorbrachte, zieht sich in südliche und östliche Richtung weiter bis in den Antarktischen Ozean. Dort bildet sie mehrere kleine Bögen aus Vulkaninseln. Bellingshausen ist eine davon und gehört zur Gruppe der Südlichen Sandwichinseln. Das wilde Südpolarmeer nagt an der Basis der Insel und hat auf einer Seite eine Felswand freigelegt, die wie im Lehrbuch die abwechselnden Schichten aus Asche und Lava zeigt, durch die sich Zickzacklinien lavagefüllter Röhren ziehen. Eisschollen umgeben die Wand wie ein zerschlissener weißer Rock, und Schneedecken schmiegen sich an ihre Hänge. Bataillone von Adeliepinguinen marschieren über diesen weißen Exerzierplatz. Bahnt man sich seinen Weg durch die Menge und klettert auf den Gipfel des Vulkans, findet man eine enorme klaffende Grube mit einem Durchmesser von einem halben Kilometer vor. Schnee bedeckt ihren Boden und Eiszapfen hängen von den Gesteinsvorsprüngen in ihrem Schlund. In den Felsen unterhalb des Kraterrandes nisten elegante, schlohweiße Schneesturmvögel. Die Vulkanfeuer sind allerdings noch nicht ganz erloschen. An ein oder zwei Stellen nahe des Kraterwalls treten nach wie vor Dampf und Gas aus den Gesteinsrissen. Die Luft stinkt nach Schwefelwasserstoff und knallgelbe Schwefelschichten bedecken die Felsen. Der Boden rund um den Schlot fühlt sich noch warm an, sodass man inmitten der eisigen Polarstürme, die einem in die Haut zu beißen scheinen, trotz des gewöhnungsbedürftigen Geruchs gern in die Hocke geht, um sich etwas aufzuwärmen. Auf den von Schnee umgebenen Gesteinsbrocken zu seinen Füßen sieht man verschiedene Moose wachsen, darunter Lebermoos.
Diese wenigen klitzekleinen Fleckchen sind die einzigen Orte der Insel, die genügend Wärme ausstrahlen, um ein Pflanzenwachstum zu ermöglichen. Obwohl die Inseln extrem abgeschieden sind – der antarktische Kontinent und die Spitze Südamerikas liegen beide 2000 Kilometer entfernt – verteilt der Wind die Sporen dieser einfachen Pflanzen über die Atmosphäre in der ganzen Welt. Auf diese Weise werden sogar solch isolierte Stellen wie diese inmitten einer sonst fast lebensfeindlichen Insel kolonisiert, sobald die Voraussetzungen dafür geschaffen sind.
Nicht nur in den bitterkalten Regionen der Erde machen sich Lebewesen vulkanische Hitze zunutze. Sogar in tropischeren Breitengraden haben sie gelernt, ihre Vorteile daraus zu ziehen. Die Großfußhühner sind eine Vogelart, deren Verbreitungsgebiet sich von Indonesien bis zum Westpazifik erstreckt. Sie haben extrem ausgeklügelte Verfahren zum Ausbrüten ihrer Eier entwickelt. Einer ihrer typischsten Vertreter ist das australische Thermometerhuhn. Dieser bemerkenswerte Vogel geht beim Nestbau wie folgt vor: Erst hebt er eine enorme Grube aus, die schon mal bis zu vier Meter breit sein kann. Dann füllt er sie mit verrottendem Pflanzenmaterial und bedeckt sie anschließend mit Sand. In den riesigen Haufen gräbt das Weibchen einen Tunnel, in den sie ihre Eier legt. Das Männchen füllt diesen Tunnel mit Sand auf und vertraut darauf, dass die aus den verwesenden Pflanzen entstehende Wärme die Eier warm hält. Allein lässt es sie allerdings nicht, ganz im Gegenteil: Mehrmals am Tag kehrt das Männchen an die Brutstelle zurück und steckt seinen Schnabel in den Sand. Seine Zunge ist so sensibel, dass sie Temperaturunterschiede von einem Zehntel Grad wahrnimmt. Bemerkt das Männchen, dass der Sand für die Eier zu kühl ist, häuft er mehr an. Ist er zu heiß, entfernt er ihn. Nach einer ungewöhnlich langen Brutzeit bahnen sich die jungen Thermometerhuhnküken im vollen Federkleid ihren Weg an die Oberfläche des Sandhaufens und machen sich auf und davon.
Ein naher Verwandter des Thermometerhuhns, das Hammerhuhn, lebt auf der indonesischen Insel Sulawesi. Dieses vergräbt seine Eier im Vulkansand an den Stränden der Insel. Da der Sand schwarz ist, nimmt er Wärme auf und wird im Sonnenschein heiß genug, um die Eier auszubrüten. Andere Hammerhühner sind von der Küste an die Vulkanhänge im Inselinneren gezogen. Dort gibt es große Bodenflächen, die permanent von vulkanischem Dampf erwärmt werden. Ganze Kolonien von Hammerhühnern legen hier ihre Eier. Aus dem sterbenden Vulkan ist ein Brutkasten geworden.
Die Bewegung der Platten auf der Erdkruste sowie Veränderungen in den Strömungen darunter sorgen schließlich dafür, dass ein Vulkan komplett erlischt. Der Boden kühlt sich ab. Pflanzen und Tiere aus der Umgebung beginnen, die neuen, bis dahin lebensfeindlichen Felsen sowie das verwüstete Land ringsum zu kolonisieren. Basaltflüsse sind für die Neuankömmlinge allerdings problematisch. Ihre glänzende, knubbelige Oberfläche ist so glatt, dass Wasser einfach über sie hinwegrinnt. Zudem gibt es nur wenige Risse, in denen Jungpflanzen ihre zarten Wurzeln bilden können. Einige der Flüsse bleiben deshalb noch über Jahrhunderte hinweg unbelebt. Die Arten von Blütenpflanzen, die sich zuerst in diesen unwirtlichen Gebieten niederlassen, unterscheiden sich von Region zu Region. Auf den Galapagosinseln, deren Flora hauptsächlich aus Südamerika stammt, sind es oft Kakteen, die als allererstes Wurzeln schlagen. Da sie dafür geschaffen sind, jedes noch so kleine Tröpfchen Feuchtigkeit zu speichern, und normalerweise in der Wüste vorkommen, überleben sie die sengende Hitze auf der schwarzen Lava. Auf Hawaii ist ein weniger bekanntes, aber ebenso wasserspeicherndes Gewächs für die Erstbesiedlung zuständig: der Ohiabaum. Dessen Wurzeln dringen tief in die Lavadecke ein und binden dort die Feuchtigkeit. Oft bahnen sie sich dabei ihren Weg in die leere Höhle, also in die Lavaröhre, die sich mittig durch die meisten dieser Flüsse zieht. Dort unten hängen die Wurzeln wie riesige braune Glockenseile von der Decke der Röhre. Regenwasser sickert von der Lavadecke durch Risse ins Innere, befeuchtet die Wurzeln und tropft anschließend auf den Boden. Fern von der Sonne verdampft das Wasser hier nicht, sondern sammelt sich in kleinen Becken und sorgt für kaltfeuchte Luft in den Höhlen.
Eine Lavaröhre ist ein unheimlicher Ort. Regen, Unwetter und Frost können ihr nichts anhaben, wodurch ihre Wand und ihr Boden nicht abgetragen werden, sondern intakt bleiben. Ihr Innenleben sieht also genauso aus wie in jenem Moment, in dem das letzte Rinnsal Lava hindurchgeflossen ist und der Boden noch heiß genug war, um alles sofort zu verbrennen, was mit ihm in Berührung kam. Geronnene Lavatropfen hängen wie Stalaktiten von der Decke. Der Boden ist von Lava bedeckt, die wie fest gewordener Haferschleim aussieht. An manchen Stellen ist sie über ein Hindernis geflossen und ließ eine erstarrte Kaskade zurück. Wenn unvermittelt eine Lavawelle hier hindurchpeitschte, schwoll der Fluss vorübergehend an, kühlte sich besonders schnell ab und hinterließ an der Wand eine Art Hochwassermarke.
Mehrere Arten von Lebewesen haben sich an diesem eigentümlichen Ort häuslich eingerichtet. In den winzigen Härchen der herabhängenden Wurzeln leben und futtern verschiedene Insektenarten, darunter Grillen, Springschwänze und Käfer, die wiederum die Beute von Spinnen sind. Diese kleinen Geschöpfe unterscheiden sich jedoch von ihren nahen Verwandten, die anderswo auf der Insel an der frischen Luft leben. Viele von ihnen haben nämlich weder Augen noch Flügel. Wenn ein Körperteil nicht mehr gebraucht wird, bedeutet seine Weiterentwicklung einen Energieverlust für das Tier. Wer seine Ressourcen nicht auf solche Weise verschwendet, hat einen klaren Vorteil gegenüber denen, die ihre Kraft weiter in Unnötiges stecken. Ungenutzte Organe bilden sich über Generationen zurück und verschwinden letztendlich ganz. Andererseits sind lange Fühler und Beine in der Finsternis der Höhle von Vorteil, denn damit können die Tierchen Hindernisse und Nahrung ertasten. Und so haben alle Wesen, die in einer Lavaröhre leben, tatsächlich ungewöhnlich lange Gliedmaßen und Antennen.
Die nach einem kontinentalen Vulkanausbruch zurückbleibende Ödnis scheint leichter zu kolonisieren zu sein als glatte Basaltflüsse, denn auf Asche und zerklüfteter Lava können die Pflanzen besser wurzeln. Die riesige Wüste, die nach der Eruption des Mount St. Helens entstand, wurde schon nach kurzer Zeit wieder von Pflanzen bevölkert. Bereits Monate nach der Katastrophe fand man an den Rändern der Schlammbänke und unter Felsbrocken kleine Ansammlungen flauschiger Flugsamen. Viele von ihnen stammten von Weidenröschen, einer hüfthohen Pflanze mit hübschen violetten Blüten. Deren Samen sind so leicht und flaumig, dass der Wind sie über Hunderte von Kilometern breittragen kann. In Europa erschienen während des letzten Weltkriegs auf zerbombten Flächen bereits nach ein paar Wochen Weidenröschen und verliehen den trostlosen Trümmern ein wenig Farbe. In Nordamerika heißt die Pflanze „fireweed“, denn nach Waldbränden ist sie eins der ersten Lebenszeichen inmitten verrußter Baumstümpfe. Genauso kühn kolonisiert das Röschen auch Gebiete, die von Vulkanausbrüchen zerstört wurden.
Kurze Zeit später kamen Lupinen hinzu. Sie gediehen trotz fehlender Nährstoffe in der Lava, da sie diese selbst bilden können. Besonders erstaunlich ist, dass auch schon bald Tiere in die obersten Höhenlagen des geborstenen Vulkans zurückkehrten, obwohl es für sie hier kaum Nahrung gab. Nach ein oder zwei Jahren fanden sich an den Hängen des Gipfels Spinnen ein, die sich durch Fadenflug fortbewegten, sowie bestimmte Käferarten. Sie ernährten sich von Teilen toter Insekten, die der Wind auf den Berg geweht hatte. Diese Schicht toter Gliederfüßer – darunter Motten, Fliegen und sogar Libellen –, die versehentlich hier landeten und aufgrund von Futtermangel zu einem frühzeitigen Tod verdammt waren, bildete letztendlich die Basis für eine dauerhaftere Besiedlung des Geländes. Nach ihrem Tod wehte der Wind Teile ihrer Körper zusammen mit Pflanzensamen in Ritzen und Ecken, wo sie sich zersetzten. Die Nährstoffe aus diesen winzigen Kadavern gelangten in die darunterliegende Asche. Jetzt waren die Samen an der Reihe: Sie keimten und fanden inmitten des sonst so sterilen, unverwitterten Vulkanstaubs einen idealen Nährboden. Heute, über vier Jahrzehnte nach dem Ausbruch, gibt es trotz der noch sichtbaren Narben wieder Lebenszeichen auf dem Mount St. Helens. Die schnelle Rekolonisierung des Bergs überraschte sogar die Wissenschaftler.
Wie komplett sich die Natur von einem Vulkanausbruch erholen kann, zeigt Krakatau. Fünfzig Jahre nach der Katastrophe tauchte ein kleiner feuerspuckender Schlot aus dem Meer auf. Die Menschen nannten ihn Anak Krakatau, „Kind des Krakatau“. Heute wachsen an seinen Flanken Kasuarinenbäume und wildes Zuckerrohr. Gut 1,5 Kilometer entfernt liegt Rakata, ein Überrest der alten Insel. Dichte Tropenwälder bedecken seine Hänge, die noch vor 150 Jahren kein Leben zuließen. Einige der Samen, aus denen sich diese Wälder entwickelten, muss wohl das Meer hier angespült haben. Andere sind mit dem Wind auf die Insel gekommen, und ein paar von ihnen hafteten sicher auch an den Füßen von Vögeln oder wurden von ihnen ausgeschieden. In den Wäldern leben jede Menge Flügeltiere wie Vögel, Schmetterlinge und andere Insekten, die offensichtlich keine Schwierigkeiten damit hatten, die gerade einmal vierzig Kilometer vom Festland aus in der Luft zurückzulegen. Auch Pythons, Warane und Ratten sind hier angekommen, vielleicht auf im Wasser schwimmenden Pflanzenteppichen, die von tropischen Flüssen ins Meer gespült wurden. Dessen ungeachtet finden sich leicht Hinweise auf das junge Alter des Waldes und die Naturkatastrophe, die seiner Entstehung vorausging. Die Baumwurzeln bedecken den Boden mit einer Art Gitterwerk, das die Erde kompaktiert. Hier und da werden sie allerdings von kleinen Bächen unterspült. Bäume fallen um und zum Vorschein kommt loser, pulvriger Vulkanstaub. Ist die Pflanzendecke einmal auf diese Art durchbrochen, spült das Wasser die unbefestigte Asche leicht weg und es entsteht eine enge, sechs bis sieben Meter tiefe Spalte unter dem Wurzelnetz. Doch solche Durchbrüche sind die Ausnahme. Der tropische Wald hat sich in nur einem Jahrhundert Krakatau zurückerobert. Zum Ende des 21. Jahrhunderts wird auch der Nadelwald wieder auf den Mount St. Helens zurückgekehrt sein und mit ihm Säugetiere und Pflanzen, die ihn ihr Zuhause nennen.
Die Wunden, die Vulkane auf der Erde hinterlassen, verheilen letztendlich. Obwohl uns Menschen in der kurzen Zeit, die wir auf unserem Planeten leben, Vulkane wie die zerstörerischsten, furchteinflößendsten Naturgewalten überhaupt vorkommen, sind sie auf längere Zeit gesehen tatsächlich die größten Schöpfer. Sie haben neue Inseln wie Island, Hawaii und die Galapagos hervorgebracht und Berge wie den Mount St. Helens und die Anden geschaffen. Und es sind gerade die großen Kontinentalverschiebungen auf der Erde und die mit den vulkanischen Aktivitäten einhergehenden Veränderungen in der Atmosphäre, die eine lange Kette von Umweltveränderungen in Gang setzen, welche ihrerseits Tiere und Pflanzen immer wieder vor gefährliche Herausforderungen stellen, ihnen aber auch neue Möglichkeiten bieten, sich weiterzuentwickeln.
KAPITEL 2
WELT AUS EIS
In den Höhen des Himalaja und der anderen großen Gebirge unserer Welt kann auf Dauer nichts überleben. Die heftigsten Winde der Erde peitschen hier erbarmungslos auf die Berge ein, zeitweise mit Geschwindigkeiten von bis 300 Kilometern pro Stunde. Zudem herrscht eine tödliche Kälte.
Es mag uns paradox erscheinen, dass die Gebiete der Erde, die der Sonne am nächsten sind, zu den kältesten der Welt gehören. Luft erwärmt sich, wenn Sonnenstrahlen hindurchscheinen, dabei zusätzliche Energie an die atomaren Bestandteile der atmosphärischen Gase abgegeben und diese deshalb öfter zusammenstoßen. Bei jeder dieser winzigen Kollisionen wird Hitze freigesetzt. Je dünner die Luft allerdings ist, desto weiter sind die Atome voneinander entfernt. Es kommt seltener zu Zusammenstößen, und die Luft bleibt kühler.
Und Kälte ist ein Killer. Dringt sie so tief in den Körper einer Pflanze oder eines Tieres ein, dass die Flüssigkeit in den Zellen gefriert, dann bersten die Zellwände bis auf wenige Ausnahmen wie gefrorene Wasserleitungen und das Gewebe wird zerstört. Kälte kann für Tiere jedoch schon tödlich sein, lange bevor sie ihre Körper steiffriert. Die meisten von ihnen – darunter Insekten, Amphibien und Reptilien – nehmen ihre Körperwärme direkt aus ihrer Umgebung auf, weshalb sie manchmal als „kaltblütig“ bezeichnet werden. Dieser Begriff ist irreführend, denn ihr Blut ist oft alles andere als kühl. Viele Echsen zum Beispiel verteilen ihre Sonnenbäder so effektiv über den Tag, dass sie ihren Körper tagsüber warm halten können. Ihre Körpertemperatur übersteigt dabei oft die von uns Menschen. Nachts kühlen sie jedoch beträchtlich aus. Diese Lebewesen dulden zwar große Veränderungen in ihrer Körpertemperatur, aber auch sie sterben, lange bevor sie gefrieren. Mit sinkender Temperatur verlangsamt sich der Energiestoffwechsel im Körper und die Tiere werden immer träger. Die Nervenmembranen sind normalerweise halbflüssig, weshalb sie winzige elektrische Signale weiterleiten können. Ab einer Temperatur von 4 °C über dem Gefrierpunkt entfällt diese Eigenschaft jedoch. Das Tier verliert seine Körperkoordination und stirbt.
Vögel und Säugetiere haben größere Überlebenschancen in der Kälte, denn sie erzeugen Eigenwärme. Dafür zahlen sie jedoch einen sehr hohen Preis. Sogar an einem recht warmen Tag verbrauchen wir die Hälfte unserer aufgenommen Nahrung für den Erhalt unserer Körpertemperatur. Wenn es richtig kalt ist und wir uns nicht warm genug anziehen, können wir unsere Körperwärme nicht so schnell erzeugen wie wir sie verlieren. Dabei ist es egal, wie viel wir essen. Unser Gehirn und die anderen hochkomplexen Organe dulden nur Schwankungen von wenigen Grad. Wenn sich unsere Körper also auf Temperaturen abkühlen, die Reptilien lediglich etwas lethargisch machen, sterben wir.
Auf den hohen Bergen der Welt, auf denen gut und gerne Temperaturen von –20 °C herrschen können, gibt es fast kein Leben. Die einzigen Ausnahmen sind kleine Organismen, die der Wind aus Versehen hierher geweht hat, sowie der eine oder andere Mensch, der sich – vielleicht aus noch unerklärlicheren Gründen – aus freien Stücken hierauf wagt.
Kletterer sehen bei ihrem Abstieg von solchen Gipfeln vermutlich kein einziges Lebenszeichen zwischen den Eisklippen und den gefrorenen Felsen, bis sie eine Höhe von rund tausend Metern unter dem Gipfel erreichen. Auf immerhin noch 7000 Metern könnte ihnen der erste Organismus begegnen. Dabei handelt es sich höchstwahrscheinlich um einen dünnen, blasigen Film auf den Felsen: die Flechten. Flechten sind keine eigenständige Spezies, sondern vereinen zwei – sie sind eine Art sehr intime Lebensgemeinschaft aus Algen und Pilzen. Der Pilz bildet Säuren, die sich in die Oberfläche des Felsens fressen, wodurch sich die Kolonie dort einnisten kann. Die Minerale im Gestein werden dabei in einen chemischen Stoff umgewandelt, der von der Alge aufgenommen werden kann. Der Pilz bildet außerdem ein schwammiges Gerüst für die Kolonie, das Feuchtigkeit aus der Luft aufsaugt. Mithilfe von Sonnenlicht stellt die Alge wiederum aus den Mineralien im Gestein sowie aus Wasser und Kohlendioxid aus der Luft Nahrungssubstanzen her, von denen sie und der Pilz sich ernähren. Beide Organismen pflanzen sich getrennt voneinander fort, und die nachfolgenden Generationen müssen die Beziehung wieder von Neuem aufbauen. Die Partnerschaft ist jedoch nicht gleichberechtigt. Manchmal wickeln sich die Pilzfäden nämlich um die Algenzellen und verschlingen sie. Während die Alge auch getrennt vom Pilz ein unabhängiges Leben führen kann, ist der Pilz für sein Überleben auf die Alge angewiesen. Der Pilz scheint die Alge zu benutzen, um kahle Gebiete zu besiedeln, was für ihn allein unmöglich wäre. Viele Algen- und Pilzarten schließen sich auf diese Weise zusammen. Bestimmte Paare sind allerdings so weitverbreitet, dass die daraus entstehenden Organismen als eigenständige Spezies mit ihren typischen Formen, Farben und Gesteinsvorlieben angesehen werden.
Auf der ganzen Welt gibt es rund 17 000 Flechtenarten. Alle wachsen langsam, aber besonders jene, die sich auf den Felsen der Berggipfel ansiedeln. In solchen Höhenlagen kann es passieren, dass das Wachstum an nur einem einzigen Tag im Jahr möglich ist. Deshalb können Flechten schon einmal 60 Jahre brauchen, um einen einzigen Quadratzentimeter zu bevölkern. Sie sind oft tellergroß, also womöglich Hunderte – wenn nicht Tausende – Jahre alt.
Die Schneefelder an den oberen Bergflanken scheinen noch lebloser zu sein als die Felsen um sie herum. Jedoch sind nicht alle von ihnen komplett weiß. Im Himalaja, in den Anden und den Alpen sowie auf den Bergen der Antarktis leuchten einige Abschnitte so rosarot wie das Fleisch einer Wassermelone. Es ist ein unglaublicher Anblick. Wer hier klettern will, muss seine Augen mit einer Schneebrille schützen. Die merkwürdigen Flecken und Streifen auf dem Schnee können durch die Brille wie Schatten oder optische Täuschungen aussehen. Untersucht man den Schnee mit dem bloßen Auge, lässt sich außer der auffälligen rosaroten Färbung immer noch nichts Außergewöhnliches entdecken. Die Ursache ist nur unter dem Mikroskop erkennbar: Unter den gefrorenen Teilchen des Schnees befindet sich eine Vielzahl winziger einzelliger Organismen. Auch das sind Algen. Jede von ihnen enthält grüne Partikel, mit deren Hilfe sie Photosynthese betreibt. Doch die grüne Farbe wird von einem starken roten Pigment übertüncht, das der Alge den gleichen Nutzen bringen mag wie uns die Schneebrille: Es filtert schädliche ultraviolette Strahlen aus dem Sonnenlicht.
Zu einem bestimmten Lebenszeitpunkt verfügen diese Algenzellen über klitzekleine pochende Fäden, die sogenannten Geißeln oder Flagellen. Mit deren Hilfe bewegen sie sich durch den Schnee, bis sie eine Position nah an der Oberfläche erreichen, wo genau die richtige Menge Sonnenlicht einfällt. Der Schnee schützt die Algen vor dem Wind, und die Temperaturen sind hier nicht so furchtbar niedrig wie an der Luft. Trotzdem benötigen die Schneealgen Schutz vor der Kälte. Zu diesem Zweck enthalten sie eine chemische Substanz, die sogar mehrere Grad unter dem Gefrierpunkt von Wasser flüssig bleibt.
Diese winzigen Pflanzen brauchen nichts weiter als Sonnenlicht und eine verschwindend geringe Menge an Nährstoffen, die sie aus dem Schnee gewinnen. Sie ernähren sich von keinen anderen lebenden Organismen und nichts ernährt sich von ihnen. Außer der zarten Rotfärbung des Schnees haben sie keine weiteren Auswirkungen auf ihre Umwelt. Sie existieren einfach und zeugen berührend davon, dass das Leben offenbar sogar auf dem unscheinbarsten Niveau einfach nur um seiner selbst willen besteht.
Auch komplexere Geschöpfe sind in den Schneefeldern zu Hause, so zum Beispiel winzige Würmer und scheinbar primitive Insekten wie Felsenspringer, Springschwänze und Grillenschaben. Diese kommen oft in solch großen Mengen vor, dass sie den Schnee nicht pink, sondern schwarz färben. Die dunkle Farbe kann ihnen zugutekommen, denn im Gegensatz zu hellen Tönen reflektieren sie Wärme nicht, sondern nehmen sie auf. Doch trotz dieses Vorteils befinden sie sich die meiste Zeit nahe am Gefrierpunkt, weshalb auch sie über körpereigene Frostschutzmittel verfügen. Ihre physiologischen Prozesse sind zudem so an niedrige Temperaturen angepasst, dass sie durch plötzliches Aufwärmen – wenn man sie zum Beispiel in die Hand nimmt – nicht mehr richtig funktionieren können und sterben. Im Gegensatz zur Schneealge synthetisieren sie ihre Nahrung nicht selbst, sondern vertilgen stattdessen Pollenkörner und die Kadaver toter Insekten, die der Wind aus den Tälern hinaufgeweht hat.
Wie von solch unterkühlten Organismen zu erwarten ist, geht ihr Leben extrem langsam vonstatten. So dauert es ein Jahr, bis das Ei einer Grillenschabe ausgebrütet ist, und die schlüpfende Larve braucht fünf Jahre, bis sie das Erwachsenenstadium erreicht. Zudem hat keiner dieser Schneebewohner Flügel. Das überrascht kaum, denn Insektenflügel müssen sehr schnell schlagen, um den Tierchen zum Flug zu verhelfen, und kein Insektenmuskel schafft das bei niedrigen Temperaturen. Es fehlt einfach an Energie. Eines dieser außergewöhnlichen Kreaturen, die flügellose Skorpionsfliege, ist auch in Großbritannien zu Hause, wo sie Schneefloh genannt wird. Sie hat ihre ganz eigene Methode entwickelt, um den Verlust ihrer Flugkraft zu kompensieren. Dafür kommt sie ohne eilige Muskelbewegungen aus. Stattdessen befinden sich an ihren Beingelenken winzige elastische Fortsätze, die langsam von den Muskeln zusammengestaucht werden und anschließend in ihrer Position einrasten. Wird das Insekt von einem Feind bedroht, lässt es die Springhilfe plötzlich und explosionsartig los und legt einen himmelhohen Satz zurück.
Zwischen den Felsen neben den Schneefeldern drängen sich kleine, kissenartige Pflanzen: Büschel-Nelken, Steinbrecher, Enziane und Moose. Sie drücken sich an das abschüssige Gelände, um sich vom Wind zu schützen. Ihre Wurzeln sind lang und dringen bis zu einem Meter tief in den Boden ein. So kann die Pflanze Stürmen standhalten und bleibt auch dann im Boden verankert, wenn die Steine verrutschen. Ihre Stängel und Blätter liegen dicht an dicht und geben sich gegenseitig Halt sowie Schutz vor der Kälte. Manche Pflanzen können ihre Nahrungsreserven sogar zur Wärmeerzeugung einsetzen und den Schnee um sich herum schmelzen. Alle wachsen extrem langsam. Ein oder zwei winzige Blättchen können schon alles sein, was eine Pflanze in einem ganzen Jahr hervorbringt und es kann ein ganzes Jahrzehnt dauern, bis sie genügend Reserven für die Blütenbildung gesammelt hat.
Weiter unten am Hang lässt die Kälte ein wenig nach. Felsvorsprünge sorgen für etwas mehr Windschutz und es ist weniger steil. Geröll und Gesteinsbrocken, die der Frost aus den Bergwänden gebrochen hat, liegen hier stabiler. Pflanzen können ausreichend wurzeln und ihre Stängel trauen sich, ein paar Zentimeter mehr in die Höhe zu wachsen. Besonders günstige Stellen sind hier fast durchgehend von einem grünen Teppich bedeckt. Allerdings hat auch in diesen relativ niedrigen Lagen der Kälteschutz allererste Priorität.