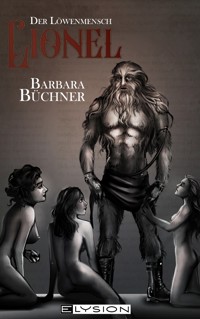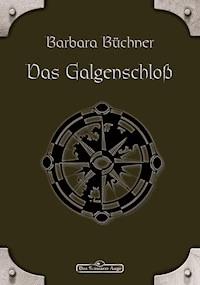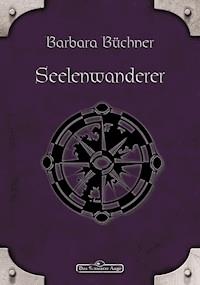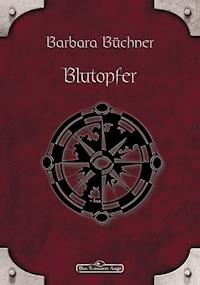4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ashera Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Schauerliches geschieht im lieblichen Wienerwald: Ein verrückter Professor raubt die Leichen der schönsten Wienerinnen, um sie als seine Sex-Sklavinnen wiederauferstehen zu lassen. Eine groteske Geschichte mit typischem Wiener Flair. (Edition Barbara Büchner 2)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Barbara Büchner
DER LEICHENRÄUBER VON WIEN
Edition Barbara Büchner
Band 2
Ashera Verlag
Die Handlung und alle handelnden Personen sind frei erfunden. Jegliche Ähnlichkeit mit lebenden oder realen Personen wären rein zufällig.
In der EDITION BARBARA BÜCHNER sind erschienen:
Der schwarze See, Lovecraftscher Roman
Der Leichenräuber von Wien, Krimi
Copyright © 2020 dieser Ausgabe by Ashera Verlag
Hauptstr. 9
55592 Desloch
www.ashera-verlag.de
Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck oder andere Verwertungen – auch auszugsweise – nur mit Genehmigung des Verlags.
Covergrafik: iStock
Innengrafiken: AdobeStock, iStock
Szenentrenner: AdobeStock
Coverlayout: Atelier Bonzai
Redaktion: Alisha Bionda
Lektorat & Satz: TTT
Vermittelt über die Agentur Ashera
(www.agentur-ashera.net)
Wien war net Wien
Waun net durt
Wo ka Gfrett is
Aans wurd.
(Zu Deutsch: Wien wäre nicht Wien, wenn nicht dort, wo an sich keine unerfreulichen Verwicklungen zu erwarten sind, doch welche auftreten sollten).
Wiener Lebensweisheit
Inhalt
Phase eins:
Ein unbestimmtes Unbehagen
Phase zwei: Das Unbehagen nimmt Gestalt an
Phase drei: Unheilige Experimente
Phase vier: Dem Bösen auf der Spur
Phase fünf: Tragisches Ende eines kühnen Experiments
Epilog
DIE AUTORIN
Phase eins:
Ein unbestimmtes Unbehagen
Ach nein! Jetzt wäre also plötzlich ich schuld an der grauslichen Geschichte? Das ist doch die Höhe! Das vergessen Sie aber ganz g´schwind wieder! Nur weil ich Doktor Strunzl mein Hinterhaus vermietet habe! Was meinen Sie denn, wovon eine alleinstehende Frau heutzutage leben soll? Hätte ich das Hinterhaus etwa leer stehen lassen sollen? Ein leeres Haus ist ein Fass ohne Boden, das müssten Sie wissen! Allein die Reparaturen – da wackelt etwas, dort rostet es, da dringt das Grundwasser ein. Und woher hätte ich, bitte schön, wissen sollen, was dieser Teufel treibt? Das hat er mir doch nicht auf die Nase gebunden! Schon gut, ich beruhige mich ja schon. Wie gesagt: Das stand extra im Mietvertrag, dass er absolut ungestört bleiben will – angeblich, weil er an einer mehrbändigen Geschichte Wiens arbeite. Feine „Geschichte Wiens“. Aber damals fand ich nichts weiter Besonderes dran. Dass man Ruhe braucht, wenn man etwas voranbringen will, dass wusste ich von mir. Schließlich bin ich ja auch Schriftstellerin. Vielleicht keine besonders wichtige – den Pulitzerpreis werde ich wohl nie kriegen –, aber auch Heftchen haben ihre Leser, und ich kann mit Stolz sagen, dass meine „Schwarze Orchidee-Romane“ zum Feinsten gehören, was es in dieser Sparte gibt.
Kennen Sie nicht?
Na, viel lesen Sie ja wohl nicht.
Aber jetzt hören Sie mir einmal zu und unterbrechen mich nicht, dann erzähle ich Ihnen die Geschichte, wie sie sich wirklich abgespielt hat. Keine Rede von dem dummen Zeug, das die Zeitungen schreiben, von schwarzen Messen und Teufelsanbetern! Nein, Doktor Heribert Strunzl hatte etwas völlig Anderes und noch viel Schlimmeres vor.
Um also beim Anfang zu beginnen: Die Villa in Nussdorf habe ich von meinen Eltern geerbt. Nussdorf ist ein altes Winzerdorf am nordwestlichen Rand von Wien, dicht an der Donau und der Eisenbahnlinie, die an der Donau entlang zur tschechischen Grenze und darüber hinaus bis nach Berlin führt. Es war ursprünglich eines der vielen Dörfer, die sich außerhalb der mächtigen Ringmauern der Stadt an die Weinberge kuschelten, und obwohl es schon seit einer Ewigkeit als Teil des Stadtbezirkes Döbling eingemeindet ist, hat es etwas von seinem dörflichen Charakter bewahrt. Die Leute, die hier wohnen, fühlen sich in erster Linie als Nussdorfer und erst in zweiter Linie als Wiener. Dasselbe bemerkt man in Grinzing, in Sievering, in Stammersdorf und wie alle die einstigen Dörfer an der nordwestlichen Peripherie heißen: Eine gewisse Insubordination herrscht dort, eine heimliche Neigung, sich von der Stadt abzunabeln und zum autonomen Gebiet zu erklären. Speziell Grinzing ist geradezu ein Rebellennest. Einige der Nussdorfer Häuser sind so altertümlich, finster und krumm, blicken aus trüben Butzenscheibenfenstern unter tief herabgezogenen Dächern so verschlagen drein, dass sie genauso gut in Lovecrafts Arkham stehen könnten, aber sie beherbergen ehrbare Buschenschänken. Das sind jene Weinbauern, die das Privileg haben, den ersten Wein des Jahres auszuschenken, was ein grüner Buschen an einer Stange kund tut: Ausg´steckt is! Im Sommer sind die lauschigen Gärten und Höfe dieser Heurigen gestopft voll mit Gästen, es duftet nach Salami, Gurkensalat und gebratenen Stelzen. Im Laub der Kastanienbäume, die die gepflasterten Höfe überschatten, schimmern wie riesige Glühwürmchen die elektrischen Lampen. Die Gäste delektieren sich an jungem Wein, Kartoffelsalat und kaltem Braten, während sich die Blut saugenden Schnaken – hierzulande Gelsen genannt – in Schwärmen an den Gästen gütlich taten. Abgesehen vom nächtlichen Radau der Betrunkenen, die den Heurigen nicht vertragen, ist Nussdorf ein friedlicher Ort, eingebettet in die Weinberge an den sanften Hängen des Kahlenbergs und des Leopoldsbergs und die Laubbäume des Wienerwalds. Die Stadt versickert übergangslos in diesem sanftmütigen Wald. Der Wanderer findet sich einmal innerhalb, einmal außerhalb der Stadtgrenze, ohne einen Unterschied zu erkennen. Eine schmale Gasse, die an einem Bächlein entlangführt, ist nach Ludwig van Beethoven benannt, der dort spazieren zu gehen pflegte. Es ist eine ruhige und freundliche Gegend, in der man nicht erwarten möchte, dass einem das Böse geradezu ins Gesicht springt – aber so war es.
Leider.
Mein geerbtes Haus steht abseits der Straße, in der Nähe des schmucken Nussdorfer Friedhofs, in einem von dichten Buchsbaumhecken umgebenen Garten. Dieser Garten ist ziemlich verwildert – ich selbst habe weder Zeit noch Lust, mich darum zu kümmern, und Gärtner sind so unverschämt teuer, dass einem nichts übrig bleibt, als gleich ein Biotop wachsen zu lassen. Biotope sind glücklicherweise sehr in Mode, seit die Grünen im Parlament sitzen. Es sieht sogar durchaus romantisch aus, wenn im Sommer die verwilderten Rosen blühen und die uralten Kastanien ihren Schatten auf den Rasen werfen, oder wenn im Herbst der wilde Wein die Mauer mit seinen flammend bunten Blättern schmückt. Leider betrachten die Katzen der Umgebung meinen lauschigen Garten als Stundenhotel, sodass ich häufig nachts von grässlichen Schreien geweckt werde. Und ich kann mich nicht einmal über das lästige Viehzeug beschweren, denn meine eigenen fünf Katzen – Berta, Lily, Tigger, Suzie und Poppyseed – treiben es am ärgsten von allen. Sie stammen alle fünf aus dem Tierheim, und obwohl sie ansonsten ihre Katzenpflichten wie Zärtlichkeit, Zuwendung und allgemeines Gestalten von Gemütlichkeit aufs Untadeligste erfüllen, hat ihre Moral unter dem vielen Herumgestoßenwerden gelitten, und es gibt keinen Kater in der Umgebung, dem sie nicht in freudiger Erwartung das Hinterteil zukehren. Sogar den völlig vertrottelten Eunuchen meiner Nachbarin versuchen sie immer wieder zu animieren.
Mitten in diesem Garten steht also meine Villa. Unter einer Villa dürfen Sie sich jetzt aber um Himmels willen keinen Palast vorstellen! In Wien heißt bald jedes einzeln stehende Gebäude, das größer als ein Mobil-Klo ist, Villa, und so besteht mein Erbstück auch nur aus einem Erdgeschoss, Parterre genannt, und einem Oberstock plus Dachboden, die allesamt von hellgrau getünchten Mauern und einem roten Ziegeldach zusammengehalten werden. Der auffallendste Zug an dem Haus ist das Türmchen, das im vorderen Teil von den Grundmauern bis übers Dach hinaus vorspringt und sich vorzüglich dazu eignet, darin meine Oleander zum Überwintern aufzustellen. Außer diesem Gebäude befindet sich noch das so genannte Hinterhaus oder Gartenhaus auf dem Gelände, ein unterkellerter Bungalow, der aus nur zwei ebenerdigen Räumen besteht und irgendwann Anno Schnee, als die Villa erbaut wurde, den Dienstboten als Wohnung diente. Es ist ein wirklich hübsches Domizil, nur eben viel zu groß für eine allein stehende Frau, und als Harry mir vorschlug, den Bungalow zu vermieten, fand ich das eine gute Idee. Harry hat immer gute Ideen, auch wenn er es zumeist anderen Leuten überlässt, sie zu verwirklichen. Das Gartenhaus eignete sich ja auch sehr dazu, es zu vermieten, denn es hat seinen eigenen Eingang, man braucht einander nicht in die Quere zu kommen. Und natürlich hatte Doktor Heribert Strunzl genau so etwas gesucht – einen Ort, wo ihm niemand auf die Finger schauen würde, und eine ahnungslose, hilflose Frau als Vermieterin!
Lassen Sie mich noch schnell schildern, wie das Gartenhaus aussieht, denn das ist wichtig für die weitere Geschichte. Stellen Sie sich eine cremegelbe Schuhschachtel vor, in deren kurze Seiten je eine Tür geschnitten ist, während sich in der vorderen Längsseite zwei kleine Fenster befinden, je eines in jedem der beiden Räume. Aus der hinteren, fensterlosen Längswand springt als vierkantiges Türmchen ein winziges Badezimmer mit Toilette und Dusche vor, das im ursprünglichen Bauplan nicht vorgesehen war. Zu der Zeit, als das Haus erbaut wurde, waren Badezimmer noch nicht allgemein gebräuchlich. Auf dem Ganzen sitzt wie ein grünes Hütchen ein Dach, sodass außer den beiden Räumen auch noch ein Dachboden vorhanden ist, den man freilich nur gebückt betreten kann, so niedrig ist er. Von größerer Bedeutung für meine Geschichte ist, dass die beiden Gebäude einen gemeinsamen Keller haben – oder besser gesagt, jedes hat seinen eigenen Keller, die jedoch durch einen schmalen unterirdischen Gang miteinander verbunden sind. Sie wurden schon zu Zeiten meiner Urgroßeltern angelegt. Noch in meiner Kindheit diente der vordere zur Aufbewahrung von Äpfeln und Einmachgläsern, während sich im hinteren ein unheimlich aussehender Ofen befindet, so groß wie ein kleines Zimmer, der mit Koks beheizt wurde. Als ich das Haus erbte, stellte ich auf die saubere und praktische Gasheizung um. Den Heizkeller sperrte ich, da es viel zu teuer und mühsam gewesen wäre, den ungeheuren Ofen zu entfernen, kurzerhand zu. Auch die Brettertür zum Verbindungsgang war – um Ratten und Feldmäuse fernzuhalten – meistens verschlossen, es sei denn, um die Gas- und Wasserrohre zu überprüfen, die dort neben den stillgelegten Heizungsrohren verliefen.
Sobald ich den Entschluss gefasst hatte zu vermieten, ließ ich den Bungalow frisch streichen, stellte eine dieser Mini-Küchen hinein – Sie wissen schon, Herd, Spüle und Kühlschrank in einem –, und investierte in einige günstige Möbel sowie einen Dauerbrandofen, der sich leicht an den schon vorhandenen Kamin anschließen ließ. Dann annoncierte ich wegen eines Untermieters. Dabei konzentrierte ich mich vor allem auf die Universitätsinstitute der Biologie und Zoologie, die nur ein Dutzend Straßenbahnstationen entfernt in einer riesigen Glas- und Betonburg untergebracht sind, denn Studenten brauchen immer preisgünstige Wohnungen und sind nicht allzu wählerisch. Allerdings warnte mich Harry, dass Biologen und Zoologen genau wie Chemiker dazu neigen, einen üblen Geruch um sich zu verbreiten. Deshalb war ich erleichtert, als sich ein Historiker meldete – eben jener Doktor Heribert Strunzl.
Woher hätte ich denn wissen sollen, was für einer er war? Er sah vollkommen harmlos und anständig aus, wenn auch nicht gerade attraktiv. Lang und dünn, mit einer knolligen Nase, einer dicken, hängenden Unterlippe und einer Brille erinnerte er an einen enorm in die Länge gezogenen Woody Allen, aber damit sah er genau so aus, wie man sich einen Wissenschaftler vorstellt. Verhuscht eben, weltfremd und unattraktiv. Er sprach mit schnarrender Stimme, abgehackt wie eine steckengebliebene Grammofonplatte, sodass es eine Plage war ihm zuzuhören, und ich bemerkte rasch, dass er auf einem Ohr taub war – er drehte nämlich immer den Kopf zur Seite, wenn ich in dieses Ohr hineinredete. Er war korrekt, aber fade und unansehnlich gekleidet. Auf jeden Fall wirkte er wie die Anständigkeit in Person, umso mehr, als er die Miete gleich für ein halbes Jahr im Voraus bezahlte, obwohl sie ziemlich gesalzen war. Schließlich ist eine Adresse so nah am Stadtrand eine Luxusadresse. Und kommen Sie mir nicht damit, ich hätte mich bestechen lassen! Das war ein sauberes Geschäft, hören Sie? Ich verschaffte mir noch extra Rückendeckung, indem ich Harry unauffällig Gelegenheit gab, einen Blick auf den Professor zu werfen, und er war völlig meiner Meinung, dass ich mir nach einem solchen Mieter alle zehn Finger abschlecken könne.
Harry – ach ja, das muss ich Ihnen auch noch erklären, denn Harry Turner spielt eine nicht zu unterschätzende Rolle in der Geschichte!
Harry ist ein kleiner, schmächtiger und etwas tuntenhafter Mann um die vierzig, der aussieht, als ernähre er sich hauptsächlich von Rauschgift. Vielleicht ist das sogar der Fall, denn seine einzige ernsthafte Beschäftigung besteht darin, Termine mit gewissen zwielichtigen Geschäftsfreunden einzuhalten. Er hat eine merkwürdige Art, andauernd zu schniefen und zu schnüffeln, aber ich habe nie herausgefunden, ob das vom Koksen kommt, oder von einem chronischen Schnupfen, oder ob er vielleicht in einem früheren Leben eines dieser kleinen wendigen Tierchen mit den spitzen, ständig in runzelnder Bewegung befindlichen Nasen war. Harry und Arbeit – nun, das ist, als wolle man eine Katze vor einen Pflug spannen! Angeblich ist er Englischlehrer von Beruf und nur im Moment durch widrige Umstände gezwungen, sich mit Nachhilfestunden über Wasser zu halten. Aber obwohl er tatsächlich sehr gut Englisch spricht und auch sonst ein helles Köpfchen ist, glaube ich ihm das nicht so recht. Die widrigen Umstände dauern nämlich, nach allem, was ich erfahren habe, schon mindestens fünfzehn Jahre an. Harry ist nicht gerade hübsch, aber auch nicht hässlich; er hat einen dicken, zausigen Schopf mausbrauner Haare, kluge, hellbraune Augen – mit einer Menge Fältchen rundherum – und einen ausgesprochen niedlichen Hintern, so knackig und straff wie der Hintern eines Sechzehnjährigen. Manchmal entdecke ich etwas leicht Sinistres in seinen Augen und seinem Lächeln, dann erscheint er mir wie ein unternehmungslustiger Leprechaun, der Anschluss an die Menschen gesucht und gefunden hat. Sein hervorstechendster Charakterzug ist jedoch, dass er rührend aussieht. Sobald man ihn sieht, möchte man ihn auf den Arm nehmen, streicheln und füttern, und hat dabei das Gefühl, ihn in letzter Sekunde vor einem elenden Tod durch Hunger und Vernachlässigung gerettet zu haben. Von diesem zerbrechlichen und pflegebedürftigen Aussehen lebt er auch. Wie ein streunender Kater macht er seine Runde bei einem Kreis mitleidiger Frauen fortgeschrittenen Alters, die ihm gut gefüllte Futterschüsseln zuschieben und ihn ankuscheln lassen. Zum Dank schläft er einmal da, einmal dort, aber da seine Leistungen auf diesem Gebiet eher mäßig sind, empfinden wir keine Eifersucht. Wir alle wissen, dass er eigentlich nur ins Bett will, weil es dort warm ist. Seine Vorstellung von gutem Sex besteht darin, dass er, alle viere von sich gestreckt, behaglich schnurrend auf der Matratze liegt, wobei er sich einmal auf den Bauch, dann auf den Rücken wälzt, um sich rundherum kraulen zu lassen, und dazu sagt: „Du bist so lieb zu mir. Ich hab noch nie eine Frau wie dich kennen gelernt.“ (Er kennt mindestens fünf bzw. sechs, wenn man die Wirtin im Nussdorfer Bahnhofsbufett mitrechnet, die ihm regelmäßig die Hälfte der Rechnung erlässt). Sein zweiter Standardspruch heißt: „Weißt du, ich habe es gerne, wenn eine starke Frau so völlig über mich verfügt. Ich bin von Natur aus passiv.“ Das heißt im Klartext: Streng du dich an und lass mich genießen! Eine der Damen aus der Runde der Harry-Turner-Fans übersetzte es sogar kurz und bündig mit: „Harry ist zu faul zum Ficken.“
Unser Englischlehrer ist also in jeder Hinsicht ein hoffnungsloser Fall, aber er ist es auf eine so charmante Art, dass es ihm niemand übel nimmt. Man nennt seinesgleichen hierzulande einen Schmähtandler – was in etwa mit „Kleinhändler mit gefälligen Unwahrheiten“ zu übersetzen ist. Als alleinstehende Frau über fünfzig lernt man solche schmeichelhaften Lügen zu schätzen. („Bauch? Ich seh keinen Bauch an dir. Meinst du etwa das herzige kleine Polsterl da vorn? Komm, lass mich den Kopf darauf legen! Aah – fühlt sich wunderbar an!“) Der Vorzug des Schmähtandlertums ist natürlich, dass es – anders als die Potenz – vom Alter unabhängig ist. Ich wette, Harry wird noch mit achtzig ein paar mütterliche Neunzigjährige dazu bringen, dass sie ihn durchfüttern.
Zu der Zeit, als Doktor Strunzl mein Untermieter wurde, hatte es sich gerade so ergeben, dass ich Harrys Hauptnahrungsquelle geworden war – seine Dosenöffnerin, um es mit dem Kater Francis zu sagen –, da eine der anderen Damen mit einem polnischen Installateur vollzeitbeschäftigt war und sich eine zweite einer Sekte angeschlossen hatte, bei der unverehelichte Bettgenossen nicht gerne gesehen wurden. Die beiden übrigen Damen überwinterten auf Mallorca. Das Bahnhofsbüfett war an einen neuen Besitzer übergegangen, der zwar ebenfalls die Hälfte der Rechnung nachließ, aber nur bei Männern, die halb so alt und drei Mal so fesch wie Harry waren. Es blieb also alles an mir hängen, aber Harry ist pflegeleicht. Er isst nicht viel, trägt keinen Dreck ins Haus und pinkelt niemals in die Dusche. Sein bisschen Futter verdient er sich, indem er Hausarbeit macht, viel sorgfältiger und netter, als ich das könnte. Auch stellt er keine großen Ansprüche, unterhalten zu werden. Er kann Stunden damit verbringen, dekorativ zusammengekuschelt und mit der Fernbedienung des DVD-Players in der Hand in einem Winkel der Couch zu liegen, völlig zufrieden damit, dass ich ihm hin und wieder durchs Haar fahre oder ihm andere kleine Zärtlichkeiten zukommen lasse. Es ist mit ihm wie mit den wirklichen Katzen auch: Sie sind eigentlich zu nichts nütze, aber man mag ihre Gesellschaft und freut sich, wenn sie sich wohlfühlen.
Es war im Jänner, kurz nach Neujahr, als Doktor Strunzl in mein Hinterhaus einzog. Später habe ich oft gedacht, dass an diesem Tag ein böses Omen dem anderen folgte, und hätte ich die Zeichen lesen können, so hätte ich die Miete zurückgegeben und dem Mann gesagt, er solle sich zum Teufel scheren. Es war einer dieser ungemütlichen, feuchten und viel zu warmen Jännertage, die Leuten mit Neigung zur Migräne die Hölle auf Erden bereiten. Grafitschwarze Wolken hingen am Himmel über dem Kahlenberg und brüteten in ihren dampfenden Bäuchen ein Wintergewitter aus, das dann auch mit Karacho über der Stadt niederging. Es blitzte und rumpelte wie Geschützdonner, und der Himmel schüttete ein graupeliges, popcornähnliches weißes Zeug herab, eine Mischung aus Hagel und Schnee, das auf den Steinplatten des Gartenwegs tanzte. Später verzogen sich die Wolken zwar, aber zwischen Leopoldsberg und Bisamberg, genau über der Donau, die dort zwischen den beiden bewaldeten Hügeln hindurch ins Tullner Feld strömt, schwelte ein giftiger, kupferfarbener Schein, ein böses Leuchten, das weitere Gewitter und weitere Migräneanfälle verhieß.
Inmitten dieser unheilvollen meteorologischen Vorzeichen erschien Doktor Heribert Strunzl. Er kam mit dem Kastenwagen eines Spediteurs und vier Männern, die eine Anzahl umfangreicher Kisten ausluden und ins Haus schleppten. Dass er so viel Zeug brauchte, wunderte mich. Ich hatte erwartet, er würde einen Computer mitbringen und vielleicht noch einige Ordner mit Unterlagen. Also fragte ich ihn, und er antwortete, die Kisten enthielten verschiedene Museumsstücke, Tonscherben von Ausgrabungen und dergleichen, die er in seinem Buch beschreiben wolle. Nun ja, das war eine vernünftige Antwort. In Wien ist schon so viel archäologisches Zeug ausgegraben worden, dass man eine komplette Stadt daraus erbauen könnte. Unter dem Stephansdom wurde sogar ein Mammutknochen gefunden, und als die U-Bahnstation Stubenring gebaut wurde, gerieten die Archäologen vollkommen aus dem Häuschen und schleppten aus der Baugrube körbeweise ihre Schätze weg, denn dort war einst die Stadtmauer verlaufen, und die mittelalterlichen Umweltverschmutzer hatten kurzerhand alles über die Wehrmauer gekippt, was sie nicht mehr brauchen konnten. Dennoch – irgendwie gefiel es mir nicht, als die vier Möbelpacker eine metallene Kiste aus dem Auto holten, die eine merkwürdige längliche Form hatte. Das Ding sah einem Sarg verflixt ähnlich, genauer gesagt einem Transportsarg, wie die Leute vom Gerichtsmedizinischen Institut sie verwenden! Unter anderen Umständen hätte ich nachgefragt und vielleicht sogar darauf bestanden, hineinzuschauen, aber mich schüttelte ein Migräneanfall, dass ich mich vor Kopfschmerzen kaum auf den Beinen halten konnte, und ich war nicht in der Stimmung, eine Diskussion anzufangen. Außer der verdächtigen Kiste trugen die Möbelpacker auch noch eine Anzahl Gemälde in den Bungalow, billigen Kitsch, auf denen ich einige historisch bedeutsame Wienerinnen erkannte. Da glänzten, in süßlichen Acrylfarben gemalt, erlauchte Häupter von der weltberühmten Kaiserin Sissi über die Kaiser-Geliebte Katharina Schratt bis hin zur armen Baronesse Mary Vetsera, daneben ein Porträt der Schauspielerin Therese Krones im rosa Frackanzug ihrer berühmtesten Rolle, der „Jugend“ in Ferdinand Raimunds „Bauer als Millionär“, eines der Tänzerin Fanny Elssner, eines der Schauspielerin Ida Orloff und weitere Damen in historischen Gewändern, deren Gesichter mir nichts sagten. Anscheinend wollte der Historiker die Wienerinnen, deren Geschichte er niederzuschreiben gedachte, immer vor Augen haben. Die Männer interessierten ihn wohl weitaus weniger, denn ich sah kein einziges Porträt eines historisch bedeutsamen Wieners. Aber vielleicht steckten deren Konterfeis auch in einer anderen Kiste. Ich war, wie gesagt, damals nicht in der Lage, auf Einzelheiten zu achten, obwohl es mir viel Ärger und Schaden erspart hätte.
Doktor Strunzl ließ also seine vielen Kisten ins Hinterhaus transportieren, und nachdem die letzte darin verschwunden war, ging er selbst hinein und klappte mir die Tür vor der Nase zu. Ich hörte, wie die Schlüssel drinnen im Schloss rasselten und der Riegel vorgeschoben wurde – ein brandneuer Riegel, den der Untermieter selbst hatte anbringen lassen. Er hatte viel Aufhebens darum gemacht, dass das Haus etwas abseits stand und Einbrecher angelockt werden könnten, also hatte ich zugestimmt, dass er sowohl die Vorder- wie auch die Hintertür des Bungalows auf eigene Kosten mit zusätzlichen Riegeln versehen durfte. Dass er bei dieser Gelegenheit ebenfalls neue Schlösser anbrachte, sodass ich mit meinen Schlüsseln nicht mehr hineinkonnte, bemerkte ich erst später – aber ich will der Geschichte nicht vorgreifen.
Von da an gab es keinen Zutritt mehr zum Hinterhaus. Nicht einmal einen Blick hineinwerfen konnte ich, denn die hölzernen Fensterläden blieben stets geschlossen, angeblich, weil das Licht beim Arbeiten am Computer störe. Dabei war es dort im Winkel der mächtigen Buchsbaumhecke, die den Garten umrahmte, selbst im Winter schummrig, und im Sommer, wenn die Bäume und Büsche dicht belaubt waren, herrschte eine ungemütliche feuchte Dunkelheit in dem Gebäude. Das war auch einer der Gründe, warum ich selbst den Bungalow nie benutzt hatte, obwohl er von der Größe her ein passables Büro abgegeben hätte. Ich hatte die Atmosphäre der beiden ebenerdigen Räume immer als ungesund und unerfreulich empfunden. Meine Katzen mochten das Gebäude auch nicht. Obwohl sie sonst überall ihre rosa Näschen hineinstecken und das Haus in der Zeit, wo es verlassen stand, sicher einiges an Mäusen und anderer interessanter Unterhaltung geboten hätte, wichen sie ihm aus, ja ich beobachtete, wie sie unbehaglich buckelten und die Pfoten setzten, als müssten sie auf Reißnägel steigen, wenn sie daran vorbeigingen. Einmal war ich sogar heftig erschrocken, als ich sah, wie Lily an der gelben Mauer vorbeischlich, dann einen Blick auf eines der staubbedeckten Fenster warf und mit einem kreischenden Entsetzensschrei zurücksprang. Was sie dort gesehen hatte, war nachher nicht mehr festzustellen, aber es musste hinreichend scheußlich gewesen sein, um einer sonst mutigen und charakterfesten Katze den Schneid abzukaufen. Niemand – auch Harry nicht – mochte also das Gartenhaus. Ein muffiger Kellergeruch hing darin und ließ sich nicht vertreiben, so oft man auch lüftete. Wahrscheinlich waren die Mauern feucht, denn ein Bach plätscherte in der Nähe einmal oberirdisch, dann wieder unterirdisch vorbei. Wien ist ja überhaupt von einem Labyrinth unterirdischer Wasserläufe durchzogen, die geheimnisvoll unter dunklen Gewölben verschwinden und dann unerwartet wieder zum Vorschein kommen, nachdem sie sich gekreuzt und gequert und das unheimliche Labyrinth der Kanalisation passiert haben, die eine Stadt unter der Stadt darstellt. Falls Sie zu den wenigen Leuten auf der Welt gehören, die nie den „Dritten Mann“ gesehen haben: Was man in Wien bescheiden das öffentliche Kanalnetz nennt, ist eine Metropole der Finsternis, mit Gebäuden so hoch wie Kathedralen, mit Brücken, Balkonen und Stegen, Gewölben und Kuppeln, erfüllt vom immer währenden Rauschen und Rieseln der Gewässer, die in den lichtlosen Katakomben dahinströmen, manchmal so seicht, dass man sich kaum die Stiefel nass macht, wenn man sie durchquert, manchmal als tosende Wildbäche, die in blinder Finsternis ein Dutzend Meter tief brüllend über schleimige Wehrmauern stürzen. Nur die furchtlosen Männer der Kanalbrigade, ortsüblich „Kanäuiiraama“ ausgesprochen, wagen sich in diese grausige Unterwelt, in der tückische, tödliche Gase und unsichtbare Krankheitserreger den Eindringling an Leib und Leben bedrohen. Merkwürdig, denke ich manchmal, dass eine Stadt im tiefsten Binnenland so sehr vom Wasser bestimmt ist – so ziemlich alles Wichtige in Wien steht in irgendeiner Verbindung mit Wasser, von der Donau bis zum Wienfluss, von den romantischen Lacken im Prater bis zum Basiliskenhaus mit seinem giftgeschwängerten Brunnen.
Das Unbehagen, das ich angesichts des Gartenhauses empfand, mochte auch mit der unheimlichen Geschichte zusammenhängen, die mir meine Großmutter erzählt hatte: Kurz nachdem die ersten Besitzer – von denen meine Urgroßeltern dann das Gebäude gekauft hatten – mit ihren Kindern und drei Dienstboten dort eingezogen waren, begann die Köchin zu kränkeln, ebenso das Zimmermädchen. Die beiden Frauen wurden immer bleicher und elender, die Haare fielen ihnen in Büscheln aus, sie klagten über häufige Magenschmerzen, Erbrechen und blutigen Durchfall. Man brachte beide ins Allgemeine Krankenhaus, wo sie sich erstaunlich rasch erholten. Schon nach zwei Wochen wurden sie wieder nach Hause entlassen. Doch wenige Tage darauf litten sie wieder unter derselben geheimnisvollen Krankheit, und es ging ihnen womöglich noch schlechter als zuvor. Ein zweites Mal wurden sie ins Krankenhaus eingeliefert, und auch diesmal besserte sich ihr Zustand fast über Nacht. Aber kaum waren sie wieder zuhause, wiederholte sich dasselbe tragische Spiel.
Glücklicherweise hatte die Familie einen intelligenten Hausarzt, der auf den Gedanken kam, dass das Leiden der beiden Dienstboten möglicherweise mit ihrem Wohnort zu tun habe. Da die Herrschaften, die im Vorderhaus wohnten, jedoch gesund geblieben waren, ebenso der Diener, der sein Quartier im Dachboden des Vorderhauses hatte, musste die Quelle des Übels im Hinterhaus zu finden sein. Und Doktor Kuttner, der scharfsinnige Hausarzt, fand sie tatsächlich. Die beiden Räume waren mit Tapeten in dem damals sehr beliebten Schweinfurter Grün ausgeschlagen, einer arsenikhaltigen Industriefarbe, die in Verbindung mit Tapetenkleister und Feuchtigkeit eine gasförmige Arsenverbindung ausströmte. Solche „Todeszimmer“ gab es um die Jahrhundertwende nicht wenige, und vor allem unter den Proletariern, deren Wohnungen zumeist feucht waren, starben viele an der schleichenden Vergiftung, ehe das reformfreudige sozialistische Wien mit seinen hellen, sauberen und trockenen Gemeindebauten dem Sterben ein Ende machte.
Als Kind hatte ich ausgesprochen hysterisch auf diese Geschichte reagiert. Ich war von da an nicht mehr zu bewegen gewesen, das Hinterhaus zu betreten, obwohl natürlich von den todbringenden grünen Tapeten längst kein Fitzelchen mehr vorhanden war. Selbst wenn ich nur von außen durch die schmutzigen Fenster in die beiden niedrigen, mit Gerümpel und Gartengeräten zugestellten Zimmer hineinblickte, wurde mir schon übel, und ich meinte zu spüren, wie mir die Haare ausfielen. Ich war ein nervöses und empfindsames Kind, das von vielerlei Ängsten und Albträumen geplagt wurde. Trotzdem – oder vielleicht gerade deshalb? – übte das Morbide und Makabre eine atemberaubende Faszination auf mich aus, und so kam es, dass das giftverseuchte Hinterhaus mich ebenso anzog, wie es mich abstieß. Vermutlich war es die trübe Quelle, aus der mein späteres Interesse an Seuchen, mysteriösen Ereignissen und ungeklärten Todesfällen entsprang.
All das fiel mir wieder ein, als ich mit meinem vom Kopfweh dröhnenden Schädel dastand und die blaugrüne Tür anstarrte, die zwischen mir und meinem Untermieter ins Schloss gefallen war, und ein absonderlicher Schauder durchrieselte mich. Mit einem Mal strömte das Gebäude wieder jene üble Aura aus, die mich als Kind so erschreckt hatte. Diesmal aber schien sie nicht von den feuchten Mauern auszustrahlen, sondern von dem Mann, der es bewohnte. Ich wünschte plötzlich, ich hätte ihn fortgeschickt.
Als ich mich umwandte und den Plattenweg zurück zum Haus ging, entdeckte ich, dass ein kleines, in schwarzes Leder gebundenes Buch neben den Rosenbüschen auf der schneebedeckten Erde lag. Zweifellos war es im Zuge der Übersiedlung zu Boden gefallen. Da ich Bücher liebe und nicht zusehen kann, wie eines misshandelt wird, hob ich es sofort sorgsam auf. Im nächsten Augenblick jedoch hätte ich es beinahe von mir fortgeschleudert, so abscheulich fühlte es sich an – genau wie ein kleiner, eiskalter, praller Kadaver! Natürlich lag das nur daran, dass das Leder bereits feucht geworden war, aber einige Sekunden lang durchschauerte mich ein so entsetzlicher Widerwillen, dass ich am liebsten zurückgesprungen wäre. Dann kehrte meine Vernunft zurück. Ich putzte mit dem Ärmel die feuchten Erdkrümel ab. Dabei stieg mir ein beißender Geruch in die Nase, als hätte das Buch in einer Selchkammer gehangen, und wieder fühlte ich diesen Schauder, der mich zwingen wollte, es weit von mir zu werfen. Es war ein ungewöhnliches Buch, offenkundig sehr alt, mit bräunlich vergilbten Seiten, und als ich es neugierig aufschlug, entdeckte ich, dass es nicht gedruckt, sondern in einer altmodischen, schwer leserlichen Schrift mit der Hand geschrieben war. Auf dem Vorsatzblatt war noch ein halb verwischtes Exlibris zu erkennen, das ich mit einiger Mühe entzifferte.
Exlibris Karl Ludwig Reichenberg zu Schloss Reisenberg am Cobenzl.
Der Cobenzl, muss ich Ihnen erklären, ist eine vorspringende Schulter des Wienerwaldes mit einem prächtigen Blick über Wien, ein wunderschöner, aber auch seltsam unheimlicher Ort. Lange Zeit stand dort im dichten Wald ein Kloster der Jesuiten, doch nachdem die Societas Jesu das Kloster im 16. Jahrhundert räumen musste, erbaute ein Graf Cobenzl an derselben Stelle sein Schloss, in dem Mozart ein häufiger Gast war. Ob es nun an den Jesuiten lag (die, wie jeder Freidenker weiß, Meister in allen finsteren Künsten sind) oder ob jener erste Graf Cobenzl etwas Unheiliges einschleppte, oder ob der trügerisch liebliche Hügel von alters her verflucht und verwunschen war – was auch der Grund sein mag, vor der idyllischen Kulisse der Nussbäume und Weinreben spielten sich schon immer die seltsamsten Teufeleien ab. So richtig berüchtigt aber wurde das Schloss erst unter einem späteren Besitzer, nämlich eben jenem Freiherrn Karl Lud¬ wig von Reichenbach, dessen Büchlein ich in der Hand hielt. Um die Mitte des 19. Jahrhunderts hatte dieser Schlossherr vom Reisenberg das Gebiet des heutigen Cobenzl in Angst und Schrecken versetzt. Der Adelige mit dem lebhaften Interesse an der Chemie galt als wienerischer Cagliostro, dem man Kenntnisse der schwarzen Magie zuschrieb, sodass jeder Wanderer, der gezwungen war, am Anwesen des Barons vorbeizugehen, dies in ängstlicher Hast und Eile tat. Gerüchte kursierten über geheime Kavernen und Verliese im Berg hinter dem Schloss, welche der Baron habe anlegen lassen. Die biederen Grinziger fürchteten sich, wenn sie die unheimliche Erscheinung des Adeligen bei Nacht und Nebel, in einen schwarzen Radmantel gehüllt, zwischen den Grabsteinen des Grinzinger Friedhofs herumschleichen sahen. Man munkelte, er schände die ehrwürdigen Gräber und stelle schaudervolle Experimente mit gestohlenen Leichen an. In Wirklichkeit war der Baron ein harmloser Spinner, der eine abstruse Theorie über ein geheimnisvolles „Od-Licht“ aufgestellt hatte, und seine nächtlichen Expeditionen dienten der Suche nach diesem Fluid. Den Grinzigern fiel trotzdem ein Stein vom Herzen, als ihm ein weniger exzentrischer Schlossbesitzer nachfolgte.
Aus dem Besitz dieses zwielichtigen Aristokraten also stammte das Büchlein. Auf dem Vorsatzblatt hatte eine zweite, viel modernere Hand – die eine starke Ähnlichkeit mit der Handschrift meines Untermieters hatte – mit Kugelschreiber einige lateinische Worte hinzugefügt: Donec veniat immutatio mea.
Ich hatte zwar in der Schule Latein gelernt, aber das war nun auch schon eine beträchtliche Zeit her, und so kam ich nicht dahinter, was der Spruch bedeutete, obwohl mir ein unbestimmtes Gefühl sagte, dass ich ihn schon irgendwo einmal gelesen hatte. Mea bedeutete „mein“, das wusste ich, und veniat war sicherlich eine Form von venire, “kommen“, aber ich war nicht sicher, ob es eine Zeitform oder eine Möglichkeitsform war. Bei immutatio reichten meine eingerosteten Sprachkenntnisse gerade so weit, dass es mit „mutieren“, „verändern“ zu tun hatte. Was donec hieß, wusste ich nicht.
Glücklicherweise habe ich ein ausgezeichnetes Sprachgedächtnis, und so hatte ich mir den Satz in Sekundenschnelle fest eingeprägt, ehe ich das Buch wieder zuschlug und an die Tür des Bungalows klopfte. Drinnen scharrte und rumpelte etwas, dann rief Doktor Strunzl mit mürrischer Stimme heraus: „Was ist? Wer will etwas von mir?“
„Ich bins, Sonja Roth“, brüllte ich, da mir einfiel, dass er auf einem Ohr taub war. „Sie haben etwas im Garten verloren.“
Der Riegel wurde zurückgezogen, ein Schlüssel knirschte im Schloss, dann ging die Tür auf – aber gerade nur so weit, dass mein Untermieter seine dicke, großporige Nase durch den Spalt schieben konnte. „Wer? Was? Etwas verloren?“, schnarrte er.
Ich hielt ihm wortlos das Buch hin. Er starrte es an, dann starrte er mich an – mit einem Blick, wie man keinen anständigen Menschen ansehen sollte! – und riss mir das Buch geradezu aus der Hand. Im allerletzten Augenblick fiel ihm noch ein, was die Höflichkeit gebot, und er stieß ein hastiges „Danke! Sehr freundlich von Ihnen! Wichtige Unterlagen!“, hervor, ehe er die Tür wieder zudrückte.