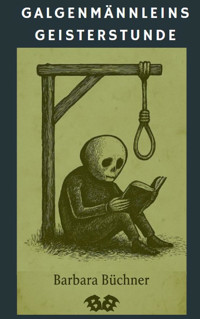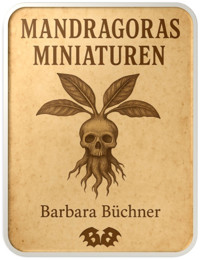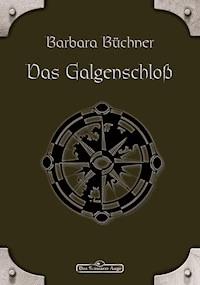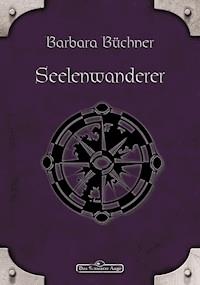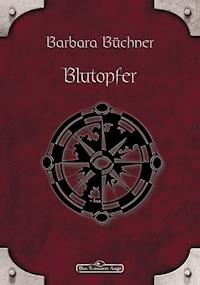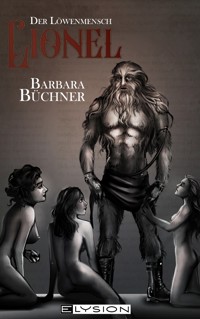
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Elysion Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Stephan Bibrowsky, geboren 1890 in Russisch-Polen, war ein Star des Showgeschäfts, ein umschwärmter Liebling der Frauen und obendrein ein gebildeter Mann, der fünf Sprachen beherrschte. In die Geschichte ging er als "Lionel der Löwenmensch" ein. So üppig war seine weiche, flachsblonde Körperbehaarung, selbst im Gesicht, dass sie einem Löwenfell ähnelte. Er führte ein Leben im Scheinwerferlicht – und zugleich ein Leben im gesellschaftlichen Abseits, denn die bürgerliche Welt war ihm verschlossen. Nur die "Freakshows" waren sein Zuhause. Aber seine Träume und Sehnsüchte waren dieselben wie die jedes anderen jungen, kraftvollen Mannes. Er liebte – und wurde von vielen Frauen wiedergeliebt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 267
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Barbara Büchner
Lionel:
Die Leidenschaft des Löwen
Impressum
VOLLSTÄNDIGE AUSGABE
ORIGINALAUSGABE
© 2021 BY ELYSION BOOKS GMBH, LEIPZIG
ALL RIGHTS RESERVED
UMSCHLAGGESTALTUNG: Ulrike Kleinert
www.dreamaddiction.de
LAYOUT &WERKSATZ: Hanspeter Ludwig
www.imaginary-world.de
ISBN (gedrucktes Buch) 978-3-96000-159-1
ISBN (ebook) 978-3-96000-160-7
1908, k.u.k. Haupt- und Residenzstadt Wien
Die Märznacht hing wie ein nasser, schwarzer Sack über Wien. Kein Mond, keine Sterne. Nebel stieg von der Erde auf und kehrte als hauchfeines »Nebelreißen« zu ihr zurück. Aus den dichten Auwäldern, die den Wiener Wurstelprater umgaben, dampfte ungesunde, nach Schlamm und Moder riechende Luft. Es war keine Nacht, in der man gerne ausging. Der hochgewachsene junge Mann im schwarzen Kapuzenmantel war das einzige lebende Wesen zwischen den geschlossenen, nur gelegentlich von trüben Lampen beleuchteten bunten Schaubuden, den »Praterhütten«. Er hielt sich sorgfältig in einem Winkel zwischen zwei Mauern verborgen, denn er wusste, wenn sein Impresario ihn ertappte, war es aus mit der schönen Nacht. Der verärgerte Joseph Sedlmeyer war das letzte Mal ziemlich deutlich geworden: »Stephan, ich weiß, dass man die Weiber von dir runterklatschen muss wie die Wespen vom Honigtopf, aber wenn du mir noch einmal auf offener Bühne einschläfst, weil du dir die ganze Nacht ein lustiges Leben gemacht hast, dann … dann such ich mir einen anderen!«
»Es gibt keinen Zweiten wie mich«, hatte Stephan Bibrowsky erwidert, wobei er sich selbstbewusst rekelte.
Der Meinung war auch die Dame gewesen, deren Zofe ihm rasch und verstohlen ein Briefchen zugesteckt hatte, ehe sich die roten Samtportieren von Präuschers Panoptikum, der bedeutendsten Attraktion des Wiener Praters, hinter dem Star der Show schlossen. Auf dem teuren, parfümierten Papier stand nur der Vermerk: Kutsche um 22 Uhr und ein rotes Herz.
Er lächelte.
Einer seiner Koffer enthielt eine große Kartonschachtel mit solchen Briefchen. Gelegentlich, wenn ihm langweilig war, stöberte er sie durch und erinnerte sich. Von den meisten Frauen wusste er keinen Namen. Nie schrieb eine ihren Namen auf die Briefchen, mit denen sie um ein Stelldichein baten, und oft blieben sie sogar namenlos, wenn er ihr Bett verließ. Daran hatte er sich gewöhnt, wie an so vieles andere auch. Viele hatte er schon wieder vergessen, wenn er nach dem Besuch in die geschlossene Kutsche stieg. Manche blieben ihm deutlicher in Erinnerung, wie die beiden entzückenden, noch blutjungen Schwestern, die ihn von oben bis unten kämmten und bürsteten und nicht genug bekommen konnten von seinen weichen, flachsblonden Locken. Erst hatten sie ihn damit erregt, bis er stark genug war, um allen beiden zu Willen zu sein, und nachher hatten sie ihn »schön glatt gebürstet, damit niemand etwas merkt«. Dabei hatten die beiden Weiblein in ihrer Lust so laut gestöhnt und gejauchzt, dass er jeden Augenblick erwartet hatte, erboste Nachbarn an die Türe pumpern zu hören! Oder die feiste, blonde Witwe mit dem Körper wie ein frisches Federbett, so weich und üppig, dass er darin zu versinken meinte. Die italienische Tänzerin, die ihn mit einer Flut melodisch murmelnder Liebesworte überschüttete, während sie ihn mit ihren dünnen, muskulösen Beinen über ihrem Bauch einzwickte wie mit einer Mausefalle. Nur zwei oder drei seiner Verehrerinnen hatte im letzten Augenblick der Mut verlassen. Beschämt über ihre Feigheit, hatten sie ihn gebeten, wieder zu gehen – schnell, auf der Stelle. Aber immerhin hatten sie ihm genauso ein wertvolles Abschiedsgeschenk mitgegeben wie die anderen, die er glücklich gemacht hatte.
Im Halbdunkel lächelte er vor sich hin, wobei kräftige weiße Zähne unter den vollen Lippen aufblitzten. Welche seiner Lebensgeschichten wollte er an diesem Abend erzählen? Dass man ihn tief in den frostigen Urwäldern Sibiriens in einer Falle gefangen hatte, ein dreijähriges Kind, das wie eine Bestie knurrte, die Zähne fletschte und keine Speise außer bluttriefendem, rohem Fleisch annehmen wollte? Oder jene andere Geschichte, wie seine Mutter, Gattin eines wagemutigen Forschers, auf Reisen in Afrika angesichts eines in ihr Zelt eindringenden wilden Löwen so erschrocken war, dass sie ein Ungeheuer zur Welt gebracht hatte? Sein Agent Joseph Sedlmeyer war ein gelehriger Schüler seines großen Vorbildes, des 1891 verstorbenen berühmten amerikanischen Zirkusdirektors Phineas T. Barnum, genannt »König Humbug«, der die Lügengeschichten nur so aus dem Ärmel geschüttelt hatte. Auch Sedlmeyers Repertoire an Legenden war schier unerschöpflich.
Plötzlich merkte der Jüngling auf. Aus den schwachen, unbestimmten Geräuschen der Nacht schälte sich eines immer deutlicher heraus: das dumpfe Klippklapp von Pferdehufen, das Quietschen eines schlecht eingefetteten Rades. Er zog seine Taschenuhr an ihrer Kette aus der Westentasche. Die Zeiger auf dem fahl im Halbdunkel leuchtenden Ziffernblatt standen genau auf zehn Uhr.
Dann tauchte der Umriss des zweispännigen Fiakers unter einer Gaslampe auf. Das Fahrzeug hielt an.
Stephan eilte mit langen Schritten hin, die Kapuze tief ins Gesicht gezogen. Es war ihm zur Gewohnheit geworden, sich zu verbergen, auch wenn es – wie jetzt – nicht notwendig gewesen wäre. Sein bloßer Anblick, das hatte sein Agent ihm seit Jahren eingehämmert, war bares Geld wert, den verschwendete man nicht an irgendwelches nicht-zahlende Volk.
Der Kutscher spähte misstrauisch vom Bock herunter. Offensichtlich fühlte er sich nicht ganz geheuer, so mutterseelenallein mit der schwarzen, unfreundlichen Nacht, dem verlassenen Wurstelprater und dem mysteriösen Fremden. Mit unsicherer Stimme fragte er: »Haben Sie den Brief dabei? Ich sollte ihn mir zeigen lassen, ehe ich irgendwen einsteigen lasse.«
Der Vermummte bemerkte spöttisch: »Oh, ich bin nicht leicht zu verwechseln!« Das Briefchen mit der Botschaft wurde von einer weiß behandschuhten Hand hinaufgereicht. Gleichzeitig hob er mit der anderen eine Sekunde lang den Rand der Kapuze, sodass das gelbe Licht der Wagenlaternen auf sein Gesicht fiel. Dann rutschte die Kapuze wieder herab, aber der Kutscher hatte genug gesehen. Er stieß einen heiseren Laut aus, in dem sich Schrecken und Abscheu vermischten. Ohne ein weiteres Wort ließ er den unheimlichen Fahrgast einsteigen und trieb seine beiden Rösser an.
Stephan lehnte sich bequem in den gepolsterten Sitz zurück und ließ seine Gedanken schweifen, zurück in die Vergangenheit, zu der ersten Frau, die er – damals ein zwölfjähriger Knabe – geliebt hatte.
1902, auf dem Gelände des Zirkus Barnum & Bailey
»Lass mich deine Muschi gucken, Gracie. Nur einmal gucken.«
Die beiden jungen Leute, halbe Kinder noch, hatten sich in eine der dumpfen Baracken hinter dem Zirkusgelände zurückgezogen, wo das Heu für den berühmten Elefanten Jumbo und die Pferde aufbewahrt wurde. Draußen brannte die kalifornische Sonne vom Himmel. Der Zirkus Barnum & Bailey gab seit einer Woche Vorstellungen in Los Angeles, und man musste lange suchen, um einen einigermaßen kühlen und dunklen Winkel zu finden. Wer nicht unbedingt arbeiten musste, verschlief die glühenden Mittagsstunden. Das galt vor allem für die Darsteller der Sideshow, die erst am späten Nachmittag ihren ersten Auftritt hatten: Dicke Damen, »lebende Skelette«, Albinos, Siamesische Zwillinge, Zwerge, Riesen, Männer und Frauen ohne Arme, Beine oder Unterleib, der Froschknabe, der Krokodilmann und andere Seltsamkeiten.
»Gracie, sei lieb …«, schmeichelte er.
Das Leopardenmädchen mit dem halb schwarzen, halb weißen Wollhaar und der schwarz-weiß gefleckten Haut lachte. Auf ihren dünnen nackten Beinen tanzte sie vor ihm hin und her und wedelte herausfordernd mit dem Saum ihres weißen Sommerkleidchens. »Mach ich nicht, mach ich nicht!«, sang sie, hob aber gleichzeitig den Rocksaum mit einer blitzschnellen Bewegung so weit hoch, dass ihre rüschenbesetzte Unterwäsche hervorblitzte.
Der Junge stöhnte. »Du darfst bei mir auch gucken«, lockte er.
Sie lachte ihn aus. »Päh, da sehe ich doch nichts als Haare! Aber komm, ich will dich kraulen.« Sie ließ sich auf einen der gepressten Strohballen sinken, spreizte weit die Beine und bedeutete ihm, sich mit dem Rücken zu ihr auf den Boden zu setzen. Er war enttäuscht, aber gekrault zu werden war immer noch besser als gar nichts. Vielleicht würde sie später noch mit sich reden lassen. Sie mochte ihn gerne, das wusste er. Alle Frauen im Zirkus mochten ihn, ausgenommen das merkwürdige Ding, das sich Josephine-Joseph nannte und auf der rechten Hälfte eine Frau war, auf der linken Hälfte ein Mann.
Es war so heiß, dass er es in überhaupt keinem Kleidungsstück aushielt und nur ein Seidentuch um die Hüften geknotet hatte, um der Sittsamkeit Genüge zu tun. Mit einem Gefühl wohliger Benommenheit ließ er den Kopf zurücksinken, direkt in Gracies Schoß. Was gäbe ich dafür, wenn ich jetzt hinten Mund und Augen hätte!, dachte er. Aber da krabbelten ihre schmalen, knochigen Hände schon an seinen Ohren herum, rieben die Ohrmuscheln und wühlten sich durch das üppige, weizenblonde Haar. Sie spreizte die Finger und ließ sie langsam, vorsichtig, um ihn nicht zu ziepen, falls irgendwo ein Elfenknoten steckte, wie eine Flachshechel durch die volle Länge der dicken Flechten gleiten. Dabei musste sie ihre dünnen schwarzen Arme beinahe in voller Länge ausstrecken, denn wenn er aufrecht stand, fielen ihm die langen Locken bis über die Ellbogen. Dann krabbelte sie mit den Fingern seinen Hals hinauf, seine bärtigen Wangen entlang bis zu der Nase, über deren Rücken sich das Haar in feinen Strähnen teilte, hinauf über die Stirn, an der die zoll-langen Augenbrauen bis über die Schläfen zurückgebürstet waren. Haare wuchsen ihm auf den Ohren und auf der Nase, auf den Wangen, der Stirn und dem Kinn, lang und üppig und so seidig weich, dass jedermann diese Löwenmähne berühren und streicheln wollte.
»Du riechst gut«, flüsterte sie und drückte einen verlockenden Kuss auf seinen Nacken, nachdem sie die Haarmähne ein Stück weit beiseite geschoben hatte.
Biest, dachte er. Gemeines kleines Biest. Willst du mich so lang necken, bis ich vor Aufregung platze?
»Lass mich gucken«, bettelte er, jetzt schon ein wenig gereizt, »oder ich geh zu … zu irgendjemand anderem.«
»Zu Josephine-Joseph?«, höhnte das Mädchen. »SIE mag dich ja, aber ER kann dich nicht leiden!« Sie sprang so abrupt auf, dass er beinahe auf den Rücken landete. Während er sich aufrappelte, trat sie vor ihn hin, zog ihr dünnes Sommerkleid hoch und streifte das Höschen bis zu den Knien hinunter. Der Junge japste bei dem Anblick. Auf Knie und Hände gestützt, beugte er sich so weit vor, dass seine Haarmähne den Schoß des Mädchens umhüllte. In die stickige Luft der Baracke mischte sich der säuerliche Duft ihrer entblößten Scham. Seine Zunge schob sich gierig leckend vor, verirrte sich aber in einem konfusen Gewirr aus üppigem schwarzem Schamhaar und seinem eigenen, weich-lockigen Haar, das in dichten Flechten sein gesamtes Gesicht bedeckte. Gracie schüttelte sich vor Lachen, als ihm die Haare in den Mund gerieten, als er spuckte und hustete.
»Du solltest dich mal rasieren, dann ginge es leichter!«, neckte sie ihn. Aber als sie dann sah, wie traurig und frustriert seine goldbraunen Augen aus der Haarmaske blickten, hatte sie Mitleid mit ihm. »Komm«, flüsterte sie, nahm seine Hand und führte sie zwischen ihre langen, wohlgeformten und so seltsam gescheckten Beine. »Greifs einfach an.«
Weich. Feucht. Zart. »Oh!«
»Weil du es bist, darfst du die Finger reinstecken, aber vorsichtig. Leck sie nachher ab, das schmeckt gut.«
Er gehorchte.
Sie hatte recht.
An diesem heißen Nachmittag machte der zwölfjährige Stephan Bibrowsky, genannt Lionel der Löwenjunge, zum ersten Mal die Erfahrung, dass Frauen etwas Köstliches waren. Und dass er in ihren Augen ein begehrenswerter junger Mann war, auch wenn andere Leute ihn einen Freak und ein Monster nannten.
Aufgebläht von Stolz, dass Gracie ihn erhört hatte, schlenderte er kurz vor Beginn der Nachmittagsvorstellung durch die schattigen Gassen zwischen den Zirkuszelten. Barnum & Baileys Zirkus, das war kein schmutziges Zelt mit ein paar schäbigen Wohnwagen rundherum. Das war eine Kleinstadt, mit zwölf großen, wetterfesten Pavillons, von denen einer für die Sideshow reserviert war, und einer Unzahl von Nebengebäuden, von Büros bis zu Requisitenkammern und Heuschuppen. Hier schlug das Herz der Zirkuswelt. Nachdem sein erstes Projekt, das American Museum in New York, zwei Mal abgebrannt war, hatte der Gründer Phineas T. Barnum sich auf reisende Shows verlegt. Und so viel von seinen bombastischen Behauptungen auch nur Schaumschlägerei gewesen war, das Eine musste man ihm lassen: Es gab tatsächlich auf der ganzen Welt nichts Vergleichbares. Der große Showman war vor zehn Jahren gestorben, aber sein Geist lebte in seinen Nachfolgern und deren Team weiter.
»Die größten, schönsten Leinwandzelte auf der ganzen Welt!«, trompetete die Reklame. »Zwei Großvorstellungen täglich an jedem Wochentag!« Ein Ring von Eisenbahngleisen umgab das Zirkusgelände, mit zwei mächtigen Lokomotiven und einem schier endlosen Zug von bunten Wohnwagen, die auf flachen Güterwagons aufgereiht standen. Jeder davon trug in scharlachrot und sonnengelb die Aufschrift: »The greatest Show on Earth!« Das war schon ein anderes Reisen als in einem schäbigen Wanderzirkus, dessen Wagen bei jedem Regen im Schlamm steckenblieben!
Stephan war stolz darauf, dass sein Impresario ihn in diesem Riesenunternehmen untergebracht hatte, das nur die besten, die skurrilsten, die extravagantesten Shows akzeptierte. Er fühlte sich als einer der ganz großen Stars in der Zirkuswelt. Wen gab es denn noch außer ihm? Den »Pudelmenschen« Jojo vielleicht, aber der war bei schlechter Gesundheit und schaffte nur noch wenige Auftritte.
Die mannshohen bunten Reklametafeln über dem Zelt der Sideshow trompeteten die unglaublichsten Sensationen in die Welt hinaus: Die größten Riesen, die dicksten Damen, die dünnsten Männer, die winzigsten Liliputaner, die man je gesehen hatte! Fräulein Beate, »das unstreitig dickste Mädchen, das je gelebt hatte!« Prinzessin Anastasia, die »lebende Teepuppe«, nur 48 Zentimeter groß! Der Koloss Heinrich, 324 Kilo schwer, mit dem unglaublichen Hüftumfang von 254 Zentimetern – der 25-jährige war aufgrund seines enormen Gewichts fast bewegungsunfähig und musste auf eine Ladebühne ins Zelt geschafft werden. Die Frau mit dem Maultiergesicht! Das Mädchen mit der Elefantenhaut! Die kleinste Familie der Welt! Die »Weißen Mohren« vom Nordpol! Nicht alle waren so groß, so dick, so klein, so abenteuerlich missgestaltet, wie die schrille Werbung behauptete. Bibrowsky zeigten die Reklametafeln als eine Art männlicher Sphinx mit einem Menschenhaupt und einem Löwenleib, umringt von einem Rudel weiblicher Löwen vor dem Hintergrund einer Wüstenlandschaft.
Für gewöhnlich herrschte jedenfalls beim intelligenten Publikum ein gewisses Misstrauen gegenüber der Echtheit der so lebhaft angepriesenen »Wunder der Natur«, denn Zirkusgründer Phineas T. Barnum hatte es mit der Wahrheit nie sehr genau genommen. Bluffs, inszenierte Konkurrenzen, sogar Betrügereien – der »König aller Showmen« hatte vor nichts zurückgeschreckt. Bei einem besonders unverschämten Coup hatte sich einer seiner Mitarbeiter als medizinischer Fachmann aus London ausgegeben, um die Echtheit einer »Fidschi-Meerjungfrau« zu bekräftigen. Was eine glatte Lüge war, denn das geheimnisvolle Meeresgeschöpf bestand aus dem gedörrten Oberkörper eines Affen, der geschickt auf einem großen, präparierten Fischleib angenäht war. Durch Barnums List jedoch war es 1842 zur meistbesuchten Sensation in New York geworden.
Seine Nachfolger hatten keine Skrupel, es dem Unternehmensgründer gleichzutun, sie arbeiteten ebenso mit Schwindeleien, ja ausgemachtem Betrug. Bei einigen Freaks hatten sie mit kleinen Tricks nachgeholfen: So schien die »Dame ohne Unterleib«, wenn sie auf dem Arm ihres Agenten hereingetragen wurde, unterhalb des letzten Rippenbogens zu enden – was freilich eine anatomische Unmöglichkeit dargestellt hätte, denn ein Bauch mit allen Eingeweiden sowie die Geschlechts- und Ausscheidungsorgane und die Hüften waren nun einmal lebensnotwendig. Was fehlte, waren allein die Beine vom Oberschenkelgelenk abwärts. Aber mit optisch geschickt arrangierter Bekleidung, extra langen Ärmeln sowie einem unter den Achseln gesmokten Oberteil, ließ sich darüber hinwegtäuschen. Die »schwarze Riesin« Ella trat mit einem mächtigen Kopfputz aus Pfauenfedern auf, der sie um gut einen halben Meter größer erscheinen ließ, als sie tatsächlich war. Die Bärenfrau, die stets auf ihren vier kurzen, missgebildeten Gliedmaßen lief, trug ein Kleid aus braunem Pelz, das auf Fotos mit ihrer dunklen Haut zusammenretuschiert wurde. Gar nicht zu Reden von der »Monsterspinne mit dem Frauenkopf« oder dem »sprechenden und singenden geköpften Haupt«, die reine Spiegeltricks waren.
Sedlmeyer freilich legte Wert darauf, dass seine Artisten in natura hielten, was die Reklame versprach. Seine Truppe bestand außer dem Löwen aus sechs Personen: Zwei kleinwüchsigen Männern, dem Zwerg Popoll, der ein dressiertes Pony vorführte, Akkordeon spielten und in der Spätabendvorstellung mit der schlüpfrig-komischen Nummer eines »Zwergen-Striptease« unterhielt, und dem puppengroßen Liliputaner Sir Lancelot. Außerdem hatte er einen Riesen namens Walentin unter Vertrag, mit seinen 2,47 Metern beachtlich groß war, allerdings nicht ganz so riesenhaft wie auf den Reklametafeln und den Trickfotografien zu Werbezwecken, in denen er einen normal gewachsenen Mann um zwei Meter überragte. Dann war da noch die imposante Bartfrau Madame Eliza und die beiden »Siamesischen Zwillinge« Devi und Durga, die Sedlmeyer in Bombay aufgekauft hatte. Kinder eines Pärchens von Bettlern und Dieben, hatten sie in den Slums von Bombay für einen Bissen Brot und eine Rupie ihre Lumpen geöffnet und vor den Augen gaffender Seeleute den fleischigen Strang entblößt, der ihre ansonsten perfekten Körper in Brusthöhe verband. Sie waren jetzt siebzehn Jahre alt, und als Sedlmeyer sie erworben hatte, waren ihre Eltern knapp davor gestanden, die damals Elfjährigen an ein Bordell zu verkaufen. Der Impresario hätte schweres Geld an ihnen verdienen können, wenn er sich als ihr Zuhälter betätigt hätte, denn immer wieder wurde er von Männern angesprochen, die sich ein doppeltes Vergnügen gönnen wollten, aber er hatte jedes Mal barsch abgelehnt. Erstens, weil er ein anständiger Mensch war, und zweitens, weil er genau wusste, dass er dann zwei verstörte und für die Show völlig unbrauchbare Geschöpfe zurückbekommen hätte. Sie teilten einen Wohnwagen mit Madame Eliza, die grimmig darüber wachte, dass ihnen niemand zu nahe kam.
Obwohl er also nur Einer in einer Truppe war, fühlte Stephan sich als Star unter Stars. Bartfrauen gab es viele, Riesen und Zwerge auch, und selbst Siamesische Zwillinge waren nicht so rar, wie man glauben mochte, da die meisten beim Zirkus landeten. Aber Löwenmenschen, richtige Löwenmenschen, davon gab es zurzeit jedenfalls nur Stephan Bibrowsky und Jojo, und darauf war der Junge sehr stolz. Er hörte es immer wieder gerne, wenn Sedlmeyer mit seiner gewaltigen Bassstimme vor dem Zelt brüllte:
»Der Vater dieses unglückseligen Monstrums, meine Damen und Herren, der Vater war ein berühmter Dompteur, ein König der Manege! Seine Frau war seit kurzem schwanger, da passierte ein entsetzliches Unglück! Die Löwen, bisher gehorsam und sanft, wurden durch Blitz und Donner eines Gewitters erschreckt! Der wildeste von ihnen, genannt Simba, der Herr der Wüste, eine riesenhafte Bestie, verfiel in Blutrausch und stürzte sich brüllend auf den Dompteur! Da half keine Peitsche, kein abwehrend erhobener Stuhl! Das Ungeheuer, rasend vor Mordlust, stürmte über alle Schranken hinweg und riss seinen Herrn nieder. Blut tränkte die Sägespäne des Bodens! Zerfleischt und blutüberströmt, trug man den Sterbenden aus der Manege. Und gerade da, meine Damen und Herren, das stellen Sie sich nur einmal vor – da sah ihn seine schwangere Frau, die auf das Geschrei der Bediensteten herbeigestürzt war! Sie brach ohnmächtig zusammen, als sie ihren geliebten Gatten so entsetzlich zugerichtet sah. Sieben Monate nach dem blutigen Ereignis schenkte sie einem Knaben das Leben. Die junge Mutter fragte nach dem Kleinen, sobald sie sich ein wenig von den Schmerzen der Geburt erholt hatte, doch mochte man es ihr zuerst gar nicht zeigen. Denn nun folgte ein neuerliches Entsetzen: Das Kind hatte die Gestalt des blutrünstigen Löwen angenommen, an dem die Schwangere sich versehen hatte! Hier ist es, hier im Zelt! Kommen Sie und sehen Sie das schreckliche Wunder der Natur, sehen Sie es lebendig!«
Stephan schlenderte auf das langgestreckte, mit grellen Riesenfiguren bemalte Zelt der Sideshow zu, an dessen Spitze bunte Fähnchen flatterten. Die beiden »Barker«, die Ausrufer, die dem Publikum mit bellendem Geschrei die Wunder im Inneren des Zeltes ankündigten, nahmen bereits ihre Plätze ein. Er musste zusehen, dass er unter Dach kam, denn wenn »Showzeit« war, wenn die ersten Neugierigen sich bereits vor dem Eingang versammelten, war es für ihn aus mit dem freien Herumlaufen. Sein Impresario, Herr Joseph Sedlmeyer, hatte ganz richtig argumentiert: Warum sollten die Leute Eintritt zahlen, um etwas zu sehen, das sie genausogut sehen konnten, wenn sie nur die Nase über den Zaun streckten?
Deshalb hielten sich um diese Zeit fast alle »Prodigys«, die »Wunder der Natur«, noch in ihren Wohnwagen auf oder bereits in den Kojen des Nebengebäudes, der Sideshow, wo sie hinter Vorhängen versteckt auf ihren Auftritt warteten. Das Publikum wanderte dann den teppichbelegten Flur entlang, während die Agenten die schweren Vorhänge hoben und den Blick auf die menschlichen Kuriositäten freigaben. Manche von ihnen standen und saßen nur da und erzählten in auswendig gelernten, hölzernen Texten, wie sie zu ihren Missbildungen gekommen waren – wobei der Zirkus-Chef ihnen oft die fettesten Lügengeschichten in den Mund legte. Andere hatten mehr zu bieten, sie sangen, tanzten, erzählten Witze oder führten kleine akrobatische Nummern vor wie der »Seelöwenmensch«, der mit seinen flossenähnlichen, an der Schulter angewachsenen Händen einen Ball fing, den man ihm aus dem Publikum zuwarf.
Stephan kam an Devi und Durga vorbei, die im schattigen Winkel zwischen zwei Zelten saßen und mit den beiden äußeren Armen ihrer Doppelgestalt an derselben Portion Fruchteis löffelten. Er wünschte, er hätte sie rechtzeitig gesehen, um einen anderen Weg einzuschlagen. Nicht, dass etwas an ihnen unangenehm gewesen wäre, sie waren zwei sehr hübsche, zarte Mädchen in weißen Strümpfen und weißen Kleidern, Seidenschleifen im langen schwarzen Haar, Straßschmuck an Hals und Händen. Sie waren viel schöner als das Leopardenmädchen, aber Stephan hätte nie gewagt, ihnen die Frage zu stellen, die er Gracie gestellt hatte. Die Schwestern lebten gewissermaßen in einer Glaskugel, zu der sie niemand anderem Zutritt gewährten; sie waren bezaubernd, geheimnisvoll und unheimlich zugleich. Natürlich saßen sie zwangsläufig in enger Umschlingung nebeneinander, wobei jede einen Arm um die Taille der Schwester gelegt hatte, aber sie sprachen auch fast nur miteinander, und das in ihrer Muttersprache – obwohl sie Englisch recht gut verstanden – und in einem verstohlenen Flüsterton, der das Gespräch für Außenstehende vollends unverständlich machte.
»Beeilt euch, Mädchen«, sagte der Junge auf Englisch, »die Show fängt gleich an, und Sedlmeyer kann es nicht leiden, wenn wir da noch im Freien rumlungern.«
Immerhin taten sie ihm den Gefallen, ihn zur Kenntnis zu nehmen, wenn er sie direkt anredete, also zwitscherte Devi (ihre Stimme erinnerte ihn immer an einen Singvogel) »Danke, Lionel«, während ihre Schwester nur eine Art Echo beisteuerte: »Ooo – Nell!«
Danach sprangen sie mit einer einzigen, erstaunlich eleganten Bewegung auf, ließen den Eisbecher fallen und liefen ins Zelt.
Mit dem Riesen Walentin wusste er nicht viel anzufangen, obwohl dieser, wie er selbst auch, aus Russisch-Polen stammte und ihm Polnisch beigebracht hatte, sodass sie sich in einer gemeinsamen Sprache unterhalten konnten. Wie die meisten Riesen bezahlte Walentin für seine extreme Größe mit ständigen Schmerzen in den Gelenken, Muskeln und Knochen; er musste sich beim Gehen auf einen Stock stützen, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren, und setzte überhaupt nur ungern einen Fuß vor den anderen. In der Show trat er in tatarischer Tracht auf, wobei er in einem gewaltigen, geschnitzten Stuhl saß und sich mit dröhnender Stimme mit seinem Partner Sir Lancelot unterhielt. Zum Glück war der Kleine witzig, gewandt und überhaupt nett anzusehen. Die Leute lachten, wenn er wie ein Äffchen auf seinem gewaltigen Partner herumkletterte, ihm die Pfeife anzündete, Goldmünzen aus seinen Ohren zauberte und sich in seinen Kleidern versteckte. Mit Walentin allein wäre kaum Geld zu verdienen gewesen. Einfältig und mürrisch, von chronischen Schmerzen geplagt, lebte er nur widerwillig in einer Welt, die überall zu kurz, zu klein und zu eng für ihn war.
»Hallo, kleiner Bettvorleger! Wie geht´s dir?«, fragte jemand auf Deutsch. Eine kräftige Hand klopfte ihm auf die Schultern. Als er sich umdrehte, stand der »König des Nordpols« hinter ihm, ein hochgewachsener, attraktiver Albino mit einem mächtigen, gezwirbelten Schnauzer und einer Haarmähne, so groß wie ein Daunenkissen, die wie gesponnenes Glas aussah.
Stephan atmete tief durch. »Häscht du jetzt Bettvorläger gesagt?« Mit Gracie und den Inderinnen hatte er Englisch gesprochen, aber diesem Mann antwortete er in perfektem Deutsch mit einem deutlich schwäbischen Akzent, denn seine ersten Jahre in Deutschland hatte er in dem Dorf Dunstelkingen bei Stuttgart verlebt, dem Heimatort seines Impresarios. Der Nordpol-König stammte ebenfalls aus Schwaben.
»Ach, du weißt doch, wie das ist. Untereinander neckt man sich.« Unter den Freaks war es durchaus üblich, sich über die eigene und fremde Missgestalt lustig zu machen. Freilich, wehe dem Außenstehenden, der das versucht hätte!
»Ist dir auch so heiß?« Der König und seine Truppe von »Eismenschen« litten alle jämmerlich unter der kalifornischen Sonnenglut. Ihre schneeige, fast durchsichtige Haut reagierte schon auf kurze Bestrahlung mit einem Sonnenbrand, und ihre ohnehin schwachen Augen waren im grellen Licht praktisch blind.
»Was denn sonst?«, gab Stephan mürrisch zurück. »Gibt´s einen hier, der nicht in der Hitze zerfließt? Einen von uns, meine ich.« Die Direktoren und Impresarios leisteten sich den Luxus von elektrisch betriebenen Deckenventilatoren, die in ihren Büro-Baracken für frische Luft sorgten, aber die anderen mussten gnadenlos schwitzen. Wenigstens, dachte Stephan, musste er nicht, wie das Heer von Arbeitern und Gehilfen, auch noch die schweren Requisiten herumschleppen. So gesehen, hatte er ein recht bequemes Leben. Er brauchte weder tanzen noch turnen, sondern lag auf einer Samtdecke, ließ sich bewundern und von ausgewählten Gästen mit kleinen Stücken von »rohem Fleisch« – das freilich nichts anderes als winzige Bissen Dörrfleisch war – füttern, und nach der Fütterung las er in gepflegtem Englisch ein romantisches Gedicht vor. Das hatte bislang noch immer genügt, die Leute in Entzücken zu versetzen.
Der König des Nordpols brummte vor sich hin. Es war schon seit Tagen so schwül, und mit jedem heißen Tag wurde seine Laune schlechter. »Ohne uns könnten sie einpacken«, murrte er, »trotzdem, wenn´s ums Geld geht, werden wir kaum besser behandelt als Tiere. Hast du das von den beiden Vogelköpfen gehört? Denen geben sie überhaupt nichts außer dem Essen, weil die armen Teufel schwachsinnig sind und keine Ahnung haben, dass es so was wie Geld überhaupt gibt. Ihr Agent frisst sich dick und voll an ihren Eintrittsgeldern und sie sind schon glücklich wie kleine Kinder, wenn er ihnen eine Orange schenkt. Und jetzt will er sie überhaupt wieder in das Irrenhaus zurückschicken, aus dem er sie geholt hat, weil sie nicht so viel bringen, wie er sich erhofft hat.«
Stephan nickte. Die Geschichte vom traurigen Schicksal der beiden war ihm auch schon zu Ohren gekommen. Die Vogelköpfe – ein Mann und eine Frau, beide Mexikaner, mit winzigen, kegelförmigen Gehirnschädeln über eigenartig geformten Gesichtern – wurden als »die letzten Azteken« ausgestellt, aber da sie, geistig auf dem Niveau von Kleinkindern, kaum etwas lernen konnten, war ihre Nummer recht langweilig. Sie knieten einfach nur, in phantastische Kostüme gekleidet, auf einem Teppich und brabbelten auf »aztekisch« vor sich hin.
Der König des Nordpols ließ seiner schlechten Laune weiterhin freien Lauf. »Fettes Geld gibt es nur die Leute vom Varieté. Ja, ein Zauberer musst du sein, oder ein Entfesselungskünstler oder eine Kunstreiterin, da überschütten sie dich mit Dollars!«
Stephan – der genau wusste, dass der geldgierige Zirkusdirektor seine sämtlichen Angestellten, Akrobaten, Künstler und Freaks gleichermaßen, übers Ohr haute, wo es nur ging – gab keinen Kommentar dazu ab und entschuldigte sich, er müsse zusehen, in seine Koje in der Sideshow zu gelangen, »sonst kommt mein Dompteur mit der Peitsche.« Er grinste dabei, denn Sedlmeyer war noch einer der Besseren unter den Impresarios. Er wurde niemals gewalttätig, nicht einmal, wenn er betrunken war. Andere schlugen ihre oft körperlich hilflosen Show-Objekte grün und blau, wenn sie einen schlechten Tag gehabt hatten.
Ein langer weißer Zeigefinger kitzelte neckend seinen Bart und die Haare auf seiner Nasenspitze. »Dann mach´s wie dein Vater und friss ihn. Simba, der schreckliche König der Wüste!«
Stephan verdrehte die Augen. Niemals hätte er sich vor anderen anmerken lassen, dass ihn eine Welle von Stolz durchschauerte, wenn Sedlmeyer seine Tirade losließ – von der er freilich ganz genau wusste, dass sie nur dummes Gewäsch war. »Muss ich mir die Ammenmärchen in meiner Freizeit auch noch anhören? Mein Vater hat in einem dreckigen kleinen Kaff in Russisch-Polen Kartoffeln und Rüben gepflanzt.«
»Das will aber keiner hören, mein Lieber. Meinst du, irgendjemand würde für mich Eintritt bezahlen, wenn sie wüssten, dass der Eismensch vom Nordpol ein arbeitsloser schwäbischer Schuster ist, der zufällig schlohweiße Haare hat?« Tatsächlich wären die Albinos – die es schließlich auch außerhalb der Sideshows zuweilen zu sehen gab – wohl kaum eine Attraktion gewesen, hätten die stets einfallsreichen Storyteller des Zirkus ihnen nicht eine faszinierende Aura des Geheimnisvollen verliehen: Sie wurden als »Nachtmenschen« oder »Weiße Mohren« zur Schau gestellt und lieferten haarsträubende Geschichten von ihrem Leben in ewiger Nacht und ewigem Eis, die sie sich vorher mühsam aus Schulbüchern zusammengelesen hatten. Der Nordpol-König hatte die längste Zeit seines Lebens gar nicht gewusst, was der Nordpol eigentlich war und wo er sich überhaupt befand. »Also, sieh zu, dass du ins Zelt kommst, die anderen sind schon fast alle drin.« Dann zog er den Jungen an sich heran und flüsterte ihm ins Ohr: »Ganz im Vertrauen … Die tätowierte Dame hat mir gesagt, sie fände dich sowas von süß und knuddelig, und wenn du nicht noch ein kleiner Junge wärst, könntest du jederzeit in ihr Bett kommen.« Er ließ ihn rasch los und schubste ihn fort. Den Finger auf den Lippen, rief er ihm nach: »Hab nichts gesagt!«
An diesem Nachmittag spulte Stephan Bibrowsky zwar seine Show wie gewohnt ab, war aber in Gedanken nicht ganz bei der Sache. Die tätowierte Dame hatte das gesagt, soso? Sie war erst kurz in der Show. Eine Kraftturnerin, die auch »gymnastische Tänze« vorführte, eine attraktive Person mit einem schönen Körper und kunstvoll auffrisiertem, nussbraunem Haar. Und was hieß hier überhaupt »kleiner Junge«? Er war so viel Mann wie jeder andere hier auch. Gut, vielleicht nicht so viel wie Hagen, der »germanische Riese«, oder die beiden »eisernen Zwerge«, die kaum größer waren als Kinder, aber mit ihren gewaltigen Muskeln jeden zu Boden rangen, der es mit ihnen aufnehmen wollte … Es würde auf jeden Fall empfehlenswert sein, vorsichtig nachzuforschen, ob schon jemand anderer die Gunst der tätowierten Dame für sich beanspruchte. Bei einigen Showleuten hier flogen rasch die Fäuste, und wer wollte schon einen zerzausten Löwen mit einem blau verschwollenen Auge sehen?
Er kicherte im Innersten in sich hinein. Seine Laune war so prächtig, dass er sich zu einem kleinen Extra hinreißen ließ: Als eine elegant gekleidete junge Frau ihm mit unsicher zitternden Fingern einen Bissen Dörrfleisch hinhielt, leckte er mit der Zunge sekundenlang über ihre Handfläche. Sie errötete so heftig, dass sie im schwachen Licht der Koje fast violett aussah, und wandte sich rasch ab, aber er spürte mit allen Sinnen, wie heftig ihr Herz klopfte. Schon im Hinausgehen, drehte sie sich an der Türe noch einmal um. Ihre Augen funkelten. Dann umklammerte sie den Arm des Mannes, der sie begleitete, und ließ sich von ihm hinausziehen, als hätte sie Angst, aus eigener Kraft der Magie des wunderlichen Geschöpfes nicht widerstehen zu können.
Es dauerte kaum eine Woche, da lernte der junge Löwe eine zweite, weniger angenehme Lektion: Frauen waren gefährlich eifersüchtig.
Er hatte noch gar keine Gelegenheit gehabt, sich schuldig zu machen; sein einziger Kontakt mit der tätowierten Dame hatte darin bestanden, dass er zufällig ihren Weg kreuzte, sie ihn anlächelte und ihm ein Schokobonbon zwischen die Lippen steckte. Aber Gracie, die natürlich davon erfahren hatte – in der kleinen Welt der Sideshow erfuhr jeder alles, und das binnen kürzester Zeit – gebärdete sich, als hätte er sie mit fünf Kindern sitzengelassen.
»Ich kratze ihr die Augen aus! Und dir gleich noch dazu!« Förmlich spuckend vor Wut, stand sie ihm gegenüber, die dünnen Beine gegrätscht, die kleinen, kohlschwarzen Fäuste geballt. »Ich hab dich meine Muschi anschauen lassen! Das heißt, du bist mein Freund, mein Freund, verstehst du? Glaubst du, ich bin eine Schlampe, die das jedem erlaubt? Du bist mein Löwe, ganz allein, mein ganz allein einzigster Löwe, und wenn dir das nicht passt, reiß ich dir alle deine Haare einzeln aus!«
Stephan, der noch nie eine solche Szene erlebt hatte, war vollkommen eingeschüchtert. Er versuchte zaghaft, sich zu rechtfertigen, da wurde ihm das Schokobonbon gewissermaßen unter die Nase gerieben: Wer Bonbons von Frauen annahm, hatte sich bereits von ihnen verführen lassen! Mit Bonbons begann es, hemmungslose Ausschweifungen waren das Ende!
Er wünschte, der Nordpol-König hätte ihm nie etwas über die tätowierte Dame erzählt. Er wünschte, die Versucherin würde abreisen und den Rest ihres Lebens in Südostasien auf Tournee gehen, denn wenn sie ihm selbst in aller Unschuld noch einmal über den Weg lief, würde Gracie ihm Schreckliches antun. Wie sie die Augen rollte, wie sie die Zähne zeigte, wie sie ihr Mäulchen aufriss, dass sein dunkelrotes Inneres sichtbar wurde! Und die langen Nägel an ihren Händen! Außerdem hatte sie zwei um einiges ältere Schwestern, die ihr zweifellos beim Haareausrupfen behilflich sein würden.