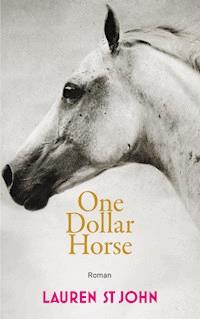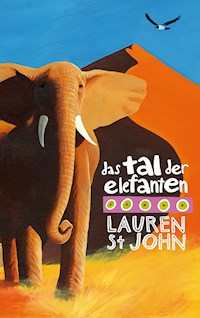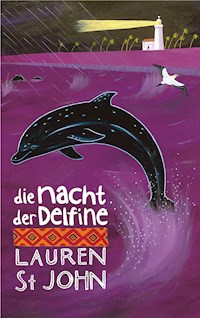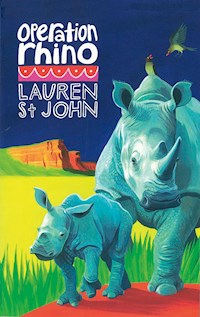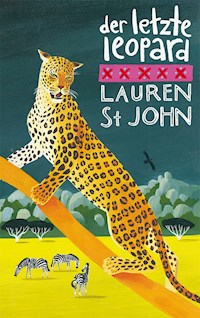
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Freies Geistesleben
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Ferien! Das bedeutet für Martine die glückliche Aussicht, jeden Tag auf ihrer geliebten weißen Giraffe Jemmy reiten zu dürfen. Aber ihre energische Großmutter macht ihr einen Strich durch die Rechnung. Eine kranke Freundin im fernen Simbabwe braucht ihre Hilfe. Und natürlich muss Martine mit. Wenigstens darf ihr bester Freund Ben sie begleiten. Zum Glück. Denn in den abgelegenen Matobo Bergen lebt nicht nur Khan, der schönste und stärkste Leopard, sondern auch ein skrupelloser Händler, der an seinem Fell verdienen will. "Der Leopard, eines der scheuesten und schönsten Wesen des Tierreichs, ist vom Aussterben bedroht. Wenn wir nicht bald handeln, werden wir eines Tages aufwachen und feststellen, dass wirklich nur noch ein letzter Leopard am Leben ist." Lauren St John
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 247
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mit Illustrationen von David Dean
Aus dem Englischen von Christoph Renfer
Verlag Freies Geistesleben
Für meinen Patensohn Matis Matarise Sandile Sithole, in der Hoffnung, dass er Simbabwe und seine Natur ebenso lieb gewinnen wird wie ich.
Und in Erinnerung an Felix und Michina, meine Londoner Leoparden (1990–2007)
• 1 •
Die Morgendämmerung überzog den rosafarbenen Himmel mit goldenen Fäden, als Martine Allen sich mit einem letzten Blick versicherte, dass sie von niemandem im Wildreservat Sawubona beobachtet wurde. Dann beugte sie sich wie eine Rennreiterin nach vorn, verkrallte ihre Finger in einem Büschel silberner Mähnenhaare und rief aus: «Los, Jemmy, los!»
Als die weiße Giraffe einen Satz vorwärts machte, wurde Martine fast abgeworfen. Doch sie fand ihren Halt schnell wieder und passte sich, die Arme um den Hals der Giraffe geschlungen, Jemmys federndem Schaukelpferdrhythmus an. Die Giraffe und ihre Reiterin schossen am Damm und an einer Herde Flusspferde vorbei, die kleine Blasen aufsteigen ließen, schreckten eine Gruppe von Silberreihern auf, die wie Glitzerkonfetti in die weite Savanne hinausstoben. Ein Chor von Tauben, Grillen und Lärmvögeln steuerte die typisch afrikanische Morgenmusik bei.
Lange Zeit war Martine nur nachts und im Geheimen mit Jemmy ausgeritten. Doch nachdem ihre Großmutter von ihren nächtlichen Ausflügen erfahren hatte, sprach sie prompt ein Verbot aus, das sie damit begründete, dass die gefährlichsten Raubtiere des Reservats Sawubona nach Sonnenuntergang auf Mahlzeitensuche waren und nichts lieber auf ihrem Speisezettel sehen würden als ein elfjähriges Mädchen, das auf einer Giraffe dahergeritten kam. Anfangs hatte Martine sich über das nächtliche Reitverbot hinweggesetzt, aber nach einigen brenzligen Situationen und einem Riesenkrach mit ihrer Großmutter musste selbst sie einsehen, dass ihre Großmutter recht hatte. Wenn die Löwen auf der Jagd waren, war es klüger, sich vom Reservat fernzuhalten.
Als weitere Regel hatte ihre Großmutter festgelegt, dass Martine nur in gemächlichem Tempo auf Jemmy reiten durfte. «Allerhöchstens im Trab, lieber noch im Schritt», sagte sie streng.
Martine hatte ihren Worten kaum Beachtung geschenkt. In ihren Augen war Jemmy ein Wildtier, und deshalb betrachtete sie es als völlig normal, dass er die Freiheit haben sollte, seiner Wesensart zu folgen – auch wenn dies bedeutete, dass er mit 35 Stundenkilometern durch die Savanne preschte. Abgesehen davon konnte sie ja auch kaum etwas dagegen ausrichten, da sie keine Zügel hatte, um ihn zu bremsen. Und was bringt es, auf einer Giraffe zu reiten, wenn sich diese höchstens im Tempo eines alterssteifen Ponys fortbewegen darf?
Damit war auch Jemmy voll und ganz einverstanden. Während sie über die Steppe flogen, pfiff der Frühlingswind in Martines Ohren. «Schneller, Jemmy», rief sie. «So schnell, wie du nur kannst.» Dann lachte sie schallend vor lauter Glück und Aufregung, auf einer wilden Giraffe zu reiten.
Plötzlich schoss etwas Graues durch ihr Blickfeld, begleitet von einem schrillen, nasalen Quieken.
Jemmy machte einen Schlenker. Im Sekundenbruchteil, bevor sie vom Körper der weißen Giraffe wegkatapultiert wurde, erhaschte Martine einen flüchtigen Blick von einem Warzenschwein, das mit nach vorne gerichteten gelben Hauern aus seinem Bau gestürmt kam. Hätte sie Jemmys Hals nicht fest mit ihren Armen umschlungen gehabt, wäre sie aus drei Metern auf den Steppenboden gestürzt. Stattdessen rutschte sie nur auf die Brustseite von Jemmys Hals, wo sie wie ein menschliches Amulett hin und her baumelte. Derweilen tänzelte Jemmy scheu herum, während die Sau in der Absicht, ihre Jungen zu verteidigen, wütend zu ihm hinaufquiekte. Fünf Warzenschweinferkel irrten mit himmelwärts ragenden Schwänzchen verängstigt umher.
Die Schmerzen in Martines Armen waren beinahe unerträglich, doch sie wollte um keinen Preis loslassen. Sie liebte Warzenschweine mit ihren Warzen, der rauen Haut, den Schweinsöhrchen und dem ganzen Drum und Dran. Doch sie wusste, dass sie zwar mit ihren Augenwimpern glamourös klimpern, im nächsten Augenblick aber mit ihren Hauern ihre Beine zu blutigem Brei schlagen konnten.
Sie biss die Zähne zusammen. «Jemmy», raunte sie der Giraffe zu. «Nichts wie weg hier, alter Junge.»
In seiner Verwirrung machte Jemmy einen Schritt zurück und beugte sich zu dem Warzenschwein hinab.
«Nein», kreischte Martine, als die Muttersau nach einem ihrer Stiefel schnappte. «Weg hier! Bloß weg hier, Jemmy!»
Jemmy ließ seinen Hals zurückschnellen, um den scharfen Hauern des Warzenschweins auszuweichen. Martine nutzte diese Bewegung, um ihre Beine um Jemmys Hals zu schlingen. Aus dieser Stellung schaffte sie es, sich auf seinen Rücken zu schwingen und ihn zu einem Sprint anzutreiben. Schon bald war die Warzenschweinfamilie nur noch ein grauer Fleck in weiter Ferne, auch wenn das triumphierende Quieken der Muttersau noch lange zu hören war.
Den Rest des Heimwegs ritt Martine in gemächlichem Tempo und mit einem reumütigen Lächeln auf den Lippen. So schnell würde sie sich nicht mehr aufspielen, nicht einmal vor einem Flusspferdpublikum. An der Eingangspforte zum Reservat beugte sich Jemmy vornüber und ließ Martine seinen silberfarbenen Hals hinabgleiten, als wäre er eine Rutschbahn. Das war zwar nicht die sicherste Methode, um von einer Giraffe abzusteigen, aber sie machte Spaß. Noch einmal umarmte sie Jemmy und schlenderte dann zwischen den Mangobäumen hindurch zum Haus mit dem Strohdach.
In der Küche stand eine Bratpfanne auf dem Herd. Darin brutzelten mit Zucker bestreute Tomaten, auf denen sich langsam eine goldbraune Karamellkruste bildete. Kleine Genussfältchen zogen sich über Martines Nase. Sie hatte einen Bärenhunger. Sechsmal in der Woche gab es bei Großmutter hartgekochte Eier mit Toast zum Frühstück, manchmal mit einer Schale Cornflakes als Lichtblick. Doch sonntags und an besonderen Tagen wie heute zeigte sich Gwyn Thomas von ihrer großzügigen Seite, tischte einen köstlichen Brunch auf, bereitete einen leckeren Braten oder erlaubte Martine, zusammen mit Tendai, dem Zulu, der als Wildhüter in Sawubona arbeitete, zu einem Frühstückspicknick am Lagerfeuer auf das Hochplateau zu fahren.
Martine streifte die Stiefel auf der Veranda ab, ging barfuß in das Haus und rief: «Morgen Großmutter!»
«Hallo Martine», sagte Gwyn Thomas, während sie die Ofentür schloss und sich aufrichtete. Sie trug eine rot gestreifte Schürze über einem Jeanshemd. «Wasch dir die Hände und setz dich hin. Hattest du einen schönen Ausritt? Und hat sich Jemmy gut aufgeführt?»
«Wie ein Engel», sagte Martine. Etwas anderes würde sie über ihren Freund ohnehin nicht sagen, ganz abgesehen davon, dass er sich immer gut benahm. Es war ja nicht sein Fehler, dass das Warzenschwein heute mit dem falschen Bein zuerst aus dem Bau gestiegen war.
An der Tür klopfte es zaghaft.
«Ah, Ben», sagte Gwyn Thomas lächelnd. «Perfektes Timing. Das Frühstück ist fast bereit. Komm, setz dich.»
«Danke, Ma’am», sagte eine klare, junge Stimme.
Als sie sich umdrehte, sah Martine den Jungen, der halb Zulu, halb Inder war, etwas schüchtern die Küche betreten. Er trug eine armeegrüne Weste, schwere braune Stiefel und ausgefranste Jeans – seine einzigen, seit er vor ein paar Wochen während eines Inselabenteuers seine anderen Jeans zu Shorts gekürzt hatte. Er hatte glänzend schwarzes Haar, seine Haut war honigfarben, und obwohl er schlank war – einige hätten ihn wohl gar als mager beschrieben –, wirkte er sportlich und kräftig.
Er wusch sich die Hände in der Küchenspüle und setzte sich an den Tisch. «Dir ist heute Morgen wohl ein Warzenschwein über den Weg gekrochen, Martine», neckte er sie. «Ihr habt den Busch ganz schön umgepflügt, du und Jemmy. Es sieht ja stellenweise so aus, als hätte hier der Start zur East African Safari Rallye stattgefunden.»
«Was ist passiert?», fragte Gwyn Thomas. «Bist du zu schnell geritten? Habe ich dir nicht ausdrücklich verboten, Jemmy galoppieren zu lassen? Meinst du, ich will, dass du dir vor meinen Augen das Genick brichst? Sag mal, Ben, haben die Spuren auch gezeigt, dass Martine sehr schnell unterwegs war?»
Martine warf Ben einen verstohlenen Blick zu. Sie wusste, dass Gwyn Thomas ihr das Leben schwer machen würde, sollte man sie beim Galopp auf Jemmy ertappen. Sie wusste aber auch, dass Ben niemals log, und hätte das auch nie von ihm erwartet. Sie machte sich schon auf eine Strafpredigt und ein Reitverbot gefasst. Großartig! Und das am ersten Tag der Schulferien.
«Ja … ääh … ich glaube», sagte Ben und wand sich auf seinem Stuhl.
Die Großmutter stemmte die Arme in die Hüften. «Was glaubst du, Ben? Rück heraus mit der Wahrheit!»
«Ich glaube, der Toast brennt an», sagte Ben geistesgegenwärtig.
Gwyn Thomas sprang auf, zog die rauchende Grillpfanne vom Herd und pustete die Flammen aus, die an den vier verkohlten Toastscheiben züngelten. In diesem Moment begann die Schaltuhr des Ofens zu piepsen und zeigte an, dass die Pilze gar waren, und Martine bemerkte, dass nun auch von den Tomaten Rauch aufstieg. Als sie schließlich das verbrannte Frühstück halbwegs gerettet, frische Toasts gemacht und ein paar Eier in die Pfanne geschlagen hatten, schien Martines Großmutter den gefährlichen Ausritt vergessen zu haben.
Ben lenkte sie zusätzlich mit einer Warzenschweingeschichte ab, die ihm Tendai am Morgen erzählt hatte. Es ging um einen jungen Jäger, den er während seiner Ausbildung zum Wildhüter kennengelernt hatte. Eines Tages wollte dieser die anderen Jägerlehrlinge unterhalten und seine Tapferkeit unter Beweis stellen, indem er ein Warzenschwein in einem Gehege einfach so zum Spaß reizte und quälte. Sollte das Tier auf ihn losgehen, wollte er über den Zaun entkommen.
«Das einzige Problem war, dass es sich um einen Elektrozaun handelte», erzählte Ben grinsend. «Und an dem blieb der junge Jäger zwanzig Minuten lang hängen, bis das Warzenschwein genug hatte und von ihm abließ.»
Martine, deren Arme immer noch von ihrer eigenen Begegnung mit einem aufgebrachten Warzenschwein schmerzten, lachte, wenn auch nicht so herzhaft wie ihre Großmutter.
«Was habt ihr beide denn für Ferienpläne?», fragte Gwyn Thomas, während sie ihnen ein Glas frischen Papayasaft einschenkte. «Natürlich abgesehen von deinen langsamen, sehr gemächlichen Ausritten mit Jemmy, Martine», fügte sie hinzu und zeigte ihrer Enkelin mit einem vielsagenden Blick, dass sie Bens Worte nicht vergessen hatte, auch wenn sie die Sache noch einmal durchgehen lassen wollte.
Mit einem dankbaren Lächeln gab Martine zurück: «Keine Sorge. Ich werde so langsam reiten, dass uns sogar Schildkröten überholen können.»
Ansonsten wollte sie ihr Wissen über das Leben und Überleben im Busch auffrischen und Aquarelle von den Tieren in der Krankenstation von Sawubona malen.
Ben hatte die Erlaubnis seiner Eltern, den Großteil seiner Ferien in Sawubona zu verbringen, um sich von Tendai in die Geheimnisse des Fährtenlesens einführen zu lassen.
Als Martine Ben kennengelernt hatte, war er beinahe stumm gewesen. Er sagte zu niemandem ein Wort – außer zu ihr und seinen Eltern. Die meisten Mitschüler glaubten denn auch, er sei stumm, und einige waren auch heute noch dieser Meinung. Doch in Sawubona schien er sich beim Plaudern mit Tendai, Gwyn Thomas oder anderen durchaus wohlzufühlen.
Während sie zuhörte, wie Ben von seinem Morgen im Reservat erzählte, spießte sie gedankenverloren mit der Gabel die letzten Kartoffeln auf und ließ die Küchenszene auf sich wirken. Vor acht Monaten waren ihre Eltern in der Silvesternacht bei einem Brand in England ums Leben gekommen. Darauf war sie wie ein Paket nach Afrika geschickt worden, wo sie bei ihrer strengen Großmutter leben musste, von deren Existenz sie vorher nicht einmal gewusst hatte. Sie war überzeugt gewesen, nie mehr in ihrem Leben glücklich sein zu können. Doch nun saß sie zufrieden am Frühstückstisch mit jener Großmutter, die nach einer schwierigen Anfangszeit einer der wichtigsten Menschen in ihrem Leben geworden war, und mit Ben, ihrem allerbesten Freund auf dieser Welt – abgesehen von Jemmy natürlich.
Durch die offene Tür sah Martine, wie ein paar Zebras in einiger Entfernung am Wasserloch herumplanschten. Ihre Eltern würden ihr immer fehlen, aber es half ihr schon sehr, dass ihre neue Heimat eines der schönsten Wildreservate der südafrikanischen Kapprovinz war, dass sie auf ihrer eigenen weißen Giraffe durch den Busch reiten konnte und dabei so dicht an Elefanten und Zebras herankam, dass sie sie berühren konnte. Außerdem mochte sie das Wetter in Afrika. Obwohl es noch früh war, tauchte die Sonne die Küchenfliesen schon in ein warmes Orange, und auch Shelby, die rötlich-braune Katze, genoss lang ausgestreckt die Wärme der frühmorgendlichen Sonnenstrahlen.
Das schrille Klingeln des Telefons schreckte sie auf. Gwyn Thomas blickte auf die Uhr und runzelte die Stirn. «Es ist noch nicht einmal sieben. Wer ruft denn in aller Herrgottsfrühe an einem Sonntagmorgen an?»
Sie ging in das Wohnzimmer, wo das Telefon stand. Die Leitung schien schlecht zu sein, denn sie musste sehr laut sprechen. In der Küche war jedes Wort zu verstehen.
«Sadie», rief sie, «was für eine Überraschung! Schön, von dir zu hören. Wie geht’s in der Black Eagle Lodge? … Nein, das darf nicht wahr sein. Das tut mir wirklich leid. Wenn ich etwas für dich tun kann, Sadie, dann sag’ es mir. Wie bitte? Oh! Oooh!»
Ben und Martine blickten sich an, und Ben zog die Augenbrauen hoch. «Klingt nicht gut», murmelte er.
«Ah, ja, ja, ich verstehe», sagte Gwyn Thomas. «Nein, nein, das muss dir nicht peinlich sein. Auf gar keinen Fall. Im Gegenteil, eigentlich passt das perfekt. Wir sind schon unterwegs. Mach dir nur mal keine Sorgen. Wir sind bald da. In der Zwischenzeit pass gut auf dich auf.»
Sie hörten, wie Gwyn Thomas den Hörer auflegte. Dann war es für eine Weile still. Als die Großmutter wieder die Küche betrat, machte sie ein ernstes Gesicht. «Martine, Ben, es tut mir leid, aber ihr müsst eure Ferienpläne fürs Erste begraben. Martine, wir fahren morgen früh für einen Monat weg. Wir müssen nach Simbabwe.»
• 2 •
Martine starrte ihre Großmutter verdutzt an und sagte: «Simbabwe? Was? Warum? Ich kann doch Jemmy nicht allein lassen. Das ist unmöglich. Ausgerechnet jetzt, am ersten Ferientag!»
«Ich kann dich verstehen, Martine. Das Ganze kommt wie ein Blitz aus heiterem Himmel, und es tut mir leid», sagte Gwyn Thomas und legte ihr die Hand auf die Schulter. «Es tut mir selbst weh, euch beide enttäuschen zu müssen. Ich weiß, wie sehr du dich auf die Ferienzeit gefreut hast. Ich würde nicht im Traum daran denken, dich von Jemmy oder Sawubona zu trennen, wenn ich eine Alternative hätte. Aber Sadie ist nun mal eine meiner ältesten und besten Freundinnen; ich kenne sie schon seit einer Ewigkeit. Sie hatte einen Unfall und braucht unbedingt unsere Hilfe.»
«Darf ich fragen, was passiert ist?», mischte Ben sich ein. Er war ebenso niedergeschmettert wie Martine, verstand es aber besser, sich das nicht anmerken zu lassen.
«Sicher», sagte Gwyn Thomas. Sie setzte sich und goss sich Kaffee nach. «Sadie führt in den abgelegenen Matobo-Bergen von Simbabwe ein Hotel – die Black Eagle Lodge. Die Matobo-Berge liegen in Matopos, einer Gegend, die für ihre bizarren Felsformationen mit den aufeinandergestapelten Findlingen und ihre Geschichte bekannt ist. Nach einer Legende soll Lobengula, der letzte König des Ndebele-Volkes, dort samt seinem Schatz begraben sein.
Unglücklicherweise ist Sadie vor einer Woche gestolpert und hat sich einen komplizierten Beinbruch zugezogen. Jetzt trägt sie einen Gips vom Fußgelenk bis zum Oberschenkel und humpelt auf Krücken herum. Mit den ganzen Missernten und politischen Problemen ist das Leben in Simbabwe im Moment kein Honiglecken. Im letzten Monat musste Sadie fast alle Mitarbeiter entlassen. Und dieser Unfall macht alles noch schwieriger. Früher war die Black Eagle Lodge besonders bei Reitern sehr beliebt. Jetzt hat sie nur noch einen Mann, der sich um die Pferde kümmert. Und wenn sich doch einmal ein paar Gäste in ihr Hotel verirren, hat sie weder Koch noch Reinigungspersonal. Da Martine eine gute Giraffenreiterin ist und ich leidlich kochen kann, könnten wir ihr doch einen Monat lang unter die Arme greifen.»
Während sie diese Worte aussprach, blickte sie Martine eindringlich an.
Martine tat so, als merke sie es nicht. Sie saß mit verschränkten Armen ruhig auf ihrem Stuhl. Tief in ihren Augenhöhlen brannten die Tränen. Alles und alle schienen sich immer wieder gegen sie und Jemmy zu verschwören. Wenn sie nicht gerade auf einer Insel gestrandet war oder nicht auf Jemmy reiten durfte, lauerten Wilderer im Reservat, um ihn zu entführen. Außerdem konnte sie sich nicht daran erinnern, dass ihre Großmutter je von Sadie gesprochen hatte, und jetzt war sie plötzlich eine ihrer ältesten und besten Freundinnen. Konnte Sadie nicht jemanden aus der Gegend um Hilfe bitten? Simbabwe war ja nicht gerade um die Ecke, sondern mehr als 1500 Kilometer entfernt.
Die Matobo-Berge mit ihren außergewöhnlichen Felsformationen und dem verlorenen Schatz des Ndebelekönigs waren zweifellos ein faszinierendes Reiseziel. Und sie hatte schon immer auf einem Pferd reiten wollen. Doch wenn sie die Wahl gehabt hätte, wäre sie in Sawubona bei Jemmy geblieben.
Ben, der genau wusste, wie viel Martine ihre geliebte weiße Giraffe bedeutete, sagte: «Kann ich irgendetwas tun? Vielleicht könnte ich an Martines Stelle mit Ihnen nach Simbabwe kommen und mich im Hotel irgendwie nützlich machen. Ich bin zwar noch nie auf einem Pferd geritten und ich muss natürlich noch meine Eltern fragen, aber ich würde das schon hinkriegen, oder ich könnte wenigstens die Pferde füttern, den Stall ausmisten oder so. Dann könnte Martine hier bei Jemmy bleiben. Äh, natürlich nur, wenn Sie wollen …» Seine Stimme wurde brüchig.
«Ben, das ist wirklich ein großzügiges Angebot, aber Martine kann unmöglich allein hier bleiben», sagte Gwyn Thomas. «Tendai hat keine Zeit, sich auch noch um sie zu kümmern. Außerdem weiß ich nicht, ob deine Eltern dich für vier Wochen mit uns nach Simbabwe fahren lassen, und dazu noch in eine so abgelegene Gegend. Aber falls sie es erlauben, würden wir dich natürlich nur allzu gerne mitnehmen. Da wärst bestimmt auch du einverstanden, Martine?»
Martine war hin- und hergerissen. Einerseits wollte sie Jemmy nicht allein zurücklassen, andererseits wollte sie nicht, dass Ben ohne sie eine Abenteuerreise unternahm.
«Martine», sagte Gwyn Thomas mit einem warnenden Unterton, «vergiss deine Manieren nicht. Wir würden uns doch freuen, wenn Ben mit uns nach Simbabwe käme?»
«Das weiß Ben, ohne dass ich es ihm unter die Nase reiben muss», murmelte Martine.
Normalerweise hätte Gwyn Thomas ihre Enkelin für ein derart rüdes Benehmen ausgescholten, doch jetzt seufzte sie nur. «Martine, das Allerletzte, was ich will, ist, dich von Jemmy zu trennen oder dich unglücklich zu machen. Aber ich mache mir echte Sorgen um Sadie. Ich hatte das Gefühl, dass … Aber vielleicht bilde ich mir das nur ein.»
«Was?», drängte Ben.
«Wahrscheinlich ist da gar nichts, aber ich habe irgendwie das Gefühl, Sadie hat mir etwas verschwiegen. Ich kenne wohl keine stolzere und unabhängigere Frau als sie, und dennoch hat sie mich praktisch angefleht, ihr zu helfen. Das passt einfach nicht zu ihr. Deshalb werde ich das Gefühl nicht los, dass da – abgesehen von ihrem Unfall – etwas nicht in Ordnung sein könnte.»
Sie ergriff Martines Hand. «Ich spüre einfach, dass sie uns braucht. Kannst du das verstehen?»
Was sollte Martine da noch einwenden? Ihre Großmutter hatte so viel für sie getan.
«Es tut mir leid», sagte sie und umarmte Gwyn Thomas. «Es kam einfach etwas überraschend. Natürlich verstehe ich das. Ich werde Jemmy ganz furchtbar vermissen, aber ich freue mich auch, ein anderes Land kennenzulernen, vor allem wenn wir Sadie helfen können und ich nebenbei noch auf Pferden reiten kann.»
«Schön», sagte ihre Großmutter sichtlich erleichtert. «Dann sollten wir uns sofort ans Packen machen. Ich will, dass diese Reise für euch zu einem Ferienerlebnis wird. Die Fahrt wird lang sein, deshalb werden wir ein- oder zweimal in Rainbow Ridge übernachten und auch bei anderen Sehenswürdigkeiten unterwegs Halt machen. Komm Ben, wir rufen gleich deine Eltern an.»
Gwyn Thomas drückte Martines Hand und sagte: «Wir werden Spaß haben, ich verspreche es dir.»
Martine behielt ihr Lächeln auf den Lippen, bis ihre Großmutter und Ben die Küche verlassen hatten. Dann stürmte sie aus dem Haus und über den Sandweg zum Tierasyl, setzte sich neben das Gehege mit den zwei verwaisten Wüstenluchswelpen und brach in Tränen aus.
Sie konnte es wirklich verstehen, dass ihre Großmutter nach Simbabwe fahren wollte, um einer guten Freundin zu helfen, die sie dringend brauchte. Sie war auch überzeugt, dass sie genau gleich handeln würde, wenn jemand, der ihr nahe stand, Hilfe brauchen würde. Sie konnte aber beim besten Willen nicht verstehen, warum auch sie in die Matobo-Berge fahren musste. Wenn Ben mitkommen durfte, würde es zwar nur halb so schlimm werden. Aber vier lange Wochen ohne ihre besten Freunde zu sein, würde sich wie eine lebenslängliche Gefängnisstrafe anfühlen. Es musste doch hier in Storm Crossing jemanden geben, bei dem sie wohnen könnte. Zum Beispiel …
Plötzlich war Martines Trauerstimmung wie verflogen. Weshalb hatte sie nicht früher daran gedacht? Sie könnte doch bei Grace, Tendais Tante, wohnen. Grace war eine Sangoma, eine Medizinfrau und Heilerin, deren Vorfahren aus dem Volk der Zulu und aus der Karibik stammten. Gleich nach ihrer Ankunft in Afrika hatte Martine eine besondere Beziehung zu Grace entwickelt, denn Grace hatte ihr als Erste gesagt, dass sie eine geheime Gabe hatte, die ihr Schicksal prägen würde. «Die Gabe kann sein ein Segen, aber auch ein Fluch. Du musst entscheiden weise», hatte sie Martine wenige Stunden, nachdem sie in Kapstadt gelandet war, geraten.
Die Gabe war selbst für Martine ein Rätsel. Sie wusste, dass sie etwas mit Heilkräften und einer alten Zululegende zu tun hatte, wonach ein auf einer weißen Giraffe reitendes Kind über alle Tiere herrschen würde. Gerade dies aber war für sie, die vor Kurzem von einer Biene gestochen wurde und deren Arme immer noch von der Begegnung mit dem Warzenschwein schmerzten, mit einigen Fragezeichen verbunden.
Schon zweimal hatte sie ihre Zukunft in geheimnisvollen Malereien auf einer Höhlenwand gesehen. Die Höhle befand sich ganz hinten im Geheimen Tal, dem Refugium der weißen Giraffe. Und die Malereien hatten beide Male erst einen Sinn ergeben, als sie die vorgezeichneten Ereignisse tatsächlich erlebte.
«Das ist nicht fair», hatte sich Martine bei Grace beklagt. «Wenn die Buschmänner des San-Stammes so viel über mein Schicksal wussten, hätten sie ihre Malereien doch etwas verständlicher gestalten können. Dann wäre es mir nämlich gelungen, all die negativen Ereignisse abzuwenden. Wenn ich zum Beispiel gewusst hätte, was sich im Juni auf dem Schiff ereignen würde, wäre ich niemals an Bord gegangen.»
«Genau», hatte Grace geantwortet. «Wenn du könntest blicken in deine Zukunft, du würdest dich nur für das Angenehme und das Bequeme entscheiden. Dann würdest du gar nicht kennenlernen und erleben das Wichtige in dieser Welt, denn oft sind die wichtigen Dinge auch die schwierigsten. Wenn du nie gegangen wärest auf dieses Schiff, wo wären jetzt die Delfine?»
«Oh», hatte Martine damals gesagt, «oh, jetzt verstehe ich dich.»
Martine fühlte sich sehr wohl in der Gesellschaft von Grace. Sie war eine weise, lustige Frau, die faszinierend viel über afrikanische Medizin wusste. Sie mochte ihr exzentrisches Haus, in dem Hühner ein- und ausgingen, vor allem aber mochte sie ihre leckeren Bananenpfannkuchen. Allerdings würde Gwyn Thomas ihre Enkelin nach längerem Aufenthalt bei Grace wohl dreimal so schwer vorfinden wie vor ihrer Abreise. Vielleicht würde sie dies allerdings positiv werten, weil sie und Grace ständig versuchten, Martine zu mästen.
Je länger Martine darüber nachdachte, desto besser gefiel ihr die Idee, während der Abwesenheit ihrer Großmutter bei Grace zu bleiben. Schließlich war Grace die beste Freundin von Gwyn Thomas in Storm Crossing – was konnte sie schon dagegen einwenden? Jetzt musste sie nur noch Grace überzeugen.
Der Plan hatte in ihren Gedanken gerade erst konkrete Formen angenommen, als sie eine Stimme mit breitem karibischen Akzent hörte: «Ich habe gerade getrunken Tee mit meinem Neffe, da höre ich doch dieses fürchterliche Heulen und Schluchzen. Und ich habe gesagt zu mir: Kein Kind, das lebt in Sawubona unter der strahlenden Sonne des Herrn, hat Grund zu weinen, als würde untergehen die Welt zu Mittagsstunde. Ich muss mal sehen, was ist passiert. Und jetzt sehe ich dich, mein liebes Kind, mit schelmischem Blick und ein Lächeln auf den Lippen. Was ist denn bloß los mit dir, Kind?»
Das plötzliche Auftauchen der Sangoma, gerade in dem Augenblick, als sie an sie gedacht hatte, war für Martine wie ein Sonnenstrahl, der durch dunkle Gewitterwolken bricht. «Grace!», rief sie, schoss auf und lief auf sie zu, um sie zu umarmen. «Ich habe gerade an dich gedacht.»
Grace ließ sich neben ihr auf die Bank sinken. Normalerweise war sie traditionell gekleidet, heute jedoch trug sie einen Rock mit Oberteil in grellem Rosa, ein Halstuch und dazu passende Schuhe in Lila. Grace, die wegen ihrer Vorliebe für ihre selbstgemachten Pfannkuchen an sich schon eine beeindruckende Gestalt war, wirkte in diesem Aufzug noch auffälliger. Sie blickte Martine erwartungsvoll an.
Martine erzählte Grace von der geplanten Simbabwe-Reise ihrer Großmutter. Zum Schluss nahm sie sich ein Herz und fragte sie: «Grace, darf ich dich um einen Gefallen bitten? Meinst du, ich könnte einen Monat lang bei dir wohnen?»
Zuerst sagte Grace gar nichts, was die Schmetterlinge in Martines Bauch zum Flattern brachte. Grace würde ihr diesen Wunsch doch nicht etwa ausschlagen? Schließlich sagte die Sangoma: «Du kannst immer wohnen bei mir, Kind, aber nicht dieses Mal.»
Martine war völlig baff und auch ein wenig verletzt, doch nachdem sie sich diesen perfekten Plan ausgedacht hatte, war sie nicht bereit, unverrichteter Dinge aufzugeben. «Ich weiß, vier Wochen sind eine lange Zeit, aber ich werde mich vorbildlich benehmen», versprach sie. «Du wirst gar nicht merken, dass ich da bin. Ich brauche nicht einmal ein Bett. Ich kann auf dem Sofa oder der Grasmatte schlafen.»
Doch die nächsten Worte von Grace zerschlugen all ihre Pläne auf einmal. «Und was ist mit der Botschaft von den Ahnen? Die willst du einfach schlagen in den Wind?»
«Welche Botschaft», sagte Martine, doch dann erinnerte sie sich mit einem Mal. Als sie im letzten Juni mit ihrer Großmutter, Ben und dessen Eltern am Strand spazieren gegangen war, hatte sie im Sand die Zeichnung eines Leoparden entdeckt. Seine Darstellung war so greifbar und genau gewesen, dass selbst die Schnurrhaare und Flecken des Raubtiers in allen Einzelheiten zu erkennen waren. Die Zeichnung war bestimmt erst vor wenigen Minuten in den Sand geworfen worden. Doch abgesehen von ein paar Fischern, die in einiger Entfernung ihren Fang ausluden, und Martines Begleitern weiter vorne war der Strand menschenleer gewesen. Sie rief Ben herbei, um ihm den Leoparden zu zeigen, doch im Sekundenbruchteil, in dem sie der Sandzeichnung den Rücken gekehrt hatte, war diese von einer Welle für immer weggewischt worden.
Martine erinnerte sich an den Schauder, der ihr damals über den Rücken lief, als die Zeichnung weg war – als wäre sie für sie allein bestimmt gewesen.
Auch jetzt lief ihr ein Schauder über den Rücken. «Woher weißt du vom Leoparden? Ich war doch die Einzige, die ihn gesehen hat.»
«Du musst nach Simbabwe fahren», fuhr Grace fort, als hätte Martine kein Wort gesagt. «Was wird geschehen, steht schon geschrieben. Es ist dein Schicksal.»
Der Telefonanruf, Sadies Unfall, der plötzliche Auftritt von Grace und vielleicht auch der Zwischenfall mit dem Warzenschwein – all diese Ereignisse des heutigen Morgens waren vielleicht kein Zufall gewesen, sondern standen irgendwie miteinander in Zusammenhang. Martine wusste nicht so recht, ob sie diesen Gedanken tröstlich oder nur unheimlich finden sollte.
Ein Windstoß blies zwei Federn aus dem Eulenkäfig. Sie wirbelten durch die Luft, bis sie neben der Bank quer übereinander auf den Boden fielen und ein X bildeten. Seltsamerweise waren sie weder gefleckt noch gelbbraun wie die Eule selbst, sondern glänzten pechschwarz. Fast – so dachte sich Martine später – wie die Federn eines Adlers.
Als Grace die Federn sah, wurde sie plötzlich sehr aufgeregt. Sie packte Martines Arm. «Dieser Junge», sagte sie eindringlich. «Dieser ruhige Junge, der Buddhist.»
Verblüfft fragte Martine: «Ben?»
«Ja, genau der. Weißt du, jetzt gehört er zu deiner Geschichte. Ihr beide seid verbunden miteinander. Auf eurer Reise nach Simbabwe müsst ihr beiden immer bleiben zusammen. Wenn ihr seid getrennt, kommt Gefahr.»
Martine konnte mit den Weissagungen und Vorahnungen von Grace nicht immer viel anfangen, aber diese Warnung erschien ihr jetzt durch und durch unvernünftig und unrealistisch. «Wir können nicht immer zusammenstecken», sagte sie Grace. «Ben ist gerne allein, und er begibt sich immer wieder auf Fährtensuche. Überhaupt: Vielleicht erlauben seine Eltern ja gar nicht, dass er mit nach Simbabwe mitkommt.»
Aber Grace blieb hart. «Ihr müsst bleiben zusammen», sagte sie unerbittlich. «Ihr müsst.»
Martine lehnte sich auf der Bank zurück und schloss die Augen. Als sie sie wieder öffnete, sah sie, wie Grace die Federn in den Lederbeutel steckte, den sie um den Hals trug.
«Was bedeutet das alles, Grace? Werde ich je wieder ein normales Leben führen können. Also, ich bin ja froh über meine Gabe, auch wenn ich nicht genau weiß, wozu sie taugt, und ich will so viele Tiere heilen wie möglich, aber es wäre auch schön, einmal ganz normale Schulferien zu verbringen, um auszuruhen, Bücher zu lesen, auf Jemmy zu reiten und all die Dinge zu tun, die andere Kinder tun können.»
Grace legte ihren Arm fürsorglich um Martines Schulter. «Wie viele Kinder hast du schon gesehen, die haben geritten auf weißen Giraffen? Hm? Wir können den Weg unseres Lebens nicht immer wählen selbst, Kind. Und der Weg, der wurde gewählt für dich, ist kein leichter Weg. Vertraue auf deine Gabe. Deine Gabe wird dich beschützen.»
Die Wüstenluchse begannen, um ihr Futter zu kämpfen, und Martine musste in ihr Gehege, um sie voneinander zu trennen. Als sie sich umdrehte, war Grace nur noch ein rosa Punkt, der sich über den staubigen Weg entfernte. Sie hatte sich nicht einmal verabschiedet. Jetzt, als Martine ihr hinterherblickte, hob sie eine Hand und winkte, ohne sich umzudrehen.
Martine setzte sich wieder auf die Bank und starrte mit leerem Blick auf die Tiere im Asyl: die Wüstenluchse mit ihren spitzen Fellöhrchen, die Eule, Shaka, der kleine Elefant, und sein neuer Gefährte, ein Zebrafohlen, das von seiner Mutter verstoßen worden war und jetzt von Tendai mit der Flasche aufgepäppelt wurde. Sie dachte an den Leoparden im Sand. Es war ein außergewöhnlich großer Leopard gewesen. Kauernd, wie zum Angriff bereit. Sie erinnerte sich immer noch an seine Klauen und wie er die Zähne gefletscht hatte.
Die Wüstenluchse begannen, in ihrem Käfig hin und her zu laufen. Sie mussten etwas gehört haben. Martine blickte auf. Vielleicht war Grace zurückgekommen. Doch es war Ben. Ein breites Grinsen zog sich über sein Gesicht.
«Ich habe mit meinen Eltern gesprochen», sagte er. «Ich darf mitkommen. Ich fahr mit nach Simbabwe.»