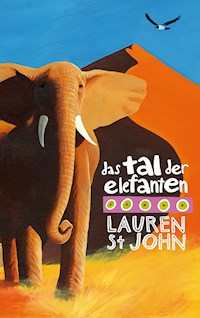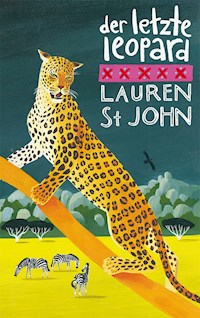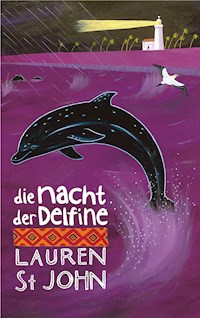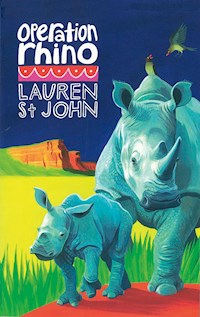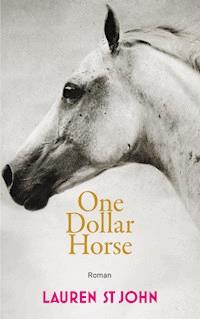
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Freies Geistesleben
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: One Dollar Horse
- Sprache: Deutsch
Casey Blue lebt in einem der schäbigsten Wohnblocks von London. Sie hilft als Pferdepflegerin in einer kleinen Reitschule aus. Aber sie hat einen Traum: das weltgrößte Turnier im Vielseitigkeitsreiten zu gewinnen. Als Casey ein fast verhungertes, halbwildes edles Pferd rettet, verspricht das Unwahrscheinliche wahr zu werden. Und Casey wird alles dazu tun! Aber sie hat nicht damit gerechnet, welche Folgen die Straftat ihres geliebten Vaters für sie haben kann. Und auch nicht damit, dem dunklen, schmelzenden Blick eines Jungen zu begegnen. Sie muss sich doch auf ihre Karriere konzentrieren! Ein atemberaubender Roman, der das Zeug zu einem Pferdebuch-Klassiker hat.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 382
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Lauren St John
ONE DOLLAR HORSE
Roman
Aus dem Englischen vonChristoph Renfer
Verlag Freies Geistesleben
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Epilog
DANKSAGUNG
Für Fiona Kennedy, meine Lektorin.Ihr Vertrauen und ihre Unterstützunghaben mein Leben verändert.
1
Casey blickte zwischen den Ohren ihres Pferdes hindurch auf das Hindernis – wie ein Scharfschütze, der sein Ziel ins Visier nimmt. Selbst aus der Entfernung sah es unüberwindbar groß aus: Mount Everest in Miniatur. Ein kunstvoll arrangierter Blumenschmuck sollte dem Hindernis das Kolossale nehmen, doch die bunten Blüten und grünen Sträucher konnten die Realität des meistgefürchteten Sprungs der Badminton Horse Trials nicht kaschieren. Jene Reiter, die hier mit ihren Pferden gestürzt waren, nannten das Hindernis die «Schreckenswand». Wenn Casey diesen Sprung schaffte, würde der Gesamtsieg der schwierigsten dreitägigen Vielseitigkeitsprüfung in greifbare Nähe rücken.
«Rhythmus und Gleichgewicht, Rhythmus und Gleichgewicht», sagte sich Casey. «Vertraue deinem Pferd, vertraue dir selbst.»
Je näher sie dem Hindernis kamen, desto größer wurde es, bis es schließlich als unbezwingbares Ungeheuer vor ihnen in den Himmel ragte.
«Los, mein Junge, du schaffst es», spornte Casey ihr Pferd an, während sie es mit Schenkeldruck und Sitz vorwärtstrieb.
Doch Patchwork wollte nicht mehr. Am heutigen Tag hatte er bereits ein Balg herumtragen müssen, das ihn ständig getreten hatte, eine Frau, die so groß und schwer war wie ein Doppeldeckerbus, und einen Jungen, der seine Polo Mints nicht mit ihm teilen wollte. Er hatte also keinerlei Absicht, dieses Monstrum vor ihm zu überspringen. Aus dem Augenwinkel legte er sich den direktesten Weg vom Parcours zu seinem Stall zurecht, wo das Abendessen auf ihn wartete. Dann preschte er mit einer leichten Richtungsänderung vor, jedoch nicht ohne den Schrotthaufen mit seiner Schulter im Vorbeigehen zu streifen. Das Getöse war Straßen weiter noch zu hören.
Vom Büro her drang die markerschütternde Stimme von Mrs Ridgeley herüber. Wie immer begann sie mit einem spitzen Schrei, der in einem regelrechten Donnergrollen endete: «Wer hat meine Blumentöpfe geklaut? Wo ist mein Lieblingsstuhl? Wo ...? Casey! CASEY BLUE! WENN DU MIR WIEDER DAS BÜRO AUSGERÄUMT HAST, NUR WEIL DU DIR EINBILDEST, DASS DU IN BADMINTON STARTEN KANNST, BRINGE ICH DICH UM!»
Die Hope Lane Riding School war allgemein als Hopeless Lane School bekannt. Der an der Hope Lane, einer mit Schlaglöchern gespickten Straße, gelegene Reiterhof mit seinem verrosteten Eingangsportal gab tatsächlich ein trostloses Bild ab. Er war eingeklemmt zwischen einer Industriebrache, randvoll mit giftigen Altlasten, und einer Reihe von Geschäften, die sich in verschiedenen Stadien des Verfalls befanden: ein chinesisches Take-away, ein Herrenfriseurladen und eine Autowaschstraße, die – so war Casey überzeugt – nur als Deckmantel für den Handel mit gestohlenen Fahrzeugen herhalten musste. Kein Wunder also, dass die Leute – zumindest außer Hörweite von Mrs Ridgeley – nur von der Hopeless Lane sprachen, wenn sie den Betrieb mit den zwölf Pferden und den drei Eseln meinten, der mit seinen einfachen Stallungen, dem schäbigen Hof und den kraftlosen Bäumen schlecht und recht der fortschreitenden Zubetonierung der Großstadt trotzte.
Kaum einen Kilometer entfernt lag der großartige Victoria Park, die grüne Lunge des Londoner Stadtviertels Hackney, das in den letzten Jahren von den jungen Kreativen entdeckt worden war. Hier nippten die Schönen in den angesagten Cafés an ihren Cappuccinos, shoppten nach abgefahrener Mode, hingen in Galerien mit weißen Wänden herum und deckten sich auf belebten Straßenmärkten mit Obst und Gemüse aus aller Welt ein. Doch in der Hopeless Lane Riding School waren das neue Geld und die Schickeria noch nicht angekommen, ebenso wenig wie an einem anderen Brennpunkt von Hackney, der berüchtigten Murder Mile, einer Straße, in der sich Gangster, Drogenhändler und jede Menge legaler und illegaler Einwanderer ein Stelldichein gaben.
Eine unsichtbare Mauer schien die zwei Welten voneinander zu trennen. Eine Schiebetür. Dann und wann öffnete sie sich einen Spalt weit, und Casey konnte einen Blick von der Sonnenseite des Lebens erhaschen. Doch noch bevor sie sich so richtig vorstellen konnte, wie es wohl wäre, wenn auch sie daran teilhaben könnte, schloss sich die Tür wieder wie der Tresor einer Bank, und Casey wurde klar, wo sie wirklich hingehörte: in ihre Mietwohnung, Redwing Tower 414, wo sie nur einen Steinwurf von der Murder Mile entfernt mit ihrem Vater lebte, in die Schule und in die Hopeless Lane Riding School mit ihren Pferden.
Doch für Casey war der Reiterhof alles andere als hoffnungslos. Auch wenn er von außen schäbig wirkte und der Dachfirst des Stallgebäudes durchhing, war er für viele ein Lichtblick in ihrem Leben und ein willkommenes Refugium. Mrs Penelope Ridgeley war eine Frau mit Führungsqualitäten und motivierender Ausstrahlung für den kunterbunten Haufen von Obdachlosen, Außenseitern, Benachteiligten und schwer Angeschlagenen, die von wohlmeinenden Hilfswerken herbeigefahren wurden. Manche waren auch aus purer Neugierde oder in einem Zustand der Vernebelung von selbst in den Reiterhof gestolpert. Nicht selten verließen sie ihn moralisch aufgerichtet und mit frischer Kraft für einen weiteren harten Tag in einem harten Leben. Dazu gehörte beispielsweise eine Frau, die hier eine Leidenschaft für den Reitsport entwickelt und es deshalb geschafft hatte, ihrer Karriere als Kleinkriminelle den Rücken zu kehren. Casey gegenüber hatte sie einmal gesagt, Mrs Ridgeley sei für sie die Schutzpatronin der gescheiterten Existenzen.
Für die bei ihr beschäftigten Reitlehrer – die stämmige, aber durchaus liebenswürdige Gillian, die schöne Hermione mit ihren langen schwarzen Zöpfen, die tagtäglich darauf zu warten schien, dass ihr jemand von hinten auf die Schulter klopfte, um ihr mitzuteilen, dass sie in Wirklichkeit eine Prinzessin sei, und den langweiligen, unsterblich in Hermione verliebten Andrew – war Mrs Ridgeley wie eine Mutter.
Für Casey und die anderen Helfer war sie halb Tyrann, halb Beistand.
«CASEY BLUE!», brüllte Mrs Ridgeley. «Wo versteckst du dich?»
«Brauchen Sie mich, Mrs Ridgeley?», fragte Casey unschuldig und trat mit einer Striegelbox in der Hand aus dem Schatten. Sie hatte eine andere Helferin gebeten, den gescheckten Tinker rasch in den Stall zu führen, während sie von der winterlichen Abenddämmerung profitierte, um Blumenkästen, Stuhl und Feldbett unbemerkt wieder in das Büro der Reiterhofbesitzerin zurückzuschaffen.
Mrs Ridgeley blickte finster zu ihr hoch. Die drahtige Frau mit ihrer ausgefransten gelbblonden Kurzhaarfrisur und der Haut eines runzeligen Pfirsichs reichte Casey kaum bis zur Brust. Doch was ihr an Statur fehlte, machte sie mit ihrer starken Persönlichkeit mehr als wett.
«Spiel mir jetzt bloß nicht die Unschuldige. Ich kenne deine Tricks, Casey. Ich habe dir oft genug gesagt, dass ich nichts dagegen habe, wenn du nach Feierabend, nachdem die anderen Reiter gegangen sind, Patchwork im Hofgelände Trab reitest. Von mir aus kannst du dich auch bis zur Erschöpfung verausgaben, nur um deinen Gaul über ein paar armselige Cavaletti zu hetzen. Aber ich verbiete dir, Mobiliar aus meinem Reiterhof dafür zu missbrauchen, deine lachhaften Fantasien auszuleben.»
Sie ging hinter Casey her in Patchworks Stall und verfolgte mit kritischem Blick, wie das Mädchen die Hufe des Pferdes sanft, aber gründlich reinigte. Ihre jüngste Helferin war mit ihren fünfzehneinhalb Jahren groß gewachsen für ihr Alter und hatte trotz ihres schmächtigen Körperbaus eine beinahe knabenhafte, kräftige Ausstrahlung. Doch ihr Gesicht, das im Kontrast zu dem struppigen dunklen Haar blass aussah, verriet den Stress des vergangenen Jahres. Auf den ersten Blick wirkte sie völlig unscheinbar. Tausend Menschen würden auf der Straße an ihr vorbeigehen, ohne von ihr Notiz zu nehmen. Erst auf den zweiten Blick sah man ihre intelligenten grauen Augen, die mit fast beunruhigender Intensität funkelten, und den blauen Ring um ihre Pupillen. Es war, als hätte die Natur sie mit einem strahlenden Himmelblau beschenken wollen und wäre dabei urplötzlich von einem dunklen Unwetter überrascht worden. Doch tiefrote Augenringe erzählten die schmerzhafte Geschichte von vielen schlaflosen Nächten. Nach allem, was Casey durchgemacht hatte, und bei einem Leben ohne Mutter und mit diesem Vater konnte das nicht weiter verwundern.
Mrs Ridgeley fuhr mit etwas freundlicherer Stimme fort: «Casey, du gehörst zu den begabtesten Helfern, die wir je in Hope Lane hatten, und falls du weiterhin so fleißig arbeitest und mir keinen Ärger machst, werde ich dir durch eine finanzielle Unterstützung die Ausbildung zur Hilfsreitlehrerin ermöglichen, wenn du im nächsten Sommer mit der Schule fertig bist. Du hast das Zeug zu einer guten Reitlehrerin. So eine wie dich könnten wir hier gebrauchen. Aber dieser Unsinn, diese Springerei über immer gewagtere Hindernisse, das muss aufhören, sonst ...»
«Sonst was?», fragte Casey ängstlich und richtete sich auf.
Mrs Ridgeley schürzte die Lippen. «Ach, lassen wir das. Patchwork muss gestriegelt werden, und ich muss den Laden abschließen. Vergiss nicht, das Licht zu löschen, wenn du gehst.»
Während Casey mit dem Striegel über das verblichene Schwarz und das schmutzige Weiß von Patchworks Fell fuhr, dachte sie über Mrs Ridgeleys Angebot nach. Sie wusste sehr wohl, dass es für sie so etwas wie das große Los war. Nur leider wollte sie dieses Los gar nicht. Auch wenn sie Patchwork gerne mochte, wusste sie doch ganz genau, dass sie ihre Zukunft nicht damit verbringen wollte, Pferde wie ihn zu reiten – sture, faule und hartmäulige Pferde, die sich nicht lenken ließen. Und sie hatte ebenso wenig Interesse daran, Stunden und Tage dafür aufzuwenden, Kindern und Eltern die Feinheiten der Durchlässigkeit und der Diagonalen einzutrichtern, wo diese im Reiterhof eigentlich nichts anderes suchten als ein bisschen Tapetenwechsel. Sie verfügte weder über die Führungseigenschaften einer Mrs Ridgeley noch über Gillians Begeisterung für den Reitunterricht oder Hermiones Vorliebe, sich von einem Dutzend pferdeverrückter Mädchen vergöttern zu lassen.
Casey träumte davon, mit einem feurigen Pferd über furchterregende Hindernisse zu springen, das Unmögliche möglich zu machen und gleich alle drei großen Wettbewerbe, den Grand Slam des Vielseitigkeitsreitens, zu gewinnen: die Badminton Horse Trials, den Kentucky Three Day Event und die Burghley Horse Trials.
Dafür brauchte sie Lkw-Ladungen voller Geld, Pferde mit glänzendem Fell und schillerndem Stammbaum, Sattelzeug, Kleidung, Stiefel – alles nur vom Feinsten natürlich – und die allerbesten Lehrer. Und dies bestätigte Mrs Ridgeleys Argument, dass sie ihre lachhaften Fantasien über Bord werfen sollte. Sie war beinahe sechzehn. Fast schon erwachsen. Sagten nicht ihre Lehrer immer, es sei höchste Zeit, sich die Pläne für eine realistische und machbare Berufslaufbahn zurechtzulegen? Leider war es nicht gerade Caseys Stärke, die in sie gesetzten Erwartungen zu erfüllen.
«Fünf Minuten bis Torschluss», rief ihr Gillian im Vorbeigehen über die Schulter zu.
«Gute Nacht.»
«Tschüss.»
Casey streckte Patchwork seine Gutenachtmöhre hin und gab ihm einen liebevollen Klaps auf sein granitfarbenes Hinterteil.
«Verdient hast du sie aber nicht», sagte sie ihm. «Mit einem klein bisschen Anstrengung hättest du dieses Hindernis aus dem Stand geschafft. Es sah vielleicht furchterregend aus, aber es war nicht einmal 50 Zentimeter hoch. Ein Vier-Sterne-Pferd, ein Badminton-Pferd, hätte so ein kleines Ding nicht einmal wahrgenommen. Aber ich muss gestehen, dass der Vergleich hinkt, denn diese Pferde haben bekanntlich Flügel.»
Der Schecke kaute ruhig auf seiner Möhre herum, ohne Caseys Abgang zur Kenntnis zu nehmen. Schon vor vielen Jahren hatten ihm die Reitschüler der Hopeless Lane den letzten Nerv geraubt, und jetzt benutzte er seine letzten Jahre im Reiterhof, um ihnen Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Wenn in seinem Stall eine Bombe explodierte, würde Patchwork nicht einmal mit der Wimper zucken.
Es war Freitagabend. Unweit der Hope Lane pulsierte das Nachtleben des Londoner East End mit einer Energie, die gleichzeitig berauschend und unheilvoll war. Exotische Sprachen und Musikfetzen – arabische Melodien, Bollywood-Schnulzen, afrikanische Rhythmen und Popsongs – waberten aus Hinterhöfen auf die Straße. Illegale Rauchschwaden drangen ebenso in Caseys Nase wie kulinarische Düfte aus aller Welt: Libanon, Korea, China, Karibik, Thailand, Griechenland, aber auch der Geruch von McDonalds und jede nur denkbare Variation von gebratenen Hähnchen.
Mit wässrigem Mund verfiel Casey in Laufschritt, um die Viertelstunde, die sie normalerweise für den Heimweg brauchte, zu verkürzen. Der kalte Januarwind biss sich in die winzige Hautpartie von Caseys Gesicht, die sie nicht mit der Kapuze ihres Sweatshirts bedeckt hatte. Auf den Eingangsstufen von Redwing Tower, dem hässlichen grauen Wohnblock, der ihr Zuhause war, saßen ein paar Jungs, rauften sich oder nippten an Getränkedosen. Casey wartete, bis sie das Feld geräumt hatten, bevor sie das Gebäude betrat. Wie ihr Vater zu sagen pflegte, war Redwing schlimmer als einige andere Sozialwohnungsbauten, aber viel weniger schlimm als eine ganze Menge anderer Siedlungen. Für Casey galt: Je weniger Leute sie in einer partywütigen Freitagnacht in ihrem Wohnblock antraf, desto besser.
Als sie im vierten Stockwerk angelangt war und im Flur auf Wohnung Nr. 414 zusteuerte, beschlich sie das Gefühl, beobachtet zu werden. Ihre Nackenhaare stellten sich auf. «Nur nicht umdrehen, nur nicht schauen, nicht schauen», sagte sie sich. Schauen war für Schwächlinge. Schauen war für Feiglinge.
Gerade als sie den Schlüssel in das Türschloss steckte, wurde das Gefühl stärker. Brüsk drehte sie sich um. Nur eine Gardine bewegte sich leicht. Ansonsten war nichts zu sehen. Nichts, niemand, kein Mensch.
Erleichtert seufzte Casey auf. Vor knapp vier Monaten war ihr Vater aus dem Gefängnis entlassen worden. Aber die unterschwellige Angst, die sie während seiner Abwesenheit wie ein Schatten verfolgt hatte, ließ sie nur langsam los. Sie blieb in der Dunkelheit stehen, bis sich ihr Herzschlag beruhigt hatte. Dann drehte sie den Schlüssel um und betrat die Wohnung.
2
«Hallo Pumpkin, du kommst gerade rechtzeitig, das Abendessen steht in zehn Minuten auf dem Tisch.»
Casey konnte sich ein Lächeln kaum verkneifen. Ihr Vater wusste beinahe auf die Minute genau, wann sie jeweils nach Hause kam. Dienstags, freitags und sonntags war sie bis kurz vor 18 Uhr auf dem Reiterhof. Der Samstag war weniger berechenbar, weil sie von 8 Uhr früh bis 13 Uhr im Tea Garden arbeitete und danach zu Mrs Smith ging, bei der es Kaffee und selbst gemachtes, meist ofenwarmes Schokolade-Shortbread gab.
Wenn Casey und Mrs Smith erst einmal ins Plaudern gerieten, vergingen die Stunden wie im Flug, und wenn sie schließlich nach Hause kam, war sie von den überbackenen Käsetoasts aus dem Tea Garden und den leckeren Keksen von Mrs Smith so satt, dass sie keinen Krümel mehr herunterkriegte.
Seit langer Zeit galt zwischen Vater und Tochter die Vereinbarung, dass der Samstagabend ganz Roland Blue und seinen Boys (keiner jünger als 50, wohlgemerkt) gehörte. Mit anderen Worten: Casey hatte die Wohnung für sich allein und konnte stundenlang auf dem Sofa herumliegen und sich im Fernsehen Pferdefilme wie Ein Pferd wird zur Legende und Der schwarze Hengst ansehen oder alte DVDs hervorkramen, bei denen es stets um das Vielseitigkeitsreiten mit seinen drei Disziplinen Dressur, Geländeritt und Springen und einen meist dünnen, sentimentalen Handlungsstrang ging.
Trotz dieses eingeschliffenen Wochenplans erklärte Roland Blue es jedes Mal als puren Zufall, dass sie genau zehn Minuten vor Essenszeit eintraf. Dabei sei er tagsüber derart beschäftigt gewesen, dass er es nur mit knapper Not geschafft habe, ein paar Zutaten in die Pfanne zu hauen. Casey wusste natürlich, dass die Sache in Wirklichkeit ganz anders aussah. Er verbrachte die Zeit meist damit, die Kleinanzeigen der Zeitungen zu durchforsten oder auf der Suche nach Arbeit durch die Straßen zu ziehen. Im Gefängnis war er zum Buchhalter ausgebildet worden, auch wenn er lauthals dagegen protestiert hatte, weil seiner Meinung nach niemand einem wegen Diebstahls verurteilten Ex-Häftling seine Buchhaltung anvertrauen würde. Und darin sollte er recht behalten.
In der Zwischenzeit hatte Roland Blue die Hoffnung auf eine Stelle als Buchhalter aufgegeben und war bereit, jeden Job – außer vielleicht als Straßenfeger oder Koch in einem fetttriefenden Schnellimbiss – anzunehmen. Trotzdem war er auch vier Monate nach seiner Entlassung noch arbeitslos. Schon mehrmals hatte man ihn beinahe eingestellt, doch wenn er dann mit seinem Strafregister herausrückte, war er plötzlich über- oder unterqualifiziert, zu erfahren oder zu unerfahren, zu alt, zu langsam, zu entspannt oder zu angespannt für die Stelle. Zweimal hatte man ihm gesagt, er sei zu geldgierig, nachdem er sich geweigert hatte, zu einem Hungerlohn überlange Arbeitszeit zu leisten.
Je länger dieser Zustand andauerte, desto verzweifelter wurde Roland. Sein Selbstvertrauen war papierdünn. Caseys Heimkehr war jeweils der Höhepunkt seines Tages. Die Freude stand ihm quer ins Gesicht geschrieben, auch wenn er sie herunterzuspielen versuchte. Diese Unfähigkeit, Gefühle zu verbergen, hatte sich bei Gericht nicht gerade zu seinen Gunsten ausgewirkt. Doch für Casey gehörte sie zu den vielen Seiten, die sie an ihrem Vater liebte.
«Sekunde, Dad, muss mir nur rasch die Hände waschen.»
Roland Blue war ein groß gewachsener Mann mit leicht gebückter Haltung. Am liebsten trug er ein ausgewaschenes Denim-Hemd und Jeans, in denen er wie ein Country-Sänger aussah, der auch schon bessere Zeiten gesehen hatte. Nun stand er am Küchentisch und schöpfte dampfende Nudeln mit einer sahnigen Soße in eine Schüssel. Auch wenn er nicht der weltbeste Koch war, so stand er doch gerne in der Küche und studierte Kochbücher, die er für wenig Geld in Antiquariaten und Weltläden zusammenkaufte. Jamie Oliver, Madhur Jaffrey, Gordon Ramsay – er mochte sie alle. Da das Geld bei der Familie Blue nicht gerade auf Bäumen wuchs, musste er auf viele der von den Promiköchen empfohlenen Zutaten verzichten, was sich zwischen Vater und Tochter längst zu einem Dauerscherz entwickelt hatte.
«Was gibt’s denn heute Abend zu essen?», fragte Casey jeweils.
«Gemüseauflauf nach Landhausart.»
«Ist alles dran?»
«Klar, mal abgesehen von den Möhren, Zucchini, dem Brokkoli und ... äh ... dem Landhaus. Bei den heutigen Immobilienpreisen kann man sich so was ja nicht mehr leisten.»
An den Currys der indischen Starköchin Madhur Jaffrey fehlten die Gewürze, auf den Torten von Delia Smith glänzte die Glasur durch Abwesenheit, und bei den Rezepten von Gordon Ramsay musste sich Roland Blue auf die wenigen Zutaten beschränken, die er sich leisten konnte.
Auch heute fragte Casey: «Was gibt’s denn zu essen, Dad?»
«Käsemakkaroni à la Jamie Oliver.»
«Ist alles dran?»
«Klar, abgesehen von Oregano, Mozzarella, Parmesan, Mascarpone und Fontina-Käse. Musste mich mit Nullachtfünfzehn-Cheddar-Käse begnügen. Aber ich habe ihn mit etwas Muskat aufgepeppt.»
Casey nahm einen Bissen und kostete. Die Nudeln schmeckten nach wenig bis gar nichts. «Schmeckt echt lecker, Dad.»
«Wirklich?», fragte Roland Blue vorsichtig nach. «War ein Kinderspiel. Hatte ich im Nu beisammen.» Mit einem Griff zur Pfeffermühle fragte er: «Und, wie war dein Tag?»
Casey zuckte die Schultern. «Schule wie immer. Patchwork wie immer. Mrs Ridgeley hat mir gesagt, ich solle mir die Vielseitigkeitsreiterei aus dem Kopf schlagen und mich auf etwas Machbares konzentrieren, zum Beispiel eine Ausbildung zur Hilfsreitlehrerin.»
Ihr Vater legte die Gabel auf den Tisch. «Und würde dich das glücklich machen?»
«Das ist bestimmt ein Super-Job, und die Reitlehrer von Hopeless Lane scheinen glücklich zu sein damit, abgesehen von Andrew natürlich, der sich eh nur für Hermione interessiert. Und klar, da könnte ich mit Pferden arbeiten, aber ...»
«Aber was?»
«Aber nichts. Mrs Ridgeley hat schon recht. Ich sollte meine blöden Fantasien vergessen. Aber ... ach Dad, du weißt, dass es nichts gibt, was ich lieber tun würde, als auf dem Rücken eines Pferdes wie von Flügeln getragen über verrückte Hindernisse zu springen und gegen die besten Reiter der Welt anzutreten. Aber das sind Wunschträume, die sich ein Mädchen wie ich nie wird erfüllen können.»
Der Gesichtsausdruck von Caseys Vater änderte sich. Er beugte sich vor und nahm ihre beiden Hände in seine großen, verwitterten Pranken. Seine atlantikblauen Augen bohrten sich in Caseys ernstem Blick fest.
«Ich möchte dich nie mehr so reden hören. Deine Mutter würde sich im Grab umdrehen. Für ein Mädchen wie dich ist alles möglich, selbst das Unmögliche. Vielleicht nicht morgen oder im nächsten Monat oder im nächsten oder übernächsten Jahr. Aber wenn es dir wirklich am Herzen liegt, wenn du hart arbeitest und wenn du daran glaubst, kannst du alles schaffen. Ich weiß es.»
Immer wenn ihr Vater so mit ihr sprach – und das geschah sehr oft –, fühlte sich Casey schuldig, weil sie bei sich dachte: «Aber wie steht es denn mit dir? Sind deine Wünsche, Träume und Hoffnungen nicht alle auf der Strecke geblieben?»
Doch sie verscheuchte diese Gedanken, so schnell sie nur konnte. Denn genau das waren die Worte von Erma Delaney, der Schwester ihres Vaters, die sich um sie gekümmert hatte, während ihr Vater im Südwesten Londons im Gefängnis saß. Acht Monate ihres Lebens, die Casey nie zurückbekommen würde. Sie wusste nur zu genau: Ohne Mrs Smith und die Pferde von der Hopeless Lane wäre sie verrückt geworden.
Erma war eine liebenswürdige Tyrannin, die die meiste Zeit damit verbrachte, hoch oben im schottischen Inverness ihrem bedauernswerten Ehemann Ed und ihren todlangweiligen Töchtern Chloe und Davinia mit ihrer Liebenswürdigkeit das Leben zu versauern. Als Roland verhaftet wurde, war Casey gerade erst 14 geworden, und Erma war schnurstracks nach London geflogen, um ihre Nichte den Fürsorgebehörden zu entreißen, die bereits auf der Matte standen und Caseys Schicksal in die Hand nehmen wollten.
«Du bist eine Träumerin, genau wie dein Vater», hatte Erma gesagt. «Du musst gar nicht lachen, denn es ist nicht lustig. Und ein Kompliment ist es auch nicht. Ganz im Gegenteil. Träume verleiten Menschen zu falschen Erwartungen. Das führt dazu, dass sie sich selbst zu wichtig nehmen und in Schwierigkeiten hineinschlittern. Auch deine Mutter war eine Träumerin, was ja kaum überrascht, war sie doch Amerikanerin. Das ist genetisch. Und daran ist nur Hollywood schuld. Den Amerikanern legt man das Hirngespinst in die Wiege, dass alles für alle möglich ist. Doch deine Mutter musste es am eigenen Leib erfahren. Sie hatte eben noch frei und ungebunden in New York gelebt und wollte Schriftstellerin werden, doch schwuppdiwupp hat sie sich in deinen Vater verguckt und landete arm wie eine Kirchenmaus in einer Sozialwohnung in Hackney, dem Ganovenviertel von London. Genau das passiert, wenn Träume überhandnehmen.»
Casey hatte diese Predigt so oft über sich ergehen lassen müssen, dass sie keine Energie mehr hatte, sich darüber zu ärgern oder ihrer Tante zu sagen, dass ihr Vater eine durchaus achtenswerte Stelle als Schulgärtner gehabt hatte, als ihre Mutter noch am Leben war. Sie sagte bloß in aller Seelenruhe: «Mama und Papa waren so ineinander verliebt, dass es ihnen egal war, wie und wo sie lebten, solange sie zusammen waren. Dad hat mir einmal genau erzählt, wie es war. Als sich ihre Blicke zum ersten Mal auf dem verschneiten Platz im Zentrum von Covent Garden trafen, wandte er sich zu seinem Freund und sagte: ‹Das ist die Frau, die ich heiraten werde.› Es war Liebe auf den ersten Blick. Voller Romantik eben.»
«Klar. Liebe macht Diebe», sagte Erma abschätzig. «Als ich deinen Onkel geheiratet habe, hatte ich kaum was übrig für ihn, und jetzt sind wir schon vierzig Jahre verheiratet.»
‹Dafür könnt ihr euch auch nicht mehr leiden›, sinnierte Casey still. ‹Das kann es ja auch nicht sein.›
«Und schon bist du wieder im Traumland», schalt sie Erma. «Wach auf, Mädchen. Komm auf den Teppich! Wart nur, bis du aus der Schule bist und vor dem Arbeitsamt Schlange stehst. Da kommst du ganz schön auf die Welt! Du brauchst gute Noten, gute Zeugnisse, DIPLOME. Wenn du nicht aufhörst zu träumen, landest du dort, wo dein Vater jetzt sitzt: hinter schwedischen Gardinen.»
Mal abgesehen von ein paar realitätsfremden, unmusikalischen Mädchen ihrer Klasse, die zu hundert Prozent überzeugt waren, eine TV-Talentshow zu gewinnen und über Nacht zum Superstar zu werden, waren ihr Vater und Angelica Smith die beiden einzigen Menschen, die nicht nur an den Wert ausgefallener Lebensziele glaubten, sondern sie auch tatkräftig dabei unterstützten, diese umzusetzen.
«Erde an Casey! Erde an Casey, bitte kommen.»
Casey fing an zu kichern, als sie merkte, dass sie mitten im Gespräch mit ihrem Vater in eine Traumwelt abgedriftet war. «Sorry, Dad. War ein langer Tag. Aber einverstanden. Ich werde an meine Träume glauben, wenigstens so lange, bis ich keine Wahl mehr habe und einen Nullachtfünfzehn-Job annehmen muss. Badminton, ich komme!» Sie stellte das Geschirr zusammen und legte es in der Spüle in Seifenwasser. «Aber du hast mir noch gar nicht von deinem Tag erzählt. Wie ist es dir ergangen?»
Ihr Vater strahlte sie an: «Ich habe gute Nachrichten. Ausnahmsweise richtig gute.»
Erst jetzt merkte Casey, dass er, seit sie die Wohnung betreten hatte, darauf brannte, ihr etwas zu erzählen. «Du hast einen Job gefunden?»
«Es ist noch nicht fest, aber es sieht gut aus. Ich habe demnächst ein Einstellungsgespräch als Schneiderlehrling. Zwar für einen Hungerlohn, aber mit großartigen Aussichten. Gute Schneider scheinen Mangelware zu sein. Wer weiß, vielleicht schaffe ich es bis in die goldene Schneidermeile von Savile Row. Stell dir vor, Casey, ich könnte dir Reitjacken für deine Turniere nähen, wenn du einmal berühmt bist.»
Casey begann, das Geschirr abzutrocknen, um die widersprüchlichen Gefühle zu verbergen, die sie bei solchen Gelegenheiten immer überfielen. Einerseits war die Begeisterung ihres Vaters so ansteckend, dass es fast unmöglich war, nicht von ihm mitgerissen zu werden. Andererseits meldete sich in ihr eine innere, fast elterliche Stimme, die ihn auf den Boden zurückholen und an frühere Misserfolge erinnern wollte. Doch er glaubte an sie, und deshalb wollte auch sie unbedingt an ihn glauben.
Sie drehte sich um und sagte lächelnd: «Das ist fantastisch, Dad. Du wirst ein Superschneider, und die Leute wären blöd, wenn sie dich nicht einstellen würden. Hast du erwähnt ...»
Sein Gesicht versteinerte sich. «... dass ich im Knast war? Nein, noch nicht. Werde ich aber nachholen. Casey ... äh ... ich wollte dich fragen, ob du mich zum Einstellungsgespräch begleiten würdest. Nicht in das Büro des Chefs, aber zumindest bis zum Geschäft. Das würde meinen Nerven guttun. Der Termin ist morgen um Viertel nach drei. Ich weiß zwar, dass dir deine Nachmittage mit Mrs Smith heilig sind, aber wenn alles gut läuft, wirst du dich nur um ein paar Minuten verspäten.»
Dabei schaute er sie so ernst an, dass Casey nicht anders konnte, als sich auf ihn zu stürzen und ihn zu umarmen. «Klar, ich bin dabei, Dad. Kein Problem. So was lass ich mir doch nicht entgehen.»
3
Es war Roland Blue, der den Dollarschein im Rinnstein entdeckte. Er war in der Hälfte geknickt, sodass nur In God We und ein Teil des Siegels der Vereinigten Staaten zu erkennen waren. Erst als er ihn entfaltet und Casey gegeben hatte, war der ganze Leitspruch In God We Trust und auf der anderen Seite das Porträt von George Washington, dem ersten Präsidenten der USA, zu sehen.
«Wer hat den wohl verloren?», wunderte sich Casey, während sie ihn mit der Hand abwischte. «Man findet nicht jeden Tag einen Dollarschein auf einer Nebenstraße von East London, schon gar nicht in einer finsteren Gasse. Hierher verirrt sich doch selten ein Tourist.»
«Das ist ein Zeichen», sagte ihr Vater. Er nahm ihr den Schein wieder aus der Hand, steckte ihn betont förmlich in seine Jackentasche und setzte seinen Gang über die Half Moon Lane mit den für ihn typischen ausholenden Schritten fort.
Casey zog gleich. «Was für ein Zeichen?»
«Ein Zeichen, dass deine Mutter heute bei uns ist, dass alles gut wird und ich den Job kriege.»
Hätte ein Unbeteiligter diese Worte mitbekommen, wäre er zumindest befremdet gewesen, nicht zuletzt, weil Roland Blue sie zu seiner Tochter gesprochen hatte. Aber Casey und ihr Vater hatten für sich die beruhigende Vorstellung entwickelt, dass Dorothy stets über sie wachte. Casey war zwei Jahre alt gewesen, als ihre Mutter zu einer einfachen Blinddarmoperation ins Krankenhaus ging und nie nach Hause zurückkehrte. Sie hatte unerwartet heftig auf das Betäubungsmittel reagiert und war noch auf dem Operationstisch verstorben.
Abgesehen von ein paar verblichenen Fotos einer lachenden Frau mit lockigem braunem Haar hatte Casey keine bildhaften Erinnerungen an ihre Mutter. Nur ein Gefühl war geblieben. Ein Gefühl von Geborgenheit, Nähe und Wärme. Vielleicht war das auch der Grund dafür, dass sie Dinge, die unerwartet in ihrem Alltag auftauchten, als Liebeszeichen der Mutter wahrnahm, die sie nie gekannt hatte, die aber immer bei ihr war: Blütenblätter einer Rose, der Lieblingsblume ihrer Mutter, auf einem viel begangenen Bürgersteig, eine hübsche Vogelfeder auf einem verrußten Fensterbrett oder den virtuosen Gesang eines Rotkehlchens an einem grauen Morgen.
Sie hatte also nichts dagegen, dass ihr Vater den aus dem Heimatland ihrer Mutter stammenden Dollarschein als gutes Omen auslegte. Sie war gerne bereit, auch daran zu glauben. Und knappe vierzig Minuten später hatte sich das Vorzeichen bestätigt, als Roland Blue aus dem Half Moon Tailor Shop gestürmt kam, Casey packte und sie herumwirbelte, bis ihr schwindelig war.
«Schon gut, schon gut, ich hab’s gecheckt» sagte sie lachend. «Du bist glücklich. Sie haben dich genommen.»
Hastig wischte ihr Vater eine Träne ab, die ihm über die Wange kullerte. Es war ihm peinlich. Seine großen Hände zitterten. «Uff! So nervös bin ich seit dem Heiratsantrag an deine Mutter nicht mehr gewesen. Das Schlimmste war, dass mir Mr Singh die Stelle angeboten hat, noch bevor ich ihm die Sache mit dem Gefängnis erzählen konnte. Ich fragte mich, ob ich den Mund halten sollte, in der Hoffnung, er würde nicht dahinterkommen. Doch das wäre ein schlechter Einstieg gewesen, und ich hätte ein schlechtes Gewissen gehabt. Ich druckste herum, bis ich schließlich Mut fasste und ihm davon erzählte. Und ich habe ihm nichts verschwiegen. Du kannst dir vorstellen, dass er ziemlich schockiert war. Er wurde immer blasser und sagte erst einmal gar nichts. Dann erzählte er mir, dass er als junger Mann selbst immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt geraten sei und dass er nicht der Mann wäre, der er heute ist, wenn man ihm damals nicht eine Chance gegeben hätte. Er dankte mir für meine Ehrlichkeit und sagte, ich könne den Job haben. Am Montag fange ich an.»
Casey war so stolz, dass sie beinahe in Tränen ausbrach. Es fühlte sich an wie ein Neuanfang. Eine zweite Chance.
Sie drückte ihm die Hand. «Herzlichen Glückwunsch, Superstar, ich bin ja so glücklich für dich. Darauf sollst du mit deinen Jungs einen trinken gehen heute Abend. Und jetzt ist es beinahe vier Uhr, ich muss zu Mrs Smith, sie erwartet mich zum Kaffee. Da vorne links ist ein Durchgang. Ich kenne da eine Abkürzung.
Und damit war es passiert. Damit waren sie am falschen Ort zur richtigen Zeit oder auch am richtigen Ort zur richtigen Zeit, je nachdem, wie man die Sache betrachtete. Später musste Casey immer wieder daran denken, dass die Chancen, genau zu diesem Zeitpunkt an genau dieser Stelle zu stehen, vielleicht 100 000 000 000 : 1 gegen sie betragen hatten. Wären sie ein paar Minuten früher dort gewesen oder hätte das Einstellungsgespräch bei Mr Singh länger gedauert, sie wären zu spät gewesen. Noch nach vielen Jahren ließ sie dieser Gedanke erschauern.
Es hing ein Geruch in der Luft, der eigentlich schon alles sagte. Man konnte sich ihm nicht entziehen. Eine unheilige Allianz aus Angst, Schweiß und Tod. Aber es war Samstagnachmittag, eine Zeit, in der die Straßen oft von den Gerüchen menschlicher Exzesse («Eau de Weekend», wie Roland Blue zu sagen pflegte) erfüllt waren, und die beiden waren derart in ihr Gespräch vertieft, dass sie ihre Umgebung ebenso wenig wahrnahmen wie die ersten Schneeflocken. Erst als sie einen schauderhaften Schrei hörten, blieben sie wie angewurzelt stehen.
«Was um Himmels willen war das denn?», stieß Roland Blue hervor. «Als wäre jemand abgestochen worden.»
Caseys ganzer Körper überzog sich mit Gänsehaut. Sie wusste sofort, was sie gehört hatte, aber sie wollte es nicht wahrhaben.
Wieder ertönte der Schrei, diesmal gefolgt von unverwechselbarem Hufgeklapper auf Beton und dem Geschrei von Männern. Etwas weiter vorne, auf der rechten Straßenseite krachte von innen etwas gegen ein hohes Holztor, das mit BJ Enterprises beschriftet war.
«Ich sehe besser mal nach», sagte ihr Vater. «Ich weiß nicht, was da drinnen los ist, aber es klingt nicht gut. Case, du wartest hier auf mich.»
«Auf keinen Fall bleibe ich hier draußen stehen», sagte Casey voller Empörung, doch bevor sie weiter protestieren konnte, ächzte das Tor erneut, um schließlich splitternd aufzubrechen. Aus dem Portal kam ihnen eine Erscheinung wie aus einem Albtraum entgegengeflogen: halb Pferd, halb Knochengerüst, das glanzlose graue Fell mit Blutflecken und schäumendem Schweiß übersät. Für einen kurzen Augenblick blieb das Ungeheuer stehen, als sei es überrascht, sich plötzlich in Freiheit zu befinden, dann schoss es, verfolgt von drei Männern mit hochroten Köpfen, die Straße hinunter direkt auf sie zu.
Während ihnen das Pferd entgegenpolterte, wunderte sich Casey, zur Salzsäule erstarrt, im Bruchteil einer Sekunde, dass sich ein derart ausgemergeltes Geschöpf überhaupt noch aufrecht halten konnte, doch es entging ihr auch nicht, dass ein furchterregender Hass aus seinen in tiefen Höhlen liegenden Augen sprach.
Tu was!
Zuerst merkte Casey gar nicht, dass sie diese Worte nicht nur gedacht, sondern laut ausgesprochen hatte. Aber natürlich machte niemand Anstalten, etwas zu unternehmen. Das Pferd donnerte jetzt so rasend schnell über den Straßenbelag, dass die Männer stehen blieben und nur noch hilflos die Arme hochwerfen konnten. Und ihr Vater war so perplex wie sie selbst.
Tu was, bevor es auf der Hauptstraße ist.
Als der Hengst schon beinahe an ihr vorbeigeschossen war, setzte Casey zum Sprung an, um den baumelnden Führstrick zu packen. Das Seil brannte auf ihrer Handfläche, doch sie warf sich mit aller Kraft und ihrem ganzen Gewicht nach hinten, sodass das Pferd schwankend und taumelnd zum Stehen kam. Sofort bäumte es sich wieder auf und riss Casey um. Hufe schossen vor ihren Augen vorbei. Auch wenn ihr urplötzlich bewusst wurde, dass das Pferd sie töten konnte, verspürte sie seltsamerweise keine Angst. Irgendwo, in weiter Ferne, rief ihr Vater ihren Namen. Alles tat ihr weh, der Strick, der ihre Handflächen aufscheuerte, ihr Körper, der immer wieder gegen seine knochige Flanke prallte, ihr linker Knöchel, der am Boden aufschlug. Doch sie ließ nicht los. Der Hengst wieherte noch einmal trotzig, doch dann fing er an zu schwächeln. Er wankte, er strauchelte, die letzte Kraft wich aus seinem Körper.
Jetzt wachte Casey aus ihrem Trancezustand auf. Nachdem sie ihr Gleichgewicht wiedergefunden hatte, packte sie das Tier sofort am Halfter. Es zuckte zusammen und blähte die Nüstern. Als Casey einen Augenblick lang dem Hengst direkt in die wilden Augen blickte, musste sie an das Zitat des unbekannten Autors denken, das gestickt und eingerahmt im Wohnzimmer von Mrs Smith hing:
... und er flüsterte dem Pferd zu: «Vertraue keinem Menschen, in dessen Auge du dich nicht als ebenbürtig reflektiert siehst.»
Eine ganze Welle von Gefühlen stürzte auf sie ein. In diesem Augenblick wusste sie, dass sie alles, wirklich alles unternehmen würde, um ihn zu beschützen.
«Ruhig, ganz ruhig, mein Junge», sagte sie mit sanfter Stimme. «Du bist in Sicherheit. Ich werde nicht zulassen, dass sie dir wehtun. Das verspreche ich dir.»
Jetzt kamen die Männer herbeigerannt und durchbrachen den Bann. Ihr Vater sagte: «Gut gemacht, Casey. Du bist eine Heldin. Das arme Tier. Es hatte eine solche Angst!»
«Von wegen Heldin!», unterbrach ihn der größte der drei Männer, ein Kahlkopf mit Wurstfingern und einem schmutzigen blauen Overall voller Blutflecken. Er stank nach gekochten Knochen, Tod und Desinfektionsmittel. «Eher eine Verrückte!»
Als er einen Schritt vortrat, scheute das Pferd und warf in Panik den Kopf zurück. «Danke, Kleines, gut gemacht. Das verfluchte Biest ist wahnsinnig geworden. Aber wir erledigen die Sache jetzt gleich.»
Casey hielt den Führstrick fest und baute sich vor dem Pferd auf. «Was geht hier vor?», wollte sie wissen. «Warum hat er so gewiehert? Was haben Sie ihm angetan?»
Nun mischte sich ein kleiner, untersetzter Mann mit einer Brandnarbe auf der Stirn und einem ähnlich schmutzigen Overall wie sein Kumpel prustend ein: «Er heult, weil er weiß, was ihm blüht. Ist doch immer dasselbe. Immer die klugen Tiere machen Probleme, stimmt’s, Dave? Die wissen, dass ihr letztes Stündchen geschlagen hat. Ist ja auch eine Abdeckerei hier, kein Pferdeheim. Er spürt, dass er liquidiert werden soll.»
«Liquidiert?» Casey bekam weiche Knie. Eine Abdeckerei? Sie hatte schon davon gehört, aber geglaubt, dass es sich dabei um ein Übel aus dem Mittelalter oder dem viktorianischen England handelte, etwas, das längst der Vergangenheit angehörte. Sie sagte: «Sie wollen ihn ...», und fuhr mit gesenkter Stimme fort: «Sie wollen ihn schlachten?»
«Ihn von seinen Qualen erlösen, trifft’s wohl besser», brüllte Dave, der langsam ungeduldig wurde. «Wir haben klare Anweisungen erhalten. Stimmt’s, Midge?»
Der Kleine kratzte sich den Stoppelbart am Kinn. «Sicher doch. Der Mann, der ihn gebracht hat, hat gesagt, sein Vater ist völlig vernarrt gewesen in die Mähre. Hat sie fast in den Bankrott getrieben. Kostet ein Vermögen, so ein Gaul.»
«Aber das Pferd ist ja völlig heruntergekommen und spindeldürr», warf Roland ein.
«Soll auch schon bessere Zeiten gesehen haben, hat mir der Sohn gesagt», antwortete Midge. «Hat mir eine ganze Story aufgetischt, dass sein Vater, dabei war, als dieses Pferd in einem Zirkus irgendwo in Litauen, der Ukraine oder sonst in so einem ehemaligen Sowjet-Dingens ausgerastet ist. Und da hat sich der Vater, selbst ein Ausländer, in den Kopf gesetzt, ihn zum besten Rennpferd der Welt zu machen. Er hat ihn nach England gebracht und ein ganzes Vermögen in das Training und die Betreuung des Tieres gesteckt. Außerhalb der Rennbahn ist er Spitzenzeiten gelaufen, hat mir der Sohn gesagt. Silver Cyclone haben sie ihn genannt, wegen seiner Farbe. Davon ist heute nicht mehr viel übrig. Der Gaul hat ein Fell wie ein Maulesel.»
«Quatsch mit Soße, wenn du mich fragst», bellte Dave ungeduldig. «Silver Cyclone, dass ich nicht lache. So ein Klepper gewinnt ja nicht mal ein Eierlaufen.»
«Und was geschah dann?», wollte Roland wissen. «Hat Silver Cyclone je ein Rennen gewonnen? Kaum zu glauben, so wie der jetzt aussieht.»
«Kein Einziges! Der Gaul war ein Blindgänger auf der Rennbahn. Schaffte es nicht einmal aus der Startbox heraus. Hatte Schiss vor seinem eigenen Schatten. Und so ging das jahrelang. Die Familie hat den Alten angefleht, das Pferd zu verkaufen, aber er war ein Fanatiker. Erst als ihm der Kuckuckskleber auf die Bude rückte, hatte er ein Einsehen. Also brachte er ihn zum Abdecker, um ihn zu Hundefutter verarbeiten zu lassen und so ein für allemal loszuwerden.»
«Und genau das werden wir tun, wenn ihr mit eurem Kaffeekränzchen fertig seid», sagte jetzt der Dritte, eine Bohnenstange mit kerzenblasser Haut. «Töten.»
«Genau», pflichtete ihm Dave bei. «Junges Fräulein, ich weiß, dass ist eine harte Sache, aber Sie müssen das Unumgängliche akzeptieren.»
«Nein!», schrie Casey.
Dave war gerade dabei, Casey den Führstrick zu entwinden, als sich der Lange von hinten dem Pferd näherte. Als Nächstes war ein scheußliches Knacken zu hören, das klang, als würde jemand einen Zweig entzweibrechen. Der Mann lag am Boden und krümmte sich vor Schmerz. «Er hat mir das Bein gebrochen», kreischte er mit weit geöffneten Augen. «Der irre Klepper hat mir doch tatsächlich das Bein gebrochen. Ruf eine Ambulanz, Midge, sofort!»
«Daran bist du schuld», blaffte Dave Midge an, der dabei war, auf seinem Handy den Notruf zu wählen. «Du mit deiner großen Klappe!»
Die Augen des Pferdes waren geweitet vor Panik und Wut. Es zitterte am ganzen Körper. Aus einer Wunde an seiner Flanke tropfte Blut auf den Schnee herab und färbte ihn rosa. Die Schneeflocken blieben in seiner zerzausten Mähne wie Konfetti hängen. Casey hatte Angst, dass der Hengst an Ort und Stelle an Unterkühlung und Schock sterben könnte.
«Geben Sie ihn mir», sagte sie. «Wenn Sie ihn mir geben, müssen Sie sich nicht mehr um ihn kümmern. Ich nehme ihn mit, und sie werden uns nie wiedersehen.»
«Casey!», rief nun ihr Vater voller Besorgnis. «Weißt du, was du da gerade gesagt hast? Was sollen wir mit dem Pferd? Es kann doch nicht bei uns in der Wohnung leben!»
Dave grinste höhnisch. «Du machst wohl einen Witz, Mädchen. Wo willst du hin mit dem Klappergestell? Willst du ihn im Victoria Park aussetzen? Hallo, willkommen in der Realität. Wir sind doch hier nicht im Kino!»
Midge kauerte sich auf den schneebedeckten Boden nieder und versicherte seinem Gefährten, dass die Ambulanz unterwegs sei. Die Jeans des Verletzten waren zerschlissen, und aus dem Riss ragte etwas Blutiges hervor, das wie ein Knochen aussah.
«Ich meine es ernst», beteuerte Casey. «Geben Sie ihn mir, und Sie sind ihn los. Damit ist ihr Problem gelöst.»
«Das geht nicht. Schon von Gesetzes wegen. Wenn kein Geld die Hand wechselt, ist so ein Handel nicht rechtskräftig. Ich könnte ihn dir verkaufen, aber schenken? Nein. Außerdem ist mein Tor kaputt und einer meiner besten Leute außer Gefecht. Wer soll das bezahlen?»
«Casey, ich bitte dich», flehte sie ihr Vater an. «Mir tut das Pferd genauso leid wie dir. Aber es muss doch eine Alternative geben. Lass uns nach Hause gehen und den Tierschutz anrufen.»
«Ich habe ein Sparschwein», wandte Casey ein. «Mit etwa fünfundfünfzig Pfund. Ich kann nach Hause laufen und bin in weniger als einer Stunde mit dem Geld wieder zurück.»
«Und was machen wir mit ihm in der Zwischenzeit?», fragte Dave. «Hier rumstehen, ein Liedchen pfeifen und zuschauen, wie er hier einen nach dem anderen k.o. schlägt? Nein, danke. Gib mir den Strick, und er ist in zehn Minuten tot. Das kann ich dir garantieren. Also los, her damit.»
Bevor sie reagieren konnte, hatte er ihr den Strick entrissen. Doch jetzt meldeten sich beim Pferd wieder die Lebensgeister. Der Hengst legte die Ohren an, sein Kopf schoss vor und sein Gebiss bohrte sich tief in Daves Arm. Das Blut spritzte nur so. Dave zielte mit seiner freien Faust auf den Nasenrücken des Tieres, doch Roland Blue kam ihm zuvor. Der ehemalige Preisboxer blockierte Daves Arm wie in einem Schraubstock.
«Stopp. Ich lasse nicht zu, dass in meiner Gegenwart ein Tier gequält wird. Wenn er Sie gebissen hat, dann haben Sie es mehr als verdient. Meine Tochter hat Ihnen ein Angebot gemacht, doch sie wollten es nicht annehmen. Was wollen Sie für das Pferd?»
«Wie viel steckt in Ihrer Brieftasche?», knurrte der Mann, während er an seiner blutenden Wunde saugte. «Geben Sie mir alles, was drin ist, wir unterschreiben den Kaufvertrag, und die Sache ist geritzt. Warum Sie sich so eine schreckliche Bestie anlachen wollen, verstehe ich nicht, aber das kann mir ja schnuppe sein.»
Roland Blue griff nach seiner Brieftasche, obwohl er ganz genau wusste, was drin war. Nichts. Bis Samstag hatte er normalerweise das kärgliche Arbeitslosengeld für Lebensmittel, Rechnungen und Unvorhergesehenes ausgegeben, und die verbleibenden 17 Pfund und 20 Pence für den Abend mit seinen Jungs lagen zu Hause auf der Kommode.
Beschämt sah er seine Tochter an, die völlig niedergeschlagen dastand. «Es tut mir leid, Casey, aber diese Woche ist fast alles für die Strom- und Gasrechnung draufgegangen.»
«Gut», sagte Midge und erhob sich von der Seite des am Boden liegenden Verletzten, der wie ein Welpe vor sich hin jaulte. «Game over. Das Pferd kommt mit.»
«Halt!», schrie Casey. «Der Dollar. Gib ihm den Dollar, Dad!»
«Ein US-Dollar?» Dave strich den Schein auf seiner Handfläche glatt. Als er ihn mit dem Zeigefinger antippte, hinterließ dieser auf George Washingtons Wange einen blutigen Abdruck. «Das hat mir gerade noch gefehlt. Sag mal, in was für einer Welt lebt ihr eigentlich? Was soll ich denn damit?»
«Das ist ein gesetzliches Zahlungsmittel», sagte Roland Blue. «Vielleicht nicht in England, aber es ist ein Geldwert, den ich Ihnen mit der Unterzeichnung des Kaufvertrages in Zahlung geben kann.»
Daves Blick wanderte von Roland Blue zu dem schlanken Mädchen, das ihn unter langen Wimpern hindurch mit einem durchdringenden Blick fixierte, als könne es in den Abgrund seiner Seele sehen. Er fühlte sich ähnlich unbehaglich wie vor zwei Stunden, als das Pferd angeliefert worden war. Es war über die Rampe aus dem Anhänger gesprungen und hatte die umstehenden Männer mit einem hasserfüllten Blick gemustert, der ihm einen eiskalten Schauer über den Rücken jagte. In all seinen Jahren als Abdecker hatte er nie etwas Vergleichbares erlebt. Natürlich wollte er es so rasch wie möglich loswerden, aber selbst sein verkümmertes Gewissen ließ ihn zögern, zwei nichtsahnenden Unschuldigen ein derart gefährliches Tier anzudrehen.
«Gut, ich gebe euch eine letzte Chance. Das Pferd gehört euch, wenn ihr es wollt. Aber ich rate euch, es euch gründlich zu überlegen, was ihr euch damit aufbürdet.»
«Das haben wir bereits getan, und unser Entschluss steht fest», gab Roland Blue zurück. Doch dann drehte er sich um und raunte seiner Tochter zu: «Casey, was machen wir bloß mit dem Pferd, wenn wir hier draußen sind? Wir sind so knapp bei Kasse. Wie sollen wir dazu noch ein Pferd ernähren?»
«Ich bringe ihn an die Hopeless Lane und überlege mir, wie die Sache weitergehen soll, wenn ich erst mal dort bin.»
«Aber was wird Mrs Ridgeley dazu sagen?»
«Das weiß ich nicht, und es ist mir auch egal», sagte Casey. «Das Wichtigste ist, dass wir ihn hier fortbringen und retten können. Er ist völlig traumatisiert.»
Draußen war schon das Einsatzhorn des Krankenwagens zu hören. Midge knurrte sie wieder an: «Wie wollt ihr ihn von hier wegschaffen? Im Abendverkehr? Na dann, viel Glück. Ich sehe schon die Schlagzeile: Zehntonner überrollt Mädchen und Pferd.»
Casey hob ihr Kinn. Der Gedanke, ein panisches Pferd am Samstagnachmittag durch den Stoßverkehr von East London zu führen, grenzte an ein Horrorszenario, aber sie wollte sich nicht anmerken lassen, dass sie Angst hatte, nicht einmal gegenüber ihrem Vater. «Wir schaffen das schon. Ich verbinde ihm die Augen mit meinem Sweatshirt, damit er nicht noch mehr Angst kriegt. Kein Problem.»
Dave blickte sie erstaunt an. «Gut, ihr habt es so gewollt. Und ich habe euch gewarnt. Zwei Irre kaufen ein durchgeknalltes Pferd, das nur noch Haut und Knochen ist. Wer soll da noch durchsteigen?»
4
Mrs Ridgeley warf einen einzigen Blick auf das Pferd und sagte: «Ich hoffe, du hast genügend Geld in deinem berühmten Sparschwein, Casey Blue. Ich hole jetzt nämlich gleich den Tierarzt, damit er das Pferd einschläfert, und die Rechnung, die bezahlst du.»