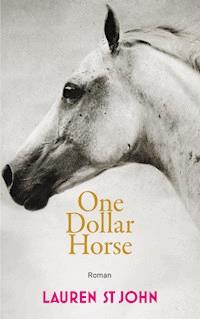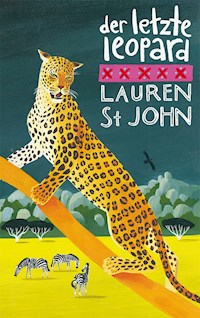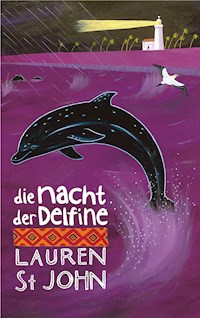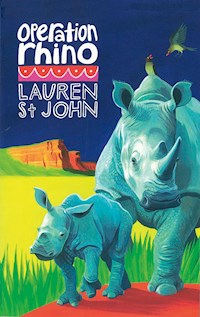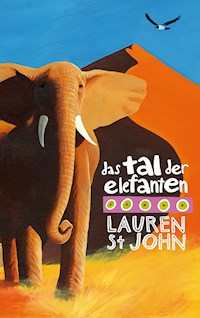
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Freies Geistesleben
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Ganze dreizehn Tage bleiben Martine und Ben, um die Hintergründe einer zweifelhaften Erbschaftsforderung aufzuklären – sonst ist die Wildtierfarm Sawubona für sie verloren. Das Gedächtnis eines Elefanten weist ihnen den Weg in die Wüste Namibias. Ein atemberaubendes Abenteuer, in dessen Mittelpunkt – wie immer bei Lauren St John – die Liebe zu den Tieren Afrikas steht. "Als ich >Das Tal der Elefanten< schrieb und mich monatelang mit dem Verhalten von Elefanten befasste, wurde mir klar, dass wir alles in unserer Macht Stehende unternehmen müssen, um diese wunderbaren Wesen mit ihren komplexen und liebevollen Gemeinschaften zu retten. Doch das schaffen wir nur, wenn wir sie – wie Martine – wirklich verstehen wollen." Lauren St John
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 288
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mit Illustrationen von David Dean
Aus dem Englischen vonChristoph Renfer
Verlag Freies Geistesleben
Für meine Nichte Alexandra Summer. Als Tochter meiner Schwester wird sie garantiert mit dem Wunsch aufwachsen, Elefanten zu retten!
• 1 •
Martine sah den Wagen zum ersten Mal, als sie sich hoch oben auf dem Plateau im Wildreservat Sawubona ein Lagerfeuerfrühstück schmecken ließ. Sie schenkte ihm jedoch keine weitere Beachtung, weil Tendai, der Zulu-Wildhüter, sie soeben mit einer lustigen Bemerkung zum Lachen gebracht hatte und weil sie gerade dabei war, herzhaft in eine leckere, rauchig-süß schmeckende Speck-Bananenrolle zu beißen. Abgesehen davon wendete der Wagen – eine schwarze Limousine mit getönten Scheiben – noch bevor er das in der Ferne gelegene Haus erreicht hatte, und fuhr davon, sodass sie zu dem Schluss kam, dass sich da jemand ganz einfach verfahren haben musste.
Erst als die schwarze Limousine am nächsten Morgen wieder auftauchte, während Martine mit der Fütterung der Asyltiere beschäftigt war, kam ihr wieder in den Sinn, dass sich der Wagen am Vortag seltsam wie in einem bedächtigen Trauerzug über die Ebene bewegt hatte. Diesmal musste sie ihn zur Kenntnis nehmen, denn er glitt langsam bis dicht an die Gehege der verletzten und verwaisten Tiere von Sawubona, als hätte er ein Recht dazu. Im Heck öffnete sich eine Tür, und ein groß gewachsener, kahlköpfiger Mann stieg aus. Er trug einen dunkelblauen Anzug und eine Armbanduhr, die aussah, als sei sie direkt aus einem Goldbarren gefertigt worden. Der Mann blickte um sich, als würde Sawubona ihm gehören.
«Kann ich Ihnen helfen?», fragte sie, eifrig bemüht, sich nicht anmerken zu lassen, wie verärgert sie darüber war, dass der Mann mit seinem Wagen die kranken Tiere verängstigt hatte. Sie war überzeugt, dass es ihm nicht im Traum einfallen würde, mit seiner Karosse in einem Krankenhaus für Menschen aufzukreuzen und die Patienten zu stören. Aber so war es nun einmal: Die wenigsten Menschen brachten Tieren denselben Respekt entgegen, den sie für ihresgleichen übrig hatten.
«Oh, ich habe, glaube ich, alles gesehen, was ich sehen wollte», antwortete der Mann. Doch er blieb einfach an Ort und Stelle stehen, ein selbstzufriedenes Lächeln auf den Lippen. Dann fischte er ein Feuerzeug und eine fette Zigarre aus seinem Anzug und begann, genüsslich vor sich hin zu paffen, als hätte er alle Zeit der Welt.
«Sonntags finden keine Safaris bei uns statt», sagte Martine. «Wir haben nur an Werktagen geöffnet, aber Sie müssen sich vorher anmelden.»
«Ich bin nicht zu einer Safari gekommen», sagte der Mann. «Ich suche Gwyn Thomas. Und wer bist du, wenn ich fragen darf?»
Mit Mühe unterdrückte Martine einen Seufzer. Sie musste drei heißhungrige Wüstenluchse füttern, die Wunde einer Antilope versorgen und war außerdem nicht in Gesprächslaune. Ganz abgesehen davon hatte ihr ihre Großmutter immer wieder gepredigt, nicht mit Fremden zu sprechen. Verhaltensmaßregeln für den Fall, dass ein Fremder anscheinend in offizieller Mission in Sawubona auftauchte und sie mit Fragen durchbohrte, hatte sie ihr allerdings nicht gegeben. Also sagte sie schließlich widerwillig: «Mein Name ist Martine Allen. Und wenn Sie meine Großmutter suchen, so finden Sie sie im Haus.»
«Allen?», fragte er nach. «Wie lange wohnst du denn schon hier, kleine Martine? Du sprichst nicht mit südafrikanischem Akzent. Woher kommst du?»
Martine fühlte sich immer unwohler in ihrer Haut. Sie hoffte, dass Tendai oder Ben, der neben der weißen Giraffe Jemmy ihr bester Freund war, auftauchen und sie aus dieser unangenehmen Situation befreien würden. Doch Tendai war zum Einkaufen nach Storm Crossing gefahren, und Ben war im Hafen von Kapstadt, um sich von seinen Eltern zu verabschieden, die sich zu einer Kreuzfahrt im Mittelmeer einschifften. Am liebsten hätte sie dem kahlköpfigen Mann gesagt, dass ihn weder ihr Name noch ihre Herkunft etwas angingen, aber sie wollte auch nicht unfreundlich zu ihm sein, vielleicht war er ja ein wichtiger Kunde.
«Ein Jahr», antwortete sie. «Ich bin jetzt seit einem knappen Jahr in Sawubona.» Sie hätte hinzufügen können: Seit meine Eltern letztes Silvester bei einem Brand unseres Hauses in England ums Leben gekommen sind. Doch das behielt sie für sich. Es war nicht ihre Art, persönliche Informationen über ihr Leben an neugierige Fremde weiterzugeben. Stattdessen fragte sie: «Werden Sie von meiner Großmutter erwartet? Ich kann Ihnen den Weg zum Haus zeigen.»
«Ein Jahr ist eine recht lange Zeit», sagte der Mann. «Lange genug, um einen Ort lieb zu gewinnen.»
Und dann sagte er etwas, das Martine erschaudern ließ: «Schade.»
Nur das. Ein einziges Wort: «Schade.»
Er sagte es in einer Weise, dass Martine den dringenden Wunsch verspürte, nach Hause zu gehen und eine Dusche zu nehmen, so sehr fühlte sie sich von ihm angeekelt. Dabei war er stets höflich geblieben und ihr auch nicht zu nahe gekommen. Sein einziges Vergehen bestand darin, das Tierasyl von Sawubona mit dem Rauch seiner Zigarre verpestet zu haben.
Doch bevor sie reagieren konnte, sagte der Mann energisch: «Gut. Ich denke, ich sollte jetzt mit deiner Großmutter reden. Aber mach dir keine Umstände. Ich kenne den Weg.»
Dann stieg er wieder in die schwarz glänzende Limousine und ließ sich davonchauffieren. Als er weg war, blieben nur der eklige Geruch seiner Zigarre und ein einziges, schweres Wort in der Luft hängen: «Schade.»
• 2 •
Als das Auto aus ihrem Blickfeld verschwunden war, überlegte Martine, ob sie nicht zu ihrer Großmutter eilen sollte, um sie vor dem unheimlichen Mann zu warnen. Doch sie hatte vergessen, nach seinem Namen zu fragen, und Gwyn Thomas ärgerte sich manchmal über Martines «Bauchgefühle». Und überhaupt: Wie sollte sie ihr Misstrauen begründen? Der Mann war elegant gekleidet, ließ sich in einem schicken Wagen durch die Gegend fahren und hatte sich nichts Schlimmeres zuschulden kommen lassen, als sie nach ihrem Namen zu fragen und zu bemerken, dass sie wohl kaum aus Südafrika stammte. Martine beschloss, im Zweifel für den Angeklagten zu entscheiden. Es wäre schließlich nicht das erste Mal gewesen, dass ihr Instinkt sie in die Irre geführt hätte.
Die Wüstenluchse waren so hungrig, dass sie an ihrem Gitterzaun herumkauten, und als sich Martine schließlich dem Gehege näherte, legten sie sich sprungbereit auf den Boden, um sich gleich auf das Fressen stürzen zu können. Sie waren als fauchende Kätzchen mit langen Pinselohren nach Sawubona gekommen und anfangs so klein und schwach gewesen, dass sie während der ersten Wochen auf Martines Bett schlafen mussten. Doch in der Zwischenzeit waren sie so kräftig geworden wie kleine muskelbepackte Löwen. Als Martine ihnen das Fleisch zuwarf, sprangen sie – wie von Düsenaggregaten angetrieben – fast drei Meter hoch in die Luft, schnappten sich ein Stück und verdrückten es bedrohlich knurrend in einem Mal. Bald schon würde man sie wieder in die freie Wildbahn entlassen können. Martine wusste jetzt schon, wie sehr sie sie vermissen würde.
Das Äffchen Ferris hockte auf ihrer Schulter, während sie die restlichen Tiere versorgte. Alle mussten sie gefüttert und getränkt werden, und die Dik Dik, eine zierliche Zwergantilope mit zwei kurzen, spitzen Hörnchen, brauchte einen neuen Wundverband. Das Tier blickte Martine vertrauensvoll an, während sie die Wunde mit einer Naturarznei pflegte, die ihr Tendais Tante Grace gegeben hatte. Grace war eine Sangoma, eine Medizinfrau und Heilerin. Sie war eine Zulu, doch ein Teil ihrer Familie stammte aus der Karibik. Sie war auch der einzige Mensch, der die Wahrheit über Martines geheime Gabe kannte – eine Gabe, die Martine die Kraft verlieh, Tiere zu heilen, und die nicht einmal sie selbst völlig verstand. Aus diesem und vielen anderen Gründen hatten sie eine ganz besondere Beziehung. Jetzt in den Schulferien hoffte Martine, Grace öfter sehen zu können als üblich.
Nachdem sie den protestierenden Ferris in seinen Käfig zurückgebracht hatte, lief sie zum Reservat, um Jemmy zu begrüßen. Die Eingangspforte lag ganz in der Nähe des Hauses. Als sie den Garten durch ein Seitentürchen betrat, sah sie die schwarze Limousine wieder. Wie ein Leichenwagen stand sie auf dem Fahrweg zum Haus. Der Fahrer rauchte, gegen die Motorhaube gelehnt, eine Zigarette. Er hob die Hand, als er Martine durch den Garten gehen sah. Sie winkte ohne große Begeisterung zurück.
Wie jeden Morgen erwartete Jemmy sie am Eingangstor zum Reservat. Sein weiß-silbernes und zimtfarben gesprenkeltes Fell schimmerte in der Sonne und hob sich vom eisvogelblauen Himmel ab. Martine ging es immer schlagartig gut, sobald sie Jemmy erblickte. Auch wenn sie sich jetzt schon seit zehn Monaten kannten und sie in dieser Zeit sogar gelernt hatte, auf ihm zu reiten, war sie jedes Mal aufs Neue aufgeregt, ihm gegenüberzustehen. Wenn sie ihn hinter den Ohren kraulte und auf seine seidenweiche, silberne Nase küsste, senkten sich seine langen, gebogenen Wimpern vor lauter Glückseligkeit und Freude.
«Noch drei Wochen Ferien, Jemmy», sagte sie. «Ich kann es kaum fassen. Drei wundervolle Wochen ohne Schularbeiten, ohne Mathematik, ohne Geschichte, ohne Mrs. Volkner, die mich rügt, weil ich zum Fenster hinausschaue, ohne Nachsitzen, ohne Schule. Punkt. Schluss. Und dann kommt auch noch Ben zu uns wohnen. Ich schwebe jetzt schon auf Wolke sieben. Wir werden jedes Mü von Sawubona erforschen, von frühmorgens bis spätabends die Sonne genießen, im See paddeln und vielleicht sogar zelten gehen.»
Jemmy stupste sie liebevoll mit der Nase an. Einen Moment lang war sie versucht, einen kleinen Ausritt mit ihm zu machen, doch dann erinnerte sie sich, dass Ben demnächst aus Kapstadt zurückkommen würde. Sicher hatte er eine Menge zu erzählen. Außerdem wollte sie ihm dabei helfen, sich im Gästezimmer häuslich einzurichten, wo er während der Weihnachtstage untergebracht sein würde, während seine indische Mutter und sein afrikanischer Vater auf Kreuzfahrt waren. Eigentlich hätte Ben mit dabei sein sollen, doch er wollte sich von Tendai zum Fährtenleser ausbilden lassen und verzichtete auf die Kreuzfahrt, um stattdessen seine Buschkenntnisse aufzufrischen.
Zusammen mit Martine freute er sich diesmal auf friedliche und lustige Ferien in Sawubona, nachdem die beiden letztes Mal ihre freie Zeit damit verbracht hatten, in der Wildnis von Simbabwe einen Leoparden vor bösen Jägern und einer wilden Bande von Schatzsuchern zu retten.
Martine war gerade dabei, das Tor zum Reservat zu schließen, als unvermittelt der Motor der schwarzen Limousine aufheulte. Der Wagen preschte mit hoher Geschwindigkeit über den Fahrweg und warf dabei fast einen Blumentopf um. Zu Martines Überraschung war ihre Großmutter weit und breit nicht zu sehen. Dabei war Höflichkeit für sie die höchste aller Tugenden. Sie begleitete Besucher immer bis zu ihrem Wagen und winkte ihnen hinterher, bis sie aus ihrem Blickfeld verschwunden waren. Ein ungutes Gefühl beschlich Martine.
Schnell lief sie durch die Mangobäume zum Haus. Da kam Tendai in seinem Jeep dahergerattert. Auf dem Beifahrersitz saß Ben. Als er Martine sah, glitt ein breites Grinsen über seine Züge, das die blendend weißen Zähne in seinem honigfarbenen Gesicht hell erstrahlen ließ.
«Tendai hat mich mitgenommen.» Er warf den Rucksack über eine Schulter und sprang vom verbeulten Fahrzeug herab. Er trug eine khakifarbene Weste, weite Tarnhosen und Wanderstiefel. «Die Leute, mit denen ich bis zur Hauptstraße fahren konnte, wollten mich nicht bis zum Haus bringen, weil sie Angst hatten, von Löwen aufgefressen zu werden.»
Normalerweise hätte Martine mit einer lustigen Bemerkung reagiert. Heute war es anders, denn das Haus kam ihr immer noch seltsam ruhig vor. Um diese Zeit saß ihre Großmutter normalerweise am Frühstückstisch, aß Toast mit Stachelbeermarmelade, trank Tee dazu und hörte die Nachrichten und den Wetterbericht im Radio. Außerdem hatte sie gesagt, sie wolle zu Bens Begrüßung Scones backen.
«Wo ist denn deine Großmutter, Kleine?», fragte der Wildhüter. «Ich habe versucht, sie über Festnetz und Mobiltelefon zu erreichen, um sie etwas wegen einer Lieferung zu fragen. Keine Antwort.»
Martine blickte ihm starr in die Augen. «Tendai, hier stimmt etwas nicht. Es ist so ein unheimlicher Mann aufgetaucht, der sie besuchen wollte. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Nein, ich weiß, dass irgendetwas faul ist.»
«Was für ein unheimlicher Mann?», fragte Ben und ließ den Rucksack auf den Rasen fallen.
Tendai legte die Stirn in Falten und sagte: «Meinst du den Mann in der schwarzen Limousine? Der hat uns fast von der Straße gefegt.»
Dann ging er schnellen Schrittes mit Martine und Ben im Schlepptau auf das Haus zu. Martine hätte sich ohrfeigen können, dass sie nicht darauf beharrt hatte, den Mann bis zum Haus zu begleiten. Was, wenn ihrer Großmutter etwas zugestoßen war?
Warrior, der schwarz-weiße Kater ihrer Großmutter, saß auf den Stufen vor der Eingangstür in der Sonne. Sein Schwanz peitschte wild hin und her, und seine Rückenhaare waren aufgestellt. Tendai machte einen Bogen um ihn und ging in das Wohnzimmer. «Mrs. Thomas?», rief er. «Mrs. Thomas, alles in Ordnung?»
«Großmutter», schrie Martine.
«Kein Grund, so zu schreien», tönte eine schwache Stimme durch den Flur. «Ich bin im Arbeitszimmer.»
Martine stürmte den Flur entlang und klopfte aus lauter Gewohnheit an die Tür des Arbeitszimmers. Gwyn Thomas saß zusammengekrümmt hinter ihrem Schreibtisch, und ihr Gesicht hatte etwa dieselbe Farbe wie das Bündel Dokumente, das sie in den Händen hielt. Als sie aufblickte, stellte Martine erschrocken fest, dass ihre blauen Augen rot unterlaufen waren, als hätte sie geweint.
«Kommt herein, Martine, Tendai», sagte sie. «Und du auch, Ben. Du gehörst zur Familie.»
«Dieser fiese, unheimliche Mann hat etwas getan, das dich so durcheinander gebracht hat. Ich wusste sofort, als ich ihn sah, dass er nichts Gutes im Schilde führte.»
«Martine, wie oft muss ich dir sagen, dass du nicht aus dem Bauch heraus über andere urteilen sollst», schimpfte Gwyn Thomas. Doch dann krampften sich ihre Hände um das Papierbündel, und sie fügte hinzu: «Nur ist es leider so, dass du in diesem Fall wahrscheinlich sogar recht hast.»
Sie hielt einen Moment inne und ließ ihre Augen sehnsüchtig aus dem Fenster schweifen, als wolle sie sich das Bild der am Wasserloch grasenden Springböcke und Zebras im Gedächtnis festschreiben. «Ich wünschte, ich müsste euch nicht erzählen, was ich euch jetzt zu erzählen habe.»
«Was immer es sein mag, es wird alles gut, Mrs. Thomas», versuchte Tendai sie zu beruhigen.
Martine war keineswegs davon überzeugt, dass alles gut würde. «Großmutter, du machst uns Angst. Was ist passiert? Wer war dieser Mann?»
«Sein Name ist Reuben James», sagte Gwyn Thomas schließlich und wandte sich ihren drei Zuhörern zu. «Er war ein Geschäftspartner meines verstorbenen Ehemanns. Ich erinnere mich dunkel daran, ihm einmal begegnet zu sein, und schon damals habe ich ihm nicht über den Weg getraut. Dabei ist das Geschäft, das er mit Henry abwickelte, eigentlich ganz gut abgelaufen. Mr. James hält sich meist in Namibia oder außerhalb Afrikas auf und behauptet nun, er habe erst vor Kurzem entdeckt, dass Henry vor zweieinhalb Jahren von Wilderern getötet worden ist. Und heute hat er mir dies hier gebracht.»
Sie hielt eines der Dokumente in die Höhe, in dessen Mitte geschrieben stand: LETZTER WILLE UND TESTAMENT VON HENRY PAUL THOMAS. Oben rechts prangte ein nach außen ausfransendes Wachssiegel, das wie ein Blutfleck aussah. Als sie näher trat, konnte Martine ein Firmensignet entziffern, auf dem Cutter & Bow, Rechtsanwälte, Hampshire, England stand.
Tendai war verwirrt. «Aber wie kommt er zu diesem persönlichen Dokument?»
«Gute Frage, und genau die habe ich ihm auch gestellt. Er sagte mir, dass Henry vor drei Jahren, als Sawubona in finanziellen Schwierigkeiten steckte, bei ihm einen großen Kredit aufgenommen habe. Er soll sich im Gegenzug bereit erklärt haben, sein Testament so abzuändern, dass das Reservat und alles, was dazugehört, im Falle einer Nichtrückzahlung des Darlehens bis zum 12. Dezember dieses Jahres – also heute – automatisch überschrieben würde an … Reuben James.»
«Oh, mein Gott», sagte Tendai und ließ sich in einen Stuhl fallen.
Martine stand wie versteinert da. Die Worte hatten zwischen ihrem Hirn und ihrem Herzen eine Lunte gelegt. Das Reservat und alles, was dazugehört … Das Reservat und alles, was dazugehört.
Ben sagte: «Bedeutet das nun, dass das ursprüngliche Testament, das Sie beim Tod von Mr. Thomas zur rechtmäßigen Besitzerin von Sawubona machte, null und nichtig ist?»
Gwyn Thomas nickte. «Ja, denn dieses Testament ist mindestens zehn Jahre älter als das Testament, das mir Mr. James heute unter die Nase hielt. Aber es kommt noch schlimmer …»
Martine schnappte nach Luft. «Noch schlimmer?»
«Ja leider. Es liegt ein Räumungsbefehl vor, der besagt, dass wir eine Frist von dreizehn Tagen haben, um Sawubona zu verlassen, dem Personal zu kündigen und uns von den Tieren zu verabschieden. In dreizehn Tagen gehört uns Sawubona nicht mehr.»
• 3 •
Martine dachte nicht oft an den Brand, bei dem ihre Eltern ums Leben gekommen waren – dieses Thema hatte sie zur Sperrzone in ihrem Kopf erklärt. Wenn sie es dennoch tat, schob sich stets eine ganz bestimmte Szene in den Vordergrund. Es war nicht der Moment, in dem sie in der rauchgeschwängerten Horrornacht zu ihrem elften Geburtstag aufgewacht war und realisiert hatte, dass ihr Elternhaus in Flammen stand und ihre Mutter und ihr Vater auf der anderen Seite einer brennenden Tür waren. Und es war auch nicht jener Moment, in dem sich ihr Zimmer in einen Glutofen verwandelt hatte, der Pyjama auf ihrem Rücken dahinschmolz, sie aus ihren Bettlaken einen Strick knüpfen und sich zwei Stockwerke hinunterhangeln musste, bevor sie schließlich in den kalten Schnee stürzte.
Nein, es ging um etwas, das erst nachher geschehen war: Als sie, nach Atem ringend, um die Hausecke stolperte, erblickte sie auf dem Rasen vor dem Haus eine ganze Menschenmenge. Und sie hörte die Schreckensrufe der Nachbarn, die sie längst als Brandopfer in den Flammen gewähnt hatten und sie jetzt plötzlich – nach ihren Eltern rufend – auf die schwelende Ruine zustürzen sahen. Ein Nachbar, Mr. Morrison, hatte es mit knapper Not geschafft, sie zurückzuhalten, und seine Frau hatte sie in die Arme genommen, wo sie schluchzend mit ihrem Schicksal haderte.
Martine erinnerte sich ganz genau, wie es ihr auf einen Schlag klar geworden war, dass sie ihre Eltern, mit denen sie noch vor wenigen Stunden ihren Geburtstag gefeiert und Pfannkuchen mit Schokoladen- und Mandelfüllung gegessen hatte, nie wieder sehen würde.
Das war der Augenblick, in dem ihr Leben offiziell zu Ende war. Der Augenblick, in dem sie alles, was ihr lieb gewesen war, verloren hatte.
Und nun geschah es wieder.
Am nächsten Morgen um 9 Uhr fuhren die Bulldozer in Sawubona auf. Wie eine Karawane gelber Raupen kamen sie dahergekrochen, bereit, alles aufzufressen, was sich ihnen in den Weg stellte. Sie blieben unmittelbar vor dem Tierasyl stehen und jagten mit ihren rasselnden Ketten und dröhnenden Motoren den kranken, verwaisten Tieren tausendmal mehr Angst und Schrecken ein als die Limousine von Reuben James am Tag zuvor.
Gwyn Thomas trat ihnen vor dem Haus mit einem grimmigen Gesichtsausdruck entgegen. Martine war erstaunt, dass die Fahrer nicht gleich kehrtmachten und das Weite suchten. Ihre Großmutter baute sich, die Arme in die Hüfte gestützt, vor dem ersten Bulldozer auf – wie ein Demonstrant vor einem Panzer.
«Was soll das? Sie dringen in mein Grundstück ein und erschrecken die ohnehin schon traumatisierten Tiere zu Tode», rief sie.
Der Vorarbeiter kletterte von seiner Maschine herab und sagte grinsend: «Wir führen nur Befehle aus, Madam.»
«Und diese Befehle führen Sie direkt ins Gefängnis, wenn Sie nicht sofort verschwinden. Wenn Sie mein Grundstück nicht in drei Minuten verlassen haben, rufe ich die Polizei!»
«Ich werde Sie bestimmt nicht daran hindern», sagte der Mann, während er ein Papier aus seinem Overall zog und auseinanderfaltete. «Das hier ist eine gerichtliche Verfügung, die uns die Erlaubnis gibt, die Arbeiten auf diesem Grundstück unverzüglich aufzunehmen. Wir wissen, dass Sie das Reservat erst in zwei Wochen verlassen werden, aber in der Zwischenzeit müssen wir mit den Vorarbeiten für den Safari-Park beginnen.»
«Von mir aus können Sie mit den Vorarbeiten für Schloss Windsor beginnen», fauchte Gwyn Thomas zurück. «Sie werden hier kein einziges Sandkorn bewegen …» Plötzlich hielt sie inne. «Entschuldigung. Habe ich richtig gehört? Womit wollen Sie beginnen?»
Der Mann überreichte ihr das Dokument. Gwyn Thomas setzte ihre Brille auf. Martine, die die Szene aus sicherer Entfernung beobachtete, sah wie sich die Schultern ihrer Großmutter verspannten.
Ihre Stimme wurde gefährlich ruhig. «The White Giraffe Safari Park», sagte sie. «Das also wollen sie hier bauen?»
Das Grinsen verschwand aus dem Gesicht des Mannes. «Ich denke schon. So jedenfalls steht es hier geschrieben.»
«Dann hören Sie mal gut zu», sagte Gwyn Thomas. «Sie können sich die ganzen Probleme sparen. Hier wird kein Safari-Park entstehen. Nicht mit einer weißen Giraffe. Auch nicht mit einem rosa Elefanten, einem schwarzen Nashorn oder was Ihnen sonst noch Abwegiges in den Sinn kommen mag. Nur über meine Leiche wird Mr. James Sawubona erben.»
«Nun beruhigen Sie sich mal, Madam», entgegnete ihr der Chef der Bulldozerfahrer. «Sie vergreifen sich im Ton. Wir tun hier nur unsere Arbeit.»
Gwyn Thomas gab ihm das Dokument mit gespielter Höflichkeit zurück. «Natürlich tun Sie nur Ihre Arbeit. Wie konnte ich das nur vergessen. Sie befolgen nur Befehle. In dem Fall wird es Sie ja wohl auch kaum stören, dass der Wildhüter meinen Befehl befolgt, dieses Tor offen zu lassen, damit die Löwen zwischen den Bulldozern herumspazieren können, während ich mich auf den Weg nach Storm Crossing zu meinem Anwalt mache. Hoffentlich haben die Tiere schon gefrühstückt. Sie lieben es nämlich, auf ihrem Morgenspaziergang einen frischen Happen Fleisch zu verspeisen …»
Martine hörte schon längst nicht mehr zu. Das Gefühl der Ohnmacht, das sie erfüllte, seit sie von Sawubonas bevorstehendem Schicksal erfahren hatte, war einer zügellosen Wut gewichen. Reuben James hatte Jemmy als Paradepferd für seinen grandiosen Plan auserkoren, das Wildreservat zu einem berühmten Zoo zu machen. Nicht genug, dass man ihr Jemmy, ihren Freund und Seelenverwandten, wegnehmen wollte. Nein, er sollte auch noch zum gefeierten Star der Reuben James Show werden.
Während sie auf den Fersen von Gwyn Thomas zum Haus zurückging, wiederholte sie still für sich: «Nur über meine Leiche, Mr. James.»
• 4 •
Drei Stunden später kam Gwyn Thomas aus Storm Crossing zurück – mit guten und schlechten Nachrichten.
«Die guten Nachrichten zuerst, bitte», sagte Martine, als sie ihrer Großmutter zusammen mit Ben in das Arbeitszimmer folgte. Sie machte ihrem Freund ein Zeichen, sich auf den freien Stuhl zu setzen, während sie sich auf einen Archivschrank hockte.
Gwyn Thomas hob ein offizielles Dokument in die Höhe. «Was immer es auch bringen mag, aber dies ist eine gerichtliche Verfügung, die Mr. James und seine Helfershelfer daran hindern wird, auch nur einen einzigen Mauerstein zu legen, bis zum Tag, an dem wir Sawubona offiziell verlassen müssen: Heiligabend. Nun aber zu den schlechten Nachrichten: Wir können sie nicht daran hindern, in der Zwischenzeit das Wildreservat zu betreten, so oft sie dies wünschen. Und sie dürfen so viele Architekten, Planer und Wildtierexperten wie nötig mitbringen, um die Übernahme des Reservats vorzubereiten.»
«Das ist eine unverschämte Frechheit», sagte Martine, die sich normalerweise nicht so drastisch ausdrückte, doch jetzt schien es ihr angebracht. «Wir können es nicht zulassen, dass dieser Fiesling hier seinen blöden Zoo plant und Leute nach Sawubona bringt, die unsere Tiere befummeln, während wir noch hier leben. Wenn er Jemmy auch nur mit einem Finger berührt, könnte ich mich zu einer Gewalttat hinreißen lassen. Ein kleiner Anschlag auf die Reifen seiner Blechkiste wäre noch das Harmloseste.»
«Martine!», rief Gwyn Thomas entrüstet. «Ich verbiete dir, wie eine Halbstarke zu reden. Es spielt keine Rolle, wie aufgebracht du bist. Ich verstehe ja, dass der Gedanke, Jemmy zu verlieren, dich in Rage bringt, aber das ist noch lange kein Grund, in diese Sprache zu verfallen.»
Sie stand auf und ging zum Fenster hinüber. «Was meinst du, wie ich mich fühle? Sawubona war mehr als die Hälfte meines Lebens lang meine Heimat, und hier hat auch deine Mutter gelebt, bevor du hierher gekommen bist. Sawubona war der Traum deines Großvaters, schon bevor ich ihn kennenlernte, und später wurde das Reservat unsere gemeinsame Vision. Und nun muss ich mit dem Gedanken fertig werden, dass der Mann, den ich geliebt habe, mich vielleicht hintergangen und diesen Traum an Mr. James überschrieben hat.»
Dann drehte sie sich um. «Aber weißt du, ich will es einfach nicht glauben. Dein Großvater war vielleicht nicht vollkommen, aber er war ein ehrenwerter Mann. Falls er Sawubona mit seiner Unterschrift tatsächlich an Mr. James abgetreten hat, so geschah es bestimmt mit den besten Absichten – vielleicht um mich zu schützen, damit ich nicht von unserer problematischen Finanzlage erfahren muss. Entweder das, oder jemand hat ihn unter falschem Vorwand dazu gedrängt, sein Testament abzuändern.
Doch das ist jetzt alles bedeutungslos. Ganz egal wie edel seine Absichten gewesen sein mögen, ich werde wegen seines Verhaltens mein Heim und mein Auskommen verlieren. Und das tut weh. Sehr weh sogar. Wenn kein Wunder geschieht, Martine, werden du und ich und die Katzen in zwei Wochen unsere Koffer packen und in eine Mietwohnung ziehen müssen.»
Martine versuchte, sich ihre Großmutter, die nichts so sehr liebte wie die Natur, in einer engen Stadtwohnung, weit weg von der Wildnis von Sawubona vorzustellen. Sie ärgerte sich über sich selbst, weil sie so egoistisch gewesen war. Der Gedanke, ihr Heim und fast alles, was sie gerne mochte, zwei Mal innerhalb eines Jahres verlieren zu müssen, hatte ihr so wehgetan, dass es ihr gar nicht in den Sinn gekommen war, wie viel schmerzhafter dasselbe Ereignis für ihre Großmutter sein musste.
«Wir dürfen nicht einfach kapitulieren», sagte sie. «Es muss einen Ausweg geben. Ein Richter muss doch verstehen, dass es vielen Tiere im Reservat ähnlich geht wie Jemmy. Sie sind Waisen oder haben ein schreckliches Leben hinter sich, sie brauchen unseren Schutz und unsere Liebe.»
Martines Großmutter verzog das Gesicht. «Wenn es um Grundeigentum geht, denken Richter leider meistens nur in Schwarz und Weiß. Ich hatte gehofft, dass sich die Unterschrift meines Mannes auf dem Testament als Fälschung herausstellen würde, aber der Handschriftenexperte meines Anwalts bestätigte ihre Echtheit.»
Es klopfte an der Tür. Es war Tendai. Mit einem traurigen Lächeln bat ihn Gwyn Thomas herein. Dann sagte sie: «Wir scheinen tatsächlich nichts tun zu können.»
Martine blickte zu Ben hinüber. Er machte das Gesicht, das er immer machte, wenn sie in einer kritischen Situation waren. Sie sah ihm an, dass er fieberhaft nach einer Lösung suchte.
Schließlich sagte er: «Und wenn es noch ein drittes Testament gibt, eines das neuer ist als das von Mr. James? Eines, das Sie als Erbin von Sawubona bezeichnet? Würde dann nicht alles anders aussehen?»
Nickend sagte Gwyn Thomas: «Sicher. Aber wenn es ein neueres Testament gäbe, hätte Henry mir davon erzählt, oder ich hätte es gefunden, als ich seine Unterlagen durchsuchte, nachdem er … gestorben war.»
Ein betretenes Schweigen erfüllte den Raum. Niemand wollte das Offensichtliche aussprechen. Doch allen war klar: Wenn Henry ihr nicht gesagt hatte, dass er Mr. James als Erben eingesetzt hatte, dann hatte er ihr vielleicht auch noch andere Dinge verschwiegen.
Martine dachte an den Großvater, dem sie nie begegnet war. Er hatte sterben müssen, weil er versucht hatte, die Eltern der weißen Giraffe vor Wilderern zu schützen. Zurück blieb ihre gebrochene Großmutter, die ihren zweiundvierzig Jahre jungen Ehemann verloren hatte. Martine sagte nochmals: «Wir dürfen nicht einfach kapitulieren. Wir müssen kämpfen.»
«Ich bin einverstanden mit dir», sagte ihre Großmutter. «Aber ich kann mir momentan nicht so richtig vorstellen, wie wir kämpfen sollen.»
«Wollen Sie, dass ich das Personal über das Schicksal von Sawubona informiere?», fragte der Wildhüter.
«Danke, Tendai. Ich würde es nicht übers Herz bringen. Deshalb wäre ich dir sehr dankbar, wenn du es übernehmen könntest.»
«Hat Mr. Thomas in den Wochen vor seinem Tod irgendetwas Ungewöhnliches gesagt?», fragte Ben. «Wirkte er manchmal besorgt oder aufgeregt?»
«Nein, ganz im Gegenteil», sagte Gwyn Thomas. «Er wirkte glücklicher als je zuvor. Er war begeistert über die Zukunft des Wildreservats und hatte jede Menge Projekte. Wenige Wochen vor seinem Tod reiste er sogar unerwartet zu einem Treffen nach England.»
Sie schlug mit der Handfläche auf den Tisch. «Ja klar, das ist es. Irgendetwas muss auf dieser Reise passiert sein. Ich weiß, dass er deine Eltern besuchen wollte, Martine. Aber ich kann mich beim besten Willen nicht an den geschäftlichen Zweck seiner Reise erinnern.»
«Wann genau ist er nach England gefahren?», fragte Martine. «Wie lautet das Datum des Testaments, das Mr. James dir vorgelegt hat? Vielleicht fällt es ja in den Zeitraum dieser Reise.»
«Ich weiß nur, dass er verreist ist, als hier Winter war, aber wann genau, das müsste ich in seinem alten Pass nachsehen. Der muss doch irgendwo hier sein.»
Sie öffnete die unterste Schublade rechts in ihrem Schreibtisch und holte eine Aktenmappe hervor. Da sie den Pass nicht fand, legte sie die Mappe wieder in die Schublade zurück. Beim Versuch, sie wieder zu schließen, schien die Schublade zu blockieren. Als sie es auch mit roher Kraft nicht schaffte, riss sie sie verärgert wieder auf und griff mit der Hand tief hinein. «Irgendetwas ist hier hinten eingeklemmt», sagte sie.
Schließlich zog sie ein Bündel mit zerknittertem und zerrissenem Papier und einen steifen blauen Umschlag mit ausgefransten Ecken hervor. Vorne auf dem Umschlag stand in dicker blauer Schrift: Gwyn.
Martine war drauf und dran, ihre Großmutter zu fragen, ob sie den Brief für sich alleine lesen wolle. Doch da hatte Gwyn den Umschlag schon mit dem Brieföffner aufgerissen und die darin steckende Notiz herausgeholt und gelesen. Sie reichte sie an Martine weiter.
Liebling
Ich hoffe, es wird nie so weit kommen, dass du diesen Schlüssel brauchst. Falls du ihn je brauchen wirst, bedeutet dies, dass ich nicht weit von der Wahrheit entfernt war. Du hast mich immer als mutigen Mann gesehen. Heute fühle ich mich alles andere als mutig. Ich hoffe, du findest in deinem Herz eine Stelle, die mir vergeben kann.
In ewiger Liebe
Dein Henry
Ein paar endlos lange Minuten sagte niemand ein Wort. Niemand wusste, was er sagen sollte. Es war, als habe Henry Thomas aus dem Grab gesprochen. Schließlich fasste sich Martine ein Herz und fragte: «Was ist das für ein Schlüssel?»
Gwyn Thomas zog ihn aus dem Umschlag und studierte die Visitenkarte, die mit einer Schnur am Schlüssel hing. «Sieht so aus wie ein Schlüssel zum Schließfach einer Bank in England.»
Sie ließ sich auf den Stuhl fallen und sagte seufzend «Was bedeutet das alles? Was muss ich ihm vergeben?»
«Vielleicht haben Sie recht», warf Ben ein. «Vielleicht ist auf Mr. Thomas’s Reise nach England etwas vorgefallen.»
«Vielleicht. Aber dieses Geheimnis, wenn es wirklich ein Geheimnis gibt, hat er mit ins Grab genommen.»
«Nicht unbedingt», gab Martine zu bedenken. «Wenn du nach England fährst, findest du die Antwort vielleicht in diesem Schließfach. Du könntest der Sache nachgehen und herausfinden, was mein Großvater in England damals unternommen und wen er getroffen hatte.»
Völlig entsetzt sagte Gwyn Thomas: «Ich kann doch nicht um die halbe Welt reisen und dich allein zu Hause lassen, schon gar nicht, wenn es hier mittlerweile von Fremden nur so wimmelt. Und ich lasse Tendai ganz bestimmt nicht hier die Suppe auslöffeln, die ich ihm eingebrockt habe. Wer weiß, welche üblen Machenschaften Mr. James in petto hat.»
«Martine wird nicht allein sein», entgegnete Ben. «Ich bin ja hier und kann sie beschützen.»
Trotz ihrer Sorgen schaffte es Gwyn Thomas, sich ein Lächeln abzuringen. «Und wer soll dich beschützen, mein lieber Ben Khumalo?»
«Wir können doch Grace anrufen und sie fragen, ob sie eine Woche oder zwei bei uns wohnen kann», warf Martine ein. «So sind Ben und ich nicht allein, und Tendai hat eine Erwachsene, die ihm zur Seite stehen kann. Ein Blick von Grace, und Reuben James sucht das Weite.»
«Grace ist in Kwazulu-Natal zu Besuch bei Verwandten», gab Gwyn Thomas zu bedenken.
«Ja, aber in zwei Tagen kommt sie zurück», sagte Tendai. «So lange kann Tobias, unser neuer Wachmann, nachts auf das Haus aufpassen.»
«Ich verstehe nicht, warum wir überhaupt darüber diskutieren», protestierte Gwyn Thomas. «Das Ganze ist doch ein aussichtsloses Unterfangen! Was soll ich Tausende von Kilometern fliegen und ausgerechnet jetzt, da wir es uns nicht leisten können, ein halbes Vermögen ausgeben, nur um zu entdecken, dass es nichts zu entdecken gibt, außer dass mein Mann die Notiz zu einem Zeitpunkt geschrieben hat, als er sich schuldig fühlte, weil er von Mr. James Geld geborgt hatte.»
«Dann weißt du wenigstens, woran du bist», entgegnete Martine. «Du weißt, dass es nichts zu finden gab und du alles Menschenmögliche unternommen hast, um Sawubona zu retten.»
Doch noch während sie sprach, beschlich sie neben der schon vorhandenen Wut und Ohnmacht ein beklemmendes Angstgefühl. «Vielleicht ist es doch keine so gute Idee», sagte sie kleinlaut. «Es ist zu weit weg, und du wirst uns fehlen.»
«Nein, ich glaube, du hattest schon recht, Martine», sagte Gwyn Thomas. «Ich muss nach England, sonst werde ich mir mein ganzes Leben lang Vorwürfe machen, es versäumt zu haben. Wenn das Schicksal von Sawubona auf dem Spiel steht, muss ich fahren.»
• 5 •
Am Tag nach Gwyn Thomas’ Abflug gab Sampson, ein älterer Wildhüter, um 6 Uhr früh per Funk durch, er sei während seines Patrouillengangs durch das Reservat auf einen Büffel gestoßen, der wegen einer Viruserkrankung sofort behandelt werden müsse. Ohne Medizin würde er verenden, meinte er.
Martine hörte von ihrem Zimmer aus das Knacken und Rauschen des Funkgeräts und ging rasch in die Küche hinunter, um herauszufinden, was los war. Ben saß frisch geduscht bei Kaffee und Toast mit Sardellenpaste am Frühstückstisch. Im Gegensatz zu Martine, die, ganz und gar kein Morgenmensch, in ihrem zerknitterten Schlafanzug und mit verwuscheltem Haar dastand und reichlich verschlafen dreinblickte, wirkte Ben so wach und munter, als könne ihn keine Herausforderung aus der Bahn werfen.
«Sampson hat an der Nordgrenze des Reservats einen verletzten Büffel aufgespürt», sagte er zu Martine. «Kommst du mit? Wir können deine Hilfe gebrauchen.»
Adrenalin schoss durch Martines Venen. Nichts weckte sie schneller als die Nachricht, dass ein Tier Hilfe brauchte. Trotz Bens Protesten nahm sie ein paar hastige Schlucke aus seiner Kaffeetasse und klaute ihm den letzten Toast vom Teller. «Ich bin gleich wieder da», sagte sie und stürmte die Treppe hoch, um den Überlebensbeutel zu holen, den sie immer mitnahm, wenn sie wegging – egal wohin –, stieg in ihre Jeans, streifte ein blaues Sweatshirt über und stürzte aus dem Haus.
Dabei hätte sie sich gar nicht beeilen müssen. Tendai und Ben warteten nicht ungeduldig auf sie, sondern steckten mit ihren Köpfen unter der Motorhaube des Jeeps und fachsimpelten über Dinge wie Zündkerzen und Einspritzpumpen.
«Diese alte Dame kurvt durch das Reservat, seit ich vor zwanzig Jahren bei deinem Großvater angefangen habe. Ich musste sie zwar immer wieder zusammenflicken, aber im Allgemeinen hat sie wirklich gute Dienste geleistet», sagte Tendai. «Gestern Abend war noch alles in bester Ordnung. Ich habe keine Ahnung, warum sie jetzt plötzlich streikt.»
Als sie gerade dabei waren, die Batterie zu testen, kam Reuben James in einem brandneuen Landrover mit offenem Verdeck forsch auf den Hof gefahren.
«Perfektes Timing», murmelte Ben vor sich hin.