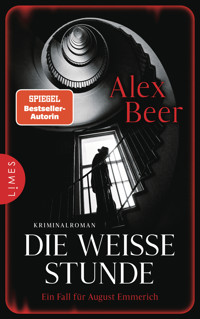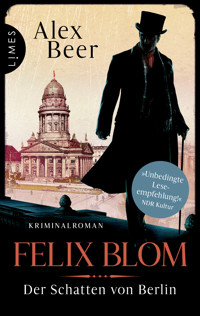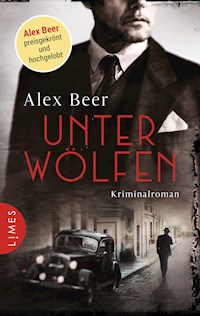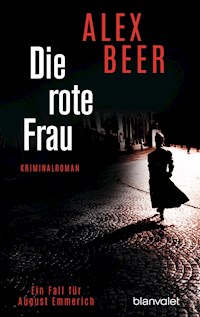9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Limes Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Kriminalinspektor-Emmerich-Reihe
- Sprache: Deutsch
Ein psychopathischer Mörder, ein getriebener Kommissar und der Beginn von Interpol – der fünfte Fall für August Emmerich!
Wien im September 1922: Die Inflation nimmt immer weiter Fahrt auf, die Lebenshaltungskosten steigen ins Unermessliche, und der Staatsbankrott steht kurz bevor. Unterdessen haben Kriminalinspektor August Emmerich und sein Assistent Ferdinand Winter es mit einem grausigen Fund zu tun: Auf dem Gelände des Wiener Hafens wurde in einem Tresor eine mumifizierte Leiche entdeckt. Und dabei bleibt es nicht, denn der Mörder tötet nach einem abscheulichen Muster, und er hat sein nächstes Opfer schon im Visier. Doch damit nicht genug: Ein alter Feind aus Emmerichs Vergangenheit taucht wieder auf – und er trachtet dem Ermittler nach dem Leben …
August Emmerich ermittelt:
Band 1: Der zweite Reiter
Band 2: Die rote Frau
Band 3: Der dunkle Bote
Band 4: Das schwarze Band
Band 5: Der letzte Tod
Alle Bände behandeln eigenständige Fälle und können unabhängig voneinander gelesen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 392
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Buch:
Wien im September 1922: Die Inflation nimmt immer weiter Fahrt auf, die Lebenshaltungskosten steigen ins Unermessliche, und der Staatsbankrott steht kurz bevor. Unterdessen haben Kriminalinspektor August Emmerich und sein Assistent Ferdinand Winter es mit einem grausigen Fund zu tun: Auf dem Gelände des Wiener Hafens wurde in einem Tresor eine mumifizierte Leiche entdeckt. Und dabei bleibt es nicht, denn der Mörder tötet nach einem abscheulichen Muster, und er hat sein nächstes Opfer schon im Visier. Doch damit nicht genug: Ein alter Feind aus Emmerichs Vergangenheit taucht wieder auf – und er trachtet dem Ermittler nach dem Leben …
Autorin:
Alex Beer, geboren in Bregenz, hat Archäologie studiert und lebt in Wien. Ihre spannende Krimireihe um den Ermittler August Emmerich ist preisgekrönt – neben zahlreichen Shortlist-Nominierungen (u. a. für den Friedrich-Glauser-Preis, Viktor Crime Award, Crime Cologne Award) erhielt sie den Leo-Perutz-Preis für Kriminalliteratur 2017 und 2019, den Krimi-Publikumspreis des Deutschen BuchhandelsMIMI2020 und den Fine Crime Award 2021. Alex Beer wurde außerdem der Österreichische Krimipreis 2019 verliehen. Neben dem Wiener Kriminalinspektor hat Alex Beer mit Isaak Rubinstein eine weitere faszinierende Figur erschaffen, die in der Reihe »Unter Wölfen« während des Zweiten Weltkriegs in Nürnberg ermittelt.
Mehr Informationen unter: www.alex-beer.com
Von Alex Beer bereits erschienen:
August Emmerich ermittelt:
Der zweite Reiter
Die rote Frau
Der dunkle Bote
Das schwarze Band
Der letzte Tod
Isaak Rubinstein ermittelt:
Unter Wölfen
Unter Wölfen – Der verborgene Feind
Alle Bände sind eigenständige Fälle und können unabhängig voneinander gelesen werden.
Besuchen Sie uns auch auf www.instagram.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag
ALEX BEER
DER LETZTE TOD
Ein Fall für
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2021 by Alex Beer
Dieses Werk wurde vermittelt durch die
Literaturagentur Kai Gathemann
© 2021 by Limes in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: René Stein
Covergestaltung: www.buerosued.de
Covermotiv: akg-images/Imagno
KW· Herstellung: sam
Satz und E-Book Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN: 978-3-641-28203-5V003
www.limes-verlag.de
»Aber die Ungeheuer werden nicht vom Himmel oder aus der Hölle in die frommen bürgerlichen Stuben geschickt.«
Joseph
Dezember 1890
»Auch im größten Grauen liegt manchmal ein Körnchen Glück verborgen. Du kannst es hier und heute wahrscheinlich noch nicht erkennen, aber das Schreckliche, das sich ereignet hat, war mit ziemlicher Sicherheit das Beste, das dir im Hinblick auf dein weiteres Leben passieren konnte.« Der Leutnant ließ sich neben ihm auf der Bettkante nieder und strich ihm mit seiner rauen Hand sanft über den Kopf. »Ob du es glaubst oder nicht – du bist ein glücklicher kleiner Junge.«
Er schluckte den Kloß hinunter, der sich in seinem Hals gebildet hatte, dachte kurz über die Worte seines Onkels nach und nickte dann. Es war ein ernsthaftes Nicken, langsam und bedacht. »Ja, das bin ich wohl.«
»Sei nicht traurig.« Der Leutnant lächelte, wobei die Falten, die die lederne Haut in seinem Gesicht zerfurchten, noch tiefer wurden.»Deine Mutter war nicht gemacht für diese Welt. Ihre Nerven waren zu schwach, genauso wie ihr Glaube und ihre Konstitution.« Das warme Licht der Kerze, die er in der Hand hielt, verlieh seinem Antlitz einen gütigen Ausdruck. Als er aufstand, verströmte er den für ihn so typischen Geruch: eine Mischung aus Seife, Pfeifentabak, Salbei und Kampfer. »Sie hat dich geliebt, aber sie konnte sich nicht richtig um dich kümmern. Ihr Herz war zu weich, ihre Seele zu zart. Sie hat sich die Pulsadern auch für dich aufgeschnitten. Sie hat ihr Blut vergossen, damit aus dir ein richtiger Mann werden kann. Verstehst du das?«
Erneut dachte er kurz nach und nickte anschließend. »Ich denke schon.«
»Guter Junge.« Der Leutnant beugte sich noch einmal zu ihm herab und tätschelte seine Wange. »Dann verrichte nun dein Gebet.«
Er faltete die Hände und haftete den Blick auf das schlichte hölzerne Kruzifix, das über dem Fußende des Bettes angebracht war. »Lieber Gott! Allmächtiger! Höre meine Bitte«, sprach er unter dem wachsamen Blick seines Vormunds. »Gerecht und gut, verständig und geschickt möchte ich werden. Meinem guten Onkel, dem ich so sehr zu danken habe, möchte ich Freude machen, denn er hat mir ein Bett gegeben, worin ich schlafen kann. Sonst müsste ich auf der harten Erde ruhen. Auch gab er mir zu essen und zu trinken, als ich durstig und hungrig war. Und all meine Verfehlungen korrigiert er zu meinem Besten. Er muss mich wohl recht lieb haben, denn es zwingt ihn niemand dazu. Aber ich vergesse zuweilen, was es heißt, anständig zu sein. Lass du, gütiger Gott, mich nicht älter werden, lass mich nicht länger leben, ohne täglich besser und klüger zu werden.« Mit dem Daumen zeichnete er sich ein Kreuzzeichen auf die Stirn, anschließend eines auf den Mund und die Brust. »Amen.«
»Amen«, wiederholte der Leutnant. Er versicherte sich, dass der Junge gut zugedeckt war, und ging zur Tür. »Dann geruh nun wohl, mein liebes Kind.«
»Sie auch, gnädiger Onkel.«
Der Leutnant trat hinaus auf den Flur und schloss die Tür hinter sich.
Dunkelheit und Stille erfüllten den Raum. Er schloss die Augen und lauschte dem Wind, der vor seinem Fenster dahinpfiff und eisigen Schneeregen gegen die Fensterscheibe peitschte. Er kuschelte sich in seine warme Daunendecke und schnupperte – von unten zog ein würziger Duft durch die Dielen. Sein Onkel kochte für morgen vor: Es würde Linseneintopf mit Debrecziner-Würsten geben, seine Leibspeise.»Was für ein glücklicher kleiner Junge ich doch bin«, murmelte er. »Was für ein glücklicher kleiner Junge.«
Freitag, 15. September 1922
1
»Warum bin ich nur immer so ein verdammter Pechvogel?« Alfons Speckl, der wegen seines üppigen roten Haarschopfs »Feuerspeck« genannt wurde, zog seine Schultern so hoch wie möglich und ging schneller. »Erst haben wir unsere letzte Marie beim Würfeln verloren, und jetzt zieht auch noch ein Sturm auf. Warum kann uns Fortuna, diese Dreckshur, nicht ein einziges Mal gewogen sein?« Schnaubend vor Wut streckte er seinen rechten Arm aus und drehte die Handfläche nach oben. Keine Sekunde später landete ein kalter Regentropfen auf seinen schwieligen Fingern, unter deren Nägeln sich der Dreck von Wochen eingenistet hatte. »Klatschnass werden wir werden, klatschnass, und dann holt uns der Quiqui.«
»Gevatter Tod? Nicht mal der will was mit uns zu tun haben. Also hör endlich auf zu jammern, du Waschweib«, knurrte sein Kumpan, ein gedrungener Ungar namens István, dem eine lange fettige Haarsträhne in die Stirn hing. Auf seinem Riesenschädel thronte eine Schieberkappe, die eher an einen Topfdeckel als an eine Kopfbekleidung erinnerte. »Lass uns zu den Lagerhallen unten am Stromhafen gehen«, schlug er vor. »Ich kenn eine, in die kommen wir hinein. Wenn du mir dein Ehrenwort gibst, das Maul zu halten und niemandem etwas davon zu erzählen, bist du mit von der Partie.«
»Die Lagerhallen?« Feuerspeck blieb stehen, hob den Kopf und blickte zu den Regenwolken, die über ihnen am schwach erleuchteten Nachthimmel vorbeizogen und deren dicke schwarze Bäuche zum Bersten voll waren. »Ich halt’s für eine dumme Idee. Mit den Kerlen von der Hafenaufsicht ist nicht gut Kirschen essen. Die prügeln Leute wie uns halb tot, wenn sie uns auf dem Gelände erwischen.«
»Totschlagen ist schnell erledigt. Wenn du dich aber erkältest und dir eine Lungenentzündung einfängst, wirst elendig verrecken. Außerdem sitzen die Wachleute bei diesem Wetter lieber in ihren Baracken und pfeifen sich beim Kartenspiel einen Sliwowitz nach dem anderen rein.«
»Ich weiß nicht …«, murmelte Feuerspeck kaum hörbar.
István zuckte zusammen, als ein schwerer Regentropfen ihm direkt in den Nacken fiel. »Tu doch, was du willst. Ich hau mich jedenfalls über die Häuser. Viszlát!« Er fasste sich an die Mütze, deutete eine Verneigung an und lief dann bis zum Ende des Feldwegs, wo die holprigen, verfahrenen Gleise der Donauuferbahn verliefen.
Feuerspeck trat nervös und unschlüssig auf der Stelle, wie ein Kind, das dringend aufs Klo musste. Als der Wind auffrischte und der Regen stärker wurde, folgte er seinem Zechbruder. »Von mir aus«, nuschelte er in seinen ungepflegten Zottelbart. »Bevor i aushuast.«
Gemeinsam eilten die zwei Landstreicher zwischen grauen Sandhügeln hindurch in Richtung Donau, an deren Ufer eine alte Eiche ihre knorrigen Äste in den Himmel reckte, begleitet vom Rauschen des Flusses und dem Knarzen der hier vertäuten Boote, die unruhig auf den Wellen schaukelten. Als aus der Ferne Donnergrollen erklang, legten die beiden einen Zahn zu, bis sich vor ihnen endlich die Umrisse von Kränen und Silos abzeichneten; dahinter ließen sich mehrere hölzerne Gebäude erahnen.
Feuerspeck sah sich nervös um. »Wohin?«, flüsterte er.
»Weiter nach hinten«, antwortete István knapp. »Dort, wo früher die Pester Lastschiffe angelandet sind.« Schneller als man es ihm mit seinen kurzen Beinen zugetraut hätte, rannte er an einem langgezogenen Schuppen vorbei, in dem die Zillen, die den Hafenarbeitern als Rettungsboote dienten, auf ihren Einsatz warteten.
Neben einem niedrigen Zaun hielt er kurz inne, fasste sich an die stechende Seite und blickte sich um. Als er glaubte, dass die Luft rein war, nahm er den Wettlauf gegen das nahende Unwetter wieder auf. Vor einem flachen Holzbau blieb er schließlich stehen, ging in die Hocke und ließ seine Finger über eine Stelle knapp über dem Boden gleiten.
Für den Bruchteil einer Sekunde erleuchtete ein Blitz die Szenerie und gab den Blick auf verdorrte Grasbüschel und morsche Bretter frei.
»Mach schnell!« In Feuerspecks Stimme lag Panik. »Bevor uns jemand sieht.«
Als ob er seinen Kumpan gar nicht gehört hätte, hielt István triumphierend eine Holzlatte in die Höhe und deutete auf einen circa dreißig Zentimeter breiten Spalt in der Außenwand der Lagerhalle.
»Da passt doch kein Schwein durch«, keuchte der völlig erschöpfte Feuerspeck, der froh war, nicht mehr rennen zu müssen, dem vermeintlichen Frieden aber nicht traute.
»Kein gut genährtes Schwein – da liegst du richtig. Elende Hungerleider wie wir beide aber schon«, sprach István und trat prompt den Beweis an, indem er sich wie ein Aal durch die Öffnung hindurchwand.
Nach kurzem Zögern tat Feuerspeck es ihm gleich. »Gerade noch rechtzeitig«, sagte er, als der Regen genau in der Sekunde, in der er hineingeschlüpft war, ein Trommelfeuer auf dem Dach veranstaltete. Er lachte und kramte seinen wertvollsten Besitz aus der zerbeulten Hosentasche: ein silbernes Sturmfeuerzeug der Marke Imco. Feuerspeck betätigte den Anzünder und sah sich um: Sie befanden sich in einem ungefähr zehn mal zehn Meter großen Lagerraum, in dem ein wildes Chaos aus kaputten Holzkisten, zerschlissenen Schiffstauen und zerbrochenen Tonkrügen herrschte. Von der Decke hingen löchrige Fischernetze, die von Spinnweben überzogen waren, der Boden war mit Rattenkot übersät.
»Ist zwar nicht das Sacher, aber dafür trocken und windgeschützt.« István zog seine zerlumpte, nach altem Schweiß und verfaultem Fleisch stinkende Uniformjacke aus und rollte sie zu einer Art Kopfkissen.
Feuerspeck ließ den Lichtschein über den schmutzigen, harten Boden wandern. »Man kann nur hoffen, dass die toten Kameraden drüben im Jenseits nicht sehen müssen, unter welchen Umständen wir armen Schweine heute dahinvegetieren – ohne Obdach, Arbeit und Sinn. Und dass sie den Niedergang unserer einst so glorreichen Nation nicht mitanschauen müssen, sonst wüssten sie nämlich, dass sie umsonst gefallen sind. Dass sie vergebens gelitten und ihr Blut vergossen haben.«
»Es ist, wie’s ist.« István ließ sich ächzend nieder, drehte sich mit erstaunlicher Seelenruhe eine Zigarette, zückte ein Streichholz und zündete es an der Oberfläche einer Kiste an.
Feuerspeck riss die Augen auf. »Was ist das? Da! Genau hinter dir.«
»Was denn?« István drehte sich um. »Ach das.« Er steckte die Zigarette an und schob sie, wie er es gerne tat, in die Lücke zwischen zwei braun verfärbten Zähnen. Er grinste dreckig und inhalierte den würzigen Rauch des schwarzen Tabaks. »Das Teil steht hier schon, seit ich denken kann.«
»Hast du schon mal probiert, ihn zu öffnen?« Feuerspeck trat vor den massiven, ungefähr einen Meter hohen Tresor, der frei im Raum stand. Beinahe zärtlich strich er über das runde Zahlenschloss, das an der Vorderseite des metallenen Schwergewichts angebracht war.
»Nicht nur einmal. Mit dem Teil habe ich mir schon viele Tage und Nächte um die Ohren geschlagen.« István paffte Rauchkringel in die Luft. »Die Finger hab ich mir daran wundgedreht. Aber Fortuna, die … wie hast du sie genannt?«
»Elende Dreckshur.«
»Fortuna, die elende Dreckshur, war mir nicht hold.«
Feuerspeck fummelte an der Drehscheibe herum, stellte wahllos, fast spielerisch, irgendwelche Nummern ein und betätigte den Griff. Die schwere Tür bewegte sich keinen Millimeter.
»Das kannst du dir sparen. Das ist ein echter Wertheim. Der ist absolut einbruchsicher.« István verschränkte die Arme hinter dem Kopf, legte sich nieder und schlug die Beine übereinander. »Ich hab’ mich erkundigt – natürlich ohne irgendwelche Details zu verraten. Dieses Modell hat vier Scheiben, damit sind 9 999 999 Kombinationen möglich.«
Feuerspeck versuchte sich dennoch an der nächsten Zahlenkonstellation. Leises, mechanisches Klicken war zu hören, gefolgt von einem enttäuschten Seufzer, als sich der Tresor erneut weigerte, sein Geheimnis preiszugeben.
»Ich hab’s mir ausgerechnet«, erzählte István weiter. »Wenn man davon ausgeht, dass jeder Versuch ungefähr eine Minute in Anspruch nimmt, dann kann man am Tag theoretisch eintausendeinhundertvierundvierzig Eingaben tätigen. Jetzt muss man aber natürlich schlafen, aufs Klo gehen und sich waschen. Und was noch wichtiger ist – man muss essen, trinken und hie und da mal eine rauchen. Und dafür braucht man Geld. Man muss also Kohle schnorren gehen. Kurzum: Man hat nicht vierundzwanzig Stunden Zeit, sondern nur zehn, wenn’s hochkommt, das heißt, es bleiben noch sechshundert Versuche. Hundert davon kann man getrost abziehen, weil die Hand auch mal Pause braucht, weil man vielleicht mal tanzen gehen will oder zocken oder mit einer schönen Frau pudern …«
»Das heißt, man kann ungefähr fünfhundertmal am Tag versuchen, die Kombination zu knacken.« Feuerspeck wagte einen weiteren Versuch, der, genau wie jene zuvor, nicht von Erfolg gekrönt war. »Wie viele Tage sind das bei den 9 999 999 Möglichkeiten?«
István lachte trocken.
»Mach es nicht so spannend.« Feuerspeck gab die nächste Kombination ein.
»Zwanzigtausend.«
»Zwanzigtausend«, wiederholte Feuerspeck und starrte auf seine Finger. »Ein Jahr hat dreihundertfünfundsechzig Tage«, murmelte er. »Das macht …«
»Das macht rund fünfundfünfzig Jahre – vorausgesetzt, man ist nie krank und wandert nicht hie und da mal in den Häfn oder das Krankenhaus. Wie alt bist du jetzt?«
»Sechsunddreißig.«
»Ich bin neunundvierzig. Als ich dieses Lager und den Panzerschrank vor ein paar Monaten entdeckt habe, war ich so begeistert davon, wie du jetzt. Ich wollte das Ding unbedingt öffnen, aber nach ein paar Tagen drehen und drücken und ziehen und fluchen habe ich beschlossen, meine Lebenszeit mit etwas Schönerem zu verbringen. Wahrscheinlich ist der Tresor sowieso leer, und selbst wenn Geld drinnen ist, dann ist es jetzt, dank der Inflation, so viel wert wie der tote Ratz dort drüben.« István zeigte auf einen Ratten-Kadaver, der nur wenige Meter von ihnen entfernt lag, und nahm einen letzten Zug von seiner Tschick. Die Glut fraß sich dabei durch das dünne Zigarettenpapier und versengte beinahe seine Fingerkuppen.
»Wahrscheinlich hast du recht.« Feuerspeck seufzte leise, drehte noch einmal an dem Rad und betätigte den Hebel. »Fortuna, die verdammte Drecks …«, murmelte er und riss die Augen auf, als der Tresor plötzlich ein leises Klacken von sich gab.
István fuhr hoch, stand auf und stellte sich neben seinen Kumpan. »Ich glaub’s nicht«, rief er und klopfte Feuerspeck auf die Schulter. »Ich glaub, ich träume!«
Vor lauter Aufregung zitterte Feuerspeck am ganzen Leib. Die Flamme seines Sturmfeuerzeugs malte wild tanzende Schatten an die Bretterwand. »Was wohl drinnen ist?«, überlegte er laut. »Gold? Edelsteine? Aktien?«
»Mach auf und find’s heraus«, forderte István.
»Ich?«
»Du hast die Kombination geknackt. Dir gebührt die Ehre.«
Feuerspeck nickte bedächtig und streckte die Hand aus.
»Halt.« István hielt ihn am Arm fest. »Du hast den Tresor geöffnet, aber ich hab dich überhaupt erst hierhergebracht. Egal, was drin ist, wir teilen es.«
»Jaja.« Feuerspeck startete einen zweiten Versuch, den Schatz endlich zu begutachten.
Erneut hielt István ihn davon ab. »Brüderlich«, sagte er mit eindrücklichem Tonfall. »Zu gleichen Teilen.«
»Ja sagte ich.« Feuerspeck wurde langsam ungeduldig. Er schob die Hand seines Kumpans von sich und umfasste den Tresorgriff. »Bereit?«
»Mach endlich.«
Feuerspeck atmete aus, zog mit einem feierlichen Gesichtsausdruck die Tür auf und leuchtete mit seinem Feuerzeug ins Innere des Stahlschranks.
»Szar«, fluchte István in seiner Muttersprache und wich erschrocken zurück, wobei er über eine morsche Kiste stolperte, die mit einem lauten Krachen unter seinem Gewicht zerbarst. »Was zur Hölle …?« Er bekreuzigte sich.
»Fortuna, du Dreckshur!« Feuerspeck rang nach Luft, hechtete zu dem Spalt, durch den sie die Lagerhalle betreten hatten, und kroch so schnell ins Freie, als hätte sich der Leibhaftige höchstpersönlich an seine Fersen geheftet. »Warum nur?«, keuchte er, während er völlig verstört durch den strömenden Regen taumelte. »Warum bin ich nur immer so ein verdammter Pechvogel?«
2
»Herr Inspektor!« Fräulein Grete, die Chefsekretärin der Abteilung Leib und Leben, winkte hinaus auf den Flur. »Inspektor Emmerich!«
Da der Angesprochene nicht reagierte, sprang sie auf, eilte aus dem Amtszimmer, in dem sie und der Rest der fleißigen Bienchen Akten ordneten, Telefonate tätigten und Briefe tippten. Mit wehendem Rock hastete sie an August Emmerich vorbei, drehte sich um und versperrte ihm, so gut es ihr mit ihren ein Meter fünfundfünfzig möglich war, den Weg. »So warten Sie doch!«
Anstatt sich über ihr Verhalten zu wundern, hielt Emmerich ihr eine Schachtel Zigaretten der Marke Azur so nah vors Gesicht, dass die Verpackung ihre Nasenspitze berührte. »Hundertzwanzig Kronen! Können Sie das glauben? Hundertzwanzig Kronen kosten die seit heute – und ich rede nicht von der ganzen Packung. Ich rede von einer Zigarett’n!« Er wirkte müde und ausgelaugt. Unter seinen Augen lagen dunkle Schatten, sein Anzug war zerknittert, Kinn und Wangen zierte ein stoppeliger, grau melierter Dreitagebart. Emmerich ging auf die vierzig zu, sah aber um einige Jahre älter aus. »Hundertzwanzig Kronen pro Stück. Wissen Sie, was die vor dem Krieg gekostet haben?« Ohne ihre Antwort abzuwarten, sprach er weiter. »Einen verdammten Heller.«
Fräulein Grete ignorierte sein Lamento bezüglich der Teuerung. »Oberinspektor Gonska …«, setzte sie in strengem Tonfall an, doch Emmerich humpelte einfach an ihr vorbei und hörte gar nicht hin.
»Hundertzwanzig Kronen«, murmelte er und kratzte sich dabei am Hinterkopf. »Hundertzwanzig Kronen pro Stück.«
»Oberinspektor Gonska möchte mit Ihnen …«, rief Fräulein Grete ihm nach, doch es war zu spät.
Emmerich hatte bereits sein Büro betreten und lautstark die Tür hinter sich ins Schloss fallen lassen.
»Guten Morgen, Chef.« Emmerichs Assistent, ein junger Mann namens Ferdinand Winter, war trotz der frühen Stunde bereits im Dienst. Wie immer wirkte er munter und war wie aus dem Ei gepellt – ein Kontrast, der Emmerichs desolate Konstitution noch stärker zur Geltung brachte. »Schauen Sie!« Mit einem strahlenden Lächeln präsentierte Winter eine Ausgabe des Neuen 8 Uhr Blattes. »Der Druckerstreik ist vorbei. Endlich gibt es wieder verlässliche Nachrichten.« Er fuhr sich mit der freien Hand über sein sauber geschnittenes und akkurat gescheiteltes blondes Haar. »Stellen Sie sich nur mal vor: Bundeskanzler Seipel hat das linke Donauufer doch nicht an die Tschechoslowakei abgetreten. Das Ganze war bloß ein dummes Gerücht, genauso wie das Attentat auf den König von Jugoslawien und der Besuch von Kaiserin Zita in Stein am Anger. In den vergangenen zehn Tagen ohne Zeitungen …«
»Vergiss den Jugo-König, den alten Seipel und die Kaisertrutschn«, unterbrach Emmerich ihn. Er reckte die Zigarettenpackung, die er noch immer in der Hand hielt, mit so viel Vehemenz in die Höhe, als würde es sich dabei um ein wichtiges Beweisstück handeln. »Hundertzwanzig Kronen hab ich vorhin dafür bezahlen müssen – und zwar pro Stück. Das muss man sich mal vorstellen. Pro Stück. Es ist schon wieder alles teurer geworden.«
»Sie müssen ja nicht immer so viel rauchen«, schlug Winter vor.
»Aber essen muss ich.« Emmerich setzte sich hinter seinen Schreibtisch und schnaubte. »Ein Kilo Schweineschmalz kostet dreiunddreißigtausend Kronen, Margarine achtunddreißigtausend – von Butter fang ich gar nicht erst an.«
Winter schlug die Zeitung zu und setzte an, etwas zu sagen, doch Emmerich war noch nicht fertig mit seiner Schimpftirade.
»Das ist – verglichen mit letztem Jahr – eine Preissteigerung von mehr als neunzig Prozent – und damals war schon alles verdammt teuer. Weißt du, was ein Ei kostet? Ein Ei kostet mittlerweile so viel wie vor dem Krieg ein Auto. Wenn die Regierung nicht schleunigst etwas unternimmt, dann wird man für einen Laib Brot bald Milliarden hinblättern müssen.« Er legte die Beine auf den Schreibtisch und zündete sich eine der Hundertzwanzig-Kronen-Zigaretten an.
Winter legte die Zeitung beiseite und musterte seinen Vorgesetzten. »Wenn Sie weiterhin so wenig schlafen und so viel rauchen, ist teures Brot bald Ihr kleinstes Problem.«
»Ach, Ferdinand, was weißt du schon von Problemen.« Emmerich nahm einen tiefen Zug und blickte durchs Fenster nach draußen. Am wolkenverhangenen Himmel schossen Schwalben wie Pfeile durch die kühle Herbstluft, die vom Geruch nach verbranntem Laub durchzogen wurde. »Du hast keine Kinder, keine Verpflichtungen und keine …« Seine Litanei wurde von einem energischen Klopfen unterbrochen.
»Ja bitte?«, rief Winter, da Emmerich nicht reagierte.
Die Tür ging auf und Fräulein Grete erschien. Wie immer, wenn sie Winter sah, röteten sich ihre Wangen.
»Hundertzwanzig Kronen«, blaffte Emmerich ihr entgegen und blies Rauch aus. »Und zwar nicht pro Packung, sondern …«
»… pro Stück«, vervollständigte sie den Satz. »Sie erwähnten das bereits.« Sie sah sich um und seufzte. »Vielleicht ist es sowieso besser, Sie rauchen weniger.« Fräulein Grete stöckelte durch den Raum, öffnete das Fenster, stemmte die Hände in die schmalen Hüften und bedachte ihn mit einem strengen Blick. »Oberinspektor Gonska will mit Ihnen reden.« Um ihre Worte zu untermauern, zeigte sie nach draußen auf den Flur.
»Gonska?« Winter runzelte die Stirn. »Was will er denn?«
Fräulein Grete zuckte mit den Schultern. »Das hat er nicht gesagt. Er meinte nur …« Sie schaute zu Emmerich.
»Er meinte was?«
»Er meinte, dass es Ihnen nicht gefallen wird.« Sie seufzte noch einmal. »Bringen Sie es hinter sich, sonst …«
»Sonst was?«
»Sonst muss ich Sie alle fünf Minuten daran erinnern.« Sie deutete auf den Telefonapparat, der vor ihm auf dem Schreibtisch stand.
Noch bevor Emmerich Zeit hatte zu reagieren, schenkte Fräulein Grete Winter ein schüchternes Lächeln, huschte hinaus und schloss die Tür hinter sich.
Winter starrte seinen Vorgesetzten an und zog die rechte Augenbraue hoch. »Was haben Sie wieder angestellt?«
»Ich? Gar nichts.« Offenbar schien Emmerich von seinen Worten nicht hundertprozentig überzeugt zu sein. »Zumindest nichts, von dem ich wüsste.« Er massierte seine Nasenwurzel und grübelte. »Wahrscheinlich hat der Alte wieder mal etwas an meinem Aufzug zu bemängeln.«
»Zu Recht«, murmelte Winter.
Emmerich blickte an sich hinunter, strich über sein zerknittertes Hemd und rubbelte mit dem Daumen an einem ockerfarbenen Fleck undefinierbarer Herkunft herum, der auf seiner Krawatte prangte.
»Ich dachte, Fräulein Irina wohnt jetzt bei Ihnen und macht den Haushalt.«
Winter spielte auf Irina Novotny an, eine junge Nackttänzerin, die bei einem Fall im vergangenen Jahr eine wichtige Zeugin gewesen war. Sie hatte unbedingt eine Unterkunft gebraucht, während Emmerich damals dringend ein Kindermädchen gesucht hatte, und so machten die beiden aus der Not eine Tugend und bildeten seither eine Art Zweckgemeinschaft.
»Schön wär’s.« Emmerich lachte auf. »Irina kümmert sich um die Kinder, im Haushalt rührt das Weibsstück aber keinen Finger. Sie sei emanzapiert, sagt sie.«
»Emanzipiert«, korrigierte Winter. »Das schreibt man mit i.«
»Von mir aus kann man das mit x schreiben.« Emmerich wedelte mit der Hand durch die Luft, als wolle er eine lästige Fliege verscheuchen.
»Die Frauen möchten …«
»Wenn’s nach mir geht, können die Weiber tun und lassen, was sie wollen. Sollen sie doch ruhig Bundespräsident und Pfarrer werden oder wonach auch immer ihnen der Sinn steht«, unterbrach Emmerich. »Mir völlig egal …« Er ließ seinen Blick wandern und starrte ins Nichts.
»Zurück zu Gonska.«
»Die Inflation galoppiert, die Leute hungern und darben, drüben in der Leopoldstadt ist wieder mal die Cholera ausgebrochen, und dieses Jahr stehen in der Kriminalstatistik bereits über dreißigtausend Verbrechen – dabei ist erst September.«
»Worauf wollen Sie hinaus?«
»Darauf, dass Gonska größere Sorgen haben sollte als meinen Aufzug.« Demonstrativ griff Emmerich zum Telefon, hob den Hörer ab und legte ihn neben den Apparat.
»Der Ärger wird davon nicht weggehen. Im Gegenteil.«
Emmerich entgegnete nichts. Obwohl die Zigarette nur noch wenige Millimeter lang war, nahm er einen tiefen Zug und zuckte kurz zusammen, als die Glut seine Fingerspitzen erreichte. Da der Aschenbecher überquoll, schnippte er den Zigarettenstummel kurzerhand zum offenen Fenster hinaus.
Winter sprang auf und sah nach draußen. »Unter uns ist ein Gehsteig«, schalt er seinen Vorgesetzten. »Irgendwann setzen Sie einen Hut oder ein Haarbüschel in Brand. Was, wenn Ihre Zigarette in einen Kinderwagen fällt?« Er schloss das Fenster. »Vielleicht will Gonska deswegen mit Ihnen reden.«
»Ach was«, wiegelte Emmerich ab und begann, einen Bleistift anzuspitzen. »Die Wiener haben einen Krieg hinter sich, eine Hungersnot und die Spanische Grippe. Von der Tuberkulose, dem Typhus, der Wohnungs- und Arbeitsnot ganz zu schweigen. Keiner wird sich wegen einem harmlosen Tschickstummel aufregen.«
Winter setzte sich wieder an seinen Platz. »Wollen Sie denn nicht herausfinden, was Gonska will?«
Emmerich seufzte und sah seinem Assistenten in die Augen. »Um ehrlich zu sein: Nein. Ich kann momentan wirklich keinen Ärger mehr gebrauchen. Davon habe ich daheim mehr als genug. Es ist wegen …«
»Wegen Ihres Vaters?«
»Erinnere mich nicht daran«, winkte Emmerich ab. »Es ist wegen …«
In dieser Sekunde klopfte es erneut an der Tür.
»Scheiße«, murmelte Emmerich und sah sich so hektisch um, als wollte er ein Mauseloch finden, in dem er verschwinden könnte. »Das ist entweder Fräulein Grete oder, noch schlimmer, der Alte höchstpersönlich.«
»Ja bitte?«, rief Winter.
Emmerichs verbissene Miene entspannte sich, als er sah, dass es sich bei dem Störenfried um Arnold Zech von der Spurensicherung handelte. »Arnold«, meinte er erleichtert. »Was gibt’s denn?«
»Eine Leiche«, erklärte Zech kurz und knapp. »Die Meldung kam gerade rein. Ich wollte sehen, ob ihr gleich mit an den Tatort kommen wollt.«
Emmerich lächelte und griff nach seinem Jackett. »Nichts lieber als das.«
»Wollen Sie nicht erst zu Gonska?«, warf Winter ein. »Wir können danach …«
»Die Leiche hat Vorrang.« Emmerich stand auf und massierte sein rechtes Bein. In der Schlacht von Vittorio Veneto hatte er sich einen Granatsplitter eingefangen und litt seither unter Arthrofibrose, einer schmerzhaften Versteifung des Kniegelenks. »Gehen wir.« Er humpelte in Richtung Treppenhaus.
»Aber …«, warf Winter ein.
»Haben sie dir denn auf der Polizeischule nichts beigebracht? Man muss einen Tatort möglichst zeitnah begehen. Je frischer die Spuren desto besser. Jede Minute zählt.« Beim Vorbeigehen warf Emmerich einen Blick ins Sekretariat. »Es gibt eine Leiche«, rief er Fräulein Grete zu, die gerade angeregt mit einem schmächtigen Mann sprach. »Richten Sie Gonska aus, dass er sich kurz gedulden muss. Sie wissen schon … Tatort, es pressiert …« Ohne ihre Reaktion abzuwarten, hastete er weiter.
»Warten Sie!«, schrie Fräulein Grete ihm nach. »Der Herr …«
Emmerich biss die Zähne zusammen, beschleunigte seinen Schritt und trieb auch Winter und Zech zur Eile an.
»Bleiben Sie stehen!« Fräulein Gretes Worte verhallten im weitläufigen Treppenhaus des Polizeigebäudes.
»Was wollte sie denn?«, fragte Zech, während sie durch das runde Vestibül gingen, das hinaus auf die Rossauer Lände führte.
Statt einer Antwort hielt Emmerich ihm die Zigarettenpackung vor die Nase. »Hundertzwanzig Kronen«, erklärte er. »Unfassbar, nicht wahr? Hundertzwanzig Kronen – und zwar pro Stück.«
3
Draußen fuhr mit lautem Rattern ein Bierwagen vorbei, dem Emmerich und Zech sehnsüchtig nachblickten.
»Scheißwetter«, murmelte Zech, als das Gefährt außer Sicht- und Hörweite war. Er zog den Kopf ein und stellte den Kragen seiner Jacke hoch.
Tatsächlich war die Witterung wenig erfreulich. Seit Tagen wurde Wien von Regen in allen möglichen Facetten heimgesucht – mal nieselte es, mal prasselte es bis zum Wolkenbruch. Und auch die vorherrschenden Temperaturen waren alles andere als behaglich. Die Sonne konnte sich am ständig bedeckten Himmel nicht behaupten, weswegen sich die spätsommerliche Luft in der vergangenen Woche empfindlich abgekühlt hatte.
»Wo ist Ihr Stock?« Winter schaute suchend umher.
»Daheim vergessen.« Emmerich humpelte in östlicher Richtung und stieß einen derben Fluch aus, als er versehentlich in eine Pfütze trat und Wasser in seinen Schuh schwappte. Von dem Gedanken an Fräulein Grete und Oberinspektor Gonska getrieben, eilte er weiter, wobei sein nasser Fuß ein schmatzendes Geräusch machte. Nach wenigen Metern bog er links in eine große Einfahrt, hinter der sich der weitläufigste von insgesamt vier Innenhöfen des Polizeigebäudes befand, der von den Mitarbeitern ›Großer Hof‹ genannt wurde. »Was für ein Elend«, murrte er und blickte auf den Fuhrpark des Polizeikorps.
Die Wagen waren allesamt blitzblank geputzt und standen akkurat in Reih und Glied geparkt, doch das konnte nicht darüber hinwegtäuschen, dass es sich bei der Fahrzeugflotte um ein armseliges Dutzend Automobile handelte, die aus Relikten der Armeeverwaltung stammten – in erster Linie Austro-Daimler, aber auch Wagen aus ehemaligen Beutebeständen.
»Von wegen den Stock vergessen. Wohl eher zu eitel, ihn zu benutzen«, murmelte Winter laut genug, dass es sein Vorgesetzter hören konnte. »Der Dienstarzt hat Sie ausdrücklich angewiesen, Ihr kaputtes Bein zu entlasten und eine Gehhilfe zu benutzen – und zwar auch …«
»Gehhilfe«, schimpfte Emmerich. »Wenn ich das Wort schon höre. Ich bin kein Greis, und außerdem haben wir ja jetzt endlich einen Dienstwagen.« Er humpelte zu einem zerbeulten Fiat Torpedo, an dessen Kotflügel Einschusslöcher zu sehen waren.
»… für die kurzen Wege«, sprach Winter seinen Satz zu Ende, während er sich hinters Steuer setzte. »Damit ist unter anderem die Strecke vom Büro bis zum Parkplatz gemeint.«
»Schon gut, Mutti«, ätzte Emmerich. Er ließ sich auf dem Beifahrersitz nieder, während Zech die Kurbel betätigte, die vorne am Wagen unter dem Kühlergrill angebracht war, um den Motor anzulassen.
Ein lautes Knattern ertönte, und das Gefährt begann heftig zu vibrieren.
Zech warf seinen Tatortkoffer auf die hintere Sitzbank und quetschte sich daneben. »Kein Wunder, dass unsere Verhaftungsquote so schlecht ist«, sagte er, während Winter langsam über den Hof in Richtung Ausfahrt tuckerte. »Während das kriminelle G’sindel in nagelneuen Steyr II oder Sascha-Porsche herumsaust, schleichen wir in einer erbeuteten Katzelmacher-Kiste durch die Gegend, die so beschädigt ist, dass selbst die Itaker sie nicht mehr zurückhaben wollten.«
»Die Automobile von Fiat sind generell gar nicht so schlecht«, erklärte Winter. »Im Grand Prix von Italien haben sie einen Sieg nach dem anderen abgeräumt.«
»Mit den neuen Modellen, den 501ern«, berichtigte Zech. »Ganz sicher nicht mit einem Schrotthaufen wie diesem.«
»Wie auch immer – wir sollten froh sein, dass wir überhaupt einen fahrbaren Untersatz zugeteilt bekommen haben«, sagte Winter. »Der Rest der Abteilung hat keinen erhalten. Inspektor Brühl soll deshalb so laut getobt haben, dass man es bis zum Schottenring gehört hat.« Er drehte sich zu Zech. »Wo geht es hin?«
»Zum Stromhafen«, wies Zech an. »Dort haben zwei Sandler eine Leiche gefunden. Offenbar ziemlich unschöne G’schicht. Professor Hirschkron von der Gerichtsmedizin ist auch schon informiert. Er muss sich noch um einen Kerl kümmern, der wegen der Inflation sein ganzes Erspartes verloren und sich drum ins Pendel g’schmissen hat, kommt dann aber gleich.« Er lehnte sich zurück. »Die armen Leut’«, murmelte er. »Verzweiflungstaten werden wir in nächster Zeit wieder viele sehen.«
Winter fuhr hinaus auf die Rossauer Lände und bog als Nächstes auf die Augartenbrücke, während Emmerich sich eine weitere seiner Hundertzwanzig-Kronen-Zigaretten anzündete und die Nase in den Fahrtwind hielt. »Stromhafen. Das klingt nach Wasserleiche?« Die Frage war an Zech gerichtet, trotzdem blickte Emmerich nicht nach hinten, sondern zu seinem Assistenten.
Winter stammte aus einem alten Wiener Adelsgeschlecht und hatte – im Gegensatz zu seinem Chef – eine behütete Kindheit und eine gute Schulbildung genossen. Während des Kriegs hatte er Dienst im K.u. k. Telegraphen-Korrespondenz-Bureau geschoben, wo er vom großen Siechen und Sterben der vergangenen Jahre relativ unbehelligt geblieben war. Deswegen war Winter noch immer recht unbedarft und zartbesaitet, wenn es um den Umgang mit Leichen ging – ganz besonders, wenn verfaultes Fleisch und schreckliche Verstümmelungen im Spiel waren.
»Ja, könnt’ eine Wasserleiche sein«, sagte Zech von hinten.
Von Winter kam keine Reaktion, anders als Emmerich erwartet hatte. Er wurde weder blass, noch rümpfte er die Nase oder kräuselte die Lippen. Stattdessen starrte er mit zusammengekniffenen Augen in den Rückspiegel.
»Da steht wohl ein scharfes Katzerl am Straßenrand«, scherzte Zech. »Wenn das unser Fräulein Grete erfährt.«
»Ich glaube, wir werden verfolgt.« Ohne den Blick vom Rückspiegel zu nehmen, bog Winter in die Schiffamtsgasse.
»Verfolgt?« Emmerich drehte sich um und spähte durch das Heckfenster. »Wer sollte uns verfolgen?«
»Ich weiß es nicht, aber der Fiaker hinter uns setzt uns nach. Seit wir den Donaukanal überquert haben, klebt er an uns dran. Sehen Sie, das Pferd rechts? Den Schimmel? Er ist mir aufgefallen, weil er aussieht, als hätte er Sommersprossen.« Winter beschleunigte, und tatsächlich – der Kutscher ließ die Zügel knallen und tat es ihnen gleich.
Emmerich streckte den Arm ins Freie und sah der Glut seiner Zigarette dabei zu, wie sie vom Fahrtwind davongetragen wurde. »Die Droschkenkutscher fühlen sich von Automobilen bedroht. Andauernd wollen sie beweisen, dass sie mindestens genauso schnell sind.« Er nickte Winter zu. »Gib Gas, Ferdinand.«
Zech lachte. »Wahrscheinlich ist es für den Kerl kein Problem, mit unserer Konservenbüchse mitzuhalten. Besonders da wir zu dritt herinnen sitzen, aber probieren sollten wir es auf jeden Fall. Los!« Er klopfte Winter von hinten auf die Schulter.
Winter zögerte kurz, drückte aber schließlich das Pedal bis zum Anschlag durch.
Die Karosserie des Fiats begann so stark zu vibrieren, dass die drei Insassen aufs Heftigste durchgerüttelt wurden, das Brummen des Motors schwoll zu einem Donnergrollen an, und das fragile Verdeck ruckelte so stark, dass es schien, als könne es jeden Augenblick davonsegeln. Fußgänger starrten dem Gefährt mit offenen Mündern nach, und ein Hund, der am Straßenrand nach etwas Essbarem suchte, zog erschrocken den Schwanz ein und rannte davon.
In der Kleinen Stadtgutgasse schafften sie es, den Abstand zur Kutsche zu vergrößern, um sie am Praterstern schließlich ganz abzuhängen.
»Ein Hoch auf den Fortschritt«, rief Zech, während Winter wieder langsamer wurde und in die Venediger Au bog.
Nach weiteren zehn Minuten Autofahrt erreichten sie endlich ihr Ziel: das flache Ufer der Donau, an dem sich der sogenannte Stromhafen befand. Dabei handelte es sich um einen schnurgeraden, rund zwölf Kilometer langen Anleger, der als Schnittstelle zwischen Frachtschiffen und der Donauuferbahn diente.
Dass der Fluss hier völlig schnörkellos, ohne Biegungen und Krümmungen verlief, war einer Stromregulierung in den Achtzehnsiebzigern geschuldet, die die immer wiederkehrenden Überschwemmungen beenden sollte. Hunderte Arbeiter aus Böhmen, Mähren, Schlesien, Galizien und Italien hatten die mühsame und gefährliche Tätigkeit für einen Hungerlohn verrichtet und meist nur von Hand mehrere Flussarme gekappt, Tonnen von Schutt, Sand und Erde bewegt und so ein neues Flussbett geschaffen, das vom Kaiserwasser bis nach Albern hinunterreichte.
Die Bezwingung des Stroms war ein Jahrhundertprojekt gewesen, und die dadurch belebte Dampfschifffahrt hatte lange als Stolz der Nation gegolten. Doch auch auf diesem Gebiet hatten der Krieg und seine Nachwehen ihren Tribut gefordert. Von der speziellen Atmosphäre des Flusshafens, einst ein schillernder, vibrierender Umschlagplatz, war nicht mehr viel zu spüren. Die baulichen Anlagen hatten, genauso wie die vor Anker liegenden Schiffe, schon bessere Zeiten gesehen.
Emmerich stieg aus dem Wagen und gab der Autotür mit seinem gesunden Bein einen Tritt. Das dünne Blech des Fiat fiel klackend ins Schloss. Er steckte sich eine Zigarette in den rechten Mundwinkel und zückte seine Streichhölzer. Der Wind pfiff streng, Nieselregen hatte eingesetzt, und es bedurfte einiger Geschicklichkeit, das Feuer in seiner zu einer Halbkugel geformten Hand am Brennen zu halten, bis die Zigarette angesteckt war. Schweigend blickte er auf das graublaue Wasser, das nach Osten strömte und irgendwann ins Schwarze Meer fließen würde. Unvermittelt musste er daran denken, dass Wien, vormals die Hauptstadt eines Weltreichs, seinen direkten Zugang zum Meer verloren hatte.
»Wo müssen wir hin?«
»Keine Ahnung«, erklärte Zech und sah sich um. »Stromhafen wurde mir am Telefon gesagt. Nicht mehr.«
»Na wunderbar.« Emmerich schaute erst ungehalten auf den unebenen Boden, in dessen Senken sich jede Menge Pfützen gebildet hatten, und anschließend auf sein Bein. »Spar dir einen Kommentar bezüglich Stock«, murrte er, als Winter den Mund aufmachte und schon wieder den Erzieher geben wollte. Er stellte den Kragen seines Mantels hoch, zog seinen breitkrempigen Filzhut ins Gesicht und humpelte los.
Über ausgetretene Wege passierten die drei Kriminalbeamten Gleise, Kräne, Güterschuppen, Kühl- und Gefrierhäuser. Die Anlage wurde hauptsächlich von der Donaudampfschifffahrtsgesellschaft genutzt, aber auch Reedereien aus anderen Donauanrainerstaaten betrieben hier vereinzelt Liegeplätze und Landevorrichtungen.
Trotz des nasskalten Wetters waren überall Hafenarbeiter zu sehen. Die sogenannten Anzahrer wuselten wie Ameisen auf dem Gelände umher und balancierten, schwer beladen mit Holzkisten und Jutesäcken, über halsbrecherisch schmale Planken, die von den Schiffen bis zu den Lagerhallen führten. Über ihnen schwebten kreischende Möwen, die wie bei einem Mobile vom Himmel hingen, während sie auf etwas Essbares lauerten.
Gerade als Winter versuchte, die Aufmerksamkeit eines Anzahrers zu erlangen, kam ein groß gewachsener Mann in schmutzigen Leinenhosen und einer blauen Jacke auf sie zugeeilt. »Sind Sie die Herren von der Kieber … ich mein, die Herren von der Polizei?«
Emmerich nickte und wischte sich einen Tabakbrösel von der Unterlippe. »Uns wurde gemeldet, dass hier eine Leiche gefunden wurde.«
Der Mann, der sich als Moritz Baum von der Hafenaufsicht vorstellte, nickte. »Zwei Sandler haben ihn …« Er machte eine kurze Pause und schluckte. »Ihn gefunden. Jetzt, da es in der Nacht wieder kühler wird, sucht das Gesindel vermehrt hier Unterschlupf. Wir tun alles, was wir können, um die Kerle von den Lagern und Schuppen fernzuhalten, aber hie und da schlüpfen uns welche durch.«
»Was genau ist passiert?«
»Die Penner sind in eines der leer stehenden Depots weiter stromabwärts eingebrochen. Dort haben sie den grausigen Fund gemacht. Einer der beiden ist wohl sofort abgehauen, obwohl es wie aus Kübeln geschüttet hat. Der andere ist geblieben und hat uns heute Morgen Bescheid gegeben, dass sich in der Lagerhalle der Firma Karl Michel & Co. ein Ghul befindet.«
»Ein was?«
»Ein Ghul«, wiederholte Baum. »Der Sandler, ein Kerl namens István, hat das Wort benutzt. Er behauptet, dass man so einen bösen Dämon nennt.« Er hob seine Mütze und kratzte sich am Scheitel. »Passt ganz gut«, murmelte er.
»Krieg, Seuchen, Unruhen, Zigaretten für hundertzwanzig Kronen …«, murrte Emmerich. »Und jetzt auch noch böse Dämonen?«
»Wir dachten erst, dieser István wäre stockbesoffen«, erklärte Baum weiter. »Doch dann sind wir in das Depot gegangen. Dort …« Anstatt weiterzureden, bedeutete er ihnen mitzukommen.
»Also keine Wasserleiche. Jetzt bin ich aber mal gespannt«, sagte Zech.
»Nicht nur du.« Emmerich nahm einen letzten Zug von seiner Zigarette, schnippte den Stummel fort und sah dabei zu, wie die dunklen Fluten ihn verschluckten.
Baum führte die drei Kriminalbeamten stromabwärts in Richtung der Öl- und Benzinhäfen. Die Donau plätscherte und gurgelte neben ihnen, der Wind frischte auf und ließ den Sprühregen nicht mehr senkrecht fallen, sondern wild durch die Luft tanzen, sodass die kleinen Tröpfchen aus allen Richtungen in die Kleidung der Männer krochen.
Kurz bevor sie die riesigen Tanks erreichten, die sich im Besitz von Ölgesellschaften wie Vacuum, Shell, Fanto Benzin oder Redeventa befanden, blieb Baum endlich stehen. »Hier ist es.« Er deutete auf einen flachen, in die Jahre gekommenen Holzbau, auf dem eine Giebelkonstruktion mit geschwungenen, gusseisernen Elementen ruhte. Das Glas der schmalen Fenster war so schmutzig, dass man nicht hindurchsehen konnte, die Bretter, aus denen die Wände gezimmert waren, schienen morsch.
»Ist das Depot nicht mehr in Verwendung?«, fragte Emmerich.
»Der Mietvertrag läuft auf eine gewisse Firma Karl Michel & Co., aber die nutzen das Depot nicht mehr.« Baum öffnete die Tür und gab den Blick auf feuchte Dielen und ein wildes Chaos aus zerbrochenen Kisten, durchgescheuerten Schiffstauen, Staub und Spinnweben frei. »Einen großen Teil der österreichischen Handelsflotte haben sich die Siegermächte unter den Nagel gerissen, und die neuen Zollgrenzen zu den ehemaligen Kronländern sind dem Handel nicht gerade zuträglich.« Er wandte sich an eine Gruppe Anzahrer, die ein paar Meter entfernt stehen geblieben war und voller Argwohn zu ihnen herüberblickte. »Ihr werdet nicht fürs Tachinieren bezahlt!«, rief er und klatschte in die Hände. »Alles gut hier. Es gibt nix zu sehen.« Er schüttelte den Kopf und wandte sich wieder an Emmerich. »Seeleute«, murmelte er. »Abergläubisches Pack. Die Geschichte vom Ghul hat schneller die Runde gemacht als der Schanker in einem Hafenpuff. Es wäre mir darum sehr lieb, wenn Sie den … die Leiche so schnell wie möglich von hier fortbringen könnten, bevor Unruhe ausbricht.« Er zog seine Jacke zu und fröstelte.
»Sehen wir uns die Sache mal an.« Emmerich betrat als Erster die Lagerhalle. Der Geruch von ranzigem Fett und Schimmel schlug ihm entgegen. »Scheiße«, entfuhr es ihm, als ein kleiner Schatten an ihm vorbeihuschte.
»Der Ghul?«, flüsterte Winter, der dicht hinter ihm gegangen war.
»Schlimmer.« Emmerich deutete auf ein angenagtes Stück Holz. »Ratten.« Er schauderte. »Ich hasse sie. Die sind uns im Schützengraben in der Nacht übers Gesicht spaziert.« Gedankenverloren wischte er sich über die Wangen. »Die Mistviecher wurden vom Leichengeruch angelockt und haben versucht, die Toten zu fressen. Apropos …« Er reckte die Nase in die Luft und schnupperte. »Wo ist der Ghul?«
»Ganz hinten links«, erklärte Baum, der in der offenen Tür stehen geblieben war. »Im Tresor.«
»Ein Dämon in einem Tresor?« Emmerich runzelte die Stirn. »Sie wollen mich wohl auf den Arm nehmen.«
»Leider nein.« Baum schüttelte den Kopf. »Falls Sie mich brauchen, finden Sie mich vorne bei den Lastenkränen.«
»Bevor Sie zurück an die Arbeit gehen, bringen Sie bitte den Sandler … diesen István zu mir«, wies Emmerich an.
»Wie Sie wünschen.« Baum nickte, tippte sich an die Mütze und verschwand.
Gemeinsam gingen die drei Kriminalbeamten durch die düstere Lagerhalle, die von zwei Gaslampen schwach beleuchtet wurde, bis vor ihnen ein Tresor auftauchte. Er war circa einen Meter hoch und aus massivem Stahl gefertigt.
Emmerich und Winter blieben ungefähr zwei Meter davor stehen und starrten gebannt auf die Tür, die einen schmalen Spaltbreit offen stand.
Feuchtkalter Wind pfiff durch die Ritzen und Löcher in den Hallenwänden, und die alten Fischernetze, die an der Decke hingen, schaukelten unruhig hin und her.
»Unheimlich«, flüsterte Winter.
Zech ging an ihnen vorbei, stellte seinen schweren Tatortkoffer neben sich auf den Boden und machte ihn auf. Bedächtig holte er Rußpulver, Bleiweiß, eine Lupe und ein Maßband daraus hervor und legte die Utensilien behutsam neben sich auf den Boden.
»Mach schon«, forderte Emmerich. »Lass uns sehen, womit wir es zu tun haben.«
»Gleich.« Zech beförderte mit der linken Hand eine Taschenlampe aus dem Koffer und schaltete sie ein, mit der rechten nahm er einen metallenen Winkelmesser und zog damit vorsichtig an der schweren Tresortür, die sich mit einem leisen Quietschen weiter öffnete. »Was um Gottes willen …«, murmelte er und verzog das Gesicht.
Winter riss die Augen auf, schlug die Hände vor den Mund und wandte sich ab. »Herr im Himmel.«
Nur Emmerich schien weniger erschrocken als ehrlich überrascht zu sein. »Na, habe die Ehre.« Er zündete eine neue Zigarette an, klemmte sie in den Mundwinkel und trat einen Schritt näher. »Darf ich?« Er nahm Zech die Taschenlampe aus der Hand und leuchtete ins Innere des Tresors.
Der Lichtkegel offenbarte ein Bild des Grauens: In dem kleinen Stahlschrank war eine Leiche eingepfercht, die den engen Raum komplett ausfüllte. Sie hielt die Gliedmaßen wie ein Kind im Mutterleib, hatte die Knie vor der Brust angewinkelt und umschlang sie mit den Armen.
»Na servas«, fand Zech seine Sprache wieder. »Kein Wunder, dass die da draußen sich halbert anscheißen.«
Tatsächlich war der Anblick der Leiche ein äußerst gruseliger. Die braunschwarz gefärbte Gesichtshaut des Toten überzog pergamentartig den Schädelknochen, und seine entstellten Züge erinnerten an das Gemälde Der Schrei von Edward Munch. Auf den vertrockneten Armen zeichnete sich das Aderngeflecht wie ein verzweigtes Flussnetz ab, Hände und Füße schienen wächsern.
»Ich habe schon viele Tote gesehen, aber so etwas noch nicht«, stellte Emmerich fest. »Das muss etwas mit dem Klima in dem Tresor zu tun haben.«
»Sind Sie sicher, dass das keine Puppe ist?«, warf Winter ein. »Vielleicht ist es ja nur ein schlechter Scherz. Vielleicht stammt das Ding aus einem Gruselkabinett.«
Emmerich ging, so gut es ihm mit seinem kaputten Bein möglich war, in die Hocke und leuchte dem Toten ins Gesicht. Die Augenhöhlen waren eingefallen, der Mund stand offen und gab den Blick auf zwei Reihen gut erhaltener Zähne frei. »Ich fürchte nicht.«
Winter schlug ein Kreuzzeichen. »Man kann nur hoffen, dass er schon tot war, ehe man ihn in den Tresor gesteckt hat«, murmelte er.
Zech hatte sich vom ersten Schreck offenbar erholt, denn er begann, die Innenseite der Tresortür mit Rußpulver einzustäuben, während Emmerich die Kleidung der Leiche begutachtete.
»Äußerst faszinierend«, sagte da plötzlich eine Stimme hinter ihnen.
Die drei Kriminalisten waren derart gebannt gewesen, dass sie gar nicht bemerkt hatten, wie jemand zu ihnen getreten war. Erschrocken fuhren sie herum.
Vor ihnen stand ein kleiner, feingliedriger Mann Mitte dreißig. Er hatte störrische braune Locken, die mehr schlecht als recht mit Pomade gebändigt waren, trug einen eleganten, maßgeschneiderten Anzug, und auf seiner schmalen Nase thronte eine runde Drahtbrille. Er schien von dem Anblick, der sich ihm bot, so gefesselt zu sein, dass er die Kriminalbeamten gar nicht wahrzunehmen schien. Ohne den Blick von dem schaurigen Szenario abzuwenden, kam er näher, stellte sich neben Emmerich und beugte sich zu der Leiche.
»Was soll das?« Emmerich richtete sich auf und packte ihn unsanft am Arm.
Der Eindringling zeigte sich davon wenig beeindruckt. Zu sehr schien ihn der Anblick des Toten zu beeindrucken. »Ich muss Ihre Hoffnung leider zunichtemachen«, wandte er sich an Winter. »Der Mann hat noch gelebt, als er in den Tresor gesperrt wurde. Sehen Sie nur.« Er deutete erst auf die Hände des Toten und anschließend auf einen abgebrochenen Fingernagel, der auf dem Boden des Tresors lag.
»Raus mit Ihnen!« Um seine Worte zu untermauern, zeigte Emmerich zur Tür und starrte dem Kerl feindselig in die Augen. »Wir befinden uns an einem Tatort. Sie haben hier nichts verloren.«
»Doch …« Der Mann fasste in die Tasche seines Mantels und kramte darin herum. »Mein Name ist Sándor Adler, ich …«
»Sei so gut und begleite Herrn Adler hinaus«, wies Emmerich Winter an. »Wir können hier keine sensationslüsternen Gaffer gebrauchen, oder noch schlimmer – die verdammte Journaille.«
»Gern.« Winter schien froh zu sein, endlich einen Vorwand zu haben, die Lagerhalle zu verlassen. Er streckte die Hand aus, um den Eindringling zu packen. »Irgendwie kommen Sie mir bekannt vor«, sagte er.
Der Fremde zog ein Blatt Papier aus seiner Tasche. »Ich wurde von Herrn Gonska autorisiert, Sie bei Ihren Ermittlungen zu begleiten.« Er rückte seine Brille zurecht. »Sie müssen Inspektor Winter sein, und der Herr mit der etwas ruppigen Kinderstube ist wohl Ihr Vorgesetzter, Inspektor …«
Emmerich riss ihm den Schrieb aus der Hand und überflog ihn. »Gonska hat was?«
»Der Herr Oberinspektor war so freundlich, mich Ihnen zuzuteilen.«
Emmerich paffte Rauchkringel in die Luft und musterte den Neuling. »Das wollte der Alte also von mir.« Er warf einen Blick zu Winter und seufzte. »Gerade hab ich einen Grünschnabel auf Spur gebracht, da schickt er mir schon den nächsten.« Er beäugte Adlers zarte Hände und dessen feinen Zwirn. »Seit wann sind die Anwärter für den Kriminaldienst alle so feine Pinkel?«
»Anwärter? Sie müssen da etwas falsch verstanden haben. Ich bin kein Polizeischüler. Ich bin Psychoanalytiker.«
Emmerich riss die Augen auf. »Ein Irrenarzt? Was sollen wir denn mit einem wie Ihnen?«