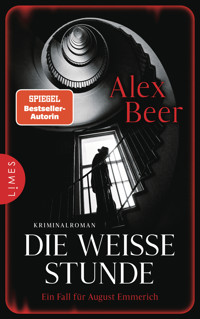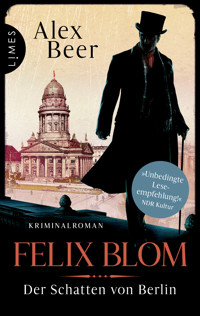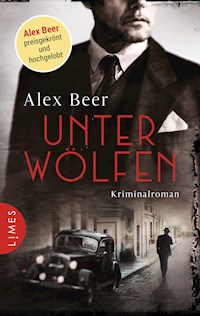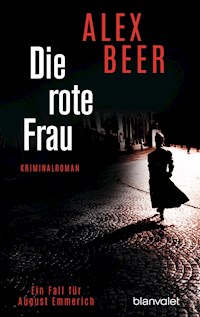9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Limes Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Isaak Rubinstein
- Sprache: Deutsch
Ein jüdischer Antiquar, getarnt als hochrangiger Nazi-Ermittler ... »Alex Beer kann einfach historische Spannung.« Emotion
Nürnberg, April 1942: Der jüdische Antiquar Isaak Rubinstein, der sich noch immer als Sonderermittler Adolf Weissmann ausgibt, lässt sich auf eine Liaison mit der Nazigröße Ursula von Rahn ein. Durch sie erhält er Zugang zu den höchsten gesellschaftlichen Kreisen und bekommt Einsicht in die Pläne der Gegenseite. Doch dann wird Nürnberg plötzlich von brutalen Morden erschüttert. Zwei junge Frauen werden erdrosselt aufgefunden. Ausgerechnet Isaak bekommt von Berlin die Order, den »Würger« aufzuspüren. Darüber hinaus hat er noch ganz andere Probleme: Seine Popularität hat Neider auf den Plan gerufen und besonders ein Mann könnte ihm gefährlich werden …
Alle Bücher der Serie:
Unter Wölfen (Bd. 1)
Unter Wölfen – Der verborgene Feind (Bd. 2)
Die Kriminalinspektor-Emmerich-Reihe:
Der zweite Reiter: Ein Fall für August Emmerich (Bd. 1)
Die rote Frau: Ein Fall für August Emmerich (Bd. 2)
Der dunkle Bote: Ein Fall für August Emmerich (Bd. 3)
Das schwarze Band: Ein Fall für August Emmerich (Bd. 4)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 364
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Buch:
Nürnberg, April 1942: Der jüdische Antiquar Isaak Rubinstein, der sich noch immer als Sonderermittler Adolf Weissmann ausgibt, lässt sich auf eine Liaison mit der Nazigröße Ursula von Rahn ein. Durch sie erhält er Zugang zu den höchsten gesellschaftlichen Kreisen und bekommt Einsicht in die Pläne der Gegenseite. Doch dann wird Nürnberg plötzlich von brutalen Morden erschüttert. Zwei junge Frauen werden erdrosselt aufgefunden. Ausgerechnet Isaak bekommt von Berlin die Order, den »Würger« aufzuspüren. Darüber hinaus hat er noch ganz andere Probleme: Seine Popularität hat Neider auf den Plan gerufen, und besonders ein Mann könnte ihm gefährlich werden …
Autorin:
Alex Beer, geboren in Bregenz, hat Archäologie studiert und lebt in Wien. Nach »Der zweite Reiter«, ihrem preisgekrönten Debüt, das den Auftakt gibt für die hochspannende Reihe um Kriminalinspektor August Emmerich, »Die rote Frau«, nominiert für den Friedrich-Glauser-Preis 2019, und »Der dunkle Bote«, Gewinner des Krimi-Publikumspreises des deutschen Buchhandels MIMI 2020, erschien zuletzt »Das schwarze Band«. Die ersten drei Bände der Reihe wurden zudem mit dem Österreichischen Krimipreis 2019 ausgezeichnet.
Daneben hat Alex Beer mit Isaak Rubinstein eine weitere faszinierende Figur erschaffen, die während des Zweiten Weltkriegs in Nürnberg ermittelt. Mit dem ersten Band von »Unter Wölfen« steht sie bereits auf der Longlist des Crime Cologne Awards 2020. Um es mit den Worten der Jury des Leo-Perutz-Preises zu sagen: »Was Alex Beer erzählt, betrifft auch die heutige Zeit, aber wie sie erzählt, lässt die ferne Vergangenheit lebendig werden.«
Mehr Informationen unter: www.alex-beer.com
Die August-Emmerich-Reihe von Alex Beer im Limes Verlag:
Der zweite Reiter · Die rote Frau · Der dunkle Bote · Das schwarze Band
Die Isaak-Rubinstein-Reihe von Alex Beer im Limes Verlag:
Unter Wölfen · Unter Wölfen – Der verborgene Feind
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag
ALEX BEER
UNTER
WÖLFEN –
DER
VERBORGENE
FEIND
Kriminalroman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2020 by Alex Beer
Dieses Werk wurde vermittelt durch die
Literaturagentur Kai Gathemann
© 2020 by Limes in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: René Stein
Umschlaggestaltung: © Johannes Wiebel | punchdesign,
unter Verwendung von Motiven von Shutterstock.com
(Sergii Gnatiuk; Vyntage Visuals; Gordan)
KW · Herstellung: sam
Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach
ISBN 978-3-641-26850-3V001
www.limes-verlag.de
Dies ist eine fiktionale Erzählung.
Obwohl sie in reale Rahmenbedingungen eingebettet ist, sind sämtliche Figuren, Ereignisse und auch
einige der Schauplätze frei erfunden.
Nähere Informationen dazu im Nachwort.
Prolog
»Wo fahren wir hin?«
»Das sehen Sie gleich.«
Isaak Rubinstein kurbelte das Fenster hinunter und blickte hinaus. Der Fahrtwind zerzauste sein Haar, über ihm erstrahlte die Milchstraße in ihrer vollen Pracht.
Es war eine gute Nacht, um zu sterben.
Das Geräusch, das die Reifen verursachten, veränderte sich. Was bisher ein ruhiges und gleichmäßiges Gleiten gewesen war, wurde plötzlich zu einem holprigen Knirschen. Auch die Luft hatte ihren Geruch verändert – von Flieder, Abgasen und Küchendunst zum Aroma von Harz und Bärlauch. Sie waren auf einen Waldweg abgebogen.
»Zerzabelshofer Forst«, riet Isaak. »Wo ich …«
»Wo Ihre Leiche irgendwann in den kommenden Tagen von Spaziergängern oder Jägern gefunden werden wird. Man wird annehmen, dass Sie sich lieber selbst umgebracht haben, als sich der Schmach auszusetzen, ins Gefängnis zu wandern.« Der andere brachte den Wagen zum Stehen, zückte einen Revolver und richtete den Lauf auf Isaaks Brust. »Mir fällt das auch nicht leicht.«
»Wie beruhigend.« Isaak starrte auf die Handschellen, mit denen seine Hände gefesselt waren, stieg aus und saugte die klare Waldluft in seine Lunge. »Hören Sie zu«, setzte er an. »Sie müssen das nicht tun.«
»Ins Unterholz!«
Vorsichtig machte Isaak ein paar Schritte nach hinten. Trockene Äste knackten unter seinen Schuhen, ein Käuzchen schrie. »Wir müssen reden.«
»Machen Sie es nicht schwerer, als es sowieso schon ist.«
»Hören Sie zu«, wiederholte Isaak. »Ich habe neue Informationen. Ich weiß jetzt, was damals wirklich passiert ist mit …« Obwohl der Mond und die Sterne die Umgebung nur schwach erleuchteten, konnte Isaak erkennen, wie sich die Züge seines Widersachers verhärteten.
»Mit wem?«
»Mit Marianne …«
Marianne
Oktober 1939
Die großen Katastrophen ereigneten sich immer freitags. All die Dinge, die ihn im Mark erschüttert und sein Leben aus den Angeln gehoben hatten, und ganz besonders das größte Unglück von allen: die Sache mit Marianne …
Obwohl die ganze Geschichte bereits zwei Jahre zurücklag, beherrschte sie noch immer seine Gedanken. Wieder und wieder stellte er sich dieselben Fragen: Wie hatte er sich so täuschen können? Warum hatte sie getan, was sie getan hatte? Warum hatte sich das Schicksal ausgerechnet ihn als Opfer dieser grausamen Scharade herausgepickt?
Sie hatten sich an einem verregneten Tag im April in einer Buchhandlung kennengelernt, an einer Regalwand mit Hölderlin und Lichtenberg. Für ihn war es einer jener Momente gewesen, die das Leben in ein Vorher und ein Nachher teilten. Der berühmte Blitz hatte eingeschlagen, und all die gängigen Klischees, die er zeit seines Lebens als schmalzigen Humbug abgetan hatte, waren plötzlich wahr geworden.
Sie war schüchtern gewesen, und es hatte ihn einiges an Überzeugungsarbeit gekostet, bis sie sich endlich einverstanden erklärt hatte, seiner Einladung auf eine Tasse Tee zu folgen.
Von jenem Augenblick an hatte es sich zwischen ihnen prächtig entwickelt – so glaubte er zumindest. Sie hatten ausgedehnte Spaziergänge entlang der Pegnitz unternommen, sich seitenlange Briefe geschrieben und schließlich im Kino verstohlene Küsse ausgetauscht. Anders als die meisten Frauen in seinem Leben, war sie eine leise und zarte Erscheinung gewesen. Sie sprach nicht um des Redens willen, machte sich nichts aus Geld oder Orden und fand Freude in den kleinsten Dingen: einem schönen Lied, einem Stück Schokolade, einer sonderbar geformten Wolke …
Bei ihr hatte er sich wohlgefühlt, gesehen, verstanden. Geliebt. Was er damals aber noch nicht gewusst hatte: Die Liebe konnte einem das Leben nicht nur versüßen, sondern auch für Bitterkeit sorgen. Diese Zweischneidigkeit sollte er an jenem unglückseligen Freitag im Oktober zu spüren bekommen. Der Krieg war ganz weit weg gewesen, und der Herbst hatte Nürnberg in goldenes Licht getaucht. Voller Vorfreude war er in das kleine Café oben im Burgviertel spaziert, in dem sie sich verabredet hatten.
Marianne saß an ihrem Lieblingsplatz, ganz hinten, neben der Tür, die zur Backstube führte, und war umhüllt vom Duft frisch aufgebrühten Kaffees und warmen Kuchens. Wie immer trug sie ein einfaches Kleid und darüber eine Strickjacke, die ihr viel zu groß war. Sie hielt den Kopf gesenkt und kaute geistesabwesend auf ihrer Unterlippe.
Als sie endlich hochblickte und ihn sah, strahlte sie übers ganze Gesicht und schenkte ihm jenes Lächeln, das ihm jedes Mal aufs Neue weiche Knie bescherte.
Mein Gott, wie sehr er sie liebte. Alles an ihr, jedes noch so kleine Detail. Die vereinzelten Sommersprossen, die wie Sternbilder auf ihrem Gesicht verstreut waren. Ihr weiches, blondes Haar, das die Farbe von reifen Ähren hatte, die kleine Narbe, direkt über ihrer Oberlippe …
Nach einem Begrüßungskuss nahm er ihr gegenüber Platz und genoss schweigend ihren Anblick. Schließlich fasste er über den Tisch und nahm ihre Hand in seine. »Ich habe meiner Familie von dir erzählt«, begann er.
Marianne riss die Augen auf, und ihre Wangen nahmen einen satten Rotton an.
Rund um sie herum herrschte rege Betriebsamkeit. Gäste unterhielten sich lautstark über den Vormarsch der Wehrmacht, schimpften über die Gier der Juden und priesen den Führer als den größten Feldherrn aller Zeiten. Besteck klapperte, und Kellnerinnen balancierten Tabletts zwischen den kleinen Tischen hindurch. Doch er nahm das Geschehen nur am Rande wahr, wenn überhaupt. Für ihn gab es nur sie, als würde sie von einem Scheinwerfer erleuchtet werden, während der Rest der Welt im Dunkeln lag.
»Aber warum?«, durchbrach sie schließlich das Schweigen und löste ihre Hand aus der seinen. »Wir haben doch gesagt, dass wir mit solchen Dingen noch warten wollen.«
»Ich konnte es ihnen nicht länger verschweigen. Wollte nicht. Ich möchte, dass die Sache zwischen uns endlich offiziell ist. Immerhin meinen wir es doch ernst miteinander. Komm nächste Woche mit zu meinen Leuten. Wir feiern den Geburtstag meines Onkels.«
Sie schaute verzweifelt und wirkte mit einem Mal noch fragiler als sonst. »Ich denke nicht, dass das eine gute Idee ist«, sagte sie mit einem leisen Beben in der Stimme. »Deine Familie …«
»Was ist mit ihnen?«
Sie starrte auf ihre Hände, als gehörten sie nicht zu ihr, und knibbelte an der Nagelhaut ihres Daumens herum. »Sie werden mich nicht mögen«, sagte sie schließlich, ohne dabei aufzublicken.
»Ach was«, winkte er ab. »Wenn sie dich nur halb so gern haben wie ich, dann werden sie dich mit offenen Armen empfangen.«
Seine Worte schienen sie nicht zu überzeugen. Im Gegenteil. Ihre Augen begannen feucht zu glänzen, und sie schüttelte den Kopf so heftig, dass ihre blonden Locken hüpften. »Du verstehst nicht …«, setzte sie an.
»Was gibt es denn da zu verstehen?« Er begriff nicht, was plötzlich mit ihr los war. »Meine Familie wird dich lieben. Genauso wie ich es tue. Hörst du? Ich liebe dich.« Es war das erste Mal, dass er diese drei Worte laut aussprach, nicht nur Marianne gegenüber, sondern überhaupt jemals. Noch nie hatte er so für irgendjemanden empfunden. Noch nie war er so glücklich gewesen.
Er hatte nicht geplant, ihr hier und heute seine Gefühle zu offenbaren, doch jetzt, da jene drei Worte die Eigeninitiative ergriffen hatten, fühlte es sich gut an. Richtig. »Ich liebe dich«, wiederholte er, und dann fügte er zwei weitere Worte hinzu, die das Luftschloss, als das sich die vergangenen Monate entpuppen sollten, zum Einsturz brachten: »Heirate mich!«
Sonntag, 19. April 1942
1
Das Geklapper von Schreibmaschinen hallte durch die Flure, vermischte sich mit dem Läuten von Telefonen und dem Klackern von Stöckelschuhen auf hartem Steinboden.
Normalerweise mochte Felix Bachmayer die geschäftige Atmosphäre, die in der Redaktion des Nürnberger Beobachters herrschte. Er mochte das Odeur aus Zigarettenrauch, Parfum und Druckerschwärze, das stets in der Luft hing. Er mochte die jungen Sekretärinnen und das alte Gemäuer. Am allermeisten aber mochte er das Gefühl, bedeutend zu sein, mehr als nur ein kleines Rädchen in dem großen Getriebe namens Deutsches Reich. Er war es, der die Menschen mit wichtigen Informationen versorgte, ihnen erklärte, was gut war und was nicht. Je nachdem, wie er seine Worte wählte, konnte er die Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzen oder für Ruhe in der Stadt sorgen. Ihm oblag es, die Stimmung an der Heimatfront zu steuern.
Noch war der Nürnberger Beobachter nicht so auflagenstark wie DerStürmer, doch schon bald würden er und seine Mitarbeiter Julius Streichers Blatt ernsthafte Konkurrenz machen, da war sich Bachmayer sicher.
Ganz gleich, wie hoch die Zahlen der Gefallenen waren, die täglich eintrudelten, egal, wie viele Stunden er arbeiten musste – Felix Bachmayer liebte seine Aufgabe und war deshalb üblicherweise gut gelaunt. Doch seit ziemlich genau einem Monat hatte sich ein Schatten auf sein Leben gesenkt, und dieser Schatten hatte einen Namen: Adolf Weissmann.
Weissmann, der als einer der besten Kriminalisten des Reichs galt, war nach Nürnberg beordert worden, um den Mord an einer berühmten Schauspielerin aufzuklären. Anstatt nach getaner Arbeit wieder zurück nach Berlin zu verschwinden, war er aber in der Stadt geblieben und seither damit beschäftigt, Ursula von Rahn den Kopf zu verdrehen.
Seiner Ursula von Rahn.
Bachmayer begehrte sie seit ihrer gemeinsamen Schulzeit, doch all die Jahre hatte sie ihn abgewiesen. Sie hatte anderen Männern den Vorzug gegeben. Reicheren Männern, mächtigeren Männern. Und ausgerechnet jetzt, da er es endlich geschafft hatte, das Attribut gut situiert für sich zu erarbeiten, warf sie sich diesem dahergelaufenen Kerl an den Hals. Diesem Weissmann.
Heute war dieses Subjekt bei den von Rahns zum Essen eingeladen, und es ging das Gerücht um, dass ein Heiratsantrag in der Luft lag. Den galt es zu verhindern. Um jeden Preis.
»Was denn?«, rief Bachmayer ungehalten, als es an der Tür klopfte und Walli Resch, eine der Sekretärinnen, den Kopf in sein Büro streckte.
»Der Chef will den Artikel über das Ende der Judenplage sehen«, erklärte sie.
»Er muss sich gedulden«, erwiderte Bachmayer, ohne von seinen Unterlagen aufzusehen.
»Er hat gesagt …«
»Das Judenpack ist aus der Stadt vertrieben. Das, was noch davon übrig ist, geht mit dem nächsten Transport nach Theresienstadt, das weiß doch jeder.« Sein Tonfall war harscher, als er es beabsichtigt hatte. »Was soll ich da groß drüber berichten?«, versuchte er, einen freundlicheren Ton anzuschlagen, was ihm aber nicht wirklich gelingen wollte.
»Der Chef meint, es ginge darum, diese infamen Behauptungen zu entkräften, die der Widerstand seit Neuestem verbreitet. Sie wissen schon … Dass die Juden alle umgebracht werden sollen. Er will, dass Sie dem etwas entgegensetzen und irgendeine schöne Geschichte darüber schreiben, wo die Leute hingekommen sind. Dass es ihnen dort gut gehe – ja sogar besser, als sie es verdient haben.«
Bachmayer schnaubte und betrachtete die Notizen, die vor ihm auf dem Tisch lagen. Er hatte versucht, mehr über diesen Weissmann herauszufinden – ein Unterfangen, das sich als schwieriger entpuppt hatte als gedacht. Doch Penetranz gehörte zu seinem Beruf, war sein Beruf, genauso wie Akribie und Hartnäckigkeit. Er hatte geschnüffelt und gegraben, bestochen und betört. Und er war tatsächlich auf etwas gestoßen. Noch war es nicht mehr als Klatsch, Vermutungen, allenfalls hinter vorgehaltener Hand geäußert. Es gab Gerüchte über eine Schießerei im Gestapo-Hauptquartier, Gerüchte darüber, dass es beim Tod von Fritz Nosske, dem ehemaligen Leiter des Judenreferats, der angeblich Selbstmord begangen hatte, nicht mit rechten Dingen zugegangen war, und Gerüchte, dass dieser Weissmann etwas mit all dem zu tun hatte.
Und tatsächlich: Je mehr er nachgeforscht hatte, desto mehr Ungereimtheiten hatte er entdeckt, und da steckte noch mehr dahinter, das sagte ihm sein Instinkt. Er hatte nämlich ein Näschen für Skandale.
»Wenn Sie keine Zeit haben, könnte ich ja vielleicht den Artikel über die Juden schreiben«, riss Walli ihn aus seinen Überlegungen.
Bachmayer blickte sie so empört an, als habe sie ihm gerade gestanden, mit den Alliierten zu sympathisieren. »Quod licet iovi, non licet bovi«, gab er zur Antwort.
Walli runzelte die Stirn.
»Ach ja, du kannst ja kein Latein.« Er seufzte theatralisch. »Das heißt frei übersetzt so viel wie: Was dem Jupiter erlaubt ist, ist dem Ochsen nicht erlaubt.«
Walli presste die Lippen aufeinander und funkelte ihn böse an. »Der Ochse könnte es doch zumindest probieren. Wenn der Artikel schlecht ist, können Sie ihn immer noch wegwerfen.«
Bachmayer schüttelte den Kopf. »Sag dem Chef, er hat ihn in einer Stunde auf dem Tisch.« Er wandte sich wieder seinen Aufzeichnungen zu und starrte auf die eine Information, die Weissmann hoffentlich als Lügner entlarven würde. Eigentlich hatte er noch abwarten und alle Geheimnisse auf einmal aufdecken wollen, doch er hatte seine Meinung geändert. Er würde heute schon zum Erstschlag ausholen.
»Können wir noch einmal darüber reden? Darüber, dass ich auch mal etwas schreiben will?« Walli schürzte die Lippen. »Vielleicht morgen?«
»Jaja«, winkte Bachmayer ab. »Von mir aus. Aber jetzt husch, husch.« Als sie endlich verschwunden war, griff er zum Telefon. Die Nummer kannte er auswendig. Er wartete, bis es in der Leitung klickte und am anderen Ende abgehoben wurde.
»Von-Rahn-Residenz.«
»Felix Bachmayer hier vom Nürnberger Beobachter. Ich möchte gerne mit Otto von Rahn sprechen. Sagen Sie ihm, es ist wichtig. Es gibt da etwas, das er unbedingt erfahren sollte.«
2
Als der dunkle Horch, der gerade im Schritttempo an ihm vorbeigefahren war, ohne ersichtlichen Grund nur wenige Meter vor ihm stehen blieb, beschleunigte sich sein Herzschlag. War nun der Moment gekommen, den er seit Wochen fürchtete? Jener Augenblick, in dem das Damoklesschwert, das all die Zeit über ihm gehangen hatte, auf ihn herabsausen und seinem Dasein ein Ende bereiten würde?
Langsam öffnete sich eine der Türen im Fond, ein korpulenter Mann streckte seinen Kopf ins Freie und musterte ihn. »Weissmann«, rief er schließlich, wobei sein ausgeprägtes Doppelkinn wackelte. »Sie sind doch Adolf Weissmann?«
Isaak Rubinstein schluckte und nickte schließlich. »Der bin ich.«
»Sie sind sicher auf dem Weg zu Otto von Rahn«, rief der Mann. »Steigen Sie ein, ich nehme Sie mit.«
Wenn er ebenfalls bei den von Rahns eingeladen war, musste der Kerl ein hochrangiger Nazi sein. Die Vorstellung, auf engstem Raum Zeit mit ihm zu verbringen, auch wenn es nur wenige Minuten waren, ließ Isaak erschaudern. »Nein, danke«, winkte er ab. »Ich kann ein bisschen Bewegung gut gebrauchen, und es ist ja auch nicht mehr weit.« Demonstrativ setzte er seinen Weg fort. »Bis gleich«, sagte er, als er den Wagen passierte.
»Wie Sie meinen.« Der Mann zuckte mit den Schultern und schlug die Tür zu.
Isaak wartete, bis das Automobil außer Sichtweite war, dann atmete er erleichtert auf. »Nicht mehr lange«, redete er sich selbst gut zu. Nur noch diese eine Sache. Danach würde er endlich nach Berlin verschwinden und dort untertauchen. Endlich würde er seine Familie wiedersehen und Clara, seine große Liebe, die dort in einem Versteck auf ihn warteten.
Während er durch die von Bäumen gesäumten Straßen des Nürnberger Villenviertels Erlenstegen spazierte, blickte er nach oben in den Himmel, an dem graue Wolken stetig dahintrieben. Er stellte sich vor, ganz leicht zu sein, zu ihnen hochzusteigen und mit ihnen davonzuziehen. Fort. Weit fort. Hinaus aus dieser Stadt. Hinaus aus diesem Reich. An einen Ort, an dem er wieder er selbst sein konnte, an dem seine Familie in Sicherheit war und an dem er und Clara nichts weiter als gewöhnliche Liebende wären.
Doch er war zu schwer für den Wind, schleppte zu viel Gewicht mit sich herum. Darum musste er noch bleiben. Noch für einige wenige Stunden war er gezwungen, die Rolle seines Lebens zu spielen.
Isaak Rubinstein gab Adolf Weissmann.
Er war ein Jude unter Nazis, ein Lamm unter Wölfen.
Isaak hatte – zugegeben nicht ganz freiwillig – die Identität eines mittlerweile toten Kriminalinspektors angenommen, immer in der Hoffnung, etwas für die elf Millionen Juden tun zu können, die die Nazis auszulöschen gedachten.
In Weissmanns Namen hatte er sich offiziell für einen Monat vom Dienst beurlauben lassen und war eine Liaison mit Ursula von Rahn eingegangen. Die schöne Sekretärin von Gestapo-Chef Georg Merten war nicht nur ein schillerndes Mitglied der besseren Gesellschaft, sondern auch die Tochter eines einflussreichen Industriellen. Durch sie hatte er sich Zugang zu wichtigen Informationen erhofft, doch leider hatte sich herausgestellt, dass sein Plan weitaus schwieriger umzusetzen war als gedacht.
Der Großteil seiner Energie war nämlich in die Aufrechterhaltung seiner Deckung geflossen. Anstatt kriegswichtige Geheimnisse an den Widerstand weiterzuleiten, hatte er sich darin geübt, wie ein echter Nationalsozialist zu sprechen, zu gehen und zu denken. Bei jeder sich bietenden Gelegenheit hatte er den Führer gepriesen, den Vormarsch der Wehrmacht bejubelt und die Wichtigkeit des Ostfeldzugs betont. Die Worte »Sieg Heil!« und »Heil Hitler!« kamen ihm mittlerweile flüssig über die Lippen, und die bei der SS übliche Tätowierung der Blutgruppe unter der Achsel hatte er sich auch stechen lassen.
All das hatte er auf sich genommen und stand doch noch immer mit leeren Händen da. Hoffentlich würde sich das heute Abend ändern.
Isaak stellte den Kragen seines Mantels hoch, zog den Kopf ein und stemmte sich gegen den kalten Wind, der helle Kinderstimmen an sein Ohr wehte.
Deutschland, heiliges Wort,
Du voll Unendlichkeit!
Über die Zeiten fort
Seist Du gebenedeit …
Das mussten die zehnjährigen Jungen und Mädchen sein, die heute ihre Aufnahme in das deutsche Jungvolk und den Jungmädelbund feierten. Kinder, die auf den Krieg vorbereitet und darauf eingeschworen wurden, Menschen wie ihn zu töten.
Isaak konnte direkt vor sich sehen, wie die unschuldigen Seelen sich mit leuchtenden Augen und strahlenden Herzen dem Führer am Vorabend seines Geburtstags selbst zum Geschenk machten. Führer, befiehl, wir folgen dir.
Was war nur aus dieser Welt geworden?
Die Uhr einer nahen Kirche schlug Viertel vor sieben. Er musste sich beeilen. Auf keinen Fall wollte er zu spät kommen. Isaak beschleunigte seine Schritte und eilte weiter bis zu der neoklassizistischen Villa, in der die Familie von Rahn residierte. Er ging über den kiesbedeckten Weg, der durch den Vorgarten führte, wobei die kleinen Steinchen wie morsche Knochen unter seinen Sohlen knirschten. Krähen zogen laut krächzend am Himmel ihre Kreise, während er die Stufen hoch bis zur Eingangstür stieg, die von einem Säulenportikus überkrönt wurde.
Bevor er die Türglocke betätigte, richtete er seine Krawatte und versuchte, seinen Puls unter Kontrolle zu bekommen. Im Inneren des Hauses war schließlich eine Handvoll hochrangiger Nazi-Funktionäre zum Abendessen versammelt, und Isaak sah sich mit einer ganz besonderen Gefahr konfrontiert: Was sollte er tun, wenn einer von ihnen den echten Weissmann kannte?
Noch bevor er wusste, wie ihm geschah, öffnete sich die Tür von allein. Wärme und der würzige Duft von frisch gekochtem Essen schlugen ihm entgegen, und eine betagte, recht hagere Frau, bei der es sich wohl um die Haushälterin handelte, musterte ihn mit kritischem Blick. Sie studierte die dunklen Schatten unter seinen Augen und seine Haut, die von geradezu ungesunder Blässe war. »Sie werden erwartet?«, fragte sie in einem eisigen Tonfall.
Noch ehe Isaak antworten konnte, kam Ursula von Rahn herbeigeeilt. Sie war die Tochter des Hauses und stets wie aus dem Ei gepellt. Ihr dunkelblondes Haar schmiegte sich in sanften Wellen um ihr ebenmäßiges Gesicht, ihr Mund war tiefrot geschminkt, und das elegante smaragdgrüne Seidenkleid, das sie trug, schmeichelte ihren Kurven. »Er wird sogar sehnlichst erwartet.« Sie blickte die Haushälterin böse an und hauchte Isaak ein Küsschen auf die Wange. »Wissen Sie denn nicht, wer das ist?«, sagte sie vorwurfsvoll zu der alten Frau. »Das ist …«
»… der berühmt-berüchtigte Adolf Weissmann.« Ein großer stattlicher Mann war hinter Ursula aufgetaucht. Er trug einen eleganten Anzug und eine Pantobrille mit schmalem Rand. Sein volles weißes Haar war seitlich gescheitelt und streng nach hinten gekämmt. Otto von Rahn. Er war nicht nur Ursulas Vater, sondern auch der Direktor jener Maschinenfabrik, die die Motoren für die deutsche Panzer- und U-Boot Flotte herstellte. Er war es, dem Isaaks wirkliches Interesse galt.
Isaak hatte Otto von Rahn im vergangenen Monat bereits mehrfach getroffen, doch heute war das erste Mal, dass der Industrielle ihn in seine Stadtresidenz eingeladen hatte. In jenes Haus, in dem sich von Rahns Tresor befand, in dem er seine Auftragsbücher und andere wichtige Unterlagen aufbewahrte.
»Adolf ist der beste Kriminalinspektor des Reichs«, erklärte Ursula der Haushälterin, die sich jedoch wenig beeindruckt zeigte.
»Das ist heillos übertrieben«, winkte Isaak peinlich berührt ab. Er trat ein und streckte dem Hausherrn seine Hand entgegen. Doch anstatt sie zu schütteln, starrte der ihm nur direkt in die Augen und verzog dabei keine Miene.
»Ihr Mantel.« Die Haushälterin deutete auf den beigen Zweireiher, den Isaak trug.
Er zog ihn aus und reichte ihn ihr. »Vielen Dank«, sagte er betont freundlich und wandte sich erneut Otto von Rahn zu. »Danke für die Einladung, Herr von Rahn.«
Ohne ein Wort zu verlieren, drehte der sich um und verschwand.
»Vati!«, rief Ursula ihm hinterher. »Welche Laus ist dir denn heute über die Leber gelaufen?« Sie schüttelte den Kopf und hakte sich bei Isaak unter. »Er hat sicher Ärger in der Fabrik«, sagte sie und schob ihn sachte ins Innere des Hauses, dessen Zentrum eine imposante Halle bildete. »Hier geht es ins Herrenzimmer«, erklärte sie stolz und zeigte auf eine Tür. »Durch diesen Flur kommt man in den Musikraum, und da vorn sind der Salon und das Speisezimmer.«
Isaak dachte an die beengten und heruntergekommenen Verhältnisse in dem Judenhaus, in dem er und seine Familie die vergangenen Monate hatten darben müssen, und an die unwürdigen, rattenverseuchten Lager, in die die jüdische Bevölkerung verschleppt worden war. »Ich bin beeindruckt«, sagte er und zauberte Ursula damit ein Lächeln ins Gesicht. »Und oben?« Tatsächlich interessierte sich Isaak für die Architektur und Ausstattung des Hauses, doch nicht aus schöngeistigen Gründen – er wollte wissen, wie er an die Dokumente gelangen und im Fall der Fälle fliehen konnte.
»Oben befinden sich das Schlafzimmer meiner Eltern und mein ehemaliges Kinderzimmer«, gab Ursula bereitwillig Auskunft. »Sowie das Damenzimmer, der Frühstückssalon, das Bad und nach hinten raus Vaters Büro.« Sie legte den Kopf schief und sah ihn an. »Mir fällt gerade auf, dass du mir noch nie erzählt hast, wie deine Wohnung in Berlin aussieht.« Sie machte einen Schmollmund, so wie sie es immer tat, wenn sie etwas wollte. Obwohl sie bereits dreißig Jahre alt war, benahm sie sich häufig wie ein verwöhntes Gör.
»Jedenfalls nicht so glanzvoll wie hier«, wich Isaak aus. Er hatte keine Lust, irgendwelche Beschreibungen zu erfinden – zu sehr war er damit beschäftigt, seine Nervosität zu verbergen. Seine Hände waren schweißnass, und in seinem Bauch breitete sich ein flaues Gefühl aus. Der Gedanke an die anderen Gäste und das komische Verhalten des Hausherrn verursachten ihm leichte Übelkeit.
Ursula hatte seine Anspannung wohl bemerkt. »Kein Grund zur Aufregung«, flüsterte sie ihm ins Ohr. »Alle freuen sich schon sehr, dich kennenzulernen – den berühmten Inspektor aus Berlin.«
»Ja, genau, warum so aufgeregt?«, fragte Otto von Rahn, der plötzlich hinter ihnen aufgetaucht war. Er musterte Isaak und bedachte ihn mit einem kritischen Blick. »Einen Mann von Ihrer Statur sollte so ein simples Diner doch nicht verunsichern.«
Isaak musste sich eingestehen, dass ihm die Atmosphäre der ständigen Bedrohung mehr zusetzte, als er es anfangs für möglich gehalten hätte. Er quälte ein Lächeln auf seine Lippen. »Ich bin ein Mann des Rechts, ein Mann der Ordnung«, sagte er. »Ein Mann, der in den vergangenen Jahren ausschließlich für das Reich und den Führer gelebt hat. Private Dinge, nun ja …« Er blickte zu Ursula, auf deren Wangen sich eine gewisse Röte abzeichnete.
»Alles wird ganz wunderbar.« Mit einer schwungvollen Bewegung öffnete sie eine große Doppelflügeltür. Dahinter befand sich ein Zimmer, das ganz in Grün und im Stil des Empire gehalten war. Die geradlinig strenge Form der Möbel, die in ihrer Monumentalität an das alte Rom erinnern sollten, war repräsentativ, aber sicher nicht gemütlich.
Das Zentrum des Raums bildete ein massiver Tisch aus dunklem Mahagoni, der reich gedeckt war. An ihm saßen zwei elegant gekleidete Männer und eine mondäne Dame, die sich so angeregt miteinander unterhielten, dass sie die Neuankömmlinge gar nicht bemerkten.
Isaak starrte auf das Tafelsilber, das feine Porzellan, die Kandelaber und Blumenvasen und konnte sich des Gedankens nicht erwehren, dass wohl das eine oder andere gute Stück bis vor Kurzem in einem jüdischen Haushalt zu finden gewesen war. Um den Zorn, der in ihm aufstieg, zu dämpfen, ließ er seinen Blick zu dem Bücherregal wandern, das die Wand links von ihm einnahm. Denn nach Clara waren Bücher seine große Liebe. Vor den antisemitischen Bestimmungen und den Enteignungen – vor einer schieren Ewigkeit –, da hatte Isaak ein Antiquariat besessen. Wie von selbst trat er an das Regal, schloss die Augen und atmete den einzigartigen Duft ein, den die Bücher verströmten: Papier, Leder, Druckerschwärze. Für einen kurzen Moment war er wieder in seinem kleinen Laden. Er hörte das Knacken der hölzernen Regale, das Surren der Deckenleuchten, spürte den leisen Luftzug, der stets durch ein undichtes Fenster im Geschäftslokal hereingezogen war, und fühlte, wie eine beruhigende Woge ihn umspülte.
Das wohlige Gefühl von Geborgenheit verschwand so schnell, wie es gekommen war, als er die Augen wieder öffnete und las, was auf den Buchrücken geschrieben stand: Die Protokolle der Weisen von Zion, Das jüdische Gaunertum, Die Judennacht … Eilig wandte er sich wieder der Tischgesellschaft zu.
»Darf ich vorstellen«, rief Ursula von Rahn, noch ehe Isaak die Gelegenheit hatte, sich zu sammeln. »Unser heutiger Ehrengast: Sturmbannführer Adolf Weissmann.«
Das Gespräch am Tisch verstummte, die Blicke richteten sich auf Isaak. Schweiß trat auf seine Stirn, und er spannte alle Muskeln an.
Ursula drückte seinen Arm und schmiegte sich an ihn, sodass ihm ihr Parfum in die Nase stieg. Rosenduft, worunter sich etwas Pudriges mischte. »Alles gut«, flüsterte sie.
Isaak antwortete nicht, stattdessen musterte er die Gesichter der Anwesenden, vor allem jene der beiden Männer. Doch keiner von ihnen schien sich zu wundern, keiner starrte ihn fragend oder ungläubig an. Wie gut, dass der echte Adolf Weissmann sich nur ungern in der Öffentlichkeit gezeigt hatte. Er hatte wohl oft verdeckt ermittelt und großen Wert darauf gelegt, dass sein Äußeres nicht allgemein bekannt wurde. Er war ein Mysterium gewesen, ein bekannter Name ohne dazugehöriges Gesicht – und jetzt war er tot.
Der Gedanke an den Mann, der in einem anonymen Grab dahinrottete, ließ Isaaks Magen verkrampfen. Zwar hatte nicht er ihn umgebracht, aber an seinem frühzeitigen Tod besaß er zumindest eine Mitschuld.
»Adolf«, riss Ursula ihn aus seinen Gedanken. Mit stolz erhobenem Haupt ergriff sie seine Hand, führte ihn zum Tisch und deutete auf einen freien Stuhl rechts vom Kopfende, an dem Otto von Rahn Platz genommen hatte. »Setz dich doch. Möchtest du einen Appetitanreger?«, fragte sie. »Vielleicht ein Glas Champagner?«
»Die Franzmänner sind ein schreckliches Volk, doch ihre Weine sind nicht zu verachten«, posaunte der dicke Mann, der Isaak vorhin mit dem Auto hatte mitnehmen wollen und ihm nun direkt gegenübersaß. »Wie gut, dass die besten Anbaugebiete fest in unserer Hand sind. Die Champagne«, begann er aufzuzählen. »Die Côte d’Or, Burgund, Bordeaux … Wird Zeit, dass wir endlich auch die Côtes du Rhône in unsere Hände kriegen. Die machen dort einen ganz ausgezeichneten roten. Mögen Sie Wein?«
Er sah ihn fragend an, und Isaak nickte.
»Ich habe einen großen Weinkeller, in dem ein paar ganz besondere Raritäten lagern. Kommen Sie ruhig einmal vorbei, dann verkosten wir ein paar davon.«
Isaak fand den jovialen Ton unangenehm, den der Kerl ihm gegenüber anschlug. »Mein Rang und meine Position verlangen einen klaren Kopf. Ich trinke deshalb nur ganz selten und zu besonderen Anlässen.«
»Wie zum Beispiel heute.« Ursula stellte ein Champagnerglas vor Isaak und ließ sich rechts von ihm nieder. »Nun muss ich euch aber bekannt machen. Das ist Konstantin von Stroop«, stellte sie den beleibten Mann vor. »Er ist der Direktor der örtlichen Kartonagenfabrik. Neben ihm sitzen Oskar Hofmann«, fuhr sie mit der Vorstellungsrunde fort, »und seine bezaubernde Gattin Magda. Die beiden sind erst vor Kurzem nach Nürnberg gezogen, weil Herr Hofmann die Stelle des Gauamtsleiters angenommen hat. Vorher haben sie in Berlin gewohnt.«
Bei der Erwähnung der Hauptstadt setzte Isaaks Herz ein paar Schläge aus, doch die beiden lächelten ihn an. Er konnte keinen Argwohn in ihren Gesichtern entdecken.
»Endlich lernen wir uns persönlich kennen.« Oskar Hofmann hob sein Glas und prostete Isaak zu. »Heinrich hat mir schon viel von Ihnen erzählt.«
Heinrich. Damit meinte er wohl Heinrich Himmler, den Reichsführer SS und engen Vertrauten von Adolf Hitler. Isaak schluckte. »Sehr erfreut«, sagte er und trank einen Schluck Champagner. Der Alkohol beruhigte seine Nerven, und die Bläschen kitzelten angenehm an seinem Gaumen. »Wie gefällt es Ihnen in Nürnberg?«, versuchte er, das Thema auf vertrautes Terrain zu lenken.
»Ich finde es ganz wunderbar hier«, erklärte Magda Hofmann. »Das viele Grün, die freundlichen Menschen … Nur für unsere Tochter ist es noch schwer. Sie ist erst achtzehn, hat Heimweh und vermisst ihre Freunde.«
Irgendetwas an ihr erinnerte Isaak an seine Mutter. Magda Hofmann hatte etwas Warmes in der Stimme, Güte sprach aus ihren Worten, zudem hatte sie Grübchen in den Wangen und Lachfältchen, die wie Fächer von ihren äußeren Augenwinkeln ausstrahlten. Seine Mutter hatte einst genau dieselben gehabt, als sie noch gelacht hatte.
»Ach«, winkte ihr Mann ab. »Sie ist als Führerin im hiesigen Bund Deutscher Mädel aktiv. Sie wird schnell Anschluss finden. Apropos Heimweh ... Wann geht es für Sie zurück nach Berlin?«
»In Bälde«, hielt Isaak sich weiterhin bedeckt. »Es gibt hier noch ein paar letzte Dinge zu erledigen.«
»Sie sehen müde aus«, brachte Otto von Rahn sich in das Gespräch ein. »Gibt es vielleicht etwas, das Sie um den Schlaf bringt?« Er schaute Isaak so durchdringend an, dass dieser fröstelte.
Isaak, der tatsächlich seit Tagen an Schlaflosigkeit litt, war durchaus bewusst, dass er nicht gerade wie das blühende Leben aussah. »Ich … Ich mache mir Sorgen um meine Kameraden an der Front«, improvisierte er.
Von Rahn schnaubte verächtlich. »Was gibt es sich da zu sorgen? Die Wehrmacht ist auf dem Vormarsch. Unsere Jungs sind im Feld nicht zu schlagen.«
»Ich habe mich falsch ausgedrückt«, wiegelte Isaak ab. Zweifel am Endsieg waren etwas, das man auf keinen Fall äußern, ja nicht einmal zwischen den Zeilen andeuten durfte. Jegliche Bedenken galten als Hochverrat und wurden rigoros bestraft. »Ich mache mir Sorgen, dass die Truppen den Sieg ganz ohne mich erringen. Wie gern wäre ich bei ihnen. Am liebsten vor Moskau oder mit Rommel in der afrikanischen Wüste. Einmal dem Feind ins Auge blicken.« Isaak sah ihn direkt an.
»Das ehrt Sie«, sagte Oskar Hofmann. »Unser Sohn Hans dient in der 4. Panzerarmee.«
Konstantin von Stroop trank sein Glas leer und stellte es lautstark vor sich auf dem Tisch ab. »Sie sind doch dicke mit Himmler. Er kann sicher ein paar Hebel in Bewegung setzen. Wir leben in einer Zeit der Helden. Verwehren Sie sich nicht die Chance, auch einer zu werden.«
»Dein Einsatz hier an der Heimatfront ist mindestens genauso von Belang wie der Einsatz im Feld, auch wenn man dafür nicht so viele Orden bekommt.« Ursula streckte ihre Hand unter den Tisch und legte sie auf Isaaks Oberschenkel. »Was du hier leistest … dass du den Mörder von Lotte Lanner gefunden und Fritz Nosske überführt hast, das ist alles äußerst wichtig.«
»Wir müssen alle unseren Beitrag leisten«, sagte von Stroop. »Jeder auf seine Art und Weise.« Er verschränkte die Hände vor seinem Bauch und nickte selbstgefällig.
»Jeder von uns ist ein kleines Rädchen in einem großen Getriebe«, erklärte Oskar Hofmann. »Nur wenn wir alle perfekt ineinandergreifen, läuft die Maschine. Nur wenn kein Virus das System unterwandert und schwächt, kann der große Organismus überleben und prosperieren. Sie sind der Arzt, der die Viren – in diesem Fall kriminelle Subjekte – ausmerzt. Seien Sie stolz darauf.«
Isaak nickte und trank noch einen Schluck Champagner.
»Wie geht es Robert? Warum ist er heute nicht hier?«, durchbrach Ursula die unangenehme Stille, die entstanden war. »Das ist von Stroops Sohn«, flüsterte sie Isaak zu.
»Seit er aus dem Krieg zurück ist, geht es ihm ganz ausgezeichnet. Seine politische Karriere blüht und gedeiht. Er ist auf dem besten Weg, der neue Reichsstatthalter zu werden.« Väterlicher Stolz brachte von Stroops Augen zum Leuchten.
»Endlich!« Ursula klatschte in die Hände, als die Haushälterin mit einem großen Tablett durch die Tür kam. »Es gibt Hummer, und zwar den guten, den einheimischen, den aus Helgoland.«
Damit begann das Diner, und Isaak, der sich mittlerweile an nichtkoschere Speisen gewöhnt hatte, versuchte, so viel wie möglich zu essen. Es war wichtig, Kalorien zu sich zu nehmen und Kräfte zu sammeln. Sobald er nämlich in Berlin untergetaucht war, würde es ihm wieder an allem mangeln. Aus den Tischgesprächen, die sich um Eintopfsonntage und den Volkswagen drehten, hielt er sich heraus. Seine volle Aufmerksamkeit war darauf gerichtet, einen Weg zu finden, unbemerkt einen Einblick in von Rahns Unterlagen zu erhaschen.
Seit einiger Zeit ging das Gerücht um, dass eine rüstungstechnische Wende bevorstand, die den Krieg zugunsten der Nazis entscheiden könnte. Man munkelte etwas von einem neuen Panzer und davon, dass kein Geringerer als Otto von Rahn den Zuschlag für die Konstruktion der Motoren bekommen hatte. Alles, was er über die neue Wunderwaffe in Erfahrung bringen konnte, würde dem Widerstand helfen, einen Sieg der Wehrmacht zu verhindern.
»… Judenfrage. Die in Berlin werden das schon irgendwie richten«, sagte von Stroop. »Meinen Sie nicht auch, Weissmann?«
»Ich stimme Ihnen voll und ganz zu.« Isaak, der keine Ahnung hatte, wovon der Kerl sprach, sah demonstrativ auf seine Armbanduhr, eine alte Junghans, die er von seinem Großvater geerbt hatte. »Apropos Berlin. Ich müsste dringend im Reichssicherheitshauptamt anrufen.«
»In der Halle steht ein Apparat«, sagte Ursula.
»Es handelt sich um ein vertrauliches Gespräch.« Isaak sah Otto von Rahn auffordernd an.
»Vertraulich. Soso.« Von Rahn blähte die Nasenflügel.
»Vati! Ich weiß wirklich nicht, was heute mit dir los ist.« Ursula wandte sich an Isaak. »Du kannst natürlich gern den privaten Apparat in seinem Büro benutzen. Die Treppe hoch und dann gleich die erste Tür rechts.« Sie wandte sich an die anderen Gäste. »Wir können das leidige Judenthema währenddessen bei einem Glas Cognac im Raucherzimmer erörtern. Was meinen Sie?«
»Exzellente Idee.« Konstantin von Stroop fischte eine Zigarre aus der Innentasche seines Sakkos und stand auf.
Isaak folgte den anderen bis in die zentral gelegene Vorhalle und stieg dann bewusst gelassen die Treppe zur oberen Etage hinauf. Nachdem er von Rahns Privatzimmer betreten hatte, schloss er die Tür und sah sich um: Der Raum war schlichter eingerichtet als der Rest des Hauses, einfach und zweckmäßig. Durch das große Fenster hatte man einen schönen Blick in den riesigen Garten, der von einer mannshohen Hecke umzäunt wurde. Es herrschte absolute Ordnung. Nirgendwo gab es Staub, sämtliche Gegenstände – auch jene auf dem massiven Mahagoni-Schreibtisch – waren bündig ausgerichtet. Selbst die Anschlussschnur des schwarzen Telefons war geradegerückt worden.
Vorsichtig öffnete Isaak die Türen eines schmalen Jugendstil-Kastens, der seitlich neben dem Schreibtisch stand. Blanker Stahl blitzte ihm entgegen – ein echter Pohlschröder. Der Panzerschrank mit Zahlenschloss war absolut einbruchsicher. »Bitte lass es Ursulas Geburtstag sein«, murmelte er leise und fasste an die Drehscheibe, als er ein gedämpftes Geräusch vernahm. Es hörte sich an, als hätte irgendjemand von außen sachte über die Tür gestrichen. Er hielt den Atem an und lauschte. Nichts. »Aber natürlich werde ich mich darum kümmern«, sagte er laut und barsch, wobei er sich den Telefonhörer ans Ohr hielt, während er geräuschlos die Nummern zwei, elf, neunzehn und zwölf einstellte und anschließend den Griff betätigte. »Was auch immer Sie anordnen. Ich vertraue voll und ganz auf Ihren Ratschluss … Ja, stellen Sie mich gern durch.«
Sein Herz sackte ab, als die schwere Tür sich keinen Millimeter bewegte. Wenn der Code nicht Ursulas Geburtsdatum war, was dann? Es gab exakt 9 999 999 mögliche Kombinationen. »Heil Hitler«, wollte er den fingierten Anruf gerade enttäuscht beenden, als ihm eine Idee kam. Zwanzig, vier, achtzehn, neunundachtzig – der Geburtstag des Führers. Er gab die Zahlenfolge ein, und tatsächlich ließ sich die Tür dieses Mal öffnen. Wenn Ursula das wüsste … »Nein, ich bin noch hier«, sagte er. »Aber ja, selbstverständlich …« Er holte sämtliche Dokumente aus dem Tresor und breitete sie vor sich auf dem Tisch aus.
»Wenn Sie wünschen, werde ich umgehend zurückkehren … Ja … Befehl ist Befehl …« Er blätterte durch die Papiere und lächelte, als er endlich fand, wonach er gesucht hatte: eine Blaupause des neuen Panzermodells, das eine sechzig Millimeter dicke Armierung aufwies und laut Beschreibung trotz seines immensen Gewichts auf eine Spitzengeschwindigkeit von fünfundfünfzig Stundenkilometern kommen sollte. Er faltete den Plan zusammen, steckte ihn ein und verschloss den Tresor. Anschließend bellte er ein »Wir sehen uns in Berlin!« ins Telefon und ließ den Hörer lautstark auf die Gabel knallen. Danach schlich er zur Tür, riss sie auf und konnte gerade noch sehen, wie ein Schatten davonhuschte. Sein Herzschlag beschleunigte.
Nicht mehr lange, rief er sich in Erinnerung.
Er würde sich mit einer Ausrede entschuldigen, von Rahns Villa vorzeitig verlassen, ins Hotel fahren und Clara anrufen. Sie würde in die Wege leiten, dass ein Kontaktmann vom Widerstand ihn abholte und fortbrachte.
Isaak fasste an die Blaupause, die in der Innentasche seines Jacketts steckte, strich über das dünne Papier und hoffte, dass er nun endlich wieder zur Ruhe kommen würde. Er war müde. Unendlich müde und ausgebrannt. Seit Tagen hatte er nicht mehr richtig geschlafen. Sobald sich seine Lider senkten, sah er die Gesichter jener Männer, Frauen und Kinder vor sich, die vor etwas mehr als drei Wochen von den Nazis in das Lager Izbica deportiert worden waren. Ihre Augen waren voller Todesangst und grenzenloser Traurigkeit gewesen, während man sie wie Vieh zur Schlachtbank getrieben hatte.
Scham überkam ihn. Er fühlte sich schuldig – jeden Tag aufs Neue –, weil er noch lebte, während man so viele andere Juden in den Tod schickte.
Während er überlegte, welche Ausrede er am besten für seinen verfrühten Abgang vorschieben sollte, hörte er von unten Stimmen. Instinktiv blieb Isaak am oberen Treppenabsatz stehen.
»Tut mir leid, dass ich Sie schon so früh verlassen muss«, hörte er Konstantin von Stroop sagen. »Aber ich habe noch ein paar dringende Dinge zu erledigen.«
»Operation Georg läuft also?«, fragte Otto von Rahn.
Von Stroop lachte selbstgefällig. »Und wie sie das tut. Der Führer wird sich noch umschauen, was ein einfacher Kartonagenfabrikant alles für den Endsieg leisten kann. Wenn das nicht für einen Orden reicht, dann weiß ich auch nicht.«
Isaak blieb wie festgefroren stehen, atmete so flach wie möglich und hoffte, dass sein lauter Herzschlag ihn nicht verriet. Inzwischen steigerte sich das höllische Trommeln des Herzens. Es wurde jede Minute schneller und schneller und lauter und lauter …, erinnerte er sich an eine Passage aus einer Kurzgeschichte von Edgar Allan Poe. Operation Georg. Was es damit wohl auf sich hatte?
»Wenn alles so klappt, wie Sie es geschildert haben, ist sogar der Deutsche Orden der NSDAP drin. Wann genau geht es los?«
»Ein paar letzte Details gehören noch geklärt, dann schlagen wir zu.«
»Erzählen Sie mir mehr«, forderte Otto von Rahn.
Ja genau, dachte Isaak. Erzählen Sie uns alles, was der Widerstand wissen muss.
»Beim nächsten Mal. Ich bin spät dran. Eines ist jedenfalls klar: Die Briten werden gar nicht wissen, wie ihnen geschieht. In ein paar Wochen gehört uns die Insel und spätestens im Sommer die ganze Welt.«
3
Der Nieselregen, der Nürnberg den ganzen Nachmittag immer wieder mit feinen Regentropfen überzogen hatte, war endlich abgeklungen. Dennoch lagen die Straßen wie ausgestorben. Stille umgab die alten Fachwerkhäuser, die Türme der Kaiserburg zeichneten sich schemenhaft vor dem grauen Abendhimmel ab, und die schmale Mondsichel, die aus nicht mehr als einer dünnen gebogenen Linie bestand, blitzte alle paar Minuten zwischen den dahinziehenden Wolken auf.
Gisela Hofmann stand am offenen Fenster im ersten Stock und blickte hinaus in die Nacht. Der Krieg, der die Welt fest in seinem Griff hielt, schien weit fort, und Nürnberg wirkte wie eine Oase inmitten von Chaos und Schmerz – doch nicht für sie. Für sie war diese vermaledeite Stadt ein Ort des Kummers.
Der Nürnberger Beobachter hatte vermeldet, dass die vorrückende Wehrmacht die 33. Armee der Russen aufgerieben und vernichtet hatte. Die deutschen U-Boote hatten die englische Flotte, Stolz des britischen Imperiums, in ihre Schranken gewiesen, und außerdem stand morgen der Geburtstag des Führers an. Dies alles waren Gründe, um zu jubeln und mit frohem Blick in die Zukunft zu sehen, doch in ihr wollte sich keine freudige Regung einstellen.
Sie vermisste ihre Freundinnen in Berlin, sehnte sich nach ihrer alten Heimat, und dann war da auch noch die Sache mit Josef …
Sie wollte das Fenster gerade schließen und zu Bett gehen, als plötzlich eine Melodie an ihr Ohr drang. Schwere, anmutige Töne in cis-Moll: Beethovens Mondscheinsonate. Wer auch immer hier spielte, war ein Virtuose.
Die wohligen Klänge streichelten ihre Seele und beruhigten ihr Gemüt, weshalb sie das Fenster einen Spaltbreit offen ließ, während sie sich entkleidete, ihr Nachthemd überstreifte, das Licht löschte und sich ins Bett legte.
Mutter und Vater würden bald nach Hause kommen, und sie hatte keine Lust, mit den beiden zusammenzutreffen. Sie hatten sie aus ihrem gewohnten und geliebten Umfeld gerissen und nach Nürnberg verschleppt, in dieses elende Provinznest, und dann hatten sie mit ihrer Borniertheit auch noch ihr letztes bisschen Freude im Keim erstickt.
Die Klaviersonate wechselte vom Adagio ins Allegretto, und Gisela schloss die Augen. Sie wusste, wo Mutter das Haushaltsgeld verwahrte … Gemeinsam mit dem Inhalt von Vaters Brieftasche und den Reichsmark, die sie von ihrem Taschengeld zusammengespart hatte, würde sie einige Zeit über die Runden kommen. Sollte sie es wagen, von zu Hause abzuhauen?