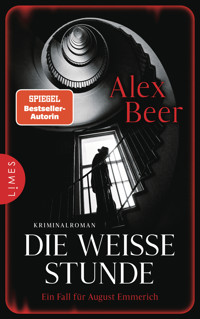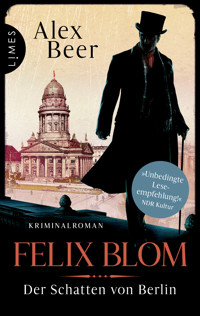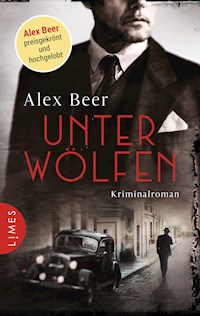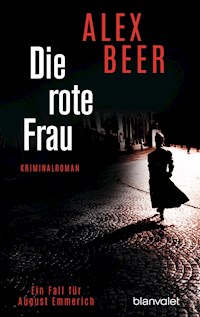9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Limes Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Kriminalinspektor-Emmerich-Reihe
- Sprache: Deutsch
Er ist dem Grauen der Schlachtfelder entkommen, doch in den dunklen Gassen Wiens holt ihn das Böse ein ...
Wien, kurz nach dem Ende des Ersten Weltkriegs: Der Glanz der ehemaligen Weltmetropole ist Vergangenheit, die Stadt versinkt in Hunger und Elend. Polizeiagent August Emmerich, den ein Granatsplitter zum Invaliden gemacht hat, entdeckt die Leiche eines angeblichen Selbstmörders. Als erfahrener Ermittler traut er der Sache nicht über den Weg. Da er keine Beweise vorlegen kann und sein Vorgesetzter nicht an einen Mord glaubt, stellen er und sein junger Assistent selbst Nachforschungen an. Eine packende Jagd durch ein düsteres, von Nachkriegswehen geplagtes Wien beginnt, und bald schwebt Emmerich selbst in tödlicher Gefahr...
Mord auf Wienerischem Pflaster – August Emmerich ermittelt:
Band 1: Der zweite Reiter
Band 2: Die rote Frau
Band 3: Der dunkle Bote
Band 4: Das schwarze Band
Alle Bände sind eigenständige Fälle und können unabhängig voneinander gelesen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 422
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Buch:
Wien, kurz nach dem Ende des Ersten Weltkriegs: Der Glanz der ehemaligen Weltmetropole ist Vergangenheit, die Stadt versinkt in Hunger und Elend. Polizeiagent August Emmerich, den ein Granatsplitter zum Invaliden gemacht hat, entdeckt die Leiche eines angeblichen Selbstmörders. Als erfahrener Ermittler traut er der Sache nicht über den Weg. Da er keine Beweise vorlegen kann und sein Vorgesetzter nicht an einen Mord glaubt, stellen er und sein junger Assistent selbst Nachforschungen an. Eine packende Jagd durch ein düsteres, von Nachkriegswehen geplagtes Wien beginnt, und bald schwebt Emmerich selbst in tödlicher Gefahr …
Autor:
Alex Beer, geboren in Bregenz, hat Archäologie studiert und lebt in Wien. Der zweite Reiter ist der Auftakt zu einer spannenden Reihe um Polizeiagent August Emmerich.
Mehr Informationen unter: www.alex-beer.com
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag
ALEX BEER
DER
ZWEITE
REITER
Ein Fall für
August Emmerich
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2017 by Alex Beer
Dieses Werk wurde vermittelt durch die
Literaturagentur Kai Gathemann
© 2017 by Limes in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Margit von Cossart
Covergestaltung: www.buerosued.de Covermotiv: ullstein bild/IBERFOTO
KW · Herstellung: sam
Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach
ISBN 978-3-641-19292-1V003
www.limes-verlag.de
»Der Krieg hat einen langen Arm.
Noch lange, nachdem er vorbei ist,
holt er sich seine Opfer.«
Martin Kessel
1
Wien, im November 1919
»Jost! Gefreiter Jost!«, ertönte es aus dem Unterholz, doch er ignorierte das Rufen. Er wusste, dass kein lebender Mensch nach ihm verlangte. Die Stimme existierte nur in seinem Kopf. Gemeinsam mit all den anderen.
Obwohl der Krieg bereits seit einem Jahr vorüber war, wollten die Erinnerungen daran nicht verblassen. Wenn er die Augen schloss, sah er sie so gestochen scharf vor sich, als wäre es erst gestern gewesen: die Toten, die Sterbenden, die Verkrüppelten. Er hatte selbst den Angstschweiß, der sich mit dem Rauch der Granaten vermischte, noch immer in der Nase. Aber vor allem hallten die Geräusche der Gefechte unentwegt in seinen Ohren, die gebrüllten Kommandos, die Trommelfeuer, die Detonationen, die Schmerzensschreie. Sie hatten in seinem Kopf ein neues Zuhause gefunden und von seinem Körper Besitz ergriffen.
Nein, er war niemals zurückgekehrt von den Schlachtfeldern Galiziens.
Dietrich Jost starrte auf seine Hände, die unkontrolliert zuckten, und blickte auf seine Füße, denen es schwerfiel, über das unwegsame Gelände zu gehen. Vor dem Krieg war er ein gut situierter Tierpfleger gewesen, jetzt war er ein Nichts. Ein Kriegszitterer. Ein Stotterer. Ein bemitleidenswerter Krüppel, der im Armenhaus leben und um Essen betteln musste. Einer, der von seinem Land, für das er alles gegeben hatte, verraten worden war. Die Beamten bezeichneten ihn als Neurotiker, als hysterischen Simulanten, nur damit sie ihm keine Kriegsopferrente bezahlen mussten. War denn ein amputiertes Bein mehr wert als eine gebrochene Seele?
»Jost! Gefreiter Jost!«
Mit schlotternden Knien, aber entschlossenem Schritt lief er tiefer in den Wald hinein, ließ den schmalen Trampelpfad, auf dem er bisher gegangen war, hinter sich und begab sich ins Dickicht. Hier irgendwo musste sich die Jagdhütte befinden, in der Geld und Papiere auf ihn warteten. Damit würde er sich einen Passagierschein für die Überfahrt von Triest nach Santos besorgen und ein neues Leben in Übersee beginnen. Brasilien würde seine Rettung sein. Das Rauschen des Meeres würde die Stimmen aus seinem Kopf spülen und die Sonne all die schrecklichen Bilder ausbleichen.
Im Büro der Auswanderungsagentur hatte er Fotografien von schönen, wohlgenährten Weibern gesehen, die pausbäckige Kinder auf ihren vollen Hüften und ein Lächeln auf den Lippen trugen. Er würde eine Frau finden und sein altes Leben hinter dem Horizont lassen. In Wien, diesem Drecksloch.
Der Kaiser war ins Exil gegangen, die Kronländer hatten sich abgespalten, und Österreich war nur mehr ein klägliches Überbleibsel, das kaum lebensfähig war. Genau wie seine Einwohner. Es mangelte an allem. An Lebensmitteln, an Kohle, an Seife und Kleidung. Die Menschen hungerten, froren und stanken. Sie prügelten sich um faules Pferdefleisch oder schimmlige Kartoffeln und teilten sich mit Flöhen ihre Betten. Es gab keine Arbeit und keine Medikamente, dafür umso mehr Verbrechen und Krankheiten.
Die ehemals so glanzvolle Reichsresidenz war zu einem schmutzigen Moloch verkommen, dem er bald entfliehen würde. Er war in Galizien gestorben und würde in Südamerika wiedergeboren werden.
»Jost! Bist du taub, oder was?«
Die Stimme war jetzt ganz nah. Neben ihm. Und sie war real. Genauso real wie der kalte Stahl der Pistole, deren Lauf sich gegen seine Schläfe presste.
»B… B… Bitte n… nicht«, presste Jost hervor.
»Ich habe gehört, du möchtest an einen schöneren Ort gelangen. Und ich bin hier, um dir dabei zu helfen.«
Ein lauter Knall zerriss die Stille des Waldes, und die Stimmen in Dietrich Josts Kopf verstummten für immer.
2
Rayonsinspektor August Emmerich saß in der Tramway, die von der Wiener Innenstadt in Richtung Hütteldorf fuhr, zog seine Schiebermütze ins Gesicht, verschränkte die Arme vor der Brust und lehnte sich zurück. Er war müde – kein Wunder, immerhin war es schon spät, und er hatte in der vergangenen Nacht kaum ein Auge zugetan. Die Kinder seiner Lebensgefährtin Luise, die ihren Mann an den Krieg verloren hatte, waren jetzt, da es kaum gelang, die Wohnung ausreichend zu heizen, ständig krank. Sie husteten sich die Lunge aus dem Leib und weinten viel. Drei kleine Menschlein, die sich eine schlechte Zeit ausgesucht hatten, um geboren zu werden. Andererseits: Gab es je eine gute Zeit dafür?
Er erlaubte seinen schweren Lidern, sich kurz zu senken, und genoss die angenehme Temperatur. Seit Kurzem war es möglich, die Straßenbahnen durch Strom aus den Oberleitungen zu beheizen, und der Schaffner meinte es an diesem Tag besonders gut. Wahrscheinlich wusste er, dass auf die Mehrzahl der Fahrgäste ein kaltes Bett in einer kalten Wohnung wartete. Kohle war rar und Einfeuern ein Luxus, den nur die wenigsten sich leisten konnten. Umso willkommener war diese kurze, warme Auszeit.
Emmerich gähnte und lehnte seinen Kopf gegen die Fensterscheibe, hinter der gerade das Casino Baumgarten vorbeizog, das mit seiner prunkvollen Fassade an bessere Zeiten erinnerte. Was die heutige Nacht wohl noch für Überraschungen bereithielt? Er warf einen Blick auf Veit Kolja, den Mann, dem er seit mehr als drei Monaten auf der Spur war und der jetzt zwei Reihen vor ihm saß – es würde einzig und allein von ihm, Inspektor Emmerich, abhängen, ob dem Ganoven endlich das Handwerk gelegt werden konnte, und es sah gut aus. Kolja hatte nämlich einen großen Jutesack auf dem Schoß liegen, und Emmerich hoffte, dass er zu einem seiner Lager fuhr.
Lebensmittel, Kleidung und Medikamente waren knapp, und Kolja war einer von denen, die aus der Not der Menschen Profit schlugen. Er war der Anführer eines Schleichhändlerrings, der an geheimen Orten Vorräte bunkerte und diese gegen Gold, Schmuck und andere Wertgegenstände tauschte.
Wenn diese Zeit der Not und Entbehrungen endlich zu Ende war, würde Kolja unsäglich reich sein oder aber, wenn es nach Emmerich ging, im Gefängnis sitzen. Im hintersten, dunkelsten, feuchtesten Loch. Für immer. Denn was gab es Schäbigeres, als sich an Leid und Elend zu bereichern?
In den vergangenen Wochen hatte er alles darangesetzt, Kolja und seine Männer dingfest zu machen. Er hatte sie verfolgt und observiert, sich bei Regen und Kälte die Beine in den Bauch gestanden, sogar den einen oder anderen Informanten geschmiert. Es war mühsam und anstrengend gewesen, doch es hatte sich rentiert. Er war ganz nah dran. Das spürte er. Die Sprengung des Schleichhändlerrings und die Verhaftung der Verantwortlichen standen kurz bevor und damit auch seine Beförderung … Wenn nicht irgendetwas den Fall in letzter Minute vermasselte. Oder besser gesagt, irgendjemand.
Denn sein neuer Vorgesetzter, Abteilungsinspektor Leopold Sander, ein ehemaliger hochdekorierter Offizier der K.-u.-k.-Armee, der viel Ahnung von Kriegsführung, aber keinen blassen Schimmer von Polizeiarbeit hatte, war auf die glorreiche Idee gekommen, ihm einen Assistenten beizustellen – Ferdinand Winter, einen Neuling, der seine Ausbildung gerade beendet hatte und mehr Bürde denn Entlastung darstellte.
Winter, der neben ihm saß, wie er selbst natürlich in Zivil, brachte mit seiner puren Anwesenheit alles in Gefahr. Er verbreitete eine Aura der Nervosität. Seine Beine zappelten, und seine Finger tippten auf das Holz der Sitzbank, als wollte er einen wirren Morsecode hinaus in die Nacht schicken. Das lenkte die Aufmerksamkeit der anderen Fahrgäste auf ihn. Die meisten von ihnen waren Fabrikarbeiter, die sich nach einer langen und kräftezehrenden Schicht auf dem Heimweg befanden. Ein derartiges Übermaß an Energie, wie Winter es gerade an den Tag legte, fiel auf. Und Auffallen war bei der Überwachung eines Verdächtigen so ziemlich das Letzte, was passieren durfte.
»Sei ruhig«, zischte Emmerich, der sich weigerte, den Grünling zu siezen. Respekt musste man sich erst verdienen. Er warf dem jungen Mann einen bösen Blick zu.
Winter hatte große, strahlend blaue Augen, glänzendes blondes Haar, eine makellose Haut und weiche Hände. Er drückte sich stets gewählt aus. Solche wie er waren der Arbeit nicht gewachsen. Solche wie er waren der Zeit nicht gewachsen. Emmerich kannte derartig zarte, feine Burschen wie Winter aus dem Waisenhaus, in dem er seine Kindheit verbracht hatte. Je lieber und unschuldiger sie waren, desto höher standen die Chancen, dass sie nicht überlebten.
Ferdinand Winter war ganz eindeutig einer von ihnen. Einer von den Lieben und Unschuldigen. Soweit er das mitbekommen hatte, war er noch dazu ein verhätschelter Sohn aus einer reichen Wiener Familie, deren Geld nun nichts mehr wert war. Die Inflation holte sich, was der Krieg übrig gelassen hatte, weshalb der Junge sich mit der Realität auseinandersetzen musste. Das war prinzipiell nichts Schlechtes, fand Emmerich – wenn es bloß nicht in seinen Zuständigkeitsbereich gefallen wäre.
»Satzberggasse«, kündigte der Schaffner die vorletzte Station an, doch Kolja blieb ungerührt sitzen. Wo wollte der Mistkerl hin?
»Beruhige dich endlich!«, flüsterte Emmerich, da Winter schon wieder hibbelig wurde. »Wir fahren an den Stadtrand, nicht an die Front.«
»Hütteldorf, Bujattigasse«, rief der Schaffner kurze Zeit später. »Endstation. Bitte alle aussteigen.«
Die verbliebenen Fahrgäste erhoben sich langsam und widerwillig. Die warme Auszeit war vorbei, und draußen wartete das Leben.
Die beiden Polizisten reihten sich in die Schlange ein, die sich schleppend durch die Schiebetür auf die hintere Plattform der Tramway schob und die zwei Stufen auf die Straße hinunterstieg. Von dort strömten die Menschen in alle Himmelsrichtungen.
Emmerich legte Winter von hinten eine Hand auf die Schulter, um ihn davon abzuhalten, sich zu nah an Koljas Fersen zu heften. »Langsam«, sagte er, nachdem der Verdächtige außer Hörweite war. »Der Kerl ist ein Profi. Am besten, du bleibst drei Schritte hinter mir.«
Aus sicherem Abstand folgten sie Kolja, der direkt auf das Gasthaus Prilisauer zusteuerte, was Emmerich entgegenkam, denn er konnte jetzt einen Schnaps vertragen. Gut und gerne auch zwei.
Doch der Schleichhändler hatte andere Pläne. Kurz vor dem Wirtshaus wandte er sich nach links, lief durch den Ferdinand-Wolf-Park am Halterbach entlang, bis zu dessen Mündung in den Wienfluss, passierte die Bräuhausbrücke und ließ jegliche Zivilisation hinter sich, indem er rechts abbog.
»Ist alles in Ordnung? Sie humpeln«, sagte Winter etwas zu laut von hinten. Emmerich stellte sich taub. »Hier ist ja nur Wald«, hielt Winter dann das Offensichtliche fest, und Emmerich musste sich zurückhalten, um ihm nicht an Ort und Stelle das Maul zu stopfen.
»Warte hier«, ordnete er an, nachdem Kolja samt Jutesack über die beschädigte Mauer geklettert war, die sich rund um den sogenannten Lainzer Tiergarten, ein weitläufiges Gebiet im östlichen Teil des Wienerwalds, erstreckte. »Und rühr dich nicht vom Fleck.« Er kam sich mehr wie eine Kinderfrau als wie ein Rayonsinspektor erster Klasse vor.
»Ist ja gu …«, setzte Winter an, hielt inne und presste die Lippen aufeinander.
Emmerich nickte. Zumindest lernte der Junge schnell.
Er kontrollierte seine Waffe, eine Steyr-Repetierpistole, vergewisserte sich, dass sein Schlagring griffbereit war, und sprang über die Mauer. Als er auf der anderen Seite aufkam, musste er sich zusammenreißen, um nicht vor Schmerz aufzustöhnen. In seinem rechten Bein steckte seit der Schlacht von Vittorio Veneto ein Granatsplitter, der nicht entfernt werden konnte und der ihm ständig Probleme bereitete. In den letzten Tagen war es so schlimm wie nie zuvor. Arthrofibrose hatten die Ärzte diagnostiziert. Ein elegantes Wort für einen kläglichen Zustand.
Emmerich massierte sein Knie, das sich durch die Vernarbung des Bindegewebes immer mehr versteifte, raffte sich hoch und stützte sich an der Mauer ab. Gut, dass er Winter zurückgelassen hatte. Niemand sollte etwas von seiner Behinderung merken, und der Kleine war schon misstrauisch geworden. Er konnte es sich nicht leisten, wegen erkannter Untauglichkeit in den Innendienst versetzt zu werden. Jetzt, da er sich um Luise und ihre Kinder kümmerte, brauchte er die Indagationszulagen. Dazu kam, dass er gerade erst sechsunddreißig Jahre alt geworden war und sich beim besten Willen nicht vorstellen konnte, den Rest seiner Karriere als Amtsdiener zu verbringen. Dafür war er nicht geschaffen. Er war Polizeiagent. Er jagte Verbrecher, und zwar in natura, nicht auf dem Papier. Außerdem war er nicht bereit, sein großes Ziel, eines Tages in die Abteilung »Leib und Leben« aufgenommen zu werden, aufzugeben. Die Männer, die dort unter der Leitung des berühmten Carl Horvat arbeiteten, waren die oberste Elite des Polizeiapparats. Sie ermittelten in sämtlichen Fällen, in denen es um Mord und schwere Delikte gegen die körperliche Integrität ging. Seit er denken konnte, wollte er zu ihnen gehören, und er würde sich so kurz vor dem Ziel nicht aufhalten lassen. Auch nicht durch sein Bein.
Emmerich fasste an seinen Glücksbringer, einen silbernen Anhänger, der an einer Lederschnur um seinen Hals hing, biss die Zähne zusammen und humpelte in den Wald. Kolja hatte zum Glück eine Lampe angezündet, von deren Schein er sich leiten lassen konnte, und gottlob dauerte die Verfolgung nicht lange. Bereits nach wenigen Metern bewegte das Licht sich nicht mehr, und Emmerich bezog hinter einem dicken Baum Stellung. Was wollte der Schleichhändler hier nur? Es gab weit und breit keine Bunker oder Ähnliches, das als Lager hätte dienen können.
Kolja begann ein Lied zu pfeifen, stellte den Sack auf den Boden und holte etwas heraus. Eine Axt.
Emmerichs Magen verkrampfte sich. Aber nicht aus Furcht oder Hunger, sondern weil ihm dämmerte, weswegen Kolja hergekommen war. Nicht, um seinen Geschäften nachzugehen, sondern um sich Brennholz zu beschaffen.
Während Kolja auf eine dünne Buche einschlug, nutzte der enttäuschte Emmerich die Gelegenheit zurückzuschleichen.
»Falscher Alarm«, zischte er und schwang sein schmerzendes Bein über die Mauer. »Winter?« Der Junge stand nicht mehr dort, wo er hätte stehen sollen. »Winter?«
Emmerich blieb auf der Mauerkrone sitzen und ließ seinen Blick schweifen. Er hatte gleich gewusst, dass sein neuer Assistent Ärger bedeutete. Was sollte er jetzt tun? Dieser elende Debütant. Wo war er nur geblieben?
Ein Aufschrei hinter ihm beantwortete die Frage.
»Winter!«
Emmerich sprang wieder von der Mauer, ignorierte den brennenden Schmerz, der durch seinen Körper schoss, und hinkte in die dunkle Nacht, die nur spärlich vom Mondlicht erhellt wurde.
War Kolja etwa doch nicht allein hergekommen? War der unerfahrene Winter von den Schleichhändlern enttarnt und verschleppt worden? Hatte ihn ein Tier angefallen? Oder hatte er sich mit anderen Brennholzsammlern angelegt?
Eine Unebenheit ließ Emmerich straucheln und brachte seinen Gedankenstrom zum Abreißen. Er ruderte mit den Händen durch die Luft, fand nichts, an dem er sich hätte festhalten können und fiel mit dem Gesicht voran in den kalten Matsch.
Der Geruch von Erde und der metallene Geschmack von Blut in seinem Mund riefen ein Stakkato von Erinnerungen in ihm hervor. Bebender Boden, donnernde Kanonen, splitternde Helme und der schrecklichste Konflikt von allen: Überlebenstrieb gegen Befehlsgewalt. Er musste sich zusammenreißen. Er musste los. Musste auf. Musste weiter. Voran. Niemals aufgeben. Niemals kapitulieren.
Er erschrak, als ihn plötzlich jemand am Arm packte und hochzog.
»Verdammt, Winter«, wollte er loswettern, als er sah, um wen es sich handelte, hielt jedoch inne, als er bemerkte, dass die Hände des jungen Mannes blutverschmiert waren. »Was ist passiert?«
Winter drehte sich um und zeigte in Richtung Waldrand. »Sie müssen mitkommen.«
Nachdem er sich versichert hatte, dass der neue Assistent unversehrt war, klopfte Emmerich sich den Schmutz von der Hose, rückte seine Mütze zurecht und lauschte. Stille. Kolja hatte mit seiner Arbeit aufgehört.
»Wohin?«, flüsterte er.
Winter bedeutete ihm zu folgen und lief los. Mitten hinein ins Unterholz, jedoch nicht in Koljas Richtung.
Der Junge ging schnell, mit großen, eiligen Schritten. Er ließ sich weder von dem unebenen Untergrund noch von tief hängenden Ästen irritieren. Immer weiter, immer tiefer ins Dickicht hinein lief er, bis die Bäume so dicht standen, dass man die Hand vor Augen nicht mehr sehen konnte.
Emmerich kam kaum nach, wollte sich aber nicht die Blöße geben, um eine langsamere Gangart zu bitten. Er war heilfroh, als Winter endlich stehen blieb. »Und?«
Winter antwortete nicht, sondern schaute sich suchend um. »Darf ich?« Er hielt eine kleine Feldtaschenlampe hoch.
Emmerich überlegte und nickte schließlich. Sollten sie Kolja oder irgendeiner anderen Menschenseele über den Weg laufen, so würde er einfach behaupten, sie seien arme Leute auf der Suche nach etwas Brennholz für ihren Ofen.
Winter schaltete die Lampe an und ließ das Licht über den Waldboden wandern. »Es muss hier irgendwo gewesen sein«, sagte er. »Ich habe Geräusche gehört und wollte nach Ihnen sehen …«
»Nach mir sehen?«, unterbrach Emmerich.
Winter nickte mit der Ernsthaftigkeit eines Kindes. »Dabei bin ich über eine Wurzel gestolpert und auf ihn draufgefallen.«
»Auf wen?«
»Auf ihn.«
Der wandernde Lichtkegel blieb endlich stehen und erleuchtete wie ein Theaterscheinwerfer ein gar grässliches Bühnenbild. Der Hauptdarsteller des makabren Szenarios war ein toter Mann, dessen bleiches Antlitz von geronnenem Blut umrahmt wurde, das von seiner Beschaffenheit her mehr an Teer als an den Saft des Lebens erinnerte. Zähflüssig, klebrig und übel riechend.
»Hast du noch nie einen Toten gesehen?«, fragte Emmerich, als er Winters Gesicht sah, das noch blasser als das der Leiche war. Die Frage war rhetorisch gemeint, weshalb er sich beinahe verschluckte, als der junge Mann stumm den Kopf schüttelte. Polizeiagent Ferdinand Winter musste der einzige Mensch in diesem Land sein, der noch nie einen Toten gesehen hatte. »Wo um Gottes willen hast du die letzten fünf Jahre verbracht?« Dieses Mal war die Frage ernst gemeint.
»Im K.-u.-k.-Telegraphen-Korrespondenz-Bureau.«
Emmerich verkniff sich jeglichen Kommentar, nahm Winter wortlos die Lampe ab, ging in die Knie und leuchtete die Leiche von unten nach oben ab. Von den ausgetretenen Schuhen mit den papierdünnen Sohlen über die abgewetzte Hose, den Strick, der als Gürtelersatz diente, die Jacke, die fast nur aus Flicken und Löchern bestand, bis hin zu den glasigen Augen, die in die Ferne zu starren schienen. Ein Blick in die Ewigkeit, den Emmerich nur zu gut kannte – er hatte ihn in seinem Leben schon viel zu oft gesehen.
An der rechten Schläfe hatte der Mann ein Einschussloch und auf der linken eine große Austrittswunde. Emmerich trat einen Schritt zurück, suchte den Boden rund um den Toten ab und fand, was er vermutet hatte: eine Waffe. Genauer gesagt eine Steyr M1912, die Standardpistole der K.-u.-k.-Armee.
Mit geübtem Griff durchsuchte er die Kleider des Mannes, steckte die Pistole ein und wandte sich an Winter. »So weit, so gut«, sagte er. »Fahren wir wieder in die Stadt.«
»Aber …«, setzte Winter an, doch Emmerich ließ ihn einfach stehen und marschierte zurück zur Tramwayhaltestelle.
»Wir können ihn doch nicht einfach liegen lassen. Wir müssen doch irgendwas tun.«
Emmerich unterdrückte ein Seufzen. »Willst du ihn etwa mit der Elektrischen transportieren? Du kannst gern zurücklaufen und ihn hertragen. Dann fahren wir zu dritt.«
Winter starrte betreten auf den Boden. »Tut mir leid«, sagte er. »Ich muss wohl noch viel lernen.«
»Am besten wir fangen gleich damit an.« Emmerich holte eine kleine braune Karte aus seiner Hosentasche, auf der die Zahl 165 vermerkt war. »Die hatte der Tote bei sich. Wir werden jetzt seine Identität feststellen und gegebenenfalls Angehörige informieren. In der Zwischenzeit können sich die Wachmänner aus dem Kommissariat um die Leiche kümmern.«
Winter musste gar nichts sagen, sein Blick sprach Bände. Er hatte so eine Karte noch nie in seinem Leben gesehen, weshalb Emmerich sie wendete, um seinem Assistenten den Stempelaufdruck auf der Rückseite zu zeigen.
Asylverein
18. Nov. 1919
für
Obdachlose in Wien
»165 ist die Bettnummer. Und siehst du diese Löcher?« Emmerich deutete auf den Rand der Karte. »Sie ist fünfmal eingezwickt, was heißt, dass der Tote fünf Nächte dort verbracht hat. Das ist das Maximum. Länger lassen sie einen nicht bleiben.«
»Glauben Sie, er hat sich aus diesem Grund …«
»… den Schädel weggeblasen?« Emmerich nickte. »Aus diesem Grund und wegen tausend anderer Dinge. Armes Schwein. Wer kann es ihm verdenken.« Er rieb so unauffällig wie möglich sein Bein und blickte stadteinwärts, wo endlich die Scheinwerfer der Linie 49 zu sehen waren. Hoffentlich hatte der Schaffner wieder gut eingeheizt, denn die Kälte war ihm tief in die müden Knochen gekrochen.
Tatsächlich erfüllte sich der Wunsch des Inspektors, und er konnte sich zum zweiten Mal an diesem Tag eine warme Auszeit gönnen. »Weck mich, wenn wir aussteigen müssen«, sagte er, lehnte sich zurück und zog sich die Mütze ins Gesicht.
»Wo genau fahren wir denn hin?«
»Erst ins Kommissariat, danach ins Obdachlosenheim.«
»Und dann?«
»Dann ist die Sache gegessen, und wir können uns wieder um die Schleichhändler kümmern.«
Emmerich schloss die Augen und döste innerhalb weniger Augenblicke weg.
3
Die Männer des Polizeiagentenkorps waren auf die zweiundzwanzig Bezirkskommissariate des Sicherheitswachekorps aufgeteilt, da sie direkt mit den uniformierten Ordnungshütern zusammenarbeiteten. Die niederen Ränge der Polizeiagenten verfügten – da sie die meiste Zeit im Außendienst verbrachten – über keine eigenen Diensträume, sondern arbeiteten an großen Tischen in den Wachzimmern.
»Wird Zeit, dass die verdammte Dienstrechtsreform endlich in Kraft tritt und wir eine eigene Schreibstube bekommen«, schimpfte Emmerich, als er sah, dass Wachmann Rüdiger Hörl, ein untersetzter Fünfzigjähriger mit Halbglatze, der in dieser Nacht Journaldienst schob, schon wieder ihren Arbeitsplatz vereinnahmt hatte. »Die hier können Sie gleich anziehen.« Er griff sich Hörls khakifarbene Uniformjacke und seine kakaobraune Tellermütze, die auf dem Tisch lagen, und warf sie ihm zu. »Draußen im Wienerwald liegt eine Leiche, die muss in die Gerichtsmedizin.«
»Der Wienerwald ist groß. Soll ich auf gut Glück fünfzehnhundert Quadratkilometer absuchen? Ostern ist erst im April.« Hörl zeigte sich nicht gerade glücklich darüber, dass Emmerich ihm Arbeit brachte.
»Über die Bräuhausbrücke, dann rechts über die Mauer zum Lainzer Tiergarten, zirka zweihundert Meter hinein ins Unterholz.«
»Na geh«, raunzte Hörl. »Ich bin doch kein Kurierdienst für Verreckte. Schon gar nicht für solche, die sich selbst ins Pendel geschmissen haben.«
»Er hat sich erschossen, nicht erhängt«, warf Winter ein.
»Umso schlimmer. Noch mehr Sauerei. Außerdem hab ich zu tun.« Hörl deutete auf eine Holzbank, auf der zwei Frauen saßen und auf den Boden starrten. »Ich muss mich noch um die gnädigen Damen kümmern.«
»Was haben sie angestellt?« Winter musterte die beiden, die nobel gekleidet waren und auch gut genährt schienen. Sie sahen weder wie Taschendiebinnen noch wie Prostituierte aus.
»Na was wohl? Ein Zubrot wollten sie sich verdienen. Heutzutage gehen nicht mehr nur die armen, ungebildeten Weiber anschaffen. Auch die feinen müssen langsam lernen, dass das Leben kein Zuckerschlecken ist. Ned wahr?«, rief er in Richtung der Frauen, die prompt erröteten und die Köpfe noch tiefer senkten.
»Lassen Sie sie doch laufen«, schlug Emmerich vor. »Ein paar Gelegenheitsprostituierte sind unsere kleinste Sorge.«
»Das sagen Sie so.« Hörl wandte sich an Winter. »Wenn dir deine Eier lieb und teuer sind, dann lass dich nicht von solchen einlullen. Geh zu den Offiziellen. Die Heimlichen haben nämlich keine Amtsarztpflicht. Sich mit denen zu vergnügen ist wie Russisch Roulette spielen.«
Er schenkte dem jungen Mann den zufriedenen Blick eines Lehrers, der seinem Schüler eine wichtige Lektion fürs Leben mit auf den Weg gegeben hatte.
Das Unbehagen der beiden Frauen war beinahe greifbar.
»Meine Damen, Sie können gehen.« Emmerich öffnete die Tür und wandte sich an Hörl. »Sie auch. Und zwar in den Wienerwald. Und wenn Sie das nächste Mal mit Frauen reden, erwarte ich mehr Anstand.«
»Danke«, hauchte ihm eine der beiden zu, bevor sie hinaus in die kalte Nacht verschwand.
Hörl schüttelte den Kopf. »Er ist der härteste Hund, den ich kenne. Aber wenn es um Huren geht, ist er auf einmal ein Kavalier«, zischte er Winter zu. »Gewöhn dich schon mal dran.«
»Warum ist das so?«
Hörl lachte laut. »Niemand durchschaut Emmerich. Daran kannst du dich gleich gewöhnen.
Das Obdachlosenasyl ist hoffentlich etwas, an das ich mich nicht gewöhnen muss, dachte Winter, als sie vor dem Gebäude in der Blattgasse eintrafen.
Ein Pulk von Männern in allen Altersklassen, vom bartlosen Knaben bis hin zum gebeugten Greis, hatte sich vor dem großen Tor versammelt. Es mussten mehrere Hundert sein, und die meisten von ihnen trugen weder Mützen noch Handschuhe oder winterfeste Jacken. Bibbernd warteten sie auf Einlass. Sie drängten sich eng aneinander, denn ein eisiger Wind, der den Geruch von Schnee heranwehte, war aufgezogen.
Das Konglomerat aus frierenden, ausgemergelten Leibern wogte ein paar Schritte zurück, als endlich ein Torflügel aufgeschoben wurde und ein bärtiger Mann seinen Kopf durch den Spalt steckte. »Karten zuerst!«, rief er. »Keine Ausnahmen.«
Sofort wurden zig kleine braune Berechtigungsscheine in die Luft gereckt, und ein Mann nach dem anderen schlurfte unter den neidvollen Blicken jener, die keine Karte besaßen, nach vorn, präsentierte das wertvolle Stück Papier dem Hausvater, der es lochte und den Glücklichen eintreten ließ.
Endlich waren auch Emmerich und Winter an der Reihe.
»Halt, halt, halt. Nicht so eilig.« Der Hausvater versperrte mit seinem stämmigen Körper den Durchgang. »Die Karte ist nicht mehr gültig. Fünf Nächte gibt’s, danach ist Pause.«
»Meine Karte gilt für jede Nacht.« Emmerich zückte sein Dienstabzeichen. »Wir wollen keinen Ärger machen, nur ein paar Fragen stellen.«
»Ha«, blaffte der Bärtige. »Von wegen keinen Ärger. Ihr Kieberer könnt doch gar nichts anderes.« Emmerich stemmte die Hände in die Hüften und starrte ihm wortlos in die Augen. Der Mann wandte sich ab, betrachtete die jämmerlichen Gestalten, die auf Einlass warteten, und seufzte. »Habe ich eine andere Wahl?«
Emmerich sparte sich die Antwort, schob den Hausvater zur Seite und zog Winter durchs Tor.
»Karten? Noch wer mit Karte? Niemand? Dann gebe ich jetzt die frischen aus«, hörten sie es hinter sich rufen, woraufhin gleich Streitereien ausbrachen.
Winter drehte sich erschrocken um, wurde aber von Emmerich weiter ins Innere des Heims gezogen. »Die prügeln sich um die restlichen Plätze«, sagte der trocken. »Das geht uns nichts an.«
Noch bevor Winter sich Gedanken um die armen Seelen da draußen machen konnte, stellte sich ihnen ein schmächtiger Kerl in den Weg, bei dem es sich wohl um einen der Aufseher handelte.
»He, ihr zwei, nicht so schnell. Wart ihr schon bei der Ungezieferkontrolle?« Er warf ihnen einen abschätzigen Blick zu. »Ich will nicht, dass ihr Läuse oder noch ärgeres Zeugs einschleppt, elendes Gesindel.«
Emmerich hielt auch ihm seine vom Bundesadler gezierte Marke vors Gesicht. »Das ist das einzige Tier, das wir am Körper tragen.«
Beim Anblick des Adlers wurde der Aufseher kleinlaut. »Verehrter Herr Inspektor«, sagte er und machte eine leichte Verbeugung. »Bin Ihnen ganz zu Diensten.«
»Das sind mir die Liebsten. Nach oben buckeln und nach unten treten.« Emmerich musterte den Mann voller Abscheu. Jene, die hier Obdach suchten, mochten vielleicht nach außen abstoßend wirken. Sie waren ihm aber tausendfach lieber als Speichellecker wie dieser. »Was weißt du über den Mann, der die letzten fünf Nächte in Nummer 165 verbracht hat?«
»165? Keine Ahnung. Wir fragen nicht nach Namen oder Herkunft. Wir fragen nach überhaupt nichts. Und auch wenn wir es tun würden … Wir haben zweihundert Betten, und ihre Belegung wechselt alle fünf Tage, wie soll ich mir da irgendwen oder irgendwas merken?«
Das leuchtete Emmerich ein. »Wo finden wir Bett 165?«
Der Aufseher erklärte es ihnen. Als sie den Schlafsaal betraten, schlug ihnen furchtbar stickige, abgestandene Luft entgegen.
Während Emmerich völlig gleichmütig tiefer in den Raum vordrang, stockte Winter sichtlich der Atem. »Vielleicht sollten wir den Hausvater befragen«, schlug er vor.
Sein Assistent sah aus, als ob er so schnell wie möglich entfliehen wollte. Die Welt da draußen war seit dem Krieg ein hartes Pflaster, aber im Vergleich zu diesem Ort erschien sie ihm wohl gar nicht mehr so übel.
»Du hast doch gehört, was der Aufseher gesagt hat: Hier werden keine Personalien aufgenommen. Die Obdachlosen kriegen ein Bett und eine warme Mahlzeit. Alles Weitere interessiert keinen. Wenn wer was weiß, dann am ehesten die anderen Elendsbrüder.«
Sie gingen durch den Schlafsaal, einen langen, schmalen Raum, in dem an zwei gegenüberliegenden Wänden fünfzehn Betten standen, zwischen denen weniger als eine Armlänge Platz war. Es war düster, sodass es schwer war, die Zahlen zu erkennen, die über den Kopfenden auf die Wand geschrieben waren.
»Hier.« Emmerich deutete auf ein leeres Bett, blieb kurz davor stehen und setzte sich dann darauf. Bequem war etwas anderes. Es gab keine Matratze, sondern nur zwei schmuddlige Decken auf einem geflochtenen Drahtnetz, das über ein Eisengestell gespannt war. Dazu ein Kissen in einem blau gemusterten Überzug, der so speckig glänzte, dass es selbst in dem schwachen Licht, das hier drinnen herrschte, zu sehen war.
Emmerich stand wieder auf. »Darf ich kurz um Ihre Aufmerksamkeit bitten?«, rief er laut, was den Männern, die auf den anderen Betten herumlungerten, nicht mehr als ein Gähnen entlockte. »Wir brauchen Informationen über den Mann aus Bett 165.«
»Der is’ unten und holt unsere Suppe«, war eine Stimme zu vernehmen.
»Wir suchen Informationen über einen Mann, der in Bett 165 vermutlich die letzten fünf Nächte verbracht hat«, verbesserte sich Emmerich. »Kennt irgendjemand seinen Namen?«
Wieder nur Gähnen, Husten und leises Gemurmel.
Die Turmuhr der nahe gelegenen Weißgerberkirche schlug acht Mal, und die anwesenden Männer interessierten sich mehr für den Verbleib ihrer Suppe als für das Anliegen der beiden Polizisten.
Emmerich durchsuchte seine Taschen, fischte ein halb volles Päckchen Tabak heraus und hielt es in die Höhe.
»Ach, jetzt fällt’s mir wieder ein«, sagte der Mann im Bett nebenan.
»Mir auch«, rief einer von gegenüber. »Ich war die letzten beiden Nächte hier, ich hab mit ihm g’redt.«
»Er heißt irgendwas mit D«, warf ein anderer ein.
Dann herrschte wieder Ruhe.
Emmerich hatte verstanden, klopfte seine Taschen ab und zauberte eine Packung Zigarettenpapier und einen Geldschein hervor.
Abwartendes Schweigen. Die Männer sahen sich misstrauisch an und fixierten dann voller Gier Emmerich, der begann, sich eine Zigarette zu drehen.
»Pst«, flüsterte einer. »Er soll noch was drauflegen.«
»Je länger ihr wartet, desto weniger bleibt übrig.« Der Inspektor zündete die Zigarette an, nahm ein paar tiefe Züge und blies eine Rauchwolke aus.
»Dietrich Jost«, rief schließlich der Mann aus dem Nebenbett und erntete dafür Flüche und Beschimpfungen.
»Na also. Geht doch.« Emmerich bedeutete Winter mitzuschreiben.
»Der hat in Galizien gedient«, rief einer. »Drei Jahre.«
»Er war Tierpfleger vor dem Krieg.«
»Aber er konnte danach nix mehr hackeln, weil die Nerven am Oasch war’n.«
»Drum is’ ihm auch seine Oide wegg’rannt. Die hat das nimmer mehr ausgehalten. Die dauernde Zitterei.« Der Mann im Nebenbett streckte die Arme nach vorn und zappelte wild herum. »Neben dem zu schlafen war echt g’schissen.«
»Er war Kriegszitterer?«, fragte Emmerich.
»O ja«, erklang es unisono.
Emmerich kannte viele Männer, die an der Front zwar nicht ihr Leben, aber die Kontrolle über ihren Körper verloren hatten. Ihre Glieder zuckten unkontrollierbar, und sie taten sich oft schwer beim Sprechen.
»Hätte er in seinem Zustand eine Pistole laden und abfeuern können?«
»Fix ned«, sagte der Mann gegenüber, und alle anderen stimmten ihm zu.
Emmerich drehte sich noch eine Zigarette, was von den Anwesenden mit lauten Protestrufen quittiert wurde, die er geflissentlich ignorierte. Er musste nachdenken. War es wirklich möglich, dass Dietrich Jost sich nicht selbst getötet hatte?
»Hat er unter seiner Situation gelitten?«
»Gelitten?« Der Mann im Nebenbett fixierte den Geldschein und die Rauchwaren, die Emmerich neben sich gelegt hatte. »Ned wirklich. Er war ein bisserl … Sie wissen schon.« Er malte auf der Höhe seiner Schläfe mit dem Zeigefinger Kreise in die Luft. »Hat rumgesponnen und sich eingebildet, dass er bald nach Brasilien auswandert.« Er fing an zu lachen. »Die Vorstellung hat ihm ziemlich gefallen. Und dazu hatte er diesen einen Freund, der ihm immer wieder mal was zugesteckt hat. Wie hieß der gleich noch mal? Irgendwas mit Z.«
»Zeiner«, half ihm einer auf die Sprünge. »Harald Zeiner. Anständiger Kerl. Hat a großes Herz.«
»Der Jost hat’s gut gehabt. Um uns arme Teufel schert sich ka Sau.«
»Was is’ jetzt eigentlich mit den Tschick? Wer darf die jetzt rauchen? Und warum überhaupt die ganzen Fragen? Hat der Jost was angestellt?«
»Wo kann ich diesen Zeiner finden?« Emmerich ignorierte die Fragen.
»Der hat ka feste Wohnung. Is’ Bettgänger. Am ehesten finden S’ den in der Katzenbar. Da hat er seit Kurzem a Hackn.«
»Katzenbar? Wo soll das sein?« Emmerich, der sich gut im Wiener Nachtleben auskannte, hatte noch nie davon gehört.
»Was weiß i. Schau ich aus, als könnt ich’s mir leisten, in a feine Bar zu geh’n? I bin scho froh, wenn i ma beim Branntweiner die billigste Budl kaufen kann. Ganz ohne Glas und ohne Bedienung.« Der Mann wurde langsam ungehalten. »Was is’ jetzt mit den Tschick?«
»Weiß sonst noch jemand was?«, rief Emmerich in die Menge, erhielt aber keine Antwort, sondern nur unzufriedenes Murren.
»Ich glaube, ich weiß, welche Bar er meint«, flüsterte Winter.
Emmerich schaute überrascht, stand auf und bedankte sich bei den Obdachlosen. »Habe die Ehre, meine Herren.« Er tippte sich an die Mütze und ging in Richtung Ausgang. Die kleinen Schätze ließ er auf dem Bett liegen.
Noch bevor sie den Raum verlassen hatten, brach wildes Geschrei und Geschimpfe aus.
»Ich würde kurz warten«, sagte Emmerich zu dem Mann, der ihnen auf dem Flur mit einem großen Topf in den Händen entgegenkam. »Es wäre schade um die Suppe.«
4
»Ich will ganz sicher sein, dass es kein Selbstmord war«, sagte Emmerich, als sie wieder draußen auf der Straße waren und endlich die kalte, klare Luft einatmeten. »Dietrich Jost hat für Gott, Kaiser und Vaterland gekämpft und einen hohen Preis bezahlt. Niemand tötet einen Kriegsveteranen und kommt ungestraft davon. Nicht in meiner Stadt. Wo ist also diese Katzenbar?«
Winter fuhr sich mit den Händen übers Gesicht, als könnte er dadurch die unsichtbare Patina von Elend und Siechtum, die sich im Obdachlosenasyl auf ihn gelegt hatte, wegwischen. »Ich glaube, er meint die Chatham Bar.«
»Die Chatham Bar?« Emmerich war sichtlich überrascht. »Warst du da etwa schon mal drin?« Die verruchte Bar war in Wien besser unter dem Namen Je-t’aime-Bar bekannt. Wobei damit nicht die romantische Liebe gemeint war.
»Ich kenne nur die Reklame. Die mit der schwarzen Katze, die vor einem Champagnerglas sitzt. Drinnen war ich noch nie.«
»Dann wird es Zeit.«
»Ist wohl ein Tag für Premieren«, murmelte Winter und folgte seinem Vorgesetzten in die Dorotheergasse im 1. Bezirk.
»N’Abend«, begrüßte Emmerich den groß gewachsenen Einlasser und griff zur Türklinke.
»Haut’s euch wieder über die Häuser«, sagte der Kerl und versperrte ihnen den Weg. »Solche wie ihr kommen nicht rein.«
»Ach, und warum nicht?« Emmerich reckte das Kinn.
»Weil ihr stinkt. Und wer sich keine Seife leisten kann, der kann auch keine Getränke bezahlen.«
Winter schnupperte an seiner Achsel. Der anstrengende Tag und der Besuch bei den Obdachlosen hatten tatsächlich olfaktorische Spuren hinterlassen.
»Schleicht’s euch, aber zackig.« Der Türsteher machte eine Geste, als würde er lästige Straßenköter wegscheuchen.
Emmerich musterte den Kerl. Dessen lädiertes Gesicht ließ keine Zweifel daran aufkommen, dass er viel Zeit im Ring verbrachte, weshalb Emmerich entschied, sich besser auf keine Handgreiflichkeiten einzulassen. Er war groß, über eins achtzig, dennoch … allein konnte er es nicht mit dem Boxer aufnehmen. Und dass Winter in einem Straßenkampf zu gebrauchen war, bezweifelte er. Zu dumm, dass er sich für seine Ermittlungen vorerst nicht als Polizist zu erkennen geben durfte – der Laden würde sonst auf einen Streich leer sein.
»Man sieht sich immer zweimal«, stellte er in Aussicht und stapfte mit Winter im Schlepptau um die Ecke zum Lieferanteneingang, wo er gegen die Tür hämmerte.
»Müllabfuhr«, sagte er, als eine junge Frau in einer karierten Schürze öffnete.
»Wie? Jetzt? Um diese Uhrzeit? Der Sammelzug kommt doch außerdem erst übermorgen. Und seit wann holt ihr den Dreck persönlich ab?«
»Haben Sie die Ankündigung nicht gelesen? Das ist ein neuer Dienst der Stadt Wien.« Emmerich fasste sich an die Mütze und machte eine leichte Verbeugung. »Wo sind denn Ihre Kübel? Wir haben nicht den ganzen Abend Zeit«, drängte er. »Wir müssen einen strengen Zeitplan einhalten, sonst kriegen wir Ärger mit dem Magistratsamt.«
Die Frau zögerte einen Moment, dann kniff sie die Augen zusammen und trat langsam zur Seite. »Gleich links um die Ecke.«
Emmerich folgte ihrer Anweisung, griff sich einen stinkenden Kübel, der voller Asche und Scherben war, und trug ihn nach draußen. Winter tat es ihm gleich.
»Hilde, verdammt nochmal, wo bleibt der Wein? Die Gäste beschweren sich schon«, brüllte ein Mann.
»Gehen Sie ruhig. Wir machen das schon.«
Emmerich wartete, bis die Frau verschwunden war, kippte den Inhalt der Kübel an die Hauswand und stellte sie wieder zurück an ihren Platz. Dann schlich er sich mit Winter ins Lokal.
Sofort wurden sie von einer warmen Wolke aus Parfum und dem Dunst unzähliger Zigaretten umfangen. Gemurmel und Getuschel erfüllten den Raum, eine Dame, ganz in Tüll gekleidet, schmetterte, begleitet von einem Mann am Piano, einen Schlagerhit.
»Die Männer sind alle Verbrecher, ihr Herz ist ein finsteres Loch, hat tausend verschied’ne Gemächer, aber lieb, aber lieb sind sie doch.«
Das Lokal war im Secessions-Stil eingerichtet. Es hatte eine holzgetäfelte Decke, und überall im Raum standen kleine Marmortische, Thonet-Sessel und weiche rote Plüschsofas, über denen kleine Lampen hingen, die ein schummriges Licht abgaben.
Die Gäste, überwiegend Männer mit dicken Geldbeuteln, waren nach der neuesten Mode gekleidet und rauchten Zigarillos. Sie unterhielten sich angeregt.
»Wir hätten ihm doch einfach unsere Dienstmarken zeigen können«, sagte Winter.
»Hätten wir. Aber manchmal ist es besser, anonym zu bleiben – das wirst du auch noch lernen.« Er marschierte an die Bar, nahm seine Mütze ab und winkte eine Schankkraft zu sich. »Ich suche den Harri.«
»Wen?« Der Barmann, der laut Namensschild Franz hieß, signalisierte ein paar Gästen, die ungeduldig nach Schnaps verlangten, dass er sich gleich um sie kümmern werde.
»Den Zeiner Harald. Der soll hier arbeiten.«
Franz runzelte die Stirn. »Beim Personal gibt’s weder einen Zeiner noch einen Harald.« Er überlegte kurz und zwinkerte dann. »Zumindest nicht beim offiziellen.«
»Vielleicht sind wir im falschen Lokal …« Winter sah seinen Vorgesetzten fragend an.
»Ich denke nicht.« Emmerich bedankte sich und wandte sich seinem Assistenten zu, der jetzt mit großen Augen die Szenerie betrachtete. »Hast du Geld dabei? Ich hab mein letztes den Elendsbrüdern in der Blattgasse vermacht.«
Winter griff in seine Tasche und brachte ein paar Kronen zum Vorschein. Emmerich nahm sie ihm aus der Hand und bestellte zwei Bier.
»Danke, stimmt so«, sagte er, als das Gewünschte gebracht wurde.
»Wir dürfen im Dienst doch nicht trinken.« Winter starrte auf das Seidel, das Emmerich ihm entgegenstreckte.
»Prost«, sagte der und nahm einen großen Schluck. Tat das gut! Es waren die kleinen Dinge, die das Leben lebenswert machten.
Winter schien den Augenblick nicht ganz so sehr zu genießen. Mit eingezogenem Kopf und an den Körper gepressten Armen wirkte er mehr wie ein begossener Pudel als wie ein junger Polizeiagent, der gerade einen aufregenden Tag hinter sich hatte.
»Was ist mit dir?«
»Wir riechen.« Sein Assistent deutete auf zwei Frauen, die in feinen Abendkleidern und Pelzstolas an ihnen vorbeischlenderten, sie kurz ansahen und sich sofort wieder abwendeten. »Und alles hier ist so elegant und edel.«
Emmerich lachte und kippte den Rest von seinem Bier hinunter. »Ich zeig dir jetzt mal, wie elegant und edel dieser Schuppen wirklich ist.« Er ging auf eine schmale Tür mit geätzten Scheiben zu und öffnete sie.
Winter starrte seinem Vorgesetzten nach und schließlich auf das noch immer volle Glas in seiner Hand. Hatte ihnen jemand etwas in die Getränke gemischt?
»Das ist die Besenkammer«, sagte er. Die vielleicht vier Quadratmeter große Kammer war vollgeräumt mit Putzutensilien.
Emmerich zog Winter in den kleinen Raum, schloss die Tür hinter ihnen und klopfte drei Mal gegen die Rückwand.
»Was sollen wir hier drin?«
Noch bevor Emmerich antworten konnte, wurde ein kleines Fensterchen geöffnet, durch das zwei wässrig blaue Augen starrten. Einen Moment später schob die Wand sich wie von Geisterhand zur Seite und gab den Blick auf einen in diffuses Licht getauchten Raum frei, der in kleine Separees aufgeteilt war. Kichern, Stöhnen und das Quietschen von Bettfedern ließen keinen Zweifel daran aufkommen, was hier vor sich ging. Lebenslust, um für ein paar süße Momente das graue Elend zu vergessen.
»Was kann ich den werten Herren Schönes anbieten?« Ein blonder Dandy mit zurückgekämmtem Haar, Zwirbelbart und übertriebener Gestik zog seine rechte Augenbraue hoch und musterte die beiden.
»Wir haben so viel Gutes über Harald Zeiner gehört, da dachten wir, wir schauen mal vorbei.«
»Harri!« Der gestriegelte Kerl lächelte und rieb sich die Hände. »Leider ist der steirische Hengst gerade beschäftigt. Kann ich Ihnen vielleicht jemand anderen empfehlen?«
Emmerich winkte ab. »Wir warten.«
»Kein Problem.« Der Dandy schlenderte zu einem Separee und warf einen verstohlenen Blick hinein. »Es kann sich nur noch um Sekunden handeln«, sagte er, als er wieder zurück war, und zückte eine Geldbörse. »Ein flotter Dreier in der Nummer 3. Ich muss leider vorab kassieren.« Er nannte eine exorbitante Summe.
»Das ist nicht nötig.« Emmerich ging einfach an ihm vorbei. »Wir nehmen keine expliziten Dienste in Anspruch, und lange wird es auch nicht dauern.«
Überraschenderweise hielt der Mann ihn nicht zurück, sondern stellte sich wieder neben die Geheimtür.
Emmerich zog den schweren roten Bühnenvorhang von Separee 3, der die Menschen darin vor neugierigen Blicken abschirmte, zur Seite. Ein dicker Mann mit einem hochroten, schweißnassen Gesicht stand mitten in dem kleinen Raum und schloss gerade die Knöpfe seiner Hose, ein anderer saß hinter ihm auf einem schmalen Bett und zählte ein Bündel Banknoten.
Emmerich räusperte sich. »Harald Zeiner? Ich muss mit Ihnen reden.«
Der Mann auf dem Bett starrte ihn entgeistert an.
»Wer ist dieser Kerl?« Der Dicke nestelte hektisch an seinem Gürtel. »Ist der von der Sitte?« Panisch stolperte er nach draußen, was ihm niemand verdenken konnte, wurde »Unzucht wider die Natur« doch mit schwerer Kerkerhaft zwischen einem und fünf Jahren bestraft.
Emmerich würdigte ihn keines Blickes. »Es geht um Dietrich Jost«, sagte er zu Zeiner.
»Was ist mit ihm?«, fragte der völlig überrumpelt.
»Er ist tot.«
»Tot? Das kann nicht sein …«
Winter tippte Emmerich von hinten auf den Rücken. »Chef«, flüsterte er.
»Gleich …«, wimmelte Emmerich ihn ab und wandte sich wieder an Zeiner. »Er hat sich erschossen. So scheint es zumindest auf den ersten Blick.«
»Erschossen?« Zeiner schüttelte ungläubig den Kopf. »Aber … aber er war doch gar nicht in der Lage, eine Waffe …«
Emmerich spürte einen unsanften Schlag auf die Schulter. »Gleich«, wiederholte er ungehalten, doch dieses Mal war es nicht Winter, sondern der bullige Türsteher. Er nahm Emmerich in den Schwitzkasten und zog ihn in ein freies Separee.
»Man sieht sich immer zweimal«, zischte er ihm ins Ohr. »Wer hätte gedacht, dass das so schnell geht.«
Der Dandy wartete bereits auf sie. »Du hast doch wohl nicht gedacht, dass du hier den Chef spielen kannst. Der bin nämlich ich.« Er zückte erneut seine Geldbörse. »Jetzt wird bezahlt.«
»Ich bin völlig blank.« Emmerich grinste. Er wunderte sich, wo Winter steckte. »Ich hab keinen einzigen Heller dabei.«
»Dann bezahlst du in einer anderen Währung.« Er holte aus und schlug Emmerich mitten ins Gesicht.
Der spuckte Blut und versuchte, sich loszuwinden, doch es war, als wäre er in einem Schraubstock eingeklemmt. Der schmierige Kerl verpasste Emmerich einen linken Haken. Er holte gerade aus, um ihm einen Tritt zwischen die Beine zu versetzen, als plötzlich ein dumpfes Krachen ertönte. Im nächsten Augenblick lockerte der Türsteher seinen Griff und ging mit einem Stöhnen zu Boden.
Emmerich wollte die wiedergewonnene Freiheit nutzen, um sich für die Prügel des Dandys mit einem K.-o.-Schlag zu revanchieren, doch dann ertönte ein Klirren, und als er aufschaute, stand da nur noch Winter, der den Henkel seines Bierglases in der Hand hielt. Die Männer lagen beide bewusstlos auf dem Boden.
»Ich hatte mich hinter dem Vorhang versteckt. Ich wusste nicht, was ich …«, erklärte Winter.
»Gut gemacht.« Emmerich klopfte ihm auf die Schulter und stieg über die Pfütze, die sich auf dem Boden gebildet hatte. »Schade nur um das schöne Bier.« Er zog den Vorhang zu und ging zurück zu Separee Nummer 3.
Es war leer.
Zeiner hatte sich in Luft aufgelöst, und Emmerich blieb nichts anderes übrig, als den Flüchtigen zur Fahndung auszuschreiben und Feierabend zu machen.
Daheim angekommen, zog er leise die Wohnungstür hinter sich ins Schloss, legte Jacke und Mütze ab und schlich in die Küche. Dort schenkte er sich ein Glas Schnaps ein. Der Sprung von der Mauer war eine leichtfertige Dummheit gewesen. Sein Bein tat noch immer weh, und er hoffte, dass der Alkohol den Schmerz so weit betäubte, dass er schlafen konnte.
Er lehnte sich gegen die gemauerte Kochstelle, die überraschenderweise noch warm war, und schloss die Augen. Es war schön, ein richtiges Zuhause zu haben.
Mit seinem Gehalt und dem Geld, das Luise durch Heimarbeit verdiente, konnten sie sich die Zweizimmerwohnung mit der kleinen Küche leisten. Seit einem Jahr lebten sie jetzt schon hier zusammen. Ihr Heim war bescheiden eingerichtet, doch sie genossen den Luxus, es ganz allein zu bewohnen. Sie waren nicht genötigt, Untermieter oder Bettgänger aufzunehmen, und das Klosett draußen im Flur des alten Zinshauses mussten sie sich nur mit der alten Frau Ganglberger von nebenan und nicht mit der ganzen Etage teilen.
Früher war die Vorstellung, eine eigene Familie zu haben, für Emmerich Teil einer abstrakten Fantasie gewesen, doch dann hatte er Luise und mit ihr eine ganz neue Seite an sich kennengelernt. Er hatte sich als hingebungsvoller Mann und fürsorglicher Familienvater wiedergefunden, obwohl er Kinder nie gemocht und das Mysterium Liebe bisher vermieden hatte.
Bei dem Gedanken an die Kinder fiel ihm auf, wie still es war. Kein Husten und kein Weinen störte die Nachtruhe. Er warf einen Blick ins Schlafzimmer, wo in einem großen Bett Emil, Ida und der kleine Paul friedlich schlafend nebeneinanderlagen.
»Da bist du ja.« Luise kam aus dem Wohnzimmer und schmiegte sich an seinen Rücken.
»Konntest du Hustensaft auftreiben?«
»Hustensaft und Bauchfilz. Den hab ich ausgelassen und Schmalz gemacht. Dazu gibt es Eichelbrot. Es ist noch was da, falls du Hunger hast.«
Er wollte sie küssen, hielt jedoch inne, als er sah, dass ihr Gesicht noch blasser und besorgter war als sonst. »Was ist los?«
Sie nahm ihm den Schnaps aus der Hand, trank einen großen Schluck und bekreuzigte sich. »Ich habe ein schlechtes Gefühl«, sagte sie. »Es wird etwas passieren.«
»Ach was.« Er nahm ihre Hände in die seinen und hielt sie fest. »Du bist müde und überarbeitet. Geh schlafen, ich komme gleich nach.«
Sie machte sich los, ging zum Herd und füllte glühende Holzkohlen in ein schweres Bügeleisen. »Es wird etwas passieren«, wiederholte sie, breitete die Bügeldecke auf dem Esstisch aus und nahm ein fadenscheiniges Hemd aus einem Korb mit frisch gewaschener Wäsche. »Damals, als Xaver gefallen ist, als der Krieg mich zur Witwe und die Kleinen zu Waisen gemacht hat, da hatte ich vorher dasselbe Gefühl.«
Luise sagte nichts mehr, sie bügelte stumm vor sich hin.
5
Harald Zeiner streifte orientierungslos durch die Nacht und versuchte, seine Gedanken zu ordnen.
Als dieser Polizist ihm erzählt hatte, sein Freund habe sich erschossen, war er erst schockiert gewesen, dann verwirrt über die Umstände, und schließlich hatten sich viele Puzzleteilchen zu einem schrecklichen Bild zusammengefügt. Mord. Alles hatte auf einmal einen Sinn ergeben: Josts unerwarteter Optimismus, sein andauerndes Gefasel über Brasilien …
Seit dem Abendessen gerade eben war Zeiner sich seiner Hypothese jedoch nicht mehr ganz so sicher. War sein Verdacht, dass Jost umgebracht worden war, nur ein Hirngespinst? Oder hatte er sich wie ein dummes Weib von den Beteuerungen und schönen Worten eines kaltblütigen Mörders einlullen lassen?
Was war gelogen, und was war die Wahrheit? Ausgerechnet er müsste das doch eigentlich durchschauen können, verdiente er doch sein Geld damit, anderen Menschen etwas vorzugaukeln.
Er zündete sich eine Zigarette an, überquerte die Nußdorfer Lände und stapfte einen mit Büschen bewachsenen Abhang zum Ufer des Donaukanals, der im Volksmund Wiener Arm genannt wurde, hinunter. Dort starrte er auf das dunkle Wasser, das sich langsam in Richtung Alberner Hafen wälzte, um sich dort mit der Donau zu verbinden und dann weiter ins Schwarze Meer zu fließen.
Vielleicht hat Jost ja doch Selbstmord begangen, dachte er. Ihm selbst war der Gedanke daran jedenfalls schon oft durch den Kopf gegangen, und er hatte unzählige Male die verschiedenen Möglichkeiten im Geiste durchgespielt. Ins Wasser zu gehen war niemals eine Option gewesen. Zumindest nicht in die Donau. Sie würde ihn nach Osten tragen, dorthin, wo er gedient hatte – und dorthin wollte er nie wieder zurück. Weder lebend noch tot.
Er blickte in die Sterne. Wie gleichgültig sie doch waren. Manche behaupteten, sie würden die Geschicke der Menschen lenken, in Wahrheit waren sie ihnen aber völlig egal.
»Genug lamentiert«, ermahnte er sich. Es wurde vom Jammern nicht besser, und Jost erwachte dadurch auch nicht mehr zum Leben.
Zeiner inhalierte den letzten Zug seiner Zigarette so tief, dass die Glut beinahe seine Finger verbrannt hätte, und schnipste die Kippe ins Wasser.
Mit einem Mal vernahm er ein Rascheln hinter sich. Noch bevor er sich umdrehen konnte, war ein Krachen zu hören, und ein dumpfer Schmerz durchfuhr seinen Schädel. Er wollte schreien und sich wehren, doch sein Körper gehorchte ihm nicht. Langsam sackte er vornüber und wurde im nächsten Augenblick von nasser Kälte umfangen.
Ein paar Meter trieb er mit dem Gesicht nach oben in Richtung Osten. Das Letzte, was er sah, bevor die dunklen Fluten ihn verschlangen, waren die Sterne am Firmament, die völlig ungerührt auf ihn hinunterschauten.
6
Emmerich war müde. In dieser Nacht waren es nicht die Kinder gewesen, die ihn wach gehalten hatten, sondern auch sein schmerzendes Bein und Luise, die sich bis in den Morgen hinein unruhig hin und her gewälzt hatte. Er würde jetzt ein Königreich geben für eine anständige Tasse Kaffee.
Stattdessen trank er nur einen Schluck kalten Tee und schlang ein Stück trockenes Brot hinunter. Dann machte er sich auf zum Kommissariat.
»Morgen.« Er gähnte, schob sich eine Strähne seines braunen Haars aus der Stirn und rieb über seine Bartstoppeln. Hörl beendete gerade die Nachtschicht. »Irgendwas Neues?«
»Es kam grad eine Meldung rein. Ein Kerl, auf den die Beschreibung von diesem Zeiner passt, ist aus der Donau gefischt worden.«
»Tot oder lebend?«
»Tot natürlich. Bei den momentanen Temperaturen erfriert man, während man ersäuft.«
»Verdammt«, fluchte Emmerich. »Irgendwelche Details?«
»Ob er erfroren oder ersoffen ist?«