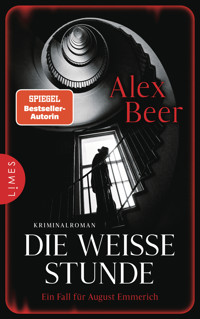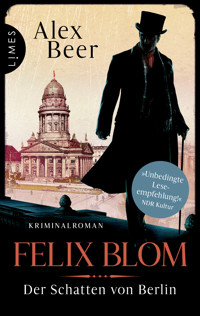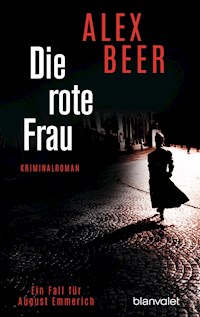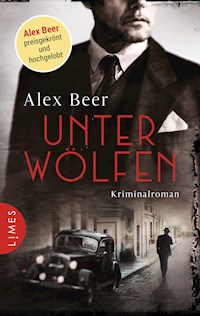
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Limes Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Isaak Rubinstein
- Sprache: Deutsch
Um seine Familie zu retten, muss sich der Jude Isaak Rubinstein in die Gestapo einschleusen und mitten unter Wölfen zum Spion werden ...
Nürnberg 1942: Isaak Rubinstein, der ständig in Angst um seine Familie lebt, bittet eine Widerstandskämpferin um Hilfe. Doch ihre Gegenforderung ist hart: Isaak soll die Gestapo infiltrieren und sich dazu als Sonderermittler Adolf Weissmann ausgeben – jenen Mann, der vom Führerhauptquartier beauftragt wurde, den Mord an einer berühmten Schauspielerin aufzuklären. Was niemand weiß: Der Kriminalist hat den Anschlag, den die Widerstandsgruppe auf ihn verübt hat, überlebt. Mitten unter Wölfen zieht sich das Netz immer weiter zu und die Gefahr, enttarnt zu werden, ist allgegenwärtig …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 391
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Buch
Nürnberg 1942: Isaak Rubinstein, der ständig in Angst um seine Familie lebt, bittet eine Widerstandskämpferin um Hilfe. Doch ihre Gegenforderung ist hart: Isaak soll die Gestapo infiltrieren und sich dazu als Sonderermittler Adolf Weissmann ausgeben – jenen Mann, der vom Führerhauptquartier beauftragt wurde, den Mord an einer berühmten Schauspielerin aufzuklären. Was niemand weiß: Der Kriminalist hat den Anschlag, den die Widerstandsgruppe auf ihn verübt hat, überlebt. Mitten unter Wölfen zieht sich das Netz immer weiter zu, und die Gefahr, enttarnt zu werden, ist allgegenwärtig …
Autorin
Alex Beer, geboren in Bregenz, hat Archäologie studiert und lebt in Wien. Nach »Der zweite Reiter«, ihrem preisgekrönten Debüt, das den Auftakt gibt für die hochspannende Reihe um Kriminalinspektor August Emmerich, »Die rote Frau«, nominiert für den Friedrich-Glauser-Preis 2019, und »Der dunkle Bote« stellt sie mit »Unter Wölfen« einmal mehr ihr Talent für lebendige Figuren, atmosphärische Schauplätze und detailreiche Recherche unter Beweis. Um es mit den Worten der Jury des Leo-Perutz-Preises zu sagen: »Was Alex Beer erzählt, betrifft auch die heutige Zeit, aber wie sie erzählt, lässt die ferne Vergangenheit lebendig werden.«
Mehr Informationen unter: www.alex-beer.com
Die August-Emmerich-Reihe von Alex Beer im Limes Verlag:
Der zweite Reiter · Die rote Frau · Der dunkle Bote
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag
ALEX BEER
UNTER
WÖLFEN
Kriminalroman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2019 by Alex Beer
Dieses Werk wurde vermittelt durch die
Literaturagentur Kai Gathemann
© 2019 by Limes in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Margit von Cossart
Umschlaggestaltung: Johannes Wiebel | punchdesign,
unter Verwendung von Motiven von Shutterstock.com
(Gordan; photomaster; IVASHstudio; Ysbrand Cosijn)
und Insane.J/photocase.de
KW · Herstellung: sam
Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach
ISBN 978-3-641-24616-7V002
www.limes-verlag.de
Dies ist eine fiktionale Erzählung.
Obwohl sie in reale Rahmenbedingungen eingebettet ist,
sind sämtliche Figuren, Ereignisse und auch
einige der Schauplätze frei erfunden.
Nähere Informationen dazu im Nachwort.
Donnerstag, 19. März 1942
1
»Heil Hitler!«
Die Worte hallten von den massiven Steinmauern der alten Kaiserburg wider und blieben in der klirrend kalten Abendluft hängen.
Zwei eher unscheinbare Männer folgten dem Gruß. Mit gelassenen Schritten gingen sie zur Pförtnerloge, die vor dem Durchgang zum inneren Burghof errichtet worden war, und starrten den Portier schweigend an. Nichts an ihrem Aussehen erlaubte Rückschlüsse auf ihre Identität. Die dunklen Anzüge waren von der Stange, das Haar trugen sie akkurat gestutzt, so wie man es dieser Tage an jeder Straßenecke sah. Weder Schmuck noch Abzeichen lieferten einen Hinweis auf ihre Herkunft oder den Grund ihres Erscheinens. Sie hätten alles Mögliche sein können: Handelsvertreter, Reporter, Soldaten auf Fronturlaub …
Trotzdem traten dem Portier bei ihrem Anblick Schweißperlen auf die Stirn. Das Selbstverständnis, das sie an den Tag legten, die Souveränität, die sie umwehte – das alles schrie förmlich nach Gestapo.
»Heil Hitler!« Der Portier, ein kriegsversehrter junger Mann, dem der rechte Arm fehlte, atmete schwer. »Was kann ich für Sie tun?« Er sprach zögerlich, befangen, so als wäre er nicht sicher, ob er die Antwort wirklich hören wollte.
»Obersturmbannführer Nosske erwartet uns«, sagte der Größere der beiden mit ausdrucksloser Miene. »Er ist vergangene Woche hier eingezogen.«
Tatsächlich hatten die Nazis begonnen, im inneren Teil der Burg, einst die Residenz der Könige und Kaiser, einen Wohntrakt für ranghohe Offiziere einzurichten.
Der Portier nickte, sichtlich erleichtert darüber, dass die Visite nicht ihm galt. »Dürfte ich bitte Ihre Namen und einen Ausweis …«
Er deutete auf ein Gästebuch, das vor ihm auf dem Tresen lag, doch die Blicke, die er dafür erntete, ließen ihn sofort wieder verstummen. Die Männer rührten sich nicht, bewegten sich keinen Millimeter. Schweigen machte sich breit, dehnte sich aus, als wäre die Zeit stehen geblieben.
»Verzeihung«, sagte der Portier, als ihm endlich dämmerte, was sie von ihm wollten. »Sie müssen in den inneren Burghof, dann gleich links zur Tür hinein, die Treppe hoch in den oberen Stock und dann ganz nach hinten.«
Ohne ein weiteres Wort zu verlieren, durchschritten die Gestapobeamten das Tor.
Aus der Ferne erklang das Läuten einer Kirchturmuhr, und in der Pförtnerloge setzte sich die Zeit wieder in Bewegung.
»Obersturmbannführer.« Sturmscharführer Gerhard Bade klopfte an die Tür, hinter der Fritz Nosske, der stellvertretende Gestapochef und Leiter des Judenreferats, seit Neuestem residierte. »Scharführer Oberhausner und ich …«
»Es ist offen«, kam es von drinnen.
Bade betätigte den Türknauf, und die beiden SS-Männer betraten den Vorraum, der mit einem schiefergrauen Spannteppich ausgekleidet war. Die Luft, die ihnen entgegenschlug, roch nach frischer Farbe, doch sie hatte zugleich einen schweren metallischen Unterton.
»Irgendetwas stimmt hier nicht.« Bade fasste an seine Pistole und beschleunigte seine Schritte.
Theodor Oberhausner folgte ihm und reckte die Nase in die Höhe. »Es stinkt nach Tod.«
Vor einer offenen Tür hielten sie inne. Nosske stand mit dem Rücken zu ihnen in einer elegant eingerichteten Suite und schaute durch ein Fenster, das einen wunderschönen Blick über Nürnberg bot. Erhaben und friedlich lag ihm die Kaiserstadt zu Füßen. Ein Meer aus Dächern, Baumwipfeln und Turmspitzen.
»Die Reichskleinodien werden in dieser Stadt aufbewahrt«, murmelte er. »Die Goldene Bulle wurde hier erlassen, das Blutschutz- und Reichsbürgergesetz verabschiedet, die Reichsparteitage wurden abgehalten. Doch man darf sich von so viel Würde und Glorie nicht täuschen lassen. Auch in Nürnberg lauert das Böse.«
Als er sich endlich umdrehte, schlugen Bade und Oberhausner die Hacken zusammen. »Heil Hit…«, setzten sie an. Der Rest des Grußes wurde von einer Mischung aus Überraschung und Bestürzung verschluckt.
Nosske war ein stattlicher Mann, groß gewachsen und breitschultrig, mit einem markanten Kinn und einer senkrechten Narbe auf der Oberlippe, die ihm einen spöttischen Ausdruck verlieh. Wie gewöhnlich war seine Kleidung akkurat gebügelt, das Haar streng nach hinten gekämmt und sein Hemd bis oben zugeknöpft. Ein normaler Anblick, wären seine Hände nicht blutbesudelt gewesen.
Doch nicht nur sie. Wie die beiden Gestapooffiziere erst jetzt erkannten, waren auch die Möbel und die Wände voller bräunlich roter Blutspritzer, selbst das Balkenwerk, das die Decke zierte, hatte etwas abbekommen.
»Was ist passiert? Sind Sie verletzt?« Bade kniff die Augen zusammen, um in dem diffusen Gegenlicht besser sehen zu können. »Ist außer Ihnen noch jemand hier?« Er zog seine Walther PPK und ließ den Blick umherwandern.
Nosske schwieg.
»Obersturmbannführer.« Oberhausner setzte an, zu ihm zu gehen, blieb dann doch stehen. Offenbar wusste er nicht, wie er sich verhalten sollte. »Geht es Ihnen gut?«
Nosske starrte regungslos durch seine Untergebenen hindurch. »Ich war es nicht«, sagte er schließlich.
Ohne ein weiteres Wort zu verlieren, verließ er das Zimmer.
Der Hauch des Todes, der drückend schwer im Raum hing, blieb.
Bade und Oberhausner sahen dem Obersturmbannführer hinterher und anschließend einander fragend an. Keiner sprach ein Wort. Als das Brummen einer grün schimmernden Fliege die gespenstische Ruhe durchbrach, ergriff Bade die Initiative und folgte Nosske.
Nach wenigen Schritten blieb er abrupt stehen und sah entsetzt auf den Boden. »Scheiße.«
Oberhausner trat neben ihn und sog die Luft scharf durch seine Zähne, als er sah, was sein Kollege gerade entdeckt hatte: Hinter einem beigen Ledersofa, auf dem blank gewienerten Dielenboden, lag keine Geringere als die berühmte Lotte Lanner.
Im vergangenen Jahr hatte die Schauspielerin sich in der Rolle der unschuldigen Sennerin Marie in die Herzen des Volkes gespielt und war bald darauf zu einem der gefragtesten Filmstars des Reiches avanciert. Obwohl an ihrem Hals eine tiefe Wunde klaffte und ihre Augen leblos an die Decke starrten, machte sie ihrem Beinamen, »die schöne Lanner«, alle Ehre. Das kräftige Rot ihrer blutgetränkten Bluse brachte das elfengleiche Weiß ihres Teints zum Leuchten, die zerzausten blonden Locken, die ihr Gesicht umspielten, verliehen ihr die Anmut einer nordischen Kriegerin.
»Ich habe sie so gefunden.« Nosske war zurückgekommen und blieb neben seinen Männern stehen. In der einen Hand hielt er einen gut gefüllten Cognacschwenker, in der anderen eine Zigarette. »Der Tod steht ihr gut.«
Bade nickte. »Fräulein Lanner und Sie … Sie beide …?«
»Schon seit einer Weile.« Nosske zog an der Zigarette und ließ den Rauch durch seine Nase entweichen. »Ich hatte einen Termin bis gegen sechs. Danach bin ich hergekommen und habe sie tot vorgefunden.« Oberhausner betrachtete Nosskes Hände. Dieser hatte den Blick bemerkt. »Natürlich habe ich sie angefasst«, blaffte er. Der aggressive Unterton in seiner Stimme war nicht zu überhören. »Ich wollte feststellen, ob ihr Herz noch schlägt.« Er stürzte den Rest des Cognacs hinunter und strich sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht. »Ich glaube, jemand will mir was anhängen.«
»Wer?«
»Was weiß ich.« Nosske sprach jetzt lauter, ungehalten. »Die Kommunisten, die Juden, der Widerstand. Suchen Sie sich jemanden aus. Gibt ja genügend. Irgendwer war auf jeden Fall hier und hat Lotte … hat Fräulein Lanner … die Kehle aufgeschlitzt.« Er ließ sich auf die Couch fallen und lehnte sich zurück. »Vielleicht hatten die feigen Mörder es auch auf mich abgesehen. Vielleicht war sie einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort.« Er wandte sich Bade und Oberhausner zu. »Sie waren früher bei der Kriminalpolizei, nicht wahr? Haben Kapitalverbrechen aufgeklärt?«
»Wir waren die Besten«, sagte Oberhausner.
»Gut. Finden Sie heraus, wer dahintersteckt.«
»Werden wir«, murmelte Bade, ohne den Blick von der Toten abzuwenden.
»Seien Sie so diskret wie möglich.« Der Obersturmbannführer stand auf, trat wieder ans Fenster und starrte hinaus. Dunkelheit zog auf, senkte sich wie ein Leichentuch über die Stadt. »Irgendetwas an der Sache stinkt«, murmelte er. »Irgendetwas schreit nach Ärger. Nach großem Ärger.«
2
Die Küchenuhr tickte. Regelmäßig und unaufhaltsam erinnerte sie Isaak Rubinstein daran, dass die Welt sich weiterdrehte. Gleichgültig und unbarmherzig schritt die Zeit voran – sie ließ sich nicht von menschlichen Schicksalen beirren, ganz gleich, wie tragisch diese auch sein mochten.
Den ganzen Tag lang hatte er in Zwangsarbeit Munition hergestellt. Munition für einen Krieg, den die Nazis nicht nur gegen die Alliierten, sondern auch gegen ihn und seinesgleichen führten. Gegen angebliche Minderwertige, Volksverderber und Reichsfeinde – gegen Juden. Damit nicht genug, machte in der Fabrik seit Neuestem ein Gerücht die Runde: Die Nazis wollten sie ganz loswerden, sie alle aus dem Reich verjagen.
»Nicht nur aus dem Reich«, hatte der alte Herr Baruch gemeint. »Vom Antlitz der Erde wollen sie uns tilgen.«
»Ach was«, hatte Isaak entgegnet. »Sie brauchen uns doch noch. Wenn wir fort sind, wer soll denn dann die Munition fertigen?«
Er war sich sicher gewesen, dass Baruch und die anderen falschlagen, aber dann war er nach Hause gekommen. Seitdem waren Stunden vergangen, doch noch immer starrte er auf die Benachrichtigung in seinen Händen. Auch Rebekka, seine Eltern und die anderen Juden, mit denen sie sich die Wohnung teilten, hatten eine erhalten.
An Herrn
Isaak Israel Rubinstein
Nürnberg
Guntherstraße 61 Nürnberg, 16. März 1942
Evakuierungsbescheid
Sie haben sich ab Samstag, dem 21. März 1942, 13 Uhr in Ihrer Wohnung aufzuhalten und dürfen diese nicht mehr verlassen.
Sie haben einen Koffer (keine sperrigen Kisten und dergleichen) mit Bekleidungs- und Ausrüstungsstücken wie Anzüge, Mäntel, Wäsche, Bettzeug mit Decken (ohne Federbett) zu packen und bereitzuhalten …
Es folgte eine lange Liste mit Vorschriften und Richtlinien. Welches Gepäck zugelassen war, welche Gegenstände nicht mitgeführt werden durften, wie mit Wohnungsschlüsseln und gültigen Lebensmittelkarten zu verfahren war … All das war penibel aufgelistet. Was nicht angegeben wurde, war das Ziel der Reise.
Wohin würden sie gebracht werden? Was würde dort mit ihnen geschehen? Er wusste nur, dass es nach Osten ging. In ein Ghetto oder Arbeitslager. In eine ungewisse Zukunft, von der nur eines sicher war: Es würde keine gute sein.
So leise wie möglich erhob er sich, trat ans Fenster und starrte voller Zorn nach draußen, wo die Nacht bereits hereingebrochen war.
Während die selbst ernannten Herrenmenschen gut lebten, wurden Juden wie Aussätzige behandelt. Erst waren sie enteignet worden. Die Nazis hatten die Rubinsteins aus ihrem Zuhause gejagt und Isaak sein Antiquariat genommen, in dem er so gern gearbeitet hatte. Als wären sie schmutziges Ungeziefer, hatte man sie in Judenhäuser gepfercht, wo sie mit wildfremden Leuten auf engstem Raum zusammenleben mussten. Dann waren die antisemitischen Bestimmungen gekommen: Die Lebensmittelrationen wurden verknappt, sie durften nicht ins Theater, nichts ins Kino, durften kein Radio hören und auch nicht telefonieren …
Isaak presste die Zähne aufeinander und schluckte den Kloß, der sich in seinem Hals gebildet hatte, hinunter.
Sein Vater war alt, seine Mutter krank, und Rebekka, seine jüngere Schwester, war verwitwet und hatte zwei kleine Kinder, um die sie sich kümmern musste. Er war somit das stärkste Mitglied der Familie. Er war es, dem es oblag, sie zu beschützen. Er war derjenige, der dafür zu sorgen hatte, dass ihnen nichts Schlimmes widerfuhr. Doch wie? Wie sollte er das bewerkstelligen?
Mit jeder Sekunde, die verstrich, wurde Isaaks Ruhelosigkeit größer. Als sie schließlich ein unerträgliches Maß erreicht hatte, schlich er auf Zehenspitzen in den Nebenraum. Dort zündete er ein Streichholz an und ließ dessen schwachen Schein über die dünne Matratze gleiten, auf der Rebekka gemeinsam mit dem sechsjährigen Elias und der zwei Jahre jüngeren Esther lag.
»Bekka«, flüsterte er.
Noch bevor er ihren Namen ganz ausgesprochen hatte, schlug sie die Augen auf und sah ihn vorwurfsvoll an.
Was ist?, formten ihre Lippen lautlos.
Isaak betrachtete die tiefen Sorgenfalten, die sich in ihr Gesicht gegraben hatten. Sie war vor Kurzem dreißig geworden, sah aber um Jahre älter aus.
»Wir müssen reden.«
Behutsam bettete Rebekka die Kinder um, erhob sich von dem harten Lager und folgte ihm auf den Flur.
»Was ist?«, wiederholte sie, nachdem sie die Tür hinter sich geschlossen hatte.
Sie nahm ihm die Streichhölzer aus der Hand, zündete eine Kerze an und hielt sie so, dass die Flamme ihre Gesichter anleuchtete.
»Wir müssen etwas unternehmen«, flüsterte Isaak. »Diese Evakuierung … ich fürchte, das ist keine einfache Umsiedlung. Die haben möglicherweise Schlimmes mit uns vor. Herr Baruch meinte, die Nazis wollen uns Juden ausrotten.«
»Ach, der alte Baruch, der fürchtet sich doch vor seinem eigenen Schatten.« Rebekka strich eine störrische Locke hinters Ohr. »Und selbst wenn er recht hätte … Was sollen wir denn machen? Du hast doch gelesen, was ganz unten in dem Bescheid steht. Wenn wir uns nicht fügen, wird das staatspolizeiliche Folgen haben. Dann kommen wir in die Ludwigstraße oder gleich nach Dachau. Du weißt, was sie dort mit Querulanten machen.«
Isaak dachte an die zugenagelten Särge, die der Israelitischen Kultusgemeinde in regelmäßigen Abständen zugestellt wurden, und nickte. »Trotzdem, wir können nicht einfach nach Osten gehen wie die Lämmer zur Schlachtbank. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache.«
»Baruch will dir nur Angst einjagen. Ich bin mir sicher, Baruch will dir nur Angst einjagen.«
»Ich möchte das gern glauben.« Isaak atmete schwer. »Aber überleg doch mal. Was wurde aus den Menschen, die im November weggebracht wurden? Den Kohns, den Sterns, den Löwenbergs? Von keinem von ihnen hat man jemals wieder etwas gehört. Und hast du gesehen, was den Bescheiden beigelegt war? Durchnummerierte Paketanhängezettel. Für jeden von uns einen. Die Nazis wollen, dass wir sie gut sichtbar an unseren Jacken befestigen. Verstehst du? Wir sind keine Menschen mehr für die, nur noch Dinge, Gegenstände. Wir sollten deshalb nicht …«
»Wir sollten nicht?!«, unterbrach Rebekka ihn. Aus ihrer Furcht war Zorn geworden. »Was bleibt uns denn anderes übrig? Für uns Juden gilt striktes Ausreiseverbot, und auch wenn wir uns dem widersetzen würden … Wo sollen wir hin? Niemand will uns haben. Spanien, die Schweiz, Australien, die USA … Sie lassen uns nicht rein. Wir sind ein gehasstes Volk.« Die Kerzenflamme warf unruhige Schatten auf ihr Gesicht und verlieh ihm einen gehetzten Ausdruck. »Außerdem haben wir kein Geld. Wenn wir alles zusammenkratzen, das die verfluchten Schweine uns gelassen haben, könnten wir nicht einmal die Reise für einen von uns bezahlen geschweige denn für die ganze Familie.« Wut und Verzweiflung trieften aus ihren Worten, und Isaak konnte erkennen, wie schwer es seiner Schwester fiel, nicht laut zu werden.
»Ich dachte …«, setzte er an.
»Du dachtest …«, zischte sie, noch ehe er den Satz beenden konnte. »Dein ewiges Denken bringt uns nirgendwohin.«
»Was, wenn ich um Hilfe bitte?«
»Wen? Wen willst du denn fragen?«
»Aaron Glasscheib hat Gerüchte gehört. Clara … Sie hat offenbar Kontakt zum Widerstand. Vielleicht kann sie ein Versteck für uns finden.«
»Clara Pflüger? Deine Verflossene?« Rebekka schnaubte. »Der kann man doch nicht trauen.« Gedankenverloren betrachtete sie das heiße Wachs, das auf ihre Finger tropfte und dort erstarrte. »Außerdem würde sie, wenn überhaupt, doch nur dir helfen. Uns konnte sie ja nie ausstehen.«
»Ach Rebekka, das waren doch alles nur Missverständnisse.«
Sie schüttelte den Kopf. »Es stimmt schon, was man sagt: Liebe macht blind.« Ihre Stimme bebte. »Wie auch immer. Es ist an der Zeit, der Realität ins Auge zu sehen. Für uns gibt es kein Entrinnen. Alles was uns bleibt, ist, uns zu fügen und das Beste zu hoffen.«
Isaak drückte seine Schwester an sich. »Unsinn. Noch ist nicht alles verloren.«
Sie wand sich aus seiner Umarmung. »Doch, das ist es. Die Nazis …« Ein leises Schluchzen hinter der Tür brachte sie zum Verstummen. »O nein«, stieß sie ächzend aus. »Nicht schon wieder die alte Herzl.«
»Im Osten werden wir alle sterben«, tönte Frau Herzls Stimme durch die Tür. Auch sie hatte einen Transportbescheid erhalten. »Am besten wär’s, wir würden uns selbst umbringen. So wie unsere Leute es damals in Masada gemacht haben, um den Römern zu entgeh’n.«
»Pssst!«, zischte Rebekka. »Seien Sie doch still. Denken Sie an die anderen. Denken Sie an die Kinder!«
Als wäre dies ihr Stichwort gewesen, fing die kleine Esther an zu weinen. »Mama? Mama, wo bist du?«
»Ruhe!«, rief Herr Kronenberg, der mit seiner Frau das Kabinett am Ende des Flures bewohnte. »So nehmen Sie doch gefälligst Rücksicht.«
Rebekka wandte sich wieder ihrem Bruder zu und schnaubte. »Zufrieden? Du hast es tatsächlich geschafft, diese schreckliche Nacht für alle noch schlimmer zu machen.«
Isaak wusste, dass ihr Groll nicht ihm galt, sondern dem grausamen System, das ihnen seit Jahren das Leben zur Hölle machte. Trotzdem trafen ihn die Worte seiner Schwester. Ohne lange nachzudenken, griff er nach seinem abgewetzten braunen Sakko, das an der Garderobe neben der Wohnungstür hing.
»Was tust du denn?« Rebekka packte seinen Arm, als er begann, an dem handtellergroßen Stern herumzunesteln, der leuchtend gelb auf der Brusttasche prangte.
»Ich muss zu Clara, muss versuchen, eine Alternative für uns zu finden.«
Rebekka wurde so blass, dass Isaak es selbst in dem spärlichen Licht erkennen konnte. »Du weißt, dass das verboten ist«, flüsterte sie. »Wir Juden haben nächtliche Ausgangssperre. Und außerdem darfst du dich nicht ohne Stern in der Öffentlichkeit zeigen.« Sie krallte ihre Fingernägel in seine Haut und trat so nah an ihn heran, dass er ihren Atem an seinem Hals spüren konnte. »Wenn sie dich erwischen, dann bringen sie dich in die Ludwigstraße. Selbst in der Hölle soll es barmherziger zugehen als dort.«
Isaak wand sich aus ihrem Griff. »Ich kann nicht einfach tatenlos abwarten.« Er löste die Fäden und nahm den Stern ab.
»Kann das nicht bis morgen warten?«
Er fasste Rebekka an den Schultern und pustete die Kerze aus. »Die Uhr tickt. Nichts kann mehr warten.«
3
»Ich kann hier nicht bleiben«, sagte Nosske.
»Natürlich.« Oberhausner starrte auf die Leiche. »Sie haben sie sicher sehr gelie…«
»Das ganze Blut«, redete Nosske weiter. »Der Geruch ist unerträglich.«
Bade betrachtete den Boden und fuhr mit den Fingerspitzen über die Wand. »Die Dielen sind hinüber, und es muss neu gestrichen werden.«
»Der Bauherr wird keine Freude haben«, murmelte Nosske und ging in den Vorraum. »Es hat Monate gedauert, die Räume zu restaurieren. Das Holz ist original aus dem Mittelalter.«
Tatsächlich hatte der Architekt des Umbaus, Horst Westinger, versucht, den Einfluss der vergangenen Jahrhunderte zu eliminieren und das Gebäude zurück auf seine ursprüngliche germanische Bauweise zu reduzieren. Er wollte das deutsche Wesen herausarbeiten, das er als rustikal und schnörkellos, einfach und hehr bezeichnete.
»Was für eine Schande, dass das jetzt alles durch die infame Tat eines Barbaren beschmutzt wurde.« Nosske kam mit einem Koffer zurück und verschwand damit im Schlafzimmer. »Tun Sie, was Sie tun müssen«, rief er durch die offene Tür. »Ich weiß, Sie beide sind gerade an wichtigen Operationen beteiligt, aber dieser Fall hat oberste Priorität.«
Oberhausner warf Bade einen vielsagenden Blick zu.
Dieser zuckte mit den Schultern, ging in die Hocke und hob den linken Arm der Toten an. Er beugte das Gelenk, was noch mit geringem Kraftaufwand möglich war, und kontrollierte anschließend ihre Lider. »Ich schätze, sie ist seit zirka zwei Stunden tot. Vielleicht kürzer. Es ist gut geheizt hier drinnen. Die Wärme beschleunigt den Verwesungsprozess.«
»Ich weiß. Rommels Jungs können ein Lied davon singen.« Oberhausner schaute auf seine Uhr. »Es ist jetzt zwanzig vor sieben. Das heißt, es ist irgendwann zwischen halb fünf und der Ankunft des Obersturmbannführers passiert.«
Bade nickte.
»Ich befrage den Pförtner. Der Kerl führt Buch. Vielleicht hilft uns das weiter.«
Bade betrachtete eine Fliege, die sich auf dem Augapfel der Toten niedergelassen hatte und nun hektisch darauf herumtrippelte. »Machen Sie das. Ich suche in der Zwischenzeit nach der Tatwaffe.«
»Heil Hitler!« Der Pförtner stand stramm.
Oberhausner musterte den jungen Mann. Er schätzte ihn auf Ende zwanzig, ein hochgewachsener Bursche mit wachen Augen und roten Wangen. »Wie lautet Ihr Name?«
»Hildebrandt. Werner Hildebrandt.«
Oberhausners Blick blieb am rechten Arm des Pförtners hängen, oder besser gesagt an der Stelle, wo dessen rechter Arm hätte sein sollen.
»Schlacht um Kiew.«
»Ein großer Sieg.« Er betrachtete das Eiserne Kreuz 1. Klasse, das auf der linken Brustseite von Hildebrandts Jacke angebracht war – eine hoch angesehene Kriegsauszeichnung. »Seit wann verrichten Sie heute hier Dienst?«
»Seit zwölf Uhr mittags.«
Nervös wischte Hildebrandt seine Hand an der Hose ab, während Oberhausner wortlos nach dem Gästebuch griff, das auf dem Empfangstresen lag.
»Sie haben sämtlichen Personenverkehr gewissenhaft notiert?«
»Aber ja, natürlich. Dafür bin ich hier. Was ist denn passiert? Ist etwas mit Herrn Nosske? Oder Fräulein Lanner?«
»Beantworten Sie einfach nur meine Fragen. Sie haben alle Personen erfasst, die heute hier ein und aus gegangen sind?«
Hildebrandt schluckte. »Ja, ich bin da sehr penibel. Ich habe lange in einer Heeresmunitionsanstalt Dienst geschoben. So etwas prägt.« Er tippte auf die aufgeschlagene Seite, die mit kleinen krakeligen Buchstaben beschrieben war.
»Sind das alle?«, gab Oberhausner sich unbeeindruckt.
»Die Fliesenleger waren hier, die Maler und der Elektriker. Die ehemalige Kemenate wird ja noch immer umgebaut. Die Handwerker haben den letzten Feinschliff vorgenommen, damit die übrigen Bewohner am Montag hier einziehen können.«
»Wer war gegen halb fünf im Haus?«
Hildebrandt fuhr mit dem Finger über die Seite. »Um 16:25 Uhr hat Fräulein Lanner uns beehrt. Abgesehen vom Elektriker, war zu der Zeit keiner mehr hier. Die anderen Handwerker waren mit ihrer Arbeit bereits fertig, und außer Obersturmbannführer Nosske ist bisher noch niemand eingezogen.«
»Der Elektriker …« Oberhausner nickte wissend, doch dann nahm sein Gesicht plötzlich einen fragenden Ausdruck an. Er drehte das Buch zu sich herum. »Warum steht hier ein zweites Mal der Name von Fräulein Lanner? Eine Stunde später?«
»Sie hatte wohl etwas vergessen und darum die Burganlage noch einmal verlassen, zeitgleich mit dem Elektriker. Das war um 17:01 Uhr, um genau zu sein. Hier, sehen Sie? Ich trage die Ausgänge hinter den Namen ein. Um 17:38 Uhr kam sie wieder zurück.«
»Vor etwas mehr als einer Stunde«, sinnierte Oberhausner.
»So ist es. Um 18:05 Uhr kam dann Herr Nosske, um 18:31 Uhr Sie und Ihr Kollege.«
Oberhausner starrte auf das Blatt.
EIN
UHRZEIT
NAME (FIRMA)
AUS
UHRZEIT
08:00
Erich Ilg & Max Wieser
(Fliesen Wieser)
16:10
08:00
Robert Wallner, Siegfried Nauber
(Maler Hess)
16:03
15:30
Hubert Bauer (Elektro Mayer)
17:01
16:25
Frl. Lotte Lanner
17:01
17:38
Frl. Lotte Lanner
18:05
Ostubaf Fritz Nosske
18:31
2 Herren Gestapo
»Wer war zwischen Fräulein Lanner und dem Obersturmbannführer hier? Wer könnte in diesen siebenundzwanzig Minuten die Wohnung betreten haben?«
»Niemand.« Ein dicker Schweißtropfen rann über Hildebrandts Oberlippe. »Ist mit Herrn Nosske und Fräulein Lanner alles in Ordnung?«, versuchte er noch einmal herauszufinden, was los war. »Kann ich bei irgendetwas behilf…«
»Fräulein Lanner war also ab 17:38 Uhr völlig allein in der Burg«, sinnierte Oberhausner laut.
»So ist es«, bestätigte Hildebrandt. »Ganze siebenundzwanzig Minuten lang, bis um 18:05 Uhr Herr Nosske eintraf.«
»Gibt es einen Hintereingang? Hätte sich jemand unbemerkt einschleichen können?«
Hildebrandt schüttelte den Kopf. »Nie und nimmer. Diese Anlage wurde zu dem Zweck erbaut, dass niemand sie unbemerkt und unbefugt betreten kann. Der einzige Weg führt an mir vorbei und da hindurch.« Er zeigte auf das schmale Tor, das in den inneren Burghof führte. »Was ist denn passiert?«
»Und Sie waren die ganze Zeit hier?«, ignorierte Oberhausner die Frage. »Sie haben keine Pause gemacht?«
Hildebrandt schaute ihn entgeistert an und streckte den Rücken durch. »Aber nein. Wo denken Sie hin? Ich nehme meine Arbeit sehr ernst.« Oberhausners Blick blieb erneut an dem Eisernen Kreuz auf Hildebrandts Brust hängen. Man bekam diesen Orden für besondere Tapferkeit vor dem Feind. Der junge Mann musste an der Front etwas äußerst Mutiges geleistet haben. »Ich schwöre bei allem, was mir lieb und teuer ist, dass meine Aufzeichnungen stimmen.« Hildebrandt fasste sich ans Herz. »Zwischen 17:38 Uhr und 18:05 Uhr war Fräulein Lanner völlig allein in der Burg.«
Oberhausner schwieg, schnappte sich schließlich das Gästebuch und ging, ohne ein weiteres Wort zu verlieren, zurück in den Wohntrakt. Er durchschritt die Eingangshalle, stieg die Treppe hoch und blickte aus einem der Fenster im Flur auf die Stadt. Die letzten einsamen Lichter, die der Nacht noch trotzten, würden in wenigen Minuten der Verdunkelungspflicht zum Opfer fallen und alles in mondkalte Schwärze tauchen.
Er überlegte. Als der Mord stattgefunden hatte, war es noch hell gewesen. Die Burg stand frei auf einer Anhöhe, völlig exponiert. Beim Umbau hatte man großen Wert darauf gelegt, sämtlichen Zierrat zu entfernen – auch den von der Fassade. Nun war alles glatt und reduziert, nüchterne deutsche Moderne, so wie der Führer es mochte. Selbst für einen erfahrenen Bergsteiger wäre es unmöglich gewesen, unbemerkt in die Wohnung des Obersturmbannführers zu klettern.
Ein Schauer kroch über Oberhausners Rücken. Nosske hatte recht. Irgendetwas an der Sache stank. Und zwar gewaltig.
»Was soll das heißen, es ist eigentlich nicht möglich?«, schimpfte Nosske, nachdem Oberhausner ihn über die neuesten Erkenntnisse informiert hatte.
»Werner Hildebrandt sitzt in seiner Pförtnerloge wie Zerberus vor dem Tor zur Unterwelt. Er hat akribisch jeden notiert, der heute ein und aus gegangen ist.« Oberhausner zeigte auf das Gästebuch, das auf dem Couchtisch lag. »Hildebrandt schwört, dass in der kurzen Zeitspanne zwischen Fräulein Lanner und Ihnen niemand die innere Burganlage betreten oder verlassen hat. Der Kerl war bei der Wehrmacht, wurde bei Kiew schwer verwundet und hat ein Eisernes Kreuz 1. Klasse …«
»Niemand? Niemand soll zwischen mir und Lotte die Burganlage betreten haben?« Nosske lief vor lauter Zorn rot an. »Wollen Sie damit etwa andeuten, dass ich …«, brüllte er so laut, dass Oberhausner zusammenzuckte.
»Natürlich nicht. Ich wollte damit ausdrücken, dass wir es mit einem sehr ausgefuchsten …«
»Wenn ich Lotte hätte umbringen wollen, dann wäre ich wohl nicht so dämlich, es selbst zu machen, und schon gar nicht in meiner eigenen Wohnung.« Speicheltropfen segelten durch die Luft. »Glauben Sie, dass ich von allen guten Geistern verlassen bin?«
Oberhausner blieb regungslos stehen. »Ich glaube weder, dass Sie von allen guten Geistern verlassen sind, noch glaube ich, dass Sie Fräulein Lanner umgebracht haben.«
Nosske schnaubte, setzte sich auf die Couch und zündete sich eine Zigarette an. »Reden Sie weiter.«
»Wer auch immer es getan hat, war äußerst perfide. Wir haben es mit einem ausgeklügelten Vorgehen zu tun. Ich denke, dass jemand Ihnen etwas anhängen will, jemand, der weiß, was er tut.«
»So weit bin ich auch schon gekommen.« Nosske schaute zu Bade, der mit regungsloser Miene die Szene beobachtet hatte. »Was haben Sie herausgefunden?«
»Die Tatwaffe steckte im Messerblock in der Küche. Frisches Blut zwischen Klinge und Heft. Der Griff war aber gründlich abgewischt. Keine Fingerabdrücke.«
»Und sonst?«
»Keine Einbruchspuren an der Tür oder den Fenstern. Keine sonstigen Zugangsmöglichkeiten.«
»Wir haben es also mit jemandem zu tun, der unsichtbar ist und durch Wände gehen kann.« Nosskes Stimme triefte vor Zynismus.
»Auf jeden Fall haben wir es mit einem sehr gefährlichen Täter zu tun.« Bade verschränkte die Arme und ließ seinen Blick durch das Zimmer wandern. »Irgendetwas übersehen wir.«
Nosske schnaubte erneut. »Sind Sie denn beide auf den Kopf gefallen? Die Lösung liegt ja wohl auf der Hand. Dieser Hildebrandt muss es gewesen sein. Wenn Ihre Ausführungen stimmen, ist er der Einzige, der infrage kommt.«
Oberhausner zeigte auf die Tote. »So wie es aussieht, hat der Täter Fräulein Lanner von hinten gepackt, sie mit einer Hand festgehalten und ihr mit der anderen die Kehle durchgeschnitten.« Er vollführte die Bewegung in der Luft. »Hildebrandt hat aber nur einen Arm.«
Nosske fasste sich an den Kopf. »Und Sie wollen einer der besten Kriminalisten der Truppe sein? Dieses Schwein hatte natürlich Komplizen. Ich wette, dass der Widerstand hinter der ganzen Sache steckt. Das waren bestimmt die Schweine von der Fränkischen Freiheit.« Er stand auf und ging ins Vorzimmer. »Worauf warten Sie?«, rief er. »Kümmern Sie sich gefälligst um dieses Subjekt.«
4
Es war beängstigend, mitten in der Nacht im Freien zu stehen, noch dazu ohne Davidstern. Isaak, der sich den antijüdischen Bestimmungen bisher widerstandslos unterworfen hatte, ließ seinen Blick erst die Straße hinunter und schließlich hinauf ans Firmament wandern. Der Mond war noch ganz jung, nicht mehr als eine schmale Sichel, und da seit geraumer Zeit Verdunkelungspflicht herrschte, um dem Feind bei einem möglichen Angriffsflug kein Ziel zu bieten, waren dies gute Voraussetzungen, um unbemerkt von A nach B zu gelangen. Er kontrollierte den Sitz seiner Mütze und versuchte, seine Nervosität in den Griff zu bekommen. Sollte er es wirklich wagen?
Isaak schluckte trocken. Er musste los, bevor die Furcht ihn zurück in die Wohnung scheuchte. »Verdunkelung ist erste Pflicht, wenn Luftgefahr und Feind in Sicht«, murmelte er eines jener Gedichte, mit denen die Nazis versuchten, Kindern die Regeln an der Heimatfront einzubläuen. »Er darf aus tausend Meter Höh’n auch nicht den kleinsten Schimmer seh’n.« Auch er durfte nicht gesehen werden. Nicht, wenn ihm sein Leben lieb war.
Mit hochgezogenen Schultern huschte er davon, eilte durch die Finsternis die Guntherstraße entlang in Richtung Steinbühl, wo Clara lebte. »Ob er nun hoch, ob niedrig fliegt, wenn alle Welt im Finstern liegt …«, zitierte er leise und überlegte, wovor er sich mehr fürchtete. Von den Nazis erwischt zu werden oder Clara wiederzusehen.
Ein knappes Jahr lang waren sie ein Paar gewesen, damals, vor dem Krieg. Wegen der Rassegesetze hatten sie ihre Liebe geheim halten müssen und darauf vertraut, dass die Herrschaft der Nazis irgendwann vorübergehen würde – so wie die Bayerische Räterepublik oder die Weimarer Reichsregierungen. Doch der Schrecken war nicht vergangen, sondern hatte an Kraft gewonnen, hatte sich von einem leisen Bach in einen reißenden Fluss verwandelt.
Clara hatte gewollt, dass sie zusammen fortgingen. Nach Wien, nach London oder New York. Irgendwohin, wo sie das sein durften, was sie waren. Zwei Menschen, die sich liebten.
»… dann kann er kein Ziel zum Angriff seh’n und lässt das Bombenschmeißen geh’n.«
Mit eiligen Schritten passierte Isaak Häuserfronten und Parkanlagen, verdrängte die Erinnerungen, die ihn zu überwältigen drohten. Er atmete die kühle Nachtluft ein, die nach nassem Asphalt roch, und besann sich auf das Gute, das es noch in seinem Leben gab. Er war kurz davor, den Hauch von Freiheit zu genießen, als sich plötzlich ein Druck in seiner Brust breitmachte. Wie von Geisterhand erzwungen, wandte sich sein Kopf nach rechts, und er hielt inne.
Seltene Bücher aus aller Welt, alte Drucke, antike Landkarten, wissenschaftliche Abhandlungen, versprach ein Aushang in einem Schaufenster. Er musste die geschwungenen Buchstaben aus schwarzer Tusche nicht lesen, um zu wissen, was dort stand. Immerhin hatte er sie selbst geschrieben. Damals, als der kleine Laden noch ihm gehört hatte.
Mit einem Mal hatte Isaak den Geruch von Druckerschwärze in der Nase. Er hörte das Knacken der hölzernen Regale, das Surren der Deckenleuchte, und spürte die Wohligkeit, die sprödes Papier in ihm auslöste, wenn er mit seinen Fingerkuppen darüberfuhr. Eine Woge von Ruhe und Geborgenheit umspülte ihn, doch das Gefühl hielt nicht lange an. Wie eine Seifenblase zerplatzte es, als er den Namen des Geschäftes sah.
JOHANN MÜLLER & SÖHNE hieß sie jetzt, seine kleine Welt. Mächtig groß und auf Hochglanz poliert, prangte ein Schild genau dort, wo früher, kleiner und bescheidener, Antiquariat Rubinstein gestanden hatte.
Die Zeit heilt alle Wunden, so sagte man, doch er wusste es besser. Seine Schätze, die er in jahrelanger Arbeit zusammengetragen, das Unternehmen, das er mit so viel Liebe und Bedacht aufgebaut hatte … Alles war von den Nazis konfisziert worden. Sie nannten das Entjudung. Er nannte es Raub. Seine Verzweiflung über diese Ungerechtigkeit – sie würde nie vergehen.
Plötzlich erklangen Schritte, kamen näher, bewegten sich zielstrebig auf ihn zu, doch Isaak konnte sich nicht losreißen. Wie gebannt, starrte er in die Auslage.
Vielleicht sollte er sich einfach verhaften lassen, dem Elend ein Ende setzen und widerstandslos zugrunde gehen …
Er dachte an seine Familie, blinzelte die Tränen fort und schlüpfte in eine Hauseinfahrt. Dort presste er sich mit dem Rücken gegen die Mauer, hielt den Atem an und stellte entsetzt fest, dass die Passanten – wer auch immer sie waren – stehen blieben. Hatten sie ihn etwa bemerkt?
»Haben Sie schon mal im Dunkeln geküsst, ja? Wissen Sie denn auch wie schön so was ist, nein? Wenn man wirklich einmal alles vergisst …«, hörte er plötzlich einen Mann nur wenige Meter von ihm entfernt völlig schief singen.
Eine Frau kicherte. »Hören Sie auf, Sie Schlimmer.«
»Jetzt seien Sie doch nicht so prüde.«
Stoff raschelte, leises Stöhnen ertönte.
»Nicht!«, sagte die Frau plötzlich. »Jetzt geh’n Sie aber zu weit.«
Sie stöckelte davon. Der Mann folgte ihr, Beschwichtigungen und Beteuerungen rufend.
Isaak atmete auf und wartete, bis die beiden außer Hörweite waren. Dann setzte er seinen Weg fort.
Als er sein Ziel endlich erreichte, war er trotz der Kälte schweißgebadet. Er wischte sich übers Gesicht, stellte sicher, dass außer ihm niemand in der Nähe war, schlich durch einen Vorgarten und klopfte gegen eine Fensterscheibe. Hoffentlich hatte Aaron recht gehabt. Hoffentlich lebte Clara noch immer in der kleinen Wohnung im Erdgeschoss.
Nichts geschah.
Er wiederholte die Prozedur. Drei Jahre hatte er sie nicht gesehen. Drei lange Jahre, in denen er täglich an sie gedacht hatte. Leb wohl, Isaak, hallte ihre Stimme in seinen Ohren wider. Es waren die letzten Worte, die er von ihr gehört hatte.
Endlich waren aus dem Inneren des Hauses Geräusche zu vernehmen. Eine Kerze wurde angezündet, ein Gesicht erschien im Fenster, und Isaaks Herz setzte für ein paar Schläge aus.
»Clara …«
Ihre Augen weiteten sich. Sie starrte ihn an – den Geist aus der Vergangenheit.
Isaak, formten ihre Lippen nach einigen langen Sekunden. Sie öffnete das Fenster.
»Bist du allein?«, flüsterte er. Sein Mund war plötzlich staubtrocken. »Kann ich reinkommen?«
Sie nickte und deutete zur Eingangstür.
Er huschte hinüber, wartete, fühlte, wie die Zeit plötzlich stehen blieb und anfing rückwärtszulaufen. Wie oft hatte er hier gestanden, hatte darauf gewartet, dass sie die Tür öffnete. Verloren geglaubte Erinnerungen stiegen an die Oberfläche seines Bewusstseins. Verstohlene Blicke, herzliches Lachen, der erste Kuss …
»Was tust du hier?« Sie öffnete die Tür, streckte den Kopf heraus, schaute nach links und rechts die Straße hinunter und hinauf und trat schließlich zur Seite. »Herrscht für euch Juden denn keine Ausgangssperre?«, flüsterte sie, während er in den Hausflur schlüpfte.
»Ja, schon, aber …«
»Aber?«
Sie sah noch genauso aus wie früher. Ihr blondes Haar fiel in sanften Wellen auf ihre Schultern, ihre Augen strahlten, und ein trotziger Ausdruck lag um ihren Mund.
»Ich brauche deine Hilfe.«
Clara schloss die Eingangstür. »Bist du sicher, dass dir keiner gefolgt ist?« Als er nickte, schob sie ihn in ihre Wohnung. »Schnell«, drängte sie.
Er atmete auf und sah sich um. »Es sieht anders aus, als ich es in Erinnerung habe.«
Clara sah ihn an. Durchdringend. Fragend. »Vieles hat sich verändert.« Sie musterte ihn. »Nicht nur die Möbel sind neu.« Sie kontrollierte die Vorhänge, vergewisserte sich, dass sie ganz zugezogen waren. »Du hast mich vielleicht erschreckt«, sagte sie schließlich, machte das Licht an und ließ sich auf das Sofa fallen. »Wenn um diese Zeit jemand anklopft, heißt das normalerweise nichts Gutes.«
»Tut mir leid.« Isaak nahm die Mütze ab und setzte sich auf einen Stuhl.
Clara sagte nichts, sah ihn nur an. Stumm. Unergründlich.
»Wir haben einen Bescheid erhalten«, erklärte er. »Die Nazis … Sie jagen uns aus der Stadt … wollen uns abtransportieren, keine Ahnung, wohin. Übermorgen werden sie uns abholen.«
Clara hob den Deckel einer kleinen silbernen Schatulle, die vor ihr auf dem Tisch stand, holte eine lange dünne Zigarette daraus hervor, zündete sie an und begann schweigend zu rauchen.
»Ich hab ein schlechtes Gefühl dabei«, sprach Isaak weiter. »Die Menschen, die im November weggebracht wurden … niemand hat mehr von ihnen gehört.«
Clara blies Rauch aus. »Und was hat das mit mir zu tun?« Noch immer war ihre Miene ausdruckslos.
»Kannst du dich an Aaron erinnern? Aaron Glasscheib? Wir haben gemeinsam Zwangsarbeit verrichtet. Eines Tages hat er so eine Andeutung gemacht … hat durchblicken lassen, dass du Kontakt zum Widerstand hast.«
Claras Kiefermuskulatur spannte sich an. »Das ist nur ein Gerücht, und zwar ein gefährliches. Sag Aaron, er soll gefälligst den Mund halten. Solche Andeutungen können mich Kopf und Kragen kosten.«
Isaak deutete auf die Schatulle, Clara nickte, und er nahm sich eine Zigarette. »Keine Sorge. Aaron kann niemandem mehr etwas erzählen. Sie haben ihn dabei erwischt, wie er versucht hat, unter falschem Namen auszureisen. Haben ihn erschossen.«
Es war schwer zu sagen, ob Clara betroffen oder erleichtert darüber war. Wahrscheinlich beides. »Nur mal angenommen, ich hätte tatsächlich Verbindungen. Was dann?«
»Dann finde ein Versteck für uns. Ich weiß, das ist viel verlangt, aber wir würden uns irgendwie erkenntlich …«
»Uns? Wir?« Ihr Gesicht nahm einen schmerzlichen Zug an. Es war das erste Mal, dass sie Gefühle zeigte. »Noch immer …«
»Clara …«
»Schon gut«, winkte sie ab. »Ich weiß. Deine Familie ist das Wichtigste für dich. Wichtiger als dein eigenes Leben. Wichtiger als …« Sie hielt inne.
»Clara …«, setzte Isaak noch einmal an.
»Schon gut«, wiederholte sie.
Es war, als wären die letzten drei Jahre nie vergangen. Als wäre die Zeit einfach stehen geblieben. Sie hatte denselben Gesichtsausdruck wie damals bei ihrem letzten Treffen. Ihre Augen waren voller Unverständnis, ihre Stimme klang vorwurfsvoll, und er fühlte sich so zerrissen wie eh und je.
»Meine Entscheidung damals – ich habe es auch für dich getan.«
Sie blickte zu Boden.
»Wir hätten niemals zusammenbleiben können. Nicht hier in Nürnberg. Nicht hier im Deutschen Reich.« Noch immer hatte er das Bedürfnis, sich zu rechtfertigen. »Die Trennung war das einzig Richtige. Sie hätten dich sonst fertiggemacht.«
»Du kannst nicht bestimmen, was für andere Menschen das Richtige ist. Wir hätten gehen können. Vor dem Krieg. Bevor alle Grenzen dicht waren.«
»Und meine Familie einfach im Stich lassen? Mutter war krank, Rebekka frisch verwitwet mit zwei kleinen Kindern. Glaub mir, ich wollte nichts mehr, als mit dir fortzugehen«, beteuerte er. »Aber sie alle hier zurückzulassen … Ich hätte mit der Schuld nicht leben können.«
»Und? Hat dein Opfer irgendjemandem genutzt?« Der Zynismus in Claras Stimme war nicht zu überhören. Sie schürzte die Lippen. »Dieses Gespräch führt zu nichts«, sagte sie schließlich. »Hat es schon damals nicht.«
Isaak rauchte still.
»Sechs Personen beim Untertauchen zu helfen ist unmöglich«, durchbrach Clara die Stille. »Einer allein ist schon eine Herausforderung. Wie stellst du dir das vor?«
Isaak zog die Schultern hoch. »Ich weiß nicht.«
»Du weißt nicht? Weißt du denn wenigstens, was die Gestapo mit Leuten tut, die Juden unterstützen?« Sie wartete nicht auf eine Antwort. »Sie werden aufgrund der Volksschädlingsverordnung, manchmal sogar wegen Hochverrats angeklagt. Sie landen in den Folterkellern oder werden gleich nach Dachau geschickt. Wenn sie Glück haben, kommen sie ein paar Monate später als gebrochene Menschen wieder zurück. Und wenn nicht …« Sie ließ die schreckliche Wahrheit unausgesprochen in der Luft hängen. »Niemand will sich freiwillig so einem Risiko aussetzen.«
Isaak drückte die Zigarette im Aschenbecher aus und starrte auf seine Hände. »Verstehe.« Er erhob sich und ging in den Vorraum. »Tut mir leid. Ich will niemanden in Gefahr bringen oder mit meinen Problemen belästigen.«
Clara betrachtete ihn lange und stand auf. »Ich werde mich umhören. Wenn mir etwas zu Ohren kommt, melde ich mich. Wohnt ihr noch immer in Gostenhof? In der …«
»Nein«, unterbrach er. »Wir mussten in ein Judenhaus ziehen.« Er schluckte seine Verbitterung hinunter und nannte die genaue Adresse.
»Es tut mir sehr leid. Alles.« Clara machte einen Schritt auf ihn zu, blieb so nah vor ihm stehen, dass er die Wärme ihres Körpers spüren konnte. Sie sah zu ihm hoch.
Isaak verlor sich im Grün ihrer Augen, spürte ihren Atem an seinem Hals.
»Auf Wiedersehen«, sagte sie und öffnete leise die Tür.
Isaak küsste sie auf die Stirn. »Leb wohl.«
5
»Ich schwöre auf mein Leben, auf das meiner Mutter! Ich weiß von nichts.«
Werner Hildebrandt rannen Tränen übers Gesicht, sie hinterließen salzige Schlieren, die unangenehm juckten, doch er konnte sie nicht fortwischen. Die Gestapoleute hatten ihn gezwungen, sich auszuziehen und sich in die Mitte eines Raumes zu stellen. Es war ihm verboten, sich zu setzen oder irgendwo anzulehnen, und auch bewegen durfte er sich nicht.
Bade kaute auf einem Zahnstocher herum und ließ seinen Blick über Hildebrandts nackten Körper wandern. »Wer sind deine Komplizen?«, fragte er ohne den Hauch einer Regung in der Stimme.
Hildebrandt keuchte, kalter Schweiß vermischte sich mit seinen Tränen. »Ich habe keine. Ich habe nichts getan. Ich weiß ja noch nicht einmal, was passiert ist.«
Er schaute seinem Peiniger direkt ins Gesicht, wunderte sich über dessen harmlose Erscheinung. Man hätte ihn für einen freundlichen Mann halten können, einen netten Nachbarn, einen fürsorglichen Familienvater. Nichts an seinem Aussehen ließ auf das schließen, was er hier und jetzt tat.
Bade zuckte mit den Schultern. »Selbst schuld«, murmelte er und schlug mit einem Ochsenziemer auf Hildebrandts rechten Oberschenkel.
Die Rute durchschnitt die Haut des jungen Mannes. Warmes Blut lief an seinem Bein hinunter und tropfte auf den schmutzigen Boden. Hildebrandt biss die Zähne zusammen und starrte, da er Bades gleichgültigen Blick nicht länger ertrug, auf die unverputzte Ziegelwand. Das fensterlose Gemäuer war feucht und verströmte einen modrigen Geruch. Die nackte Glühbirne, die die schmale Zelle mit schwachem Licht versorgte, flackerte nervös, das Gekrabbel von Ungeziefer drang aus den dunklen Ecken.
»Ich bin unschuldig«, stieß er hervor. »Ich weiß von nichts, ich habe Ihnen alles gesagt.«
»Spar dir die verdammten Lügen.« Erneut ließ Bade den Ziemer durch die Luft sausen. »Du glaubst, dein Arm fehlt dir? Versuch mal, dir vorzustellen, wie es sich ohne Augen lebt.« Er trat mit dem Fuß gegen Hildebrandts Schienbein. »Die Fahne hoch! Die Reihen fest geschlossen! SA marschier, mit ruhig festem Schritt. Kam’raden, die Rotfront und Reaktion erschossen, marschier’n im Geist in unser’n Reihen mit«, sang er, während er langsam einmal um Hildebrandt herumging.
Als er wieder am Ausgangspunkt angekommen war, zog er das rechte Lid des jungen Mannes nach oben und hielt die Spitze des Ochsenziemers vor den Augapfel. »Du hast den Führer verraten, das Volk und das Vaterland.«
»Nein, nicht, bitte … Ich war an der Front … war in Kiew … Wir stehen auf derselben Seite, kämpfen für dieselbe Sache …« Hildebrandt wollte das Gesicht wegdrehen, doch Bade packte seinen Kopf und hielt ihn fest.
»Von wegen. Gute Männer haben ihr Leben gelassen, wegen Verrätern wie dir. Ein Auge ist das Mindeste …«
In diesem Moment wurde die massive Holztür aufgerissen. Schmerzensschreie und gedämpftes Wimmern waren von draußen zu hören. Hildebrandt war nicht der Einzige, der hier unten festgehalten wurde.
»Sie werden gebraucht«, ertönte eine Stimme.
»Kann das nicht warten?«, fragte Bade. Sein Tonfall war trocken und geschäftsmäßig.
»Leider nein. Es eilt. Obersturmbannführer Nosske hat Razzien angeordnet. Sämtliche Personen, die unter Verdacht stehen, der Fränkischen Freiheit anzugehören, sollen noch heute Nacht verhaftet werden.«
»Schon heute?« Bade zog eine Augenbraue hoch. »Ist das nicht noch zu früh? Soweit ich informiert bin, wollten die Kollegen, die sich um die politischen Gegner kümmern, damit aus taktischen Gründen noch abwarten.«
»Wie auch immer. Der Obersturmbannführer besteht darauf, dass die Aushebungen augenblicklich beginnen.«
»Glück gehabt«, zischte Bade in Hildebrandts Ohr. »Aber lass dir eins gesagt sein: Aufgeschoben ist nicht aufgehoben.«
6
Das Klopfen war so heftig, dass das Türblatt vibrierte. »Aufmachen!«, verlangte ein Mann lautstark. Die Aufforderung war sicher im ganzen Haus zu hören. »Aufmachen«, wiederholte er, noch bevor irgendjemand in der Lage gewesen wäre, der Forderung nachzukommen.
Ein kurzer stiller Augenblick wurde von aggressivem Hundegebell durchbrochen.
Sie waren gekommen. Hitlers Schergen.
Es war Teil ihrer Taktik, plötzlich und unerwartet aus dem Nichts aufzutauchen. Sie brachen ein, nahmen mit, was sie wollten, und verschwanden so schnell, wie sie gekommen waren. Der einzige Unterschied zu gewöhnlichen Dieben bestand darin, dass es Menschen waren, die sie raubten.
»Öffnen Sie sofort, oder wir brechen das Schloss auf!« Der Unterton, der in seinen Worten mitschwang, ließ keinen Zweifel daran, dass der Mann es ernst meinte.
»Moment. Einen kleinen Moment!«
»Sofort, hab ich gesagt!«
»Ich komme ja schon.«
Er zog sich ein Hemd über und öffnete.
»Arthur Krauss?«
Ein schmaler, unscheinbarer Kerl stellte sich so nah vor ihn, dass sich ihre Nasen beinahe berührten. Sein Atem roch nach Zigarettenrauch, sein gescheiteltes Haar glänzte ölig.
»Ja?« Krauss trat einen Schritt zurück, musterte sein Gegenüber und wandte seine Aufmerksamkeit schließlich den drei anderen Männern zu, die wie menschliche Türme hinter ihm aufragten. Sie waren in Zivil gekleidet und wirkten auf den ersten Blick gar nicht mal so furchterregend. Genau das war es aber, was Arthur Krauss einen kalten Schauer über den Rücken jagte. Wenn die vergangenen Jahre ihn eines gelehrt hatten, dann war es die Tatsache, dass die tiefsten Abgründe meist hinter den banalsten Fassaden lauerten. »Ich wollte gerade zu Bett gehen. Was …«
»Das erfahren Sie noch früh genug.« Der Mann deutete ins Treppenhaus.
»Ich verstehe nicht.« Krauss strich eine Strähne seines braunen Haars hinters Ohr und sah ihn fragend an.
»Das tun Sie sehr wohl.« Er machte eine kurze Pause. »Ich verhafte Sie aufgrund der Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutze von Volk und Staat. Kommen Sie mit!«
»Zum Schutze von Volk und Staat?« Krauss riss die Augen auf. »Das muss ein Missverständnis sein, eine Verwechslung. Ich habe nichts Schlimmes getan.«
»Wenn es so wäre, dann wären wir wohl kaum hier.«
Der Mann steckte sich einen Zahnstocher zwischen die spröden Lippen und packte Krauss am Oberarm.
Dieser wand sich aus dem Griff. »Was erlauben Sie sich? Ich bin ein rechtschaffener Bürger, dem Vaterland und dem Führer treu ergeben.«
»Dann haben Sie ja nichts zu befürchten.« Der Mann grinste.
Arthur Krauss knöpfte sein Hemd zu und verschränkte die Arme vor der Brust. »Darf ich mir wenigstens noch eine Hose anziehen?«, bat er und erschrak darüber, wie viel Panik in seiner Stimme mitschwang.