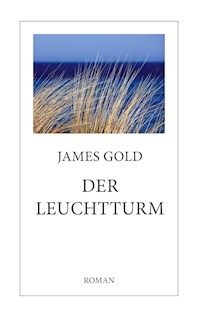
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Es ist die Hoffnung, die uns als Menschen am Laufen hält. Hoffnung auf positive Veränderungen, auf ein besseres Morgen, auf die Verwirklichung von Träumen. Auch der Ich-Erzähler dieses Romans hofft. Zum ersten Mal in seinem Leben bringt er den Mut auf, seinem Dasein eine entscheidende Richtung zu geben. Alles lässt sich gut an: Ein neuer Beruf, ein neues Heim, vielleicht sogar die Liebe seines Lebens. Aber kann es auch zu viel Glück auf einmal geben? Lebenswege verlaufen nicht stets gerade, aber: Was bei uns bleibt, ist immer Hoffnung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 126
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vermutlich ist es nicht weiter ungewöhnlich, bei einem Umzug noch einmal mit verklärter Wehmut auf das Haus und den Ort, wo man lange Jahre verbracht hat, zurückzublicken, dort Erlebtes am geistigen Auge vorüberziehen zu lassen, an Menschen zu denken, denen man begegnet ist, sich liebgewonnene Ecken und Plätze ins Gedächtnis zu rufen, und vielleicht auch angesichts all der hochkommenden Erinnerungen die eine oder andere Träne des Abschieds rollen zu lassen.
Bei mir war es ganz anders. Als ich meine Koffer und Reisetaschen im Auto verstaut hatte – die Möbel waren bereits einige Tage vorher von einer Umzugsfirma abgeholt und am Zielort abgeliefert worden –, stieg ich ein, knallte die Tür zu und gab Gas, ohne auch nur einen letzten Blick an das Mietshaus zu verschwenden, in dem ich die letzten elf Jahre in einer kleinen Wohnung zugebracht hatte, und auch bei der Fahrt aus der Stadt hinaus überkam mich weder Sehnsucht noch der Wunsch, irgendeinen Platz, den ich in all den Jahren liebgewonnen hatte, noch einmal aufzusuchen, denn einen solchen Platz gab es nicht. Im Gegenteil, als ich die Stadt hinter mir hatte und mich in nördlicher Richtung immer weiter weg von ihr bewegte, verspürte ich ausschließlich das erleichternde Gefühl, einen Abschnitt meines Lebens, der mich nicht weitergebracht hatte, zu beenden, und einen neuen, hoffnungsvollen zu beginnen, begleitet von grenzenloser Vorfreude auf das Unbekannte und einem hellen Funken Lust an Veränderung.
Die persönliche Wahrnehmung eines zeitlichen Abstands ist immer an eine gewisse Verhältnismäßigkeit gebunden, so mögen elf Jahre jemandem, der älter ist, nicht sehr lang vorkommen, für mich hingegen, der ich zum Abreisezeitpunkt neunundzwanzig war, machten sie immerhin mehr als ein Drittel meines Lebens aus, und ich empfand sie jetzt mehr denn je als verschwendete Zeit. Durchaus hatte ich einst in die große Stadt gewollt, dies lässt sich nicht leugnen, und als ich dort angekommen war, war ich nicht nur voller Hoffnung und Spannung gewesen wie viele junge Leute, die in eine Hauptstadt kommen, in ihr aufgehen und sich in ihr spiegeln möchten, aber nichts hatte sich so entwickelt, wie ich es mir vorgestellt hatte. Nie hatte ich mich in der Stadt heimisch gefühlt, das Berufsleben empfand ich als langweilig und eintönig, und der Anspruch und die Erwartung an mich selbst, es als freier Autor zu schaffen, erfüllte sich nicht. Irgendwann hatte sich Enttäuschung und Unzufriedenheit über meine Lage eingestellt, und irgendwann war ich auch nicht nur meines trockenen Brotberufes, sondern auch der lärmigen Stadt überdrüssig geworden, und begann mich nach einem stillen Rückzugsort im Grünen zu sehnen, um dort ungestört von großstädtischer Unruhe meinen dichterischen Ehrgeiz endlich in ertragreiche Bahnen lenken zu können. Ohne ausreichende wirtschaftliche Grundlage gestaltete sich dies natürlich schwierig, jedoch ergab sich Grund zur Hoffnung, als ein Verlag, an den ich eines meiner Manuskripte gesandt hatte, mir antwortete. Zwar schrieb man, dass man den Gegenstand des Manuskriptes, obwohl gut beschrieben, für altmodisch und daher nicht für veröffentlichungsfähig hielte, jedoch, schrieb man weiter, mein Stil gefalle, ob ich denn nicht ein weiteres Manuskript liefern könne, mit dem sich vielleicht eine Basis für eine künftige Zusammenarbeit ergäbe. Man würde sich auf eine baldige Einsendung meinerseits freuen und hatte mir sogar nach einem langen Telefongespräch mit einem Lektor des Hauses und der Unterzeichnung eines Vertrages einen Vorschuss überwiesen. Vielleicht wurde ich dadurch etwas zu übermütig, denn ich zählte all mein Geld zusammen, zählte es nochmal und nochmal, so lange bis mir das Ergebnis gefiel, begann mit einem neuen Manuskript, kündigte meine Arbeit und machte mich gleichzeitig auf die Suche nach einem neuen Heim, und zwar weit, weit weg von der Stadt – ich wollte nicht mehr auf strömende Verkehrsfluten und immer größer werdende Häusermeere unter Auspuffwolken vor der mir so gleichgültigen Bergkulisse blicken, ich wollte Aussicht auf eine Weite, auf flaches Land, vielleicht auf ein Wasser. Beim Lesen der Wochenzeitung war mir in diesen Tagen eine Anzeige aufgefallen, in der ein kleines Haus in ruhiger Lage angepriesen wurde, zu einem erschwinglichen Mietzins, und zwar genau dort, worauf sich schon lange meine unerfüllten Sehnsüchte gerichtet hatten, nämlich am anderen Ende des Landes, im Norden, an der Küste. Eilig hatte ich an den Makler geschrieben, von dem ich daraufhin Fotos des Hauses zugesandt bekam. Nichts weiter als grenzenlose Begeisterung hatte sich daraufhin bei mir eingestellt, und ich hatte einen Besichtigungstermin vereinbart und war hingefahren. Der Makler führte mich durchs Haus und über das kleine Grundstück, obwohl dies alles gar nicht notwendig gewesen wäre, denn alles erschien mir schon von Weitem wie geschaffen für mich. Die Vermieterin lernte ich dabei nicht kennen, sie wohne jedoch im Haus nebenan, sagte der Makler. Wenige Tage später hatte ich den Mietvertrag im Briefkasten, unterzeichnete ihn freudig und sandte ihn zurück. Danach schickte ich, wie schon erwähnt, die Möbel mit dem Umzugswagen voraus, und heute war nun der Tag meiner Abreise, meines Aufbruchs gekommen.
Die Monatsmiete des Hauses war erwartungsgemäß höher als die meiner Wohnung, was die Geldseite meiner Unternehmung natürlich noch gewagter machte. Aber ich konnte und wollte nicht mehr anders, ich war fest entschlossen, einmal in meinem Leben alles aufs Spiel zu setzen und ihm dadurch eine, wie ich hoffte, entscheidende Richtung zu geben. So war ich also ohne den berühmten Blick zurück heute aufgebrochen. Bei der Fahrt zum ersten Besichtigungstermin war ich noch mit höchster Geschwindigkeit über die Autobahnen gehetzt und nach frühmorgendlichem Aufbruch am späten Nachmittag angekommen, hatte mir jedoch für heute vorgenommen, es deutlich ruhiger angehen zu lassen, und plante, gemächlich zu fahren, auch die eine oder andere Landstraße zu nutzen, und da ich nicht den ganzen Tag im Wagen verbringen wollte, war es keinesfalls meine Absicht, heute noch im Norden anzukommen, im Gegenteil, mein Ziel war es, vielleicht die Hälfte oder zwei Drittel der Strecke zu schaffen, mich danach zur Übernachtung in irgendeinen freundlichen Landgasthof zu begeben und morgen den Rest der Strecke zurückzulegen. Es war Sonntag, der letzte Augusttag des letzten Jahres eines bewegten, von gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Umwälzungen geprägten Jahrzehntes, und es schien mir, als ob heute alles mit der angenehmen Spätsommersonne im Rücken langsamer und entspannter fahren würde als sonst, und als ob selbst Landschaft und Himmel zuversichtlichen Geist atmeten.
Spontanität ist meine Sache nicht, ich bevorzuge lange, in die Zukunft gerichtete Planungen, die mich mit Zeit und Sicherheit beruhigen, so dass mir die Aussicht, noch nicht zu wissen, wo ich heute Abend schlafen würde, im Normalfall den einen oder anderen Schub an Unruhe bereitet hätte, aber heute störte mich das nicht. Vermutlich war dies Teil einer Selbstüberschätzung, denn ich fühlte mich jetzt schon fast wie ein erfolgreicher Autor, der längst frei von wirtschaftlichen Sorgen war, und der sich auf den Weg zu seinem Ferienhaus machte, wo ihm wieder ein großer Wurf gelingen würde. So nun hatte ich das Steuer fest in den Händen, mein linker Ellbogen ruhte dabei lässig abgestützt auf der Fahrertür, mit der Rechten fingerte ich in den Ablagen dann und wann nach bereitliegenden Schokoladeriegeln, der Motor schnurrte, das Radio spielte leis‘ Musik, und mir ging’s gut. Zwar glaubte ich, meinen Zielort aufgrund meiner ersten Reise mühelos wiederzufinden, hatte aber dennoch auf dem Beifahrersitz den schwergewichtigen Straßenatlas liegen, und fühlte mich so alles in allem bestens gerüstet für meinen Abschied von meinem bisherigen Leben.
Irgendwann stellte ich fest, dass die Schokolade den Hunger nicht mehr beruhigte, denn ich hatte mittlerweile mehr als drei Stunden Fahrt ohne Pause hinter mir, so beschloss ich, das Autobahnstück, auf dem ich mich gerade befand, bei der kommenden Ausfahrt zu verlassen und im nächsten Ort einen Gasthof aufzusuchen. Hinter der Autobahn ging es noch zwei, drei Kilometer auf einer schmalen Landstraße, die leicht bergauf führte, dahin, und anschließend in den ersten Ort hinein, in eine Kulisse aus alt gewordenen Fachwerkhäusern, die sich vor tannenbewachsenen Hügeln ängstlich aneinanderdrängten. In der Ortsmitte fand sich ein Gasthof, in dem ich mir ein reichliches Menü bestellte. Müdigkeit lähmte mich danach, aber ich fand, dass es noch zu früh war, um im Gasthof ein Zimmer zu belegen, und beschloss zunächst, im Auto einen Schlafversuch zu wagen, der aber aufgrund der eingeschränkten Platzverhältnisse scheiterte. Aus dem Kofferraum kramte ich eine Decke hervor und marschierte damit geradewegs in ein Waldstück hinein, breitete sie vor einem Baum aus, setzte mich drauf, lehnte mich an den Stamm, kreuzte die Hände vor dem Bauch und schloss die Augen, umfangen vom Rauschen der Höhen und dem Knacksen kleiner Waldbewohner um mich herum im Unterholz. Bereits nach zwanzig Minuten Schlaf brach ich mein Lager wieder ab, ging zum Gasthof zurück und sah aus der Entfernung, dass eine Gruppe junger Leute in lederner Motorradkleidung, ihre Maschinen vor dem Gasthofe geparkt, um mein Auto herumstand. Vermutlich bekamen sie nicht jeden Tag hier in ländlicher Abgeschiedenheit ein in schillerndem Spinatgrün metalliclackiertes und breitbereiftes Sportcoupé mit großstädtischem Kennzeichen zu sehen, so war mein erster Gedanke, und ich lag nicht ganz falsch. Als ich mich dem Wagen näherte, trat man respektvoll beiseite und stellte mir die eine oder andere technische Frage zu dem Fahrzeug. Dabei keimte in mir kein falscher Besitzerstolz, im Gegenteil, der funkelnde Blechhaufen, auf den ich beim Kauf vor ein paar Jahren noch sehr stolz gewesen war, er war mir in letzter Zeit zunehmend peinlich und nicht mehr zu meinem neuen Selbstbild vom Stadtflüchtling passend erschienen. So war es meine Absicht, mich auch im Hinblick auf zusätzliche wirtschaftliche Sicherheit am Ende der Reise von dem Gefährt zu trennen, und ich hatte mich schon längst mit dem Gedanken angefreundet, aufs Fahrrad umzusteigen.
Die Motorradfahrer warfen ihre Maschinen an und donnerten über die Windungen der Straße eine Anhöhe hinauf, wo sie sich zwischen Föhrenstämmen verloren, und auch ich setzte meinen Weg fort. Nach einem kurzen Blick in den Straßenatlas fuhr ich zum nächsten Ort und gelangte von dort aus wieder auf die Autobahn. Es war jetzt früher Nachmittag, und ich nahm mir vor, vielleicht noch zwei Stunden zu fahren und dann auf die Suche nach einer Bleibe für die Nacht Ausschau zu halten. Während der ganzen Fahrt hielt das gute Gefühl über meine vermeintlich jetzt zu beginnen wollende Laufbahn als Romancier an, in meinem Kopf flatterten Entwürfe für künftige Bücher hin und her, und ich malte mir mein Dasein als zurückgezogen lebender, Pfeife rauchender, Strickjacke und Hornbrille tragender Erfolgsautor in meinem kleinen Haus an der Küste aus. Für mich stand fest, ich wollte schreiben, nicht um berühmt zu werden, ich wollte schreiben, um zu schreiben. Von Reichtum träumte ich nicht. Vom Dasein als Autor leben können, wie ein Arbeiter von seinem Lohn leben kann, das war mein Ziel, eine andere Berufung hatte ich nie gewollt – außer vielleicht, irgendwann als Bootsmann auf einem großen Frachtschiff die Meere zu befahren.
Am Nachmittag lenkte ich den Wagen wieder herunter von der Autobahn, zwischen in weiches Sonnenlicht getauchte sanfte Anhöhen, auf denen dicht an dicht stehendes Nadelholz spitze Schatten warf. Nur eine ungefähre Ahnung hatte ich, wo ich war, aber es interessierte mich auch nicht weiter, denn ich wollte es machen wie heute Mittag, hinein in den nächsten Ort und einen Gasthof finden. Im ersten Dorf hatte ich kein Glück, ein Gasthof schien einladend und freundlich, nur gab es dort kein Zimmer, ein anderer hatte geschlossen. So nahm ich wieder hinter dem Lenkrad Platz und fuhr weiter in eine Kleinstadt, wo schon am Ortseingang eine Beschilderung auf den Gasthof hinwies, ich mich jedoch bis an den Ortsausgang verirrte, dort umdrehte, und auf diese Weise ein zweites Mal die in zarten Erdfarben gekalkten Häuser der Altstadt bewundern konnte. Schließlich fand ich den Gasthof doch noch, ein altes, sich an einen Hang voller fruchtschwerer Apfelbäume drückendes, würdig ruhendes Gebäude. Meine Anfrage nach einer Übernachtungsmöglichkeit war erfolgreich, und ich bezog im ersten Stock ein behagliches Zimmer. Zunächst überlegte ich, mein ganzes Gepäck hinaufzubringen, da ich mich nicht wohlfühlte bei dem Gedanken, es nachts im Auto zu lassen, die Wirtin jedoch bot mir an, das Auto in ihrer Garage zu parken, was ich dankbar annahm und folglich nur meine Reisetasche mit aufs Zimmer nahm. Wieder kroch Müdigkeit in Kopf und Körper, so legte ich mich aufs Bett und ruhte eine knappe Stunde. Danach setzte das nächste Bedürfnis ein: Hunger. Frisch geduscht fand ich mich unten in der Stube ein. Wie so oft in unseren Gasthöfen kam die Speisekarte meiner Abneigung gegen fleischliche Nahrung nicht entgegen, aber die stets freundliche Wirtin ließ den Koch ein für mich geeignetes Mahl aus dem Stegreif zubereiten, noch dazu in einer Menge, die gut für zwei gereicht hätte. Nach dem Essen überlegte ich, wie ich den restlichen Abend verbringen könnte. Es war noch zu früh, um sich aufs Zimmer zu begeben, so bat ich die Wirtin, die Garage noch einmal aufzusperren, denn ich wollte zurück in den Ort und die schöne Altstadt noch einmal auf mich wirken lassen. So stellte ich den Wagen dort auf einem öffentlichen Parkplatz ab und flanierte auf von der Frühabendsonne durchleuchteten Gassen, dabei oft bedauernd, dass auch hier die Unsitte sich durchgesetzt hatte, alte Häuser im Erdgeschoß durch den Einbau von riesigen Schaufenstern das Aussehen von Aquarien, in denen Banken und Versicherungsagenturen hausten, zu verleihen. In einer Eisdiele erwarb ich einen Familienbecher, setzte mich auf dem Stadtplatz an den Rand des Springbrunnens und beobachtete dabei die vorbeiziehenden, sonntäglich gutgelaunten Menschen, sich alle des milden Spätsommers freuend. Noch im Eisbecher löffelnd, begann ich einen Rundgang um den Stadtplatz und bedauerte dabei, meinen Fotoapparat nicht mitgenommen zu haben. Nach etwa einer Stunde Aufenthalt fuhr ich zurück Richtung Gasthof. Kurz vor meinem Ziel war auf der Gegenfahrbahn ein Kleinlaster rechts rangefahren, die Motorhaube stand offen, der Fahrer war über den Inhalt des Motorraums gebeugt. Die Scheibe meines Wagens herunterkurbelnd, hielt ich an und fragte ihn, ob ich ihm helfen könne. Er berichtete in zerknirschtem Ton und mit hilflosen Gebärden von einem Motorschaden, und dass ihn dies im ungünstigsten Augenblick treffe. Er müsse den Wagen erst einmal stehen- und ihn dann morgen abschleppen lassen, und fragte dann, ob ich ihn nach Hause fahren könne, er wohne in einem Nachbardorf, und er versicherte wiederholt, dass dies nur vier Kilometer Fahrt seien. Gern erklärte ich mich bereit, mein Stundenplan sah für heute ohnehin nichts mehr vor, und nachdem er in meinem Auto Platz genommen hatte, sagte er, ich solle einfach der Straße folgen, dann würden wir direkt bei ihm ‚vor der Tür‘ ankommen. Während der Fahrt klagte er in hiesiger Mundart ausgiebig über seine Lage, und dass ihm die Panne seine ganze Planung durcheinanderbringen würde, aber ich hakte nicht nach, was genau er damit meinte, da ich mich nicht zu neugierig geben wollte. Bei ihm zuhause angekommen, lud er mich auf einen Umtrunk, wie er es nannte, ein, denn schließlich sei ich sein Taxi gewesen, und er müsse mich ja irgendwie entlohnen. Entlohnen müsse er mich nicht, hielt ich dagegen, aber da ich auch sonst auf Reisen gern Anschluss zu den Einheimischen halte – sie haben immer die besten Geschichten zu erzählen –, nahm ich die Einladung gern an. In seinem





























